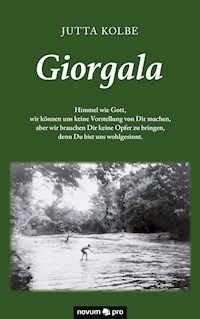Inhalt
Impressum 2
Vorwort 3
Prolog 8
Rückblick und Aufbruch mit dem Postdampfer „Wahehe“ 19
Ankunft in Freetown 36
Weiter nach Bo 44
Kailahun 48
E szasza neyo na bendu Foyah (O Du neue Straße zum großen Foyah)55
Foyah Customs 68
Die Fathers 89
Giszitown 106
Das Hospital 111
Visite 131
Sanga 220
Kindersterblichkeit 244
Familie 253
Malaria 257
Father Campbell und der Paramount Chief der Gbande, Fofi 267
Jochen kommt 271
Werner Junge 311
Farm, Haus und Tiere 317
Namenlos 331
Kaiha 340
Zauber in Bolahun 352
Post 384
Ein Bischofsbrief 430
ANHANG 439
Jutta Kolbe 15.12.1910–21.06.1961448
Literaturverzeichnis 476
Impressum
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie.
Detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://www.d-nb.de abrufbar.
Alle Rechte der Verbreitung, auch durch Film, Funk und Fernsehen, fotomechanische Wiedergabe, Tonträger, elektronische Datenträger und auszugsweisen Nachdruck, sind vorbehalten.
© 2020 novum publishing
ISBN Printausgabe: 978-3-99107-003-0
ISBN e-book: 978-3-99107-004-7
Lektorat: Bianca Brenner
Umschlagfoto und Innenabbildungen: Jutta Kolbe
Vor- und Nachsatz: Robert Erskine Campbell
Umschlaggestaltung, Layout & Satz: novum publishing gmbh
www.novumverlag.com
Vorwort
Jutta Kolbe und Jochen Krüger in Bolahun – mit einheimischer Kuh
„Am meisten träume ich davon, heimzukehren. Mein Herzschlag ist Liberia; ich schlafe, esse und atme Liberia. Trotz allem, was geschehen ist – wenn ich an Glück denke, denke ich an mein Land“1
1 Leymah R. Gbowee: Wir sind die Macht, J. G. Cotta’sche Buchhandlung, 2012
Obwohl meine Mutter, Jahrgang 1910, nur knapp drei Jahre in Liberia gelebt hat, könnte auch sie diesen Satz geschrieben haben – allerdings fünfzig Jahre früher und über ihre Zeit Anfang der dreißiger Jahre im letzten Jahrhundert. Also viele Jahre vor dem schrecklichen Krieg in Liberia, über den Leymah Gbowee aus eigenem Erleben berichtet und zu dessen Ende sie wesentlich beigetragen hat.
Meine Mutter hat im Alter von neunzehn Jahren einen sich auf Heimaturlaub befindenden Arzt aus der anglikanischen Missionsstation (Holy Cross) in Bolahun/Liberia gefragt, ob dort eine Laborantin gebraucht werden könne, und ist dann abenteuerlustig und alleine mitten in den nordliberianischen Busch gezogen, wo es bis dato keine Straßen- oder Bahnverbindung gab. Als zwei Jahre später ein neuer Arzt in das Missionshospital kam, fand sie ihre große Liebe, und bald haben die beiden geheiratet. In Bolahun ist ihr erstes Kind zur Welt gekommen. Wenige Wochen nach dessen Geburt erkrankte mein Vater schwer, sodass die Familie wieder nach Deutschland zurückkehren musste.
In diesem Buch beschreibt sie eingängig, humorvoll und anrührend ihre Schifffahrt nach Afrika, den Aufenthalt in Monrovia, den Fußmarsch durch den Busch, den Bau ihres Hauses, das Leben mit den Boys, den Priestern der Mission „Holy Cross“, und den Alltag im Hospital. Sie schildert die Schwierigkeiten bei der Arbeit bei wechselnden finanziellen Gegebenheiten und großen medizinischen Herausforderungen; aber auch den Zauber der Natur, das wechselnde Grün des Waldes, den wunderbaren Nachthimmel und die geräuschenden oder leuchtenden Tiere der Nacht; und die abenteuerlichen Erlebnisse am Fluss Kaiha.
Ganz besonders berührend schreibt sie, rund fünfundzwanzig Jahre danach, über die in Bolahun beginnende Liebe ihres Lebens; als Liberia noch ursprünglich und – zumindest im Norden – friedlich war. So durfte auch sie träumen, so viele Jahre später, und sich an ihr Glück in diesem wunderbaren Land erinnern. Ein Glück, das nur neun Jahre gedauert hat, da ihr Mann 1941 im Krieg geblieben ist.
Das Manuskript meiner Mutter ist zwischen 1958 und 1961 entstanden, und ich habe es in mehreren Anläufen bearbeitet – mit zum Teil jahrzehntelangen Pausen. Ich erinnere mich, dass sie nach Beendigung ihrer Tätigkeit bei der englischen CCG (Control Commission for Germany) in jeder freien Stunde – schließlich hatte sie mit Haus und Garten genug zu tun – schrieb und schrieb und schrieb. Zunächst von Hand, dann „ins Reine“ mit der Schreibmaschine. Zu Hause spät am Abend, in den Sommerferien im Zelt an der Ostsee oder während ihrer Besuche in Schweden. Auf meine Frage, was sie denn so alles zu schreiben habe, antwortete sie, dass sie daran arbeite, die Briefe unseres Vaters, die er ihr aus Afrika geschrieben hatte, zu veröffentlichen und dass sie darum herum ihre Erinnerungen aus der Zeit in Bolahun aufschreibe. Als ich fragte, ob sie denn auch ihre eigenen Briefe veröffentlichen wolle, antwortete sie, dass er alle kurz nach dem Lesen verbrannt habe, weil Briefe nur für den Augenblick geschrieben seien2. Zur Endredaktion der Briefe meines Vaters ist sie nicht mehr gekommen; einige hat sie in ihren Text integriert.
2 Seine Erklärung dazu: „Briefe sterben so schnell. Wie Blumen, die man pflückt. Wie ist ein Brief lebendig, wenn Du ihn aufmachst. Und wenn Du ihn morgen u. übermorgen wieder liest, welkt er schon, u. schließlich ist er tot. Ich kann keine Brief aufheben, auch Deine nicht. Ich empfinde es bei Deinen besonders.“
Das Manuskript, auf rosafarbenem, dünnen „Durchschlagspapier“ getippt, aber auch nur mit der Hand geschrieben, ist zum Teil schlecht lesbar. Es ist zwar am Anfang durchnummeriert, verliert aber später die Übersichtlichkeit, weil meine Mutter durch ihren plötzlichen Tod 1961 ihre einzelnen, erst mal „nur so dahingeschriebenen“ Gedankengänge nicht mehr hat ordnen können. Schließlich habe ich das Manuskript ungeordnet und unvollständig an mich genommen.
In ihrem Text sind postkoloniale Denkweisen noch erkennbar – und sie hat Worte (z. B. „Neger“) aus dieser Zeit benutzt, die ich geändert habe. Sie erkennt die Notwendigkeit, die hergebrachte Kultur der einheimischen Bevölkerung zu erhalten; das wird besonders deutlich in der Beschreibung der Entbindung der Köchin Sanga. Vermutlich lässt sie die Beschneidung der jungen Mädchen im Gri-Gri-Busch auch aus diesem Grund unkommentiert („ethnic sensitivity“), wobei die Gesichter der Mädchen nach der Zeremonie zerstört und leer wirken (S. 108). Andererseits ist sie entsetzt über die hohe Säuglingssterblichkeit, die ihrer Meinung nach vor allem durch falsche Ernährung bedingt ist.
Überwältigt vom Alltag im afrikanischen Busch kann sie dennoch ihre Haltung als „Miss Europe“ nicht verleugnen.
Unser Haus war voll von afrikanischen Gegenständen (Elefantenzähne, Masken, Figuren und Sitzmöbel, Stoffe und Gewänder, Schwerter und andere Waffen, lederumflochtene Flaschen und Zigarettendosen …) und man könnte heute überlegen, ob diese zurückzugeben sind. Diese Erinnerungsstücke wurden im Jahre 1935 aus Bolahun mitgenommen, waren geschenkt oder gekauft und sind nun in den Händen der Kinder und Enkel verstreut.
Felwine Sarr, Schriftsteller und Wirtschaftswissenschaftler an der Universität in Saint-Louis, Senegal, schreibt in seinem Buch „Afrotopia“: „Afrika denken bedeutet, eine zaghafte Morgenröte zu durchwandern, entlang eines markierten Weges, auf dem der Gehende aufgerufen ist, das Schritttempo zu erhöhen, um den Zug einer Welt zu erreichen, die bereits vor einigen Jahrhunderten abgefahren zu sein scheint. Es bedeutet, sich durch das Gestrüpp eines dichtbewachsenen und buschigen Waldes zu kämpfen, einen Weg vermessen, der von Dunst umhüllt ist; einen Ort, der mit Begriffen belegt ist, mit Aufforderungen zu Reflexion gesellschaftlicher Zwecke: einen bedeutungsschwangeren Raum.“3
3 Felwine Sarr: Afrotopia, Mathes & Seitz, Berlin, 2019
Jutta Krüger
Prolog
Das Haus war aus Lehm. Adam und Eva wurden aus nur einem Klumpen geschaffen, aber dafür war es auch Gottes Hand, die es tat. Für das Haus stampften viele schwarze Füße den Lehmbrei, und viele schwarze Hände brauchten viele Klumpen, um das Haus zu formen. Die Füße stampften im Takt zu dem Lied, das Amara sang. Er sang von dem neuen, großen Haus, das sie für die weiße Missi bauten, und die vielen Hände klatschten mit dem Lehm herum.
Ob Gott auch vor sich hin sang, als unter seinen Händen die Form entstand, weiß ich nicht; mag sein, dass er summte oder ein wenig pfiff. Denn Gott war ein Mann, und er sah, wie seine Gedanken Gestalt gewannen. Was soeben noch formlose Masse gewesen war, wuchs zu einem hohen, ranken Leib, die geraden Schultern trugen auf kräftigem Hals den schmalen Kopf. Unter den arbeitenden Händen wurde der raue Lehm glatt, er wurde dunkel wie die Erde, er wurde blank wie Ebenholz; und wenn die Sonne durch die dichten Bäume Edens ihre Schlaglichter warf, so spiegelten sie sich wider vom sattesten Mahagonirot bis zum tiefsten Schwarz. Der erste Mensch stand da – der Geist war noch nicht da.
Viele Sonnen und viele Monde sollten noch vergehen, doch dann wollte der Mensch mehr sein als die Erde, aus der er gekommen war, da er meinte, anders sein zu müssen – ohne Tarnung –, abstechen zu müssen von der Umwelt. Es war ihm nicht genug, dass als einziger Kreatur ihm der Geist eingeblasen ward – nein, alle sollten das und auch ihn sehen. Die Wolken am blauen Himmel waren hoch über allem, majestätisch zogen sie ihre Bahn. Von allen wurden sie gesehen, beachtet – sie waren weiß. Weiß, entschied der Mensch, ist die einzige Farbe, die meiner würdig ist, ja hell, nein, weiß muss ich werden. Und er zog aus im Garten Eden, das Mittel zu finden, das ihm die Tarnkappe nehmen und ihm weiße Farbe geben sollte. Wie viele Generationen so suchten, vermag ich nicht zu sagen. Tatsache ist, dass ein See gefunden wurde, dessen Wasser die schwarze Farbe fortspülten, und der Mensch nun blütenweiß dahinspazierte. Und die Fanga trommelte das Wunder von allen Höhen, und die Menschen kamen in Scharen, fielen auf die Knie und badeten sich weiß und rein. Nur zu den entlegenen Siedlungen drang der Ton der Fanga nicht. Erst verirrte Buschläufer brachten Kunde, aber bis man sich aufgemacht und die Stelle, an der einst der See gewesen war, erreicht hatte, fand man nur noch eine große Pfütze. Zu viele Menschen hatten bereits gebadet. Die Lasten wurden abgesetzt, es fing ein großes Wehklagen an. Ja, eine alte Frau riss sich das Zeug vom Leibe, verbrannte all ihre Habe und bestreute sich mit Asche. Man wurde müde, man hatte Durst, und so ging man in die Pfütze. Die Fußsohlen wurden benetzt, man bückte sich und legte noch die Handflächen daneben. Ein wenig Linderung! Dann machte man kehrt und ging zurück, dieselbe Straße zu den entlegenen Siedlungen – so schwarz, wie man gekommen war. Aber die Fußsohlen und die Handflächen waren hell geworden. Nur die alte Frau – so glaube ich – blieb zurück. Man hat sie in Mondnächten noch oft klagen hören.
Als sie das Haus mit Lehm bewarfen, sahst du nichts von den hellen Handflächen und Fußsohlen und wenig von der schwarzen Haut. Die Weiber hatten ihre Lappas und ihre bunten „hankies“ abgenommen und fortgelegt. Sie waren über und über mit Lehm bespritzt und verschmiert. Aber sie waren glücklich und sangen den Refrain, den Amara gab. Das Gewirr der errichteten Pfähle nahm eine – wenn auch etwas unverständliche – Form an durch den Lehm, der Pfähle und Flechtwerk verband. „Wir haben viele Hütten gebaut, aber sie waren rund. Dieses Haus ist groß, und es sind viele Hütten darin, doch sie sind nicht alle rund“, so sangen sie und warfen den Lehm, und die Männer kamen aus dem Busch, Palmblattbündel auf den Köpfen; und die Palmblätter wurden denen zugereicht, die auf dem Dachgesperre saßen und vertäuten. Das Dach war breit und ausladend und zweimal so hoch wie das Haus selbst. Man könnte es ein gutes Dach nennen, denn es breitete seine Arme weit über das Haus. Du hattest das Gefühl: Hier hast du Schutz, hier bist du geborgen. Hier können die Tornados der Regenzeit, der heiße Wüstenwind, der Harmattan, drüberbrausen, hier mag die glasige Äquatorsonne noch so flimmern. Das Haus duckte sich unter seinem Dach, so wie ich mich in deinen Arm gekuschelt habe, wenn ich müde war oder traurig oder furchtsam. Das Dach wuchs organisch von unten zum First. Die Palmblätter – noch grün – wurden in dicken Lagen auf das untere Dachgestänge gepackt und mit geschnittenen Blattrippen fest verknotet. Noch war der Rand nicht geschnitten, und lange Blattspitzen hingen wirr, ein wenig traurig und welkend, tief herab. Die schwarzen Leiber der hantierenden Männer glänzten in der Sonne; wenn sie zu uns hinabblickten und lachten, blitzten ihre weißen Zähne. Wir waren glücklich, denn wir bauten das Haus.
Wer ein Haus baut, will verweilen. Vielleicht ist er von Küste zu Küste gewandert, vielleicht hat er viel Geld gemacht, vielleicht ist er müde geworden. Nun kommt er zurück in sein Dorf und baut ein Haus. Er wird seine schattige Kühle suchen, wenn die Sonne brennt, und er wird ein Feuer anzünden, wenn ihn friert. Er ist zu Hause.
Der First des Daches zeigte von Ost nach West, sodass die Frühsonne ihre ersten Strahlen in das Bad und die Küche – dein späteres Schlafzimmer – schickte, dann hoch im Süden über den langen First kletterte, um glutrot im Westen zu versinken, alles vergoldend und dem Halbrund der Veranda zugewandt, unserer Porch. Zwischen ihren Pfosten würden später unsere Hängematten schaukeln, hier würden die Liegestühle und die kleinen Tische stehen; die niedrige, breite Brüstung, die die Porch halbrund umlief, würde Platz für viele Besucher bieten. Ja, wie es sich später herausstellte, war noch Raum genug für Asinus, den Esel, wenn er uns seine gelegentlichen Visiten abstattete. Und Raum brauchten wir, denn wer von unseren Brüdern aus den entlegenen Siedlungen Edens, die nur noch Fußsohlen und Handflächen mit den bleichenden Wassern hatten benetzen können, wollte ohne Palaver leben? Und wer war auserkoren, einen Streit zu schlichten, wenn nicht der große Bruder dazu berufen war, der so rein und weiß gewaschen war?
„Missie, du bauen ein ganzes Dorf in dein neues Haus: das Schlafhaus, das Badehaus, das Kochhaus und das Palaverhaus. Weißer Mann klug zu viel, he savie plenty“, so sagte wohl Pelema, der Koch, und die großen, breiten Zehen gruben sich vor Verlegenheit und Stolz in den Sand.
Dabei bot sich die Architektur des Hauses doch einfach an. Jeder Bauherr darf Zweckmäßigkeit und landesübliches Material verlangen. Ich schlug der Mission Zement und Wellblechdach rundweg ab. Ich wollte nicht in diesen imitierten europäischen Kästen leben, in denen die Hitze brütend lähmt, durch deren moskito-verdrahtete Fenster keine Brisen wehen und in denen du dein eigenes Wort nicht verstehst, wenn der Regen Tage um Tage auf das Wellblechdach herniederprasselt.
Im Jahre 1945 habe ich wieder Wellblech gesehen, und ich wollte es unseren Kindern zeigen, aber ich habe es dann doch nicht getan. Sie waren noch so jung. Lager Friedland – ein Konglomerat von Wellblech, knietiefem Lehm und Lumpen! Durchgangslager für 3.000 Flüchtlinge am Tag – Deutschland war unterwegs! Ich war Dolmetscherin bei den Alliierten, und englische Soldaten errichteten Nissenhütten dort. Wellblechplatten wurden in den Lehm gesteckt, aneinander genietet, zum Halbrund gebogen, um wieder die Erde zu erreichen. Vorder- und Rückfront bildeten Wellblechplatten. Eine Wellblechtür bot hundert Schlafbedürftigen Einlass. Der Winter 1945/46 war streng und mahnte an Russland. Wenn du durch Friedland gekommen bist, brauche ich nichts mehr zu sagen; wenn du nicht durch Friedland gekommen bist, auch nicht. Die Menschen, die kamen, glichen Auguste Rodins „Bürger von Calais“, „Der Denker“, „Schöpfung aus Gottes Hand“. Einige mochten wohl auch Georg Kolbes Hand entstammen. Ich sah die Lumpen, die Rucksäcke, die Pappkartons nicht. Aber wir alle waren von Barlach, von Käthe Kollwitz gezeichnet. Die Nissenhütten taten ihr Übriges. Und doch hat hier das Wellblech triumphiert – jedoch nicht im Sinne unseres Freundes, des Tropenhygienikers –, das war, als die englische Heilsarmee-Majorin Margaret Mitchel ihre Nissenhütte direkt hinter dem Schlagbaum errichten ließ. Wenn du über Besenhausen kamst, so wirst du dich nicht der kleinen, unscheinbaren, uniformierten Frau erinnern, die unermüdlich Tag und Nacht am Werke war, sondern du wirst vielleicht an den ersten heißen Trank, den ersten Bissen denken, der dir dargeboten wurde. Und so gewiss, wie du dich nicht des Wellblechs der Baracke erinnerst, so gewiss ist meine anfängliche Behauptung falsch, dass einmal das Wellblech triumphierte. Nein, es wurde bezwungen durch den Geist, durch die Liebe einer Frau, die furchtlos war und Kakao kochte. Sie ist die Einzige, die mich das Wellblech vergessen machte, die ungeachtet der Militärgesetze, des Nürnberger Gerichts, der Zonenteilung ihren Weg ging und lächelte. Sie hat das Wellblech bezwungen und ihm ihren Stempel aufgedrückt.
Als wir das Haus bauten, war ich jung und unfähig, Wellblech zu akzeptieren. Wir lebten nicht in Europa, sondern im Busch, und wir lebten gerne dort. So wollte ich ein gewachsenes Haus, ein afrikanisches Haus. Die Eingeborenen unserer Gegend bewohnten runde Hütten mit nur einem Raum. Die Feuerstelle war in der Mitte, ihr Rauch trocknete das Dach. Hier wurde gekocht, und hier herum lag oder saß man in kalten Nächten im Kreise. Es waren Pfahlbauten mit Lehm gebunden. Die Konstruktion und Dichtung des Daches war denkbar einfach, denn der gefährdete First war ja nur ein Punkt, die Spitze des Kegels. Bei fehlerhafter oder altersschwacher Dichtung wurde schlicht ein Country-Topf aufgestülpt, und der Regen konnte wieder das Dach herniederrauschen, ohne in die Hütte zu tropfen. Das Einraumhaus entsprach nicht ganz meinen Wohnvorstellungen. Ein großes Rundhaus mit abgeteilten Räumen würde nicht an alle die ersehnte Brise bringen. Aber wie, wenn man die Eingeborenenhütte teilte und die Hälften auseinanderzog, aus dem Kreis eine Ellipse machte? Segen des Papiers und des Bleistifts, dank dir, Zivilisation! Die westliche Hälfte würde Palaverhaus (Veranda oder Porch). Dann, hintereinanderliegend, Wohnzimmer, Esszimmer, Schlafzimmer. Der östliche Restteil der Hütte bekäme eine Trennwand für Bad und Küche. Alle Räume könnten zu beiden Seiten Fenster erhalten, der Wind würde sie kühlen. Und Komowalla, der Tischler, müsste uns Läden für die Nächte machen. Die drei mittleren Räume würden einen Meter vom Rand der Ellipse eingerückt und der Sonne ganz entzogen. Von der Porch konnten nun die Boys auf jeder Seite des Hauses die Küche oder das Bad über den zwölf Meter langen offenen Gang erreichen, ohne durch die Zimmer zu müssen.
Das Haus – fertig
Das Haus im Bau
Nach Aussagen anderer Weißer ist es dann ein recht komisches Haus geworden. Unsere englischen Nonnen tauften es Arche Noah. Und Dr. Junge meinte, es fehlten nur die Schornsteine, denn Bug und Heck, Promenadendeck, Deckkajüten und viele Masten wären vorhanden. Und die Gangway, die an Bord führte, sei ständig herabgelassen. Jedes Mal, wenn er komme, wundere er sich, dass es noch da ist und nicht längst im Ozean schwimmt. Es ist gut, dass Dr. Junge nicht nachts da war, wenn ein Tornado niederging. Da knisterte, da ächzte, da krachte das Dachgebälk, die Fensterläden klapperten, Wassermassen schlugen rauschend das Dach hinab. Und du wundertest dich, dass das Bett noch stillstand und der Boden nicht von einer Seite zur anderen schlingerte. Ich war auch froh, dass Dr. Junge uns nicht zu Bade- und Geschirrspülzeiten visitierte, denn wir hatten eine Methode ausgeklügelt, das auf dem Kopf des kleinen Bolli mühsam hereingeschleppte Wasser wieder loszuwerden. Und zwar einen Meter lange, gebogene Bleche, die aus Küche und Bad herausragten und zu gegebenen Zeiten dann ihren Inhalt in die ums Haus gegrabene Furche ergossen. Wahrscheinlich hätte er uns dann noch mehr ausgelacht und uns an Vergnügungsfahrten auf dem Rhein erinnert.
Wir, die Boys und ich, waren aber mächtig stolz auf unsere Errungenschaften, so auch auf diese: „Missie, wo du essen, wir lassen ganz offen. Wir nur machen auf jede Seite drei runde Bögen, in der Mitte für Tür, in die anderen du hängen Country-Topf mit Blumen. Ich schon sehen bei schwarze Fathers in Frenchie.“ Tjämo brauchte nicht Papier und Tinte, er beschrieb mit den Armen, und wir alle verstanden. „Tjämo right, Ma, he come far way, he will make am.“ Das war Kapili, der Wäscher, der immer für andere das Hifthorn blies. Ja, Tjämo kam von weither. Er war vom stolzen Stamm der Mandingo, Mohammedaner aus Französisch-Guinea. Seine Leute hatten ihn frambösiekrank zum Hospital gebracht und waren fortgezogen. Als er genesen war, saß dann der etwa Zwölfjährige eines Abends auf meiner Türschwelle. Er saß auch noch da, als ich gebadet und gegessen hatte. Er saß dann jeden Abend da und verschwand in die Nacht, wenn ich schlafen ging. Wir konnten wenig miteinander reden, bis er mich das Giszi lehrte. Aber wir schauten uns an und waren beide nicht allein. Und dann lächelten wir einander zu. Von allen Schwarzen habe ich dich wohl am meisten geliebt, Tjämo, und ich werde dich nie vergessen. Du kamst von weither, aber wie weit, das weißt du nicht. Deine Vorfahren haben am Nil gesessen, denn du brachtest deinen Kopf von da, den kühnen Kopf der Nofretete. Tjämo war geblieben, und als wir das Haus planten, verschwand er nicht mehr in die Nacht, sondern wohnte schon lange im Boys-Haus.
Als wir den Plan fertig hatten, suchten wir einen Platz, und wir fanden einen Berg, der abseits von der großen Straße lag. Und wir rodeten den Urwald, aber ließen die Palmen stehen. Wir ließen auch zu beiden Seiten des Weges, der zum Haus führte, das hohe Elefantengras stehen, das so beredt zu flüstern verstand, wenn der Wind darüber hinstrich. So bin ich denn unendliche Male den Weg entlanggegangen, der in der Regenzeit so rot war wie ein neuer Blumentopf, zu beiden Seiten das mannshohe, grüne Gras, darin die Palmen standen; und vor mir lag langgestreckt das Haus aus grauem Lehm unter seinem Palmblattdach. Diesen Weg schritten auch wir zwei, du, Jochen, und ich. Und der Mond schien wirklich und wahrhaftig, und nicht nur, weil er in die Geschichte und zu Liebenden passte. Er schien von irgendwo, von weither. Vielleicht war er im Dunst der dampfenden Erde oder hinter jenen hohen Kapokbäumen. Und er tauchte das Land in ein blaues Licht. Alles Gegenständliche wurde riesengroß. Das Elefantengras zu unserer Seite schien ein Wald zu sein, und seine Spitzen wiegten sich hin und her, und es war mir, als schlügen sie über mir zusammen. Ich schaute zu den Palmen, sie waren so hoch, so hoch in jener Nacht. Es war, als wollten ihre langen Wedel mit den Wolken kosen. Am Himmel standen keine Sterne, ich glaube, sie waren zu uns herabgekommen und leuchteten als Glühwürmchen zu Tausenden den Weg entlang. Eins von ihnen war dir an die Schulter geflogen, Jochen. Ich wollte es wegküssen, aber ich konnte es nicht, denn ich zitterte. Und ich legte meinen Kopf an deine Schulter, und dann schauten wir uns an. Und Deine Augen waren so blau, wie ich sie noch nie gesehen, so blau wie das Land umher. Und sie waren so still, so gut, wie ich sie nie gekannt. Ob ein Tier schrie aus dem Urwald, ob ein Vogel aufgescheucht von seinem Ast flog oder ob sie von den Bergen die Fanga trommelten, ich weiß es heute nicht mehr. Ich weiß nur von der großen Ruhe, die über allem lag und die uns einbezogen hatte in ihren Frieden – dich und mich. Und wie wir entlang des Weges schritten und oft verharrten, und doch dem Hause, das nun ganz auf dich wartete, näher kamen, wusste ich, dass wir der Erde entstammen und dass alle Herrlichkeit auf Erden ist.
Wer vermag die vielen Schritte zu zählen, die wir beide tun mussten, bis sich einmal unsere Fährten kreuzten? Der rote Weg, nun schon lange überwuchert und der Wildnis zurückgegeben, der wir ihn entrissen, hat sie am Ende getragen. Es war Sonntag und glutheiß, und die Sonne stand hoch am Himmel, als ich deine Fährte das erste Mal sah. Wir waren im Busch, am Kaiha gewesen und hatten gejagt. Bergauf, bergab waren wir gelaufen und hatten den Fluss gesehen und an seinen Ufern gepirscht. Nun kamen wir heim, müde, zerschunden und durstig. Und da war auch schon der Weg. „Missie, weißer Mann ist da. Neuer Loketa in unser Haus. Look!“ Kapili wies auf die Spuren deiner nagelbeschlagenen Schuhe, die du dem Lehm aufgedrückt hattest. „He be big man!“ Ich stellte meinen Fuß daneben, und wir alle lachten. „He be quick too much.“ Und in kindlicher Spielerei traten wir in deine Fußstapfen, und da sie so weit auseinander lagen und nicht auf unser Schrittmaß passen wollten, so liefen wir, und der kleine Bolli hüpfte und sprang vor Vergnügen. So kamen wir an das Haus, an das komische Haus, ein noch komischerer Zug im Gänsemarsch: voran das weiße Mädchen mit den schwarzen Haaren und hinterdrein die kleine Kavalkade schwarzer Boys. Und dann standest du plötzlich vor mir, Jochen. Aus einem tiefen Stuhl der Porch erhobst du dich langsam und sagtest deinen Namen. Ich sah hinauf, und ich sah einen großen Mann, der so braungebrannt war wie das Khaki, das er trug. Unter den blonden Haaren sah ich ein starkes, männliches Gesicht, das irgendwie belustigt schien, und ich schämte mich sehr. Und als ich die Boys nach Tee schickte, da wusste ich schon, dass ich meine Fährte gefunden hatte, und ich schämte mich noch mehr. Ich sagte: „Froh, Sie zu treffen. Dr. Junge ist krank. Wir haben Sie eher erwartet. Afrika, ein verrücktes Land.“
Deine Fährte, Jochen, ist von der Wildnis überwuchert, von der Wildnis, die grausamer ist als die des Urwalds. Der Krieg hat sie davongeschwemmt. Ich bin ihr weiter gefolgt, nicht lachend und laufend. Aber ich habe versucht, mich deinem Schrittmaß anzupassen, denn vier kleine Fährten liefen hinterdrein. Und auch diese sind nun fast so groß wie deine und bahnen sich den Weg durch ihre Wildnis.
Meine Fährte mag der Wind zuwehen.
Rückblick und Aufbruch mit dem Postdampfer „Wahehe“
Auf der „Wahehe“, 4. 3. 1930
Noch sind wir auf der Elbe, fahren also durch deutsches Gebiet. Es schwimmt zwar regengrau, flach und verhangen dahin, aber es ist noch da. Als die Bordkapelle gestern Abend „Muss i denn, muss i denn“ spielte (ich dachte: Das hat mir gerade noch gefehlt), wir vom Kai ablegten, die Schlepper uns sachte die Elbe hinunterschleppten und die Lichter Hamburgs immer kleiner wurden, habe ich doch schon Abschied genommen. Ich hoffte so sehr, heute Morgen auf einer stürmischen Nordsee und, wenn möglich, etwas seekrank zu sein.
Aber wie üblich, „nichts von alledem“, wie Tante Ruth zu sagen pflegte, wenn man irgendetwas tun möchte, was sich nicht für ein junges Mädchen schickt. Wir glitten gestern Abend kaum eine Stunde dahin und weg von allem, an dem ich hänge und an dem ich nicht hänge, als ein wahnsinniges Gerenne und Getue an Bord begann, Ankerketten rasselten und es von allen Seiten tutete. Wir lagen im Nebel fest, die ganz Nacht. Heute Morgen bin ich ziemlich müde, ich schlief nicht allzu gut. Wahrscheinlich war es das Ungewohnte, dann schimmerte das Licht vom Gang in die Kabine, Stewards schimpften, Leute rannten auf und ab, Geschirr klapperte, es wurde gescheuert, dazu das Getute vom Nebelhorn – na, es ist schon alles Gewohnheitssache.
Bin ich schon wieder zum Nachsitzen verdonnert? Mein Dauerzustand in der Schule: Eine Stunde Nachsitzen, Eintragung ins Klassenbuch wegen Trägheit, Frechheit, nicht gemachter Schulaufgaben, Zuspätkommens, groben Unfugs und derlei mehr. Ich bin nun gut zwei Jahre der Schule entronnen, dieser Enge der ungelüfteten Klassenzimmer, diesem Zwangskorsett meiner eigenen Gedanken, diesem erhobenen und in Moralin getauchten Zeigefinger. Und ich sitze schon wieder fest. Wenn das so weitergeht, kann es ja noch gut im Leben werden. Ich sollte also gestern Abend beim Abspielen des wehleidigen Liedes so recht und laut von Herzen heulen. Und weil es nicht klappte, Nebel drauf und die Sache nochmal exerziert. Herr Zeigefinger, verlassen Sie sich drauf, auch durch Nachsitzen ist keine Besserung zu erzielen. Schreiben Sie mich lieber ins Klassenbuch wegen Gefühlsrohheit, groben Betrugs der Umwelt oder was Ihnen sonst an Verbrechen einfällt. Die „Drei“ im Betragen wird’s nicht ändern.
Hier im Salon unterhält man sich im Augenblick über Schlangen, Elefantengruben, Affen, Leoparden und Pferdefleisch. Das Schiff fährt so ruhig, dass man meinen könnte, man säße in einem Hotel. Wir haben erst zwanzig Passagiere, in Rotterdam werden wir vier Schweizer, in Boulogne vier Franzosen und in Southampton zweiundzwanzig Engländer bekommen. Bisher sind allerlei verschiedene Leute an Bord: eine recht hübsche und elegante Frau mit Brillantnadel am Wollturban, Typ Baronin Eckstein, ein Inspekteur der Woermann-Linie, sehr hofiert, junge Kaufleute, eine dicke, ewig strickende Missionarsfrau, zwei vollkommen verwildert aussehende „Afrika-Forscher“, ein alter Mann mit Seidenreisemütze und lilagrauem Schal, ein junges Ehepaar aus Bayern, ein Göttinger Freiherr von Gemmingen, der auf eine Pflanzung geht, und noch so ein paar andere, die über Woher und Wohin noch nicht Laut gegeben haben oder an zugigen Ecken an der Reling stehen und mit ihren Ferngläsern dahin zurückschauen, von wo sie gekommen sind.
Von wo sie gekommen, von wo ich gekommen? Ja, woher bin ich eigentlich gekommen? Manchmal sage ich: Aus unserer kleinen Stadt in Mecklenburg – zu anderen: Vom Lande. Beides stimmt, und beides stimmt nicht. Genau gesagt komme ich aus drei Städten; in jeder war ich etwa sechseinhalb Jahre, macht neunzehn. Davon müssen wiederum zehn Sommer abgezogen werden, nicht von meinen Jahren, aber von den Städten. Wenn ich von etwas Negativem – und ich empfand die Steinmauern mit ihren vielen Menschen, dem Gehaste, Lärm und Staub als solches –, etwas subtrahiere, so muss ich zu einem Positivum kommen; und das war das Land, das war für mich Neu Nieköhr. Neu Nieköhr, das weiße Haus mit seinem rundgeschwungenen Giebel, darunter die Veranda, die Freitreppe, rechts und links die beschnittenen Linden, davor das rosenumstandene Rondell, dann der Hof und dahinter und rundherum die Felder, so weit das Auge reichte. Meine erste Erinnerung an Neu Nieköhr ist aber nicht das Haus, sondern ein grau-weißer Pferderücken, auf den ich hinaufgehoben wurde und der mich immerzu im Kreise trug. Zu der Zeit gab es auf dem Lande noch keine elektrischen Pumpen, wie es auch kein elektrisches Licht gab. Das Wasser wurde aus dem Brunnen in verschiedene Behälter auf die Dachböden des Hauses und der Ställe gepumpt. Der Brunnen lag vor dem Küchenanbau unter einer großen Linde. Über dem quietschenden und rumpelnden Zahnradgetriebe war eine runde Scheibe aus groben Planken angebracht, die mittels einer Deichsel vom Grauschimmel mehrere Stunden des Tages um sich selbst gedreht wurde. Im Mittelpunkt der Scheibe saß auf einem Holzschemel der Altenteiler Ludwig, ein kleines, verwittertes Männchen, von dem ich nur die große Mütze, den krummen Rücken und die schlorrenden Schritte erinnere, wenn er nach getaner Arbeit hinter Grauschimmel, der ebenso verbraucht und staksig war, zum Stall trottete. Umgeben war das Paar meist von einigen Hofspatzen, die ganz vertraut mit der Routine des Tages durch freches Geschimpfe Grauschimmel aufzufordern schienen, doch endlich eine gute Mahlzeit für sie fallen zu lassen.
Dieses Pumpenkarussell ist meine erste Kindheitserinnerung, und so teile ich mit allen Kindern das größte Entzücken des Karussellfahrens, nur, dass ich nicht auf springenden Holzpferdchen saß, nicht in glitzernde Spiegel und Bilder schaute und dass statt der Drehorgel das Pumpwerk seine Weise spielte.
Dann musste ich in die Schule und kam deshalb in die Stadt, und beide waren grau und fremd, das ganze Jahr hindurch. Wenn’s aber Sommer wurde, dann konnte ich es kaum erwarten, dass die Koffer gepackt und wir nach Neu Nieköhr verfrachtet wurden. Wenn wir dann endlich den letzten Umsteigebahnhof erreicht hatten und damit die kleine Bahn, die vor den Kurven und Wegüberkreuzungen schrille Pfiffe ausstieß und keuchend schwarzen Dampf nach hinten spuckte, hörte sogar das ewige Gezänk mit meinem Bruder auf und wir liefen in den leeren Abteilen von einem Fenster zum anderen und drückten unsere Nasen platt. Hier kannten wir jedes Dorf, jede Kirche, und auch uns schien jeder zu kennen. Der Schaffner, der schon den Großeltern mit seiner silbernen Zange Löcher in die grün-weißen Fahrkarten geknipst hatte, würde sagen: „Na, sünd ji wedder dor? Wat uk Tid, ji sünd ja bannig leg worden!“ In Klein Bukow würde Karl mit dem Kutschenwagen stehen und mit uns dem heißersehnten Ziel zutraben. Vielleicht durfte man auch ab und zu die Zügel halten, falls er nicht gerade seinen Brummigen hatte. Der letzte Teil der drei Kilometer langen Strecke führte durch den Boddiner Wald, und hier mussten die Räder halbspur über die ausgefahrenen Wagenrinnen balanciert werden. Dann kam die Kurve, noch den kleinen Abhang hinab, über die Holzbrücke des Baches, und Pferdehufe und Wagenräder polterten schon die gepflasterte Dorfstraße entlang, angekläfft von zahlreichen Hunden, geflohen von noch zahlreicheren Hühnern und Enten und angestaunt und angelächelt von kleinen und alten Gesichtern. Durch das eiserne Gartentor der Hofmauer schimmerte schon das Haus.
Neu Nieköhr
Die Pferde noch einmal nach rechts gelenkt, herum um den hohen, weißgekalkten Feldstein, der zum Schutz der Mauer an deren Ecke stand, und wir fuhren in den Hof ein. Tante Ruth kam die Treppe herab, wir sprangen vom Wagen in ihre Arme. Die Koffer wurden ins Haus geschleppt, und wir standen in der halbdunklen, getäfelten Diele, deren Wände über und über mit Geweihen und Gehörnen behangen waren und auf deren rundem, poliertem Tisch ein Riesenstrauß Kornähren leuchtete. Der Kaffeetisch war im Gartenzimmer gedeckt, und nach Vertilgung von ungezählten Schmalz- und Honigbroten stürmten wir nach draußen, um alles und jeden zu begrüßen. Die große Zeit der Freiheit, des Einfahrens, des Erdbeerenpflückens, des Räuber-und-Prinzessin-Spielens hatte begonnen – und war verflogen, ehe man sich’s versah.
Und wieder wurde mit Koffern, Stapeln geplätteter Wäsche und mitzunehmenden Würsten hantiert. Ich schlich mich aus dem Haus, hockte mich auf die Haferkiste des leeren Pferdestalles und schaute den Schwalben zu, die ein- und ausflogen und ihre Schnäbel in die aufgerissenen Schnäbel der kleinen Brut steckten. Irgendeine Katze schnurrte um mich herum. Hier war es still und heimelig, hier roch es so vertraut, hier würde man mich so bald nicht finden.
Ich wurde aber doch plötzlich beim Schopf gepackt, und vor mir stand Onkel Willi, groß und schwer, den Strohhut über dem sonnenverbrannten Gesicht, den Krückstock über den Arm gehängt, und sah mich an. Er zog ein bisschen die Nase hoch, sagte aber nichts und ging davon.
Als wir dann später alle an dem langen, weißgedeckten Abendbrottisch saßen und ich wie immer den verzweifelten Kampf mit dem riesengroßen Glas Milch aufnahm, zwinkerte er mir zu, wandte sich an Tante Ruth und sagte: „Also, Mamming, mit der Reise von Emil wird nichts, das schlagt euch Frauen man ruhig aus dem Kopf. Ich kann sie bei der Erntezeit und im Pferdestall nicht entbehren. Und packt ihr die Sachen nicht wieder aus dem Koffer, dann verstecke ich mich im Boddiner Wald und reiße Emil vom Wagen, wenn sie morgen früh zur Bahn fahren. Ob ihr uns beide dann je wiederseht, ist sehr die Frage!“
„Emil“, ca. 1925
Von da an stand fest, dass ich nur Onkel Willi heiraten würde, Tante Ruth sollte dann bei uns kochen, und das Hochzeitsdinner sollte aus Kartoffelpuffern und Vanilleeis bestehen.
So blieb ich bis zum Winter in Neu Nieköhr. Da ich lang und aufgeschossen war, war ein Attest für die Schule unschwer zu beschaffen. Unterricht wurde mir schlecht und recht noch zusätzlich vom Erzieher meines Vetters erteilt. Dieses Spiel mit Vom-Wagen-Reißen wiederholte sich dann drohend jedes Jahr, obschon niemand mehr zur vorgeschriebenen Zeit sich mit meinen Koffern zu schaffen machte. Und zehn lange Sommer war ich so in Neu Nieköhr „unentbehrlich“ geworden.
Auch anno 1917 waren mein Bruder und ich nach Neu Nieköhr „abgestellt“ worden, während Tante Ruth unsere Zelte in der ersten Stadt abbrach und Mama auf das großelterliche
Neu Nieköhr: Pause auf dem Feld
Gut Boddin geholt wurde. Ich wusste damals nicht, was es zu bedeuten hatte, als ich eines Morgens vor dem Schulweg die Schlafzimmertür verschlossen fand, mittags im Hause dann den Arzt, eine Krankenschwester und unten im Herrenzimmer die Großeltern, Tanten und Onkel versammelt antraf. Es war mir sehr unheimlich, und ich verkroch mich auf die dunkle Eckbank der Diele, von wo aus ich alle Türen am besten beobachten konnte. Auf dieser Bank hatte ja auch Mama immer gesessen, wenn sie Kummer hatte. Und wie oft, wie oft hatte ich sie da unten sitzen und weinen sehen, wenn ich abends, weil ich nicht einschlafen konnte, auf bloßen Füßen auf den Flur schlich und dann im Nachthemd durch das Treppengeländer hinunter auf die Diele lugte.
Inzwischen weiß ich nun, was das alles zu bedeuten hatte, denn Mama hat es mir erzählt. Aber verstehen tue ich es trotzdem nicht. Mama und Papa waren sieben Jahre heimlich verlobt, gegen den Widerstand der Familie: „Mon Dieu, ein armer Pastorensohn, ein zechender Waffenstudent, der noch dazu durch alle Examina fiel.“ Sie heirateten – auch heimlich –, die Examina und Promotion wurden im Fluge gemacht, Versöhnung, Hausbau und Anwaltspraxis in jener kleinen Stadt am Bodden unweit der See. Sieben glückliche Jahre eilten dahin. Der Erste Weltkrieg nahm Papa 1914 als Reserveleutnant von uns fort, wenige Wochen danach wurde es still um ihn – vermisst. Mama hat ihm mit einem Tuch aus dem Hause nachgewinkt, als er ging. Sie ließ es fallen. Wenn sie es wiederfände, würde er zurückkommen. Sie sagt, sie hat es nie gefunden. Im Herbst 1917 ist sie allein nach Ostpreußen gefahren und hat nach seinem Regiment bei Hindenburgs Schlachten um Tannenberg gesucht. Sie hat es in Walterkehmen in Massengräbern gefunden. Sie hat die Gräber öffnen lassen und Papa an den Zähnen erkannt. Sie hat ihn umbetten lassen und einen großen Stein gesetzt. Dann ist sie nach Hause gefahren und wollte nicht mehr. Doktor Knitter hat ihr den Magen ausgepumpt und gesagt: „Sie werden mir noch einmal auf Knien danken, dass ich Ihnen das Leben gerettet habe.“ „Nein“, hat sie gesagt, „das werde ich nicht tun.“ Und jetzt sagt sie, sie hat es ihm auch nie gedankt und trägt immer Schwarz.
Wir sind im Jahre 1917 in seine westpreußische Vaterstadt gezogen, und als Großvater 1923 starb, zurück nach Mecklenburg zur Großmutter, die Geld zu der kleinen Rente gab und dafür ihrerseits von Mama umsorgt wird. Wir wohnen dort in einem großen Eckhaus über dem Kolonialwarengeschäft und einer Bäckerei, deren Gerüche sich im Hausflur treffen. Über uns wohnt ein alter Opernsänger, der Gesangsstunden gibt. Auch unsere Pensionäre üben oft auf dem Klavier, aber dafür bezahlen sie auch und sind die Ferien über nicht bei uns. Unser Haus gehört einem alten Postbeamten, dessen drei Söhne ein Hippodrom besitzen. Die Leute im Hause mögen sie nicht, weil sie dunkel sind und geschminkt sein sollen, und weil immer andere Frauen oder Bräute die Treppen wischen. Ich sehe ihnen aber immer gerne nach, denn sie tragen karierte Hosen und Lackstiefel, und ich kann dann wenigstens an ein Karussell denken.
„Wahehe“, 13. 3. 1930, 18.00 Uhr
Jetzt endlich ist es wieder möglich, überhaupt eine Feder in der Hand zu halten. Drei Tage – bis heute Morgen – lagen wir in der Biskaya bei Windstärke 8. Das ist an sich nicht viel, aber wir hatten Quersee, und das Schiff rollte von einer Seite zur anderen. Es hat furchtbar viel Spaß gemacht. Und außerdem waren der Speisesaal, die Halle und das Deck herrlich leer. Alle waren seekrank. Irgendwann nachts fing es an. Es polterte, es rutschte etwas in der Kabine, es zischte, es klatschte etwas an das Bullauge. Was war denn mit dem Bett, mit der Koje los? Träumte ich, war ich wieder auf einem Pferderücken? Oder seit wann gehen Kojen über einen Parcours? Wieso lag mein Kopf plötzlich unten, während irgendeine Macht den Körper hochhob und meine Füße erneut gegen die Wand gestoßen wurden? Dann ein Verharren, ein Stampfen, und der Film wurde wieder rückwärts abgewickelt. Wie nimmt man Hindernisse in Kojen? Ich winkelte die Beine an. So, jetzt ging es besser über die Bahn. Wenigstens bumsten Kopf und Füße nicht mehr abwechselnd an die Bande. Ich machte die Augen auf. Der inzwischen vertraut gewordene Lichtschein vom Gang stand auch nicht mehr still, sondern wurde hin- und hergeschwenkt, wie die Laterne in der Hand eines Bahnwärters, der nachts beim Rangieren irgendwelche Zeichen gibt. Die ganze Kammer machte die abenteuerlichsten Bewegungen. Nur mein Kleid am Haken, vorbildlich auf den Bügel gehängt, hielt lotrecht der Bewegung stand und ruhte sich glättend aus. Dass draußen noch mehr Geschirr zu poltern, noch eiligere Füße auf- und abzutrippeln schienen und dass das Schiff nun auch noch von außen gescheuert wurde, regte mich nicht mehr auf. Ich schaute auf das Kleid und dachte: Was du kannst, kann ich noch lange!, zog die Decke über den Kopf und war bald sanft entschlafen. Die kleine Frau aus Bayern soll die ganze Nacht hilfeheischend die Gänge entlanggelaufen sein, weil sie den Film Atlantis gesehen und an den Untergang der Titanic gedacht hat. Da habe ich mich doch ein bisschen für mein Kleid und mich geschämt.
Die ganze Zeit über, in der wir in der Biskaya lagen, waren nur drei Frauen zu sehen, und ich habe gar nichts gemerkt, war überhaupt nicht seekrank. Bei Tisch hatten wir keine Tischtücher, die Schlingerleisten waren hochgestellt und nur das notwendigste Geschirr war gedeckt. Aber trotz aller Vorsichtsmaßregeln kam dann doch ein ganzer Segen vom Gegenüber: Messer, Löffel, Suppe, Obst. Das Servieren, die Handhabung der Stewards mit den Tabletts grenzte an artistische Leistungen. Im Salon konnte es passieren, dass ein todernster Bridgepartner sich plötzlich in seinem Clubsessel davongetragen und am Tisch der strickenden Gattin, der Elefantengrubensteller oder diskutierender Fremdsprachler wiederfand, ohne nun seine gute Hand, den Trumpf, ausspielen zu können. Ich habe mich königlich amüsiert und tue es noch heute, wenn ich in Gasthäusern sitze und die verschiedenen Tischrunden beobachte, bei der Vorstellung all der dummen und maskenlosen Gesichter, wenn die Biskaya hier plötzlich ein „Bäumchen-wechsle-dich-Spiel“ veranstalten sollte. Bei dem unberechenbar schwankenden Boden musste man sich sehr vorsehen, dass man nicht fiel. Mir sind aber inzwischen schon die richtigen Seebeine gewachsen. Und die Tastatur der diversen Tische habe ich mittlerweile auch gelernt.
Die Zeitrechnung ist mir hier bei dem faulen Leben verlorengegangen, aber ich glaube, es war vorgestern, als wir Kap Finisterre passierten. Wie ein Nebel lag die Küste längsseits, alles Felsen, und mit dem Fernglas konnte man sogar die Feuertürme und Häuser erkennen. Dazu die wilde See, wirklich haushohe Brecher, die sich über Bug und Luv ergossen und – Möwen. Übermorgen werden wir auf den Kanarischen Inseln und in einer Woche in Afrika sein!
Ich sah auch noch keine Wale und all das, die See war zu unruhig. Aber nach den Inseln wird das Wasser klar und still werden, wir werden Fliegende Fische, Delfine, Haie und afrikanische Möwen haben. Außerdem ein Schwimmbassin und Chinin!
Ich werde hier sehr verwöhnt und bin oft beim Kapitän. Er hat mir schon Filme entwickelt, wir trinken Liköre oder so etwas, seine Zigaretten darf ich rauchen, auch wenn er nicht in seiner Kammer ist, seine Kanarienvögel füttern, Bilder ansehen, und vor allem seinen Geschichten zuhören. Aber ich darf auch meine Langeweile durch Anstreichen von Geländern an Deck vertreiben.
Er ist so die richtige Type eines alten Seebären. Dann ist hier ein Engländer, der Diamantenfelder an der Goldküste hat und mir Englischunterricht gibt.
Jutta Kolbe beim Anstreichen eines Schiffsgeländers
Das heißt, er kann ganz gut Deutsch, wir unterhalten uns, und was ich nicht weiß, kann ich fragen. Er ist alt und dick und kennt die ganze Welt. Er behauptet, dass ich eine gute Aussprache habe und „sweet“ bin. Ausgerechnet ich, ich habe mir derlei Komplimente auch schon verbeten. Dann erzählte er mir, dass ich hier bei den Engländern den Namen Mona Lisa trage, und schleift alle jungen Landsleute heran, die behaupten, mir vorgestellt werden zu wollen. Sie nennen mich Miss Mona, obgleich ich ihnen zu erklären versuche, dass ich alles andere eher wäre als die ewig lächelnde Dame im Louvre und zu Hause Emil hieße. Aber sie bleiben dabei. Wahrscheinlich kommt das von meinem roten Samtkleid mit dem Spitzenkragen und weil sie ziemlichen Respekt vor Adligen haben und Samt und Spitzen mit Tradition, Monarchie und Gemälden verknüpfen.
„Mona Lisa“
Die Franzosen sind Luft für sie, ich habe nur einmal einen Franzosen mit einem Engländer sprechen sehen. Der Kapitän setzt sie von vornherein nie an einen Tisch, um Ärger zu ersparen. „We hate them more than we can say“, meint mein Diamantenfreund. Womit natürlich nicht gesagt sein soll, dass sie uns lieben. Unter den Engländern sind noch ein Arzt und ein Major, die vom Völkerbund nach Liberia geschickt wurden, weil von dort Sklaven von St. Isabel verkauft worden sein sollen. Abends ist alles im Smoking, und heute werden wir einen Tanzabend haben. Es ist nur gut, dass ich mein Rosenkleid mitgenommen habe und alles so schön gewaschen ist. Das muss ich nun alles selbst machen, auch Strümpfe stopfen. Noch geht das ja sehr gut, denn es ist noch alles heil, aber vor dem Später graut mir.
Wir kamen in Southampton und Boulogne gar nicht von Bord. Southampton liefen wir spätabends an, und außerdem hatte ich Kopfschmerzen und lag in der Koje. Jetzt haben wir eine sanfte Dünung und ich liege an Deck in einem Liegestuhl. Dann umsäuselt mich so sanft der Essensduft aus der Offiziersmesse. Unten bläst es, in einer halben Stunde ist Dinner. Wir haben übrigens schon Kaviar, Hummer, Austern gehabt und essen von morgens bis abends „vom großen Löffel“. Am liebsten würde ich mal wieder in eine recht dicke Schwarzbrotscheibe beißen.
Eben ist der Mond aufgegangen und legt einen silbernen Schleier über das grüne Wasser. Das Promenadendeck wird leer, ich muss mich umziehen. Man wird dinieren, den Mokka in der Halle nehmen, man wird dann tanzen, flirten, Herzen brechen, und der Alkohol wird alles wieder ins Lot bringen. Und unbemerkt werden wir Stunde um Stunde, Tag um Tag durch fremde Wasser zu unbekannten und bekannten Zielen gezogen. Eine bunte Gesellschaft, aus einem großen Würfelbecher für kurze Zeit auf ein paar Schiffsplanken geworfen.
Da lagen sie eines Tages vor uns, die Kanarischen Inseln, eine Oase der Seefahrer an der Nordwestküste Afrikas. Obgleich es noch sehr früh war, schien ein warmer Wind vom Lande her uns sirenenhaft entgegenzuströmen. Bizarre Felsen stiegen steil aus dem Meer auf, von der Brandung umspült; unwahrscheinlich schön, umgoldet von der aufgehenden Sonne, erhob über allem der 3.200 Meter hohe Piko del Teide von Teneriffa sein Haupt. Ein wahrhaft adeliger Name für einen Schaumgeborenen. Bald konnten wir mit bloßem Auge die hellen Häuser, die tiefgrünen Bäume und Palmen, die Felsenwohnungen ausmachen, die unmittelbar aus der Brandung hervorzuragen schienen. Ankerketten rasselten, wir lagen auf Reede, und mit der offiziellen Hafenbarkasse schossen auf die graue „Wahehe“ Schwärme von Boten zu, die ihren Inhalt auf unser Deck ergossen. Dunkelhäutige, geschmeidige Händler breiteten mit unbeschreiblichem Getöse ihre Waren aus. Ein fröhliches Gefeilsche hub an, gestikulierend suchte einer den anderen zu unterbieten. Ich konnte mich dem Zauber der japanischen Tassen nicht entziehen, die auf einem ovalen Untersatz standen, Teller und Untertasse vereinend. Zarteste Motive leuchteten unter Goldfäden in allen Schattierungen, und niemals hat ein goldgelber Tee, der durch das hauchdünne Porzellan schimmerte, so gemundet wie aus jenen Tassen, die nun auch schon lange den Weg alles Irdischen gegangen sind. Vorsintflutliche Vehikel fuhren uns in halsbrecherischem Tempo hinauf in den 1.200 Meter hohen Mercedeswald, durch Santa Cruz’ winklige Gassen, vorbei an Eseltreibern, Ziegen, an zerlumpten Bergbewohnerinnen, die Obst zum Markte trugen, und vorbei an zahlreichen, noch zerlumpteren Kindern. Ich trottete lange zwischen Weingärten, Bananenplantagen und Lorbeerbäumen einher und sah tief unter mir das blaue Meer, auf dem wie Spielzeug die Ozeanriesen lagen, umgeben von der Meute der Pilotfische.
Und dann fand sich die Würfelgesellschaft plötzlich wieder in Don José Luis Benitez’ „La Gatiana“, einem zwielichtigen Keller mit dem süßmodrigen Duft, der den riesigen Weinfässern und den Mauern entströmte. Wir saßen auf Holzbänken vor langen, ungehobelten Tischen, die hohe, schmale Gläser mit hellen und dunklen Landweinen und Teller mit an Holzstäbchen gespießtem Eselsschinken kredenzten. Wir tranken und lachten und spuckten die Olivenkerne auf den Boden, weil es dort so Sitte war.
Abends lagen wir vor Gran Canaria, und die Städte La Luz und Las Palmas warfen ihre Lichter in die Nacht und lange Streifen auf das tiefblaue Meer. In kleinen Booten durchklatschten wir das Wasser auf das Licht und die Palmen zu, die nicht nur am Hafen, sondern überall an mosaik-ausgelegten Plätzen zwischen Springbrunnen standen und mit ihren langen Wedeln einer gemächlich dahinschlendernden Menge eine leichte Seebrise zuzufächeln schienen. Die wenigen Frauen, die man sah, waren schwarz gekleidet, schneeweiß gepudert oder trugen Schleier. So manche geheimnisvoll Verhüllte schaute aus kleinen Fenstern der maurischen Häuser zu ihrem Gitarre spielenden Anbeter hinab, wenngleich oder vielleicht weil die Nächte dort so lind sind und die Lichter von La Luz auf der anderen Seite der Bucht noch so funkeln. Ich würde es genauso machen wie sie: ein wenig schauen, ein wenig lächeln, ein wenig spielen und funkeln lassen und dann vom Fenster fort in den mit Mosaiken ausgelegten Hof gehen, das Wasser des Springbrunnens über die Hand sprühen lassen und träumen, den Blick zu den Sternen.
In Las Palmas habe ich mir für fünfzehn Pesetas ein kleines, weißes Wollknäuel mit hellbraunen Flecken und Zottelohren gekauft. Wenn es groß ist, wird es bellen können. Noch passt es in ein Tomatenkistchen und wird wie alle Damen an Bord furchtbar verzogen. Passen wir auf, dass wir nicht überfüttert werden, denn das macht dumm und dick, und wir können die Abstinenz des wartenden Urwalds dann schlechter parieren.
Ankunft in Freetown
21. 3. 1930
Zuerst wäre ich am liebsten an Bord und im Bett geblieben. Es war so drückend in der Kabine und der Kopf so schwer.
Das Ohr war das erste Sinnesorgan, das Afrika empfing. So viel Geschrei aus Kehllauten und Vokalen mit dem Konsonanten „L“ als verbindender Note komponiert! Ein fremder Singsang, der so früh am Morgen in voller Lautstärke und aus nächster Nähe gesendet wurde, und beim Empfänger keinen Widerhall fand.
Wir waren da, aber ich wollte gar nicht da sein. Es war heiß, und doch fröstelte mich. Ist so das Lampenfieber vor dem großen Auftritt? Wie kam ich nur hierher, was wollte ich in diesem Land? Ich konnte nichts – und wer in aller Welt wollte mich denn auftreten sehen? Noch war der Vorhang nicht geöffnet, doch die Geräusche des Parketts drangen an mein Ohr.
Ich zog die Decke über den Kopf und fluchte der alten Neu Nieköhrer Erzieherin, die acht Jahre in Indien gewesen war und mich ganz in den Bann der Fremde gezogen hatte. Und ich fluchte meinem Starrsinn, der immer an einer einmal gefassten Idee festhielt und mir nicht erlaubte, das Nächstliegende zu tun und in der Nähe das Heil zu suchen. Und ich fluchte der Leichtigkeit, mit der sich alles hatte verwirklichen lassen: Besuch eines früheren Assistenten unseres Instituts, der Arzt bei einer amerikanischen Missionsstation in Liberia war; vom ganzen Labor ausgelacht hatte ich ihn angesprochen, ob er nicht eine Laborantin benötigte, und nun saß ich – sechs Monate später – hier!
Als ich genug gehadert hatte, stand ich auf, schlich zu meines imaginären Vorhangs Guckloch, und als ich durch das Bullauge auf das geschäftige Getöse all dieser schwarzen Menschen sah, wusste ich, dass wir mit vertauschten Rollen spielten. Die Akteure waren im Parkett, und ich, die Zuschauerin, stand auf der Bühne.
Ein unbeschreiblich buntes Bild bot sich dem Auge. Auf dunstig-blauem Wasser schaukelten kleine Boote, ruderten oder winkten und lachten sich zu. Sie riefen unverständliche Laute durcheinander, die weißen Zähne und die weißen Augäpfel blitzten, denn alle, alle waren schwarz. Ob es nun die Besatzungen der Leichter, der Barkassen waren, die uniformgeschmückt mit Tropenhelmen und wichtig großem Schreibblock sich ihren Weg zum Schiff bahnten, sie waren eben alle schwarz.
Das ist nun keine besonders tiefsinnige Feststellung beim Anblick der afrikanischen Küste, die bergig und grün bewaldet so greifbar nahe stand, aber ich muss gestehen, dass es mir heute – nach über fünfundzwanzig Jahren – nicht anders geht. Es ist der Kernpunkt der Probleme, die sich aus Kolonisation, Missionierung und Afrika ergeben. Zwei Welten stoßen aufeinander und werden sich nie verdauen – Schwarz und Weiß.
Man kann sich darüber streiten, ob es einen Sinn im Leben gibt, aber auch der größte Skeptiker kann seltsame Zufälle nicht wegleugnen. So unwahrscheinlich sie klingt, so ist auch diese kleine Begebenheit wahr, wie alles, was ich so vor mich hin schreibe. Denn gerade heute, als ich aus alten Briefen und der Erinnerung meine ersten Eindrücke von Afrika zusammensuchte und inmitten der nun gewachsenen eigenen Familie in unserem deutschen Garten lag, klingelte es an unserer Tür. Ich lief hinein und vor mir stand ein junger Mann in blauem Anzug, weißem Hemd und Schlips, den Hut in der Hand, die gelbe Aktentasche unter dem Arm, der er einen Zettel mit meinem Namen und meiner Adresse entzog. Und er war – schwarz.
„Mein Name ist Anthony Zeze, ich komme aus Liberia, um hier Deutsch und Französisch zu studieren. Father Parsell gab mir Ihre Anschrift.“ Wir tranken Tee, jemand hatte den Fernsehapparat angestellt, denn es wurde der Grand Prix International in Wiesbaden ausgetragen, und wenn Zeze nicht gerade seinen Tee balancierte, dann klopfte er auf seine gut gebügelte Kniefalte und rief einen Ausdruck des Bedauerns aus beim Fallen jeder Hürde. Einer nach dem anderen der Familie schaute herein, hockte sich irgendwo hin, wenig bekleidet, barfuß und sonnengebräunt. „Ein Freund von uns aus Liberia.“ Und: „Sie heißen Zeze, dann sind Sie vom Buzi-Stamm.“ „Nein, Madame, ich bin Loma!“ Und da waren sie wieder, die schlichten Erzählungen: „Wir heißen überall Buzi, aber wir sind Loma. Als unsere Leute zum ersten Mal zur Küste gingen, herrschte ein Häuptling namens Buzu. Sie kamen von Buzu und hießen nun Buzi. Aber wir sind Loma!“ Ich war so froh, dass der alte Stolz des großen Stammes bei ihm nicht hatte übertüncht werden können. „Der Häuptlingsstuhl dort ist aus Ihrem Land, aus Sigeta.“ „Das sind zwei Wegstunden von meinem Heimatdorf.“ „Sigeta ist etwa drei Tagesreisen von Bolahun entfernt, wie kamen Sie zur Mission?“ „Mein Vater nahm mich als Knabe dorthin, ich sollte lernen. Ich schrie und weinte, ich wollte nicht zum weißen Mann. Ich hatte Furcht, aber ich musste mit. Father Parsell nahm mich auf und ich blieb zwölf Jahre dort.“
Zu meiner Zeit hatte noch kein Loma-Vater seinen Sohn zum weißen Mann gebracht, und ich sah die beiden vor mir, wie sie im blau-weiß gestreiften Country-Cloth, die wenige Habe auf dem Kopf, barfuß die endlosen Pfade durch den Busch dem Ziel zustrebten. „Wie alt sind Sie?“ Zeze war erstaunt über diese Frage, und sie war auch dumm und europäisch, denn Jahre spielen dort keine Rolle. Wir mussten ihm helfen, sein Alter auszurechnen. Er meinte, er sei etwa 1930 geboren, in demselben Jahr also, in dem ich erstmalig Afrika betreten hatte.
Nun saß er hier, ein Stipendiat des liberianischen Erziehungsministers, geschniegelt und gebügelt inmitten lauter Weißer, die in ihrer saloppen Wochenendaufmachung viel besser in den Busch zu passen schienen als er. Was mochte sich in seinem schwarzen Kopf abspielen? Gingen unsere Gedanken ähnliche Wege bei der Schau der gegenseitigen Kontinente: für mich Wilde – Schwarze dort vor fünfundzwanzig Jahren; für ihn Wilde – Weiße hier und jetzt?
Werden fünf Jahre Studium in Deutschland genügen, um ihm den mühsam erlernten europäischen Lack wieder zu mattieren, ihm die Gezwungenheit der Konventionen zu nehmen und ihn wieder der Natürlichkeit seiner Väter zuzuführen, die frei und stolz waren? Wir wollen es mit ihm versuchen. Vielleicht haben wir Glück, denn er lachte so froh, als ich beim Abschiedshändedruck auf Eingeborenenart mit seinem Mittelfinger knallte und „Maleho“ rief. Maleho, das heißt auf Wiedersehen. Wir werden ihn wiedertreffen, er studiert in unserer Stadt, und er wird uns von unseren Freunden erzählen, die mir bei der Ankunft in Freetown noch so fremd waren und sich – so hoffen wir – beim Füllen weißer Blätter noch herausschälen werden.
Auf Wiedersehen, so hieß es auch für mich, auf Wiedersehen Europa, auf Wiedersehen „Wahehe“. Die Zeit war um, und du magst es wollen oder nicht, sie rollt ab, dein Auftritt oder Abgang kommt. Der Ausdruck nur ist relativ. Die „Wahehe“ hatte am Vorabend den letzten Händedruck getan mit ihrem Farewell-Dinner: Kaviar, Sekt, Känguruschwanz-Suppe, Chiemsee-Lachs, Masthuhn, Cumberlandtunke, Braunschweiger Stangenspargel, Holsteinischer Nierenbraten, eingemachte Reineclauden, Kopfsalat, illuminierte Monte-Christo-Eisbombe, Makronenaufsätze, Käseplatte, Früchte und Mokka. Du wunderst dich nicht mehr über den schweren Kopf, aber vielleicht wunderst du dich, wie ich das alles behielt. Ganz einfach: die Speisekarte liegt vor mir.
Nun drückten wir die Hand des Kapitäns und vieler anderer, die uns dann von der hohen Reling her nachwinkten, während wir von der Gangway in die wippenden Barkassen hineinjonglierten und die erste schwarze Hand ergriffen, die uns dort Halt bot. Durch das Gewimmel der Boote strebten wir viel zu schnell der Küste zu und waren bald vom geräuschvollen Hafen, von Zollschuppen und Passformalitäten aufgesogen. Die vielen Formalitäten überhaupt, die vielen formellen Besuche bei Weißen, das teils hoheitsvolle, teils huldvolle Benehmen der anderen Farbe gegenüber, ja selbst der Küstenkaste unter sich, sind es, die bei dem Namen Freetown sich dem Gedächtnis entrollen.
Sie ließen wenig Zeit für den ersten Schrecken des leeren Hotelzimmers mit seinem moskitonetz-behangenen Eisenbett, der fremden Speisen, die nicht à la carte und von ach so schwarzen Händen serviert wurden, und der eklig-hässlichen Geier, die überall und immer in nächster Nähe saßen und einen anzuglotzen schienen, um dann nach einer Bananenschale oder sonstigen Tischabfällen flügelschlagend und kreischend auf den Erdboden zu stoßen.
Wahehe: Speisekarte
Nicht nur die Geier balgten sich auf Freetowns heißem Pflaster, halbnackte, dickbäuchige und wollköpfige Kinder entrissen sich eine Frucht, eine leere Schachtel, im Dutzend stürzten sich hohlwangige, mit Fetzen behängte Schwarze auf einen Koffer, eine „Box“ der Weißen, sich gegenseitig unterbietend, ihn für einen Sixpence zum Hotel zu tragen. „No take’m, Ma’m, he be bad man, you never see him back again. I be fine boy. I wanta job. I savie plenty.“
Ich schaute sie nicht an, ich starrte einer Katze nach, die mit unwahrscheinlich schmalem Kreuz, fast einem Schattenriss gleich, um die Häuserecke schnürte.
Pelema
„You never watch’m, Ma, dat be thrash.“ Pelema, der gute, lange Gbandeboy, von der Mission geschickt, leitete mich majestätisch und weiß gekleidet durch all die Balgerei dem Hotel zu. Und da zankten sich dann auch „Weißgekleidete“ herum, aber sie waren nicht dunkelbraun und nicht majestätisch in ihren Bewegungen wie mein Urwaldboy, sondern weiß und laut und schnell. Und sie schrien nicht im Straßenlärm umher, sondern saßen am frühen Morgen auf Barhockern an der Bar und tranken eisgekühlten Whisky-Soda aus hohen Gläsern. Jedoch auch ihr Thema war Geschäft und Lebensunterhalt, wenn auch nicht nach Sixpences, Bananenschalen oder leeren Schachteln gerechnet wurde. In ihrem Golf- und Tennisclub, an der „Lovely Beach“, dem palmbestandenen Strand, in ihren Bungalows auf Hillstation, unerschöpflicher Gesprächsstoff blieb das Geschäft: Kurse von Palmkernen, Piassava, Erdnüssen, die in hohen Bergen gleich am Hafen aufgeschüttet waren. Man diskutierte über das Ein- und Auslaufen der Schiffe, über Baumwollernten, das holländische Diamantenschürfsyndikat in Liberia, die Zeitspanne, die dieser und jener noch benötigte, um „well-off“ und „home“ zu sein.
Man saß in Liegestühlen in blauen Tabaksqualm gehüllt, man klatschte in die Hände, um weißlivrierte und oft bereits ergraute „Boys“ aufzufordern, die ständig leeren Gläser mit neuen „Drinks“ zu füllen. Man klagte über die Unzuverlässigkeit der Schwarzen, die sie „Neger“ nannten, über schlechte Köche, den Schmutz der Stadt, das mörderische Klima, über – Langeweile.
Man kann zwar mit der Frau des Hauses abends Teneriffasterne knüpfen und auch die Schneckensammlung des Hausherrn, deines Chefs, bewundern, aber man wird keinen menschlichen Kontakt finden. Man trägt beim Essen langes Abendkleid und weißen Smoking nach englischem Muster, doch es stehen keine Blumen auf dem Tisch. Es hängt kein Bild an der Wand, nicht einmal eine Fotografie der drei kleinen, daheimgebliebenen Kinder, keine bunten Kissen oder Deckchen sind zu sehen, nirgends ein Farbklecks.
Nein, ich bin nicht mit ihnen warm geworden. Ob sie es miteinander wurden, weiß ich nicht.
Man war hier, der Weiße unter „Niggern“, und verpflichtet, das Leben eines Grandseigneurs zu führen, zu gleicher Zeit mit billig-europäischem Tand Erzeugnisse des Landes zu erheischen, in möglichst kurzer Zeit ein möglichst großes Vermögen zu erraffen, um dann ins Vaterland, welcher Nationalität auch immer, zurückzukehren.
Freetown, das heißt Freie Stadt. Wer mag der Stadt, die so wundervoll in ihre Berge eingebettet liegt, den Namen wohl gegeben haben? Ich habe wenig freie Menschen dort getroffen.
Weiter nach Bo
25. 3. 1930
Endlose, endlose Wälder dehnten sich zu beiden Seiten aus, ein nimmer enden wollendes, sattes Grün, so weit das Auge reichte. Die ganze Welt bestand einfach aus Grün, und dieses Grün hatte alle anderen Farben aufgesogen. Da waren keine Weiden, keine Felder, keine Menschen, keine Tiere. Ein dichtes Strauchwerk, ein Gewirr von Zweigen, fremdartigen Bäumen und Palmen war ungeachtet der verschiedenen Höhe durch Schlingpflanzen filzig miteinander verknüpft. Hier hatte noch keine ordnende Hand die Wälder aufgeteilt in Laub- und Nadelwälder, in Eichen-, Buchen- und Kiefern- oder Tannenwälder. Die Bäume standen nicht wie Soldaten und waren nicht vom Unterholz befreit. Hier kämpfte jedes um sein bisschen Licht, wer hier die stärkste Wurzel hatte, erhob sich über den anderen und wurde doch von Kletterpflanzen erreicht, umschlungen, im Wuchs gehemmt, verbogen und schließlich wieder eingeebnet in diese grüne Kappe, die Berg und Tal und Sumpf gleichsam überzog und Mensch- und Tierreich, die Erdkruste und Wasserläufe überdeckte. Hinauf, hinab, so rechts wie links, der undurchdringlich grüne Schleier schien mit dem Erdboden tief verzahnt und lief mit allem mit.
Das also war der Busch, wie viele tausend Jahre schon mochte er so wuchern? Wenn man hier hineintauchte, wie sollte man dann jemals zurückfinden? Und ob man das noch wollte?