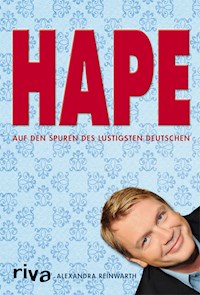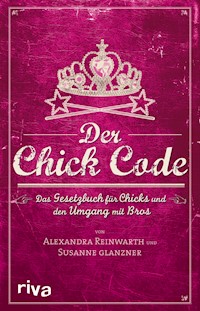Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: mvg Verlag
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Alexandra Reinwarth trifft ihre Entscheidungen rational. Also einigermaßen. Das dachte sie zumindest, bis sie sich intensiver mit der Frage beschäftigte, ob das 17. Paar schwarze Schuhe im Schrank wirklich nötig war. Jetzt weiß sie: Der Verstand hat nichts zu melden. Regelmäßig wird man von anerzogenen Denkfehlern in die Irre geführt. Scharfsinnig und witzig zeigt Alexandra Reinwarth, wie man diesen Fehlern auf die Spur kommt und endlich kluge Entscheidungen trifft. Eine unerlässliche Hilfe für alle, die sich wundern, warum sie gute Vorsätze nie einhalten, tolle Ideen nicht umsetzen und dauernd Dinge kaufen, die sie niemals brauchen werden.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 258
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Alexandra Reinwarth
Glaub nicht alles,was du denkst
Alexandra Reinwarth
Glaub nicht alles,was du denkst
Wie du deine Denkfehler entlarvstund endlich freie Entscheidungen triffst
Bibliografische Information der Deutschen NationalbibliothekDie Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie. Detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://d-nb.de abrufbar.
Für Fragen und Anregungen
Originalausgabe
5. Auflage 2020
© 2019 by mvg Verlag, ein Imprint der Münchner Verlagsgruppe GmbH
Nymphenburger Straße 86
D-80636 München
Tel.: 089 651285-0
Fax: 089 652096
Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme gespeichert, verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Redaktion: Sybille Beck
Umschlaggestaltung und -abbildung: Laura Osswald und shutterstock.com/tn-prints
Satz: inpunkt[w]o, Haiger (www.inpunktwo.de)
Druck: CPI books GmbH, Leck
ISBN Print 978-3-7474-0043-2
ISBN E-Book (PDF) 978-3-96121-377-1
ISBN E-Book (EPUB, Mobi) 978-3-96121-378-8
Weitere Informationen zum Verlag finden Sie unter
www.mvg-verlag.de
Beachten Sie auch unsere weiteren Verlage unter www.m-vg.de
INHALT
Einleitung
1. Kognitive Dissonanz
2. Die Geschichte des Clowns
3. Elliot
4. Wenn der Clown irrt – Bescheidenheit
5. Die Investition
6. Autoritäten
7. Nein
8. Zielscheiben und Bestätigung
9. Tunnelblick
10. Halo-Effekt
11. Ich bin verhandelbar
12. Jemand muss sich um mich kümmern
13. The Self-Serving Bias
14. Die Verzögerungstaktik
15. Der Barnum-Effekt
16. Der Attributionsfehler
17. Ich will aber!
18. Ich kann alles ändern, was ich will
19. Spotlight
20. Bahnung und andere Leute
21. Negativ!
22. Stell Dich nicht so an!
Nachwort
Natürlich wissen wir, wie man Hieben ausweicht.Das Problem ist, dass wir irgendwann angefangen haben zu glauben, dass wir sie verdient haben.Mark Manson
EINLEITUNG
WAS WIR WISSEN, WAS WIR GLAUBEN UND WAS WIR GLAUBEN ZU WISSEN
»Glücklicher in 10 Schritten!«, lese ich laut vor. Ich stehe vor dem Bücherregal von Anne und halte den Kopf in dieser Schräglage, die man automatisch einnimmt, wenn man versucht, die Buchrücken in Regalen zu lesen.
»Und? Hat’s funktioniert? Bist du glücklicher?«, frage ich Anne, die derweilen in der Küche Tee aufsetzt.
»Nee!«, schallt es zurück.
»Und was ist mit Fünf Wege zur Effektivität? Bist du effektiver geworden?«
»Nope!«, kommt es aus der Küche. »Und Denk dich reich?«, frage ich weiter, »tut sich da was, finanziell gesehen?«
»Auch nicht«, sagt Anne und stellt den Tee auf den Wohnzimmertisch. Wenn ich mich so umsehe, kann ich außerdem feststellen, dass das Buch Aufräumen für Dummies auch keine Wirkung erzielt hat. Und: »Wow, Anne?! Was ist mit Multi-Orgasmen leicht gemacht?« Aber an Annes Gesichtsausdruck ist zu erkennen, dass auch dieser Ratgeber nicht zum Erfolg geführt hat.
Ich habe mich schon immer gefragt, warum das nie funktioniert – also nicht das mit den multiplen Orgasmen (obwohl …), sondern das mit den Ratgebern.
Es ist schon witzig – wir meinen immer, wir müssten nur verstehen, wie etwas geht oder wie man etwas vermeidet, das machen wir dann Schritt für Schritt, und schon sind wir: organisierter, erfolgreicher, effizienter, glücklicher, führen eine bessere Beziehung und haben einen Orgasmus nach dem anderen. Aber in Annes Wohnzimmer ist es mir mal wieder aufgefallen: Verstehen reicht nicht.
Sonst würden wir nicht immer wieder Entscheidungen treffen, bei denen man sich hinterher und bei Licht betrachtet oft selbst ans Hirn greift.
Es könnte doch alles so schön sein – schließlich ist niemand von uns ein Idiot (zumindest meistens nicht) und eigentlich wissen wir ja – alles.
Wir wissen, was uns guttut:
Freunde,
gesundes Essen,
Bewegung an der frischen Luft,
kuscheln,
mit dem Herzen entscheiden.
Wir wissen, was wir mehr machen sollten:
Freunde treffen,
kochen,
uns an der frischen Luft bewegen,
kuscheln,
mit dem Herzen entscheiden.
Und was wir besser lassen sollten:
Wein,
Kippen,
Netflix gucken bis in den Morgen,
nörgeln (gut, das mache vielleicht nur ich),
laue Kompromisse machen.
Wir wissen auch, was wir unter gar keinen Umständen machen sollten:
auf der Weihnachtsfeier mit dem Kollegen aus der Buchhaltung knutschen,
mehr Geld ausgeben, als wir haben,
heimlich auf das Display vom Handy unseres Partners linsen,
über Probleme grübeln, auf die wir keinen Einfluss haben.
Und trotzdem … seufz. Irgendwie …
Wein, die Kippe in späten Nächten und Netflix bis in die Puppen sind ja noch das geringste Problem – wir wissen nämlich auch die wichtigen Dinge: dass wir das Leben leichter und uns selbst etwas weniger ernst nehmen sollten. Wir wissen, dass wir uns insgesamt weniger Gedanken machen sollten und den Moment genießen und dass wir – und nur wir – unseres Glückes Schmied sind. Dass es gescheiter wäre, sich nicht über Kleinigkeiten zu ärgern. Dass man sagen sollte, was man denkt, leben, wie man fühlt, und machen, was man will. Weiß man alles, den ganzen Schmu.
Es weiß auch jeder Mensch, dass niemand auf dieser Welt für immer bleiben wird und man diese kurze Zeit daher mit etwas füllen sollte, das einem sinnvoll erscheint – oder zumindest einen Heidenspaß macht, am besten sogar beides. Warum machen wir das dann nicht einfach? Wenn wir so schlau sind, warum nützen uns diese ganzen spitzenmäßigen Einsichten im täglichen Leben so wenig? Etwas einzusehen, verändert anscheinend gar nichts, außer, dass man ein schlechtes Gewissen hat, weil man es einfach nicht hinbekommt – obwohl man es doch besser wüsste! Aber nicht nur man selbst bekommt es nicht hin … sondern sonst auch niemand. Noch nicht mal jene, die schlaue Lebensweisheiten auf Facebook teilen (erfahrungsgemäß die am allerwenigsten) …
»Man kann das Glück nicht finden, man kann nur aufhören, es zu übersehen.«
So steht es dann da, vorzugsweise in Schreibschrift vor einem Buddhakopf in Aquarellfarben – und überhaupt, immer diese Buddhaköpfe überall! Manchmal frage ich mich, ob in anderen Teilen der Welt eine ähnliche Faszination für die christliche Religion besteht. (Ich stelle mir so etwas vor wie:
»Die zweite Wange ist der Weg!«
… vor einem Jesuskopf mit Dornenkrone, ebenfalls in Aquarell, der im indischen Facebook fleißig geteilt wird.)
Das Wissen darüber, wie alles sein sollte, im Allgemeinen und im Besonderen man selbst, hilft anscheinend nicht viel. Warum ist das so? Warum treffen wir immer wieder Entscheidungen, bei denen wir uns hinterher selbst an den Kopf langen? Wissen ist anscheinend nicht alles und unser Gehirn lässt uns jeden Tag in Denkfallen tappen, ohne dass wir es überhaupt merken.
Bis vor Kurzem hielt ich mich jedenfalls für ein freies, selbstbestimmtes und rationales Wesen. Die Recherchen zum Thema haben gezeigt, dass das eine reine Illusion ist.
Ich möchte Ihnen in diesem Buch zeigen, welche Denkfehler sich mein Hirn (und das einiger Freunde und Bekannten) so leistet, vielleicht ist etwas dabei, das Ihnen bekannt vorkommt. Und im Idealfall kommen Sie ein paar eigenen Denkfehlern auf die Spur.
Wir alle versuchen, mehr dies oder weniger das zu sein, auf jeden Fall – anders. Besser. Und da sind wir gleich beim ersten Denkfehler: Wenn zum Beispiel sehr glückliche Leute Ratgeber schreiben, behaupten die ja gerne; sie hätten irgendetwas verstanden, was wir noch nicht verstanden haben, und das müssten wir uns nur aneignen. Dann würden wir uns endlich weniger sorgen, uns weniger über unseren Partner ärgern, zufriedener sein mit dem, was wir haben, und der Glückseligkeit stünde nichts mehr im Weg. Das persönliche Glücksempfinden ist aber zu einem großen Teil in einem selbst angelegt.
Das ist ein bisschen so wie in der Werbung. Der Trugschluss ist, dass diese traumhaft schönen, makellosen Models, die sich die neue Faltencreme ins Gesicht schmieren, so schön sind, weil sie ebendiese Creme benutzen. Derweilen machen sie den Job ja nur, weil sie so traumhaft schön und makellos aussehen. Auch das wissen wir zwar eigentlich, aber die Werbung funktioniert trotzdem! Weil unser Hirn, wenn wir nicht permanent höllisch aufpassen, völlig ungeachtet unseres Wissens darauf hereinfällt. Aus dem gleichen Grund kauft meine Freundin Anne auch gerne Klamotten, die die Taille betonen. Nicht, weil die ihr besonders gut stehen würden, sie hat nämlich so gut wie keine Taille, aber an den Schaufensterpuppen sehen die Sachen großartig aus und genau so will Anne auch aussehen. Anne ist weder doof noch blind, aber sie braucht manchmal die Zeit von der Kasse bis nach Hause vor den Spiegel, bis ihr einfällt, dass sie schon wieder dem Trugschluss aufgesessen ist, die Klamotten machten die Taille.
Fragen Sie einen besonders glücklichen Menschen, warum er so ein Sonnenschein ist! Er wird nie sagen: »Keine Ahnung, das ist halt so!«, sondern, im Gegenteil, immer Gründe finden: entweder seine Einstellung oder seine Taten, auf jeden Fall etwas, das er aktiv richtig macht und das zu diesem beneidenswert positiven Gemüt führt.
Dieser Drang, eine logische Erklärung für bestimmte naturgegebene Eigenschaften zu formulieren, liegt übrigens in uns allen.
Wir alle versuchen permanent, uns und anderen zu erklären, warum wir so sind, wie wir sind, und weshalb wir tun, was wir tun. Und meistens liegen wir damit total daneben. Tatsächlich bestimmen nämlich unsere Gefühle einen Großteil unserer Entscheidungen, die vernünftigen Gründe erfinden wir hinterher. Das Lustige ist: Auch das ist ganz normal so, heißt es.
Und wenn das nicht verblüffend, spannend und höchst beunruhigend ist, dann weiß ich auch nicht.
1.KOGNITIVE DISSONANZ
Wir entscheiden nach Gefühl? »Kann nicht sein«, schüttle ich zunächst ungläubig den Kopf – aber dann fällt mir eine Reihe von Exfreunden ein, die eindeutig beweist, dass die Beteiligung des Verstandes bei einigen Entscheidungen nahezu ausgeschlossen ist. Unter anderem gab es einen Er-trennt-sich-bestimmt-bald, einen Irgendwann-wird-er-mich-lieben und nicht zu vergessen den Er-wird-sich-bestimmt-ändern. Ehrlich gesagt, gab es von Letzterem sogar drei.
Aber hey – wäre ja auch komisch, wenn Herzensangelegenheiten nicht vom Gefühl bestimmt würden. Und dass man den gleichen Fehler gleich dreimal hintereinander macht, kann vielleicht noch als extreme Dämlichkeit ausgelegt werden.
Von Exfreunden abgesehen, bin ich allerdings durchaus ein herausragendes Beispiel an Rationalität und fälle meine Entscheidungen ausschließlich nach einem ausgewogenen Abwägen aller Fakten, finde ich. »Tust du überhaupt nicht«, findet hingegen L., mein meistens reizender Lebensgefährte. Noch während ich entrüstet die Backen aufblähe und gedanklich zum Angriff blase, deutet L. stumm auf eine beachtliche Reihe Schuhe, die unseren Gang ziert.
»Was?«, blaffe ich ihn an. »Menschen brauchen nun mal Schuhe!« Und L. nickt verständig mit dem Kopf: »17 Paar …«, aber so schnell gebe ich mich nicht geschlagen.
»Ich kann ja schlecht immer dieselben tragen, sogar du hast mehrere!«, muss aber sogar selbst zugeben, dass das nicht mein stärkstes Argument ist. Tatsächlich ergibt sich vor dem Schaufenster eines schönen Schuhgeschäfts in meinem Kopf regelmäßig ein immer gleicher Argumentationsstrang:
Diese Absatzhöhe/Farbe/Form habe ich noch nicht.Zumindest nicht ganz so.Hohe/bequeme/schwarze Schuhe kann man IMMER brauchen.Ich habe mir eigentlich eine Belohnung verdient.Bis zum Schlussverkauf sind sie bestimmt weg!/Runtergesetzt sind sie auch noch!Und das finale Argument, das immer geht: Die sehen toll zu Jeans aus!Und ich muss zugeben: Ich mache das ständig. Also nicht nur vor Schuhgeschäften, sondern generell. Ich will etwas – warte, ich finde ein paar Gründe dafür, warum ich es brauche. Man kann sich selbst geradezu innerlich dabei zusehen, wie man angestrengt irgendwelche kruden Argumente zusammenkratzt. Dann kann man über sich selbst schmunzeln – und die Dinger schließlich kaufen, weil man gar so niedlich ist.
Das geht auch andersherum, nämlich mit Ausreden, ganz hervorragend. Andi zum Beispiel, mein kettenrauchender Freund aus Jugendtagen, wartet mit den absonderlichsten Argumenten auf, warum er die Raucherei nicht endlich an den Nagel hängt:
Er lebt ja sonst so gesund.Ein Laster muss man ja haben.Sooo viel raucht er ja gar nicht.Zucker/Feinstaub/Fett ist das wahre Gesundheitsrisiko.… und überhaupt: An irgendwas muss man ja irgendwann sterben. Außerdem hat Opa auch geraucht und gesoffen wie nichts Gutes und ist 90 Jahre alt geworden! Ja nun.
Dass wir uns permanent vor uns selbst das Hirn verbiegen, hat einen Grund, den Fachleute ›kognitive Dissonanz‹ nennen, und sie bezeichnet das scheußliche Gefühl, dass die eigene Handlung mit der eigenen Überzeugung irgendwie nicht in Einklang zu bringen ist. Wer das schnell mal spüren möchte kann sich kurz in diesen Gedanken hineinfühlen:
Wie schlimm finden Sie es, auf einer Skala von 1 bis 10, dass alle zehn Sekunden ein Kind an Hunger stirbt?
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Fertig?
Gut. Und jetzt überlegen Sie, wann Sie das letzte Mal etwas dagegen getan haben: ………………………………………………………………………………………………
Merken Sie es? Dieses unangenehme Gefühl ist kognitive Dissonanz und wir haben zwei Möglichkeiten, damit umzugehen:
Möglichkeit 1: Wir ändern unser Handeln, also spenden jetzt zum Beispiel einer Hilfsorganisation eine Summe X.
Möglichkeit 2: Wir suchen einen anderen Ausweg, der könnte zum Beispiel so aussehen:
Die Spenden fließen zum Großteil eh in die Bürokratie …… oder in die Hände korrupter Politiker im Bestimmungsland.Finanzielle Hilfe hindert die armen Länder, selbst auf die Beine zu kommen.Erst mal muss man ja wohl den Obdachlosen vor Ort helfen.Man kann ja nicht die ganze Welt retten.Und für die ganz Hartgesottenen: Ist doch nicht mein Problem, wenn die das dort nicht auf die Reihe kriegen.Seit Facebook kommt noch die Möglichkeit 3 hinzu: Ich teile einen emotionalen Post gegen den Hunger auf der Welt.
Das ändert zwar gar nichts an der Realität, aber fühlt sich ganz gut an. Jetzt kann man natürlich über den Sinn von Entwicklungshilfe generell durchaus diskutieren (und das wird ja auch getan), aber es ist ja nicht im Umkehrschluss so, dass sich jemand wegen der obigen Gründe dann Gedanken darum macht, wie er dem Obdachlosen vor Ort helfen kann. Im Gegenteil, da geht es dann weiter mit:
Wenn er wirklich wollen würde, dann hätte er Arbeit.Der ist faul/hat die falschen Entscheidungen getroffen.Der muss doch nur zum Sozialamt.Er hat es sich vielleicht so ausgesucht.Das ist eh alles eine Mafia.Sie verstehen, was ich meine? Um das konkrete Thema geht es hier gar nicht, sondern um das Prinzip. Das Suchen von solchen Argumenten, die die eigene Welt wieder in Ordnung bringen, ist eine Möglichkeit, diese unangenehme kognitive Dissonanz aufzulösen. Eine andere geht so: Wenn ich es endlich vor mir selbst so hingebogen habe, dass ich die Schuhe praktisch kaufen muss, weil sie wunderschön, dringend benötigt (na ja) und noch dazu ein großartiges Schnäppchen sind – also, wenn es sie dann in meiner Größe nicht gibt, dann kann ich direkt weitermachen:
Sooo schön sind sie auch wieder nicht.Meine anderen schwarzen sind eigentlich noch ganz gut in Schuss.Das Geld kann ich wirklich für was anderes brauchen.… und bin wieder ganz zufrieden. Eigentlich kann man kognitive Dissonanz auch so beschreiben:
Ich mach mir die Welt, widdewiddewie sie mir gefällt …
Genau. Und zwei mal drei macht vier. Sagte schon Pippi Langstrumpf.
Und das funktioniert in allen Lebenslagen! Ich habe zum Beispiel lange Zeit unfassbar viel Sprite getrunken – diese pappsüße Zitronenlimonade. Literweise. Das ging so lange gut, bis das Kind groß genug war zu fragen, warum es selbst eigentlich nur Wasser und Saftschorle zu trinken bekommt und nicht den guten Stoff. Wenn Sie da anfangen mit »Da ist nur Zucker drin, das ist höllisch ungesund«, wird es Sie eventuell mit großen Augen ansehen, denn wo bleibt denn da der Sinn, wenn Sie das Zeug weiterhin in sich hineinschütten, als müssten Sie einen Großbrand löschen? Aber kaum hatte der Verstand beschlossen, dass es wirklich besser, gesünder und klüger wäre, auf die Plörre zu verzichten, sprang in meinem Kopf ein Clown aus der Kiste, der lamentierte: »Bist du bescheuert? Warum immer auf alles verzichten, was Spaß macht oder schmeckt? Dann kannst du ja auch gleich vegan werden, den Fernseher abschaffen und auf einen Selbstversorgerhof ziehen – und zwar ohne fließend Wasser!« Zugegeben, mein innerer Clown übertreibt manchmal schamlos.
Er ist es auch, der zum Abendessen gern Strawberry-Cheesecake-Eis von Häagen-Dazs hätte, das isst er nämlich am liebsten. Da ist sie wieder, die kognitive Dissonanz – ich weiß nämlich, dass Eis kein Eins-a-Abendessen ist und mein Hirn versucht, diese Missstimmung sogleich zu lösen, und sagt so etwas wie: »Hey – es war ein langer Tag, du hast dir echt ein bisschen Eiscreme verdient, ein bisschen Cheesecake-Eis hat noch keinen umgebracht. Außerdem ist da Erdbeere drin und Erdbeeren sind gesund!« Und ich kann aufatmen und den großen Löffel aus der Schublade holen. Danke, Hirn!
Und so geht das die ganze Zeit.
Natürlich sollte niemand in der verkehrsberuhigten Zone schneller als Dingsbums fahren und wenn das jemand tut, halten wir ihn für einen egoistischen, rücksichts- sowie verantwortungslosen Idioten. Ich hingegen hatte es gerade furchtbar eilig, ich hatte praktisch keine andere Wahl! Und es ist ja auch nur dieses eine Mal und es ist eh nichts passiert.
Apropos Wahl. Sollte man hingehen, stimmt’s? Aber die eine Stimme ändert eh nichts am System und deswegen kann man genauso gut im Bett bleiben und einen Film streamen, das ist zwar illegal, aber hey – es ist ja praktisch alles illegal, was Spaß macht … Sie verstehen den Plot?
Ob die Schuhe nun gekauft werden oder nicht, ob Sie den Becher Eis essen oder ob Sie dem Obdachlosen nun Geld geben oder nicht, spielt keine so große Rolle (außer für den Obdachlosen) – aber das Prinzip, dass unser Hirn sich irgendeine Argumentation zusammenkratzt, um zu rechtfertigen, was wir den lieben langen Tag so tun und lassen, das schon.
Das Erstaunliche an diesem Prinzip sowie noch an einigen anderen Mechanismen in unserem Gehirn ist, dass wir es unfassbar oft einfach nicht bemerken, wenn sie zum Einsatz kommen (nämlich ständig), und zwar bei Dingen, die wesentlich bedeutsamer sind als Schuhe und Kleingeldbeträge. Tatsächlich, so sagt die moderne Hirnforschung, ist unser Hirn permanent damit beschäftigt irgendwelche Geschichten zu erfinden, die uns und anderen erklären, warum wir irgendetwas tun oder nicht tun – und macht dabei jede Menge Fehler. Also jetzt nicht nur Ihr Gehirn, sondern Gehirne generell. Und das kommt so:
2.DIE GESCHICHTE DES CLOWNS
In der Vergangenheit ging man stets davon aus, dass der Clown aus der Kiste – unsere Gefühle, unser Unbewusstes – irgendwie von unserem Verstand in Zaum gehalten werden muss. So wie ein wildes Tier durch einen Dompteur. Stellen wir uns den Verstand, die Ratio, als einen seriösen Herrn im dunklen Anzug vor. Er ist der Gegenpart zu dem albernen Clown mit der roten Nase. Sein Job ist es, dafür zu sorgen, dass der Clown nicht die Herrschaft übernimmt und uns in einem spektakulären Strudel aus Eiscreme, Sofa, Filmen, Drogen, Partys und spontanen One-Night-Stands in den Abgrund reißt. Er lässt durchaus was durchgehen, besonders am Wochenende, aber irgendwann muss es auch wieder gut sein. Er ist der kühle Kopf, er versteht Argumente (und Gegenargumente), er plant unseren Weg und er weiß, was gut für uns ist. Der Clown hingegen weiß, was sich gut anfühlt – und wenn es weitab vom Weg irgendwo glitzert, dann: HEIDEWITZKA, NICHTS WIE HIN! ES GLITZERT! So ist er.
Er ist aber nicht nur ein hedonistischer Partyteufel, sondern hat die ganze Bandbreite der Gefühle dabei, auch Rache und Zorn und Eifersucht und Unsicherheit und Gier und das ganze unschöne Gesocks. Wenn man zum Beispiel eine Mail von einem Kunden bekommt, die einen so richtig auf die Palme bringt, eine, in der einem in höchst herablassenden Worten Inkompetenz vorgeworfen wird, dann fängt der innerliche Clown schon an zu sabbern und wenn man ihn lässt, dann wird er umgehend eine Antwort verfassen, in der Worte wie Rindvieh, kreuzweise und zum Teufel scheren vorkommen. Darum hat es sich bewährt, in solchen Situationen eine Nacht mit der Antwort zu warten. In der Regel hat bis dahin der seriöse Herr im dunklen Anzug das Ruder übernommen (er ist nun mal nicht der Schnellste) und kümmert sich um die Sache mit dem Antwortschreiben. Da steht dann unter Umständen zwar sinngemäß genau das Gleiche, aber eben mit anderen Worten. Lange Zeit wurde der seriöse Herr im dunklen Anzug über den grünen Klee gelobt, die Ratio, die Selbstbeherrschung, die Vernunft.
Plato, der griechische Philosoph, hielt Gefühle für eine Krankheit, der nur mit dem Verstand beizukommen sei, und wäre es nach den Stoikern gegangen, dann hätten sie die gesamte Gefühlswelt vermutlich direkt abgeschafft. Ihrer Meinung nach konnte nur ein selbstbeherrschter Mensch die Dinge sehen, wie sie tatsächlich sind, und dementsprechend handeln. Jemand, der von Impulsen und Gefühlen beherrscht wird, ist hingegen ein triebgesteuerter Vollidiot. Gut, sie sagten nicht Vollidiot, aber das meinten sie. Den spitzohrigen Mister Spock von der Enterprise hätten die Stoiker geliebt – jemand, der völlig frei von Emotionen analysiert und stets die richtigen Entscheidungen trifft. Die Idee, dass wir das wilde Tier in uns kontrollieren müssen, hat sich lange gehalten und es hat auch lange Sinn gemacht.
Wenn wir einen Blick in die Vergangenheit werfen, in die Zeit, als es noch deutlich rauer zuging – und mit rauen Zeiten meine ich die, in denen Hexen verbrannt wurden und öffentliche Hinrichtungen ein geeignetes Sonntagsnachmittagsspektakel für die ganze Familie waren –, dann wird klar:
Die Idee, Vernunft und rationales Denken einzuführen, war nicht die schlechteste.
Nachdem das mit dem Hexenverbrennen und dem Vierteilen aufgehört hatte und man nicht mehr befürchten musste, wegen irgendwas Nase oder Ohren abgehackt zu bekommen, wurde das Leben deutlich angenehmer. Es kam die Aufklärung und es wurden so grandiose Dinge wie Menschenrechte, Autos und Digitaluhren erfunden. Das Leben wurde sogar so angenehm, dass jede Menge Mittelschichtkinder auf die Idee kamen, sie hätten sich lange genug dem seriösen Herrn im dunklen Anzug untergeordnet und es wäre an der Zeit, ihre Gefühle zu befreien. Wenn man nichts anderes gewöhnt ist, als ebenjene zu unterdrücken, dann muss sich das wie ein Erweckungserlebnis angefühlt haben – all die Urschrei-Seminare, Meditations-, Energie- und Channelingkurse, die psychedelischen Drogen (oft LSD) und all die anderen Möglichkeiten, ›Zugang‹ zu den eigenen Gefühlen zu bekommen, kommen von dort. Kurz: Der innere Clown lief Amok und die Leute fanden es Wahnsinn. Meine Mutter auch, die war eine von denen. Aus dieser Zeit stammt ein Spruch, der immer auf unseren Kühlschrank gepinnt war:
Jemandem zu sagen, was du fühlst, stimmt nicht, ist Seelenmord.
Was natürlich totaler Quatsch ist. Wir fühlen die ganze Zeit irgendwelches hanebüchenes Zeug, und manches beruht auf einem dämlichen Irrtum oder wird falsch interpretiert. Ein Gefühl ist noch lange kein Grund, im Recht zu sein …
Sie: »Du liebst mich nicht! Ich fühle es!«
Er: »Warum denn? Ich tue doch alles für dich!«
Sie: »Aber ich fühle es nun mal!«
Er: verdreht die Augen.
Dass Gefühle nicht die ultimative Wahrheit bedeuten und man mit seinen Gefühlen auch mal falschliegen kann, wird niemand mehr bestreiten. Die Tendenz der Ausgewogenheit fand zu der Überzeugung zurück, dass weder das ausschließliche Favorisieren von Gefühlen noch von Ratio der ganz große Wurf ist, sondern dass es die Zusammenarbeit von Clown und Verstand braucht, um einigermaßen gesund durchs Leben zu kommen. Heißt: Der dunkle Herr im Anzug trifft die Entscheidungen und passt auf, dass der Clown uns mit seinen Ideen nicht in Teufels Küche bringt. Das klingt vernünftig, logisch und ist außerdem vollkommen falsch.
Es ist nämlich genau andersherum.
3.ELLIOT
Sie haben ganz richtig gelesen, es ist genau andersherum. In unserem täglichen Leben ist es der Clown, der die Entscheidungen fällt. Herausgefunden hat das António Damásio, ein Professor für Neurologie und Psychologie und die Nummer eins der Top of the Tops der Hirnforscher.
Bei dieser spektakulären Herausfindung (und wir werden noch sehen, was daran so spektakulär ist) half ihm ein Patient, den Damásio ›Elliot‹ nennt. Elliot ist ein stinknormaler, liebenswürdiger, intelligenter Mann mit einem guten Job. Verheiratet, zwei Kinder, ein angesehener Kollege und liebender Ehemann. Es läuft bei Elliot – bis die Kopfschmerzen anfangen. Elliots Kopfschmerzen verwandeln sich in etwas Unerträgliches, das ihn schließlich daran hindert, sein normales Leben zu führen, und es stellt sich heraus: Elliot hat einen Hirntumor, ungefähr so groß wie eine kleine Mandarine, im sogenannten präfrontalen Kortex, also direkt hinter seiner Stirn. Aber, gute Nachrichten, der Tumor kann komplett entfernt werden, Elliot übersteht die Operation ohne größere Komplikationen, er erholt sich schnell und kann in sein normales Leben zurückkehren.
Aber irgendwie funktioniert sein normales Leben nicht mehr – beziehungsweise ist es Elliot, der nicht mehr funktioniert. Normal, werden Sie vielleicht sagen, schließlich hat man dem guten Mann den Kopf geöffnet und einen beeindruckend großen Teil seines Gehirns entfernt. Das Komische ist aber: Elliot ist nach der Operation genauso intelligent und auf der Höhe wie vor der Operation. Sein Erinnerungsvermögen ist um keinen Deut eingeschränkt, er kann überzeugend argumentieren und ist sich seiner Situation vollkommen bewusst. Trotzdem geht sein Leben, und zwar jedes Einzelteil, nach und nach in die Brüche.
In seinem Job bringt er seine Arbeiten nicht zu Ende oder sie sind fehlerhaft, und auch wenn eine Zeit lang alle Rücksicht nehmen (schließlich hat man dem guten Mann den Kopf geöffnet und einen beeindruckend großen Teil seines Gehirns entfernt), wird ihm schließlich gekündigt. Er lässt sich auf fragwürdige Finanzgeschäfte mit einem dubiosen Partner ein, geht prompt bankrott und zu Hause läuft es kein Stück besser. Er tut die ganzen Liebender-Ehemann-Dinge nicht mehr und versagt als Vater auf ganzer Linie bis, Überraschung, seine Frau die Koffer und die Kinder packt und ihn verlässt.
Er heiratet wieder, eine Frau, die ebenso fragwürdig ist wie zuvor seine Finanzgeschäfte, vor der ihn seine Geschwister eindringlich warnen und die sich nach einem Jahr mit seinem verbleibenden Hab und Gut aus dem Staub macht. Elliot zieht schließlich bei seinem Bruder ein und beantragt Invalidenrente – die er nicht bekommt. Alle Ärzte, die ihn begutachten und entscheiden sollen, ob Elliot aufgrund seiner Operation behindert ist, kommen zu dem Schluss:
Elliot ist ein qualifizierter, intelligenter und körperlich gesunder Mann. (Der sich jetzt mal bitte am Riemen reißen und in die Arbeitswelt zurückkehren soll.) Diese Diagnosen lassen ihn entweder als faul oder als Betrüger dastehen. Elliots Bruder findet sich damit nicht ab und insistiert, dass etwas nicht stimmt, dass bei der Operation mehr als dieser Tumor aus Elliot entfernt wurde, nämlich Elliot selbst. Ungefähr zu diesem Zeitpunkt, im Jahr 1982, kommt Elliot zu António Damásio, der ihn ebenfalls auf Herz und Nieren untersucht. Elliot besteht alle Intelligenztests, wie schon zuvor, mit Bravour. Sein Lang- und Kurzzeitgedächtnis sind vollkommen in Ordnung, sein mathematisches Verständnis top, seine sprachliche Gewandtheit und seine Auffassungsgabe normal – kurz, Elliot ist nicht doof. Aber er verhält sich so. Damásio sieht sich daraufhin an, was genau Elliot Probleme bereitet, und stellt fest, dass Elliot in der Arbeit einen ganzen Nachmittag lang damit verbringen kann, sich zu überlegen, wie er seine Dokumente ordnen soll. Nach Eingangsdatum? Oder nach Dringlichkeit? Oder vielleicht nach der Größe des Dokuments oder doch nach einem ganz anderen System? Elliot kann sich nicht entscheiden – nicht, wie er seine Dokumente ordnen soll, ob etwas verkauft oder eingekauft werden soll, obwohl er alle Möglichkeiten ohne Probleme aufzählen kann.
Damásio berichtet, dass Elliot minutenlang brauchte, um sich zu entscheiden, welchen Stift er zum Ausfüllen seiner Fragebögen verwenden sollte, über eine halbe Stunde, um den nächsten Termin auszumachen – und einige Stunden, um sich zu entscheiden, wo er zum Mittagessen hingehen wollte.
Es war ihm fast unmöglich, Pläne zu machen, sei es für die nächsten Stunden, Monate oder Jahre. Vor allem aber schien es so, als würde Elliot das alles nicht das Geringste ausmachen.
»Elliot erzählte die Tragödie seines Lebens mit einer Distanziertheit, die dem Ausmaß der Ereignisse nicht angemessen war«, schreibt Damásio, und weiter: »Er war immer kontrolliert und beschrieb die Szenen als leidenschaftsloser, unbeteiligter Zuschauer. Zu keinem Zeitpunkt spürte er sein eigenes Leiden, obwohl er selbst der Protagonist war.«1 Damásio kam es so vor, als ob ihm die Geschichte seines Patienten mehr zusetzte als diesem selbst.
Damásio fiel es daraufhin wie Schuppen aus den Haaren: Alle Tests, die Elliot mit Bravour bestanden hatte, waren dazu da gewesen, seine kognitiven Fähigkeiten zu messen, sein Denken. Elliot konnte hervorragend denken. Was Elliot fehlte, war die Fähigkeit zu fühlen.
Also machte Damásio einen anderen Test mit Elliot, einen, bei dem es ums Fühlen ging: Er legte ihm Fotografien vor, die normalerweise starke Emotionen auslösen. Bilder von verbrannten Menschen, schrecklichen Unfällen, Kriegsschauplätzen und verhungernden Kindern – kurz: alles, was Sie und mich innerhalb kürzester Zeit in Tränen ausbrechen lässt. Elliot hingegen betrachtete das alles und fühlte – nichts. Gleichzeitig war ihm vollkommen bewusst, dass die Bilder ihn eigentlich zutiefst verstören müssten – und das auch getan hätten, damals, in seinem früheren Leben. Aber jetzt waren sie ihm einfach nur egal. Genauso egal wie sein verlorener Job, seine Frau, sogar seine Kinder. Für Elliot war der Verlust seiner Familie so bewegend wie das Ausräumen der Spülmaschine. Elliot war sozusagen zu Mr. Spock geworden (bis auf die Ohren).
Das ist zwar menschlich gesehen für den Mann eine schier unvorstellbare Katastrophe (die ihm egal ist), aber wenn wir von der Idee ausgehen, dass unser Clown von unserem Verstand im Zaum gehalten werden muss und wir unsere Entscheidungen mit dem Verstand fällen – warum konnte Elliot dann keine vernünftigen Entscheidungen mehr treffen? Wenn Elliot schon keine Gefühle im Weg standen, die sein rationales Denken beeinflussten, dann müsste er doch zumindest zu einem kühlen Strategen geworden sein! Warum brachte er es in der Arbeit nicht fertig, sich für ein Ordnungssystem zu entscheiden? Er war doch trotz allem ein intelligenter Kerl, warum konnte er dann nicht rational zu einer Lösung für eine Aufgabe, so klein sie auch sein mochte, gelangen? Man möchte doch meinen, dass jemand, der nicht von seinen Emotionen abgelenkt wird, umso klarer und analytischer vorgeht! Aber das Verstummen des Clowns in seinem Hirn hatte nicht dazu geführt, dass Elliots Verstand zu einem weisen Alleinherrscher wurde. Es hatte sein Leben zerstört. Und es war ihm vollkommen egal.
Dass es bei einer Schädigung dieses Hirnareals (dem präfrontalen Kortex) zu Verhaltensänderung kommen kann, ist in der Psychologie seit Langem bekannt – noch mehr: Durch eine gezielte Schädigung versuchte man diese Verhaltensänderung bewusst herbeizuführen. Ab 1936 wurde in der Psychochirurgie eine Methode weltweit populär, die sich Lobotomie nennt und Stoff für jede Menge Horrorfilme liefert (zartbesaitete Gemüter mögen diese Zeilen überspringen):
Psychisch Kranken wurde dabei, oft gegen ihren Willen, oberhalb des Augapfels ein langes, spitzes Werkzeug, ›Eispickel‹ genannt, eingeführt (ja, genau, ins Auge) und die dort sehr dünne Schädeldecke durchstoßen. Dann bohrte man nach Ermessen noch ein bisschen weiter und bewegte den Eispickel hin und her, um das Gewebe zu zerstören. Ach so: Nein, es brauchte für den Eingriff keine Narkose, eine geringe lokale Betäubung reichte aus. (Das war übrigens die ›verbesserte‹ Methode. Ursprünglich bohrte man den Patienten links und rechts oberhalb des Ohres Löcher in den Schädel und arbeitet sich mit einem länglichen Messer zum präfrontalen Kortex vor, also hinter die Stirn, und stocherte dort ein bisschen herum.)
Diese Methode machte viele psychisch Kranke zu lebenslangen Pflegefällen, verhalf den weltweit geschätzt ungefähr einer Million Patienten zu schwersten Persönlichkeitsstörungen und seinem Erfinder im Jahr 1949 zum Nobelpreis. Herzlichen Glückwunsch. Bis in die 1960er- und 1970er-Jahre gab es Ärzte und Psychiater, die den Eingriff als geeignete Maßnahme zur Behandlung renitenter Gefängnisinsassen, rebellischer Jugendlicher und zur Vermeidung von Rassenunruhen empfahlen. Besonders pervers ist, dass sich die Behandlung im Nachhinein als so gut wie wirkungslos herausgestellt hat. Bis heute existieren keine Belege zur Wirksamkeit der Methode. Und mehr: Die Methode verwandelte die Menschen in so etwas wie Zombies. Es ging zwar dadurch vielleicht eine Angststörung weg, aber eben alles andere auch. Selbst einer der begeistertsten Verfechter der Lobotomie, der US- amerikanische Psychiater Walter Freeman, sagte erschreckend offen: »Die Psychochirurgie erlangt ihre Erfolge dadurch, dass sie die Phantasie zerschmettert, Gefühle abstumpft, abstraktes Denken vernichtet und ein roboterähnliches, kontrollierbares Individuum schafft.«2 Krass, oder?
Das alles ist mit einer Schädigung des Frontalhirns zu haben. Des Weiteren sind in diesem Symptomkomplex gratis unter anderem folgende Symptome zu haben: motorische Verlangsamung, Teilnahmslosigkeit, Gleichgültigkeit, Verlust von Initiative und sexuellem Verlangen, Vernachlässigung des äußeren Erscheinungsbilds, Entschlussunfähigkeit und Müdigkeit.3