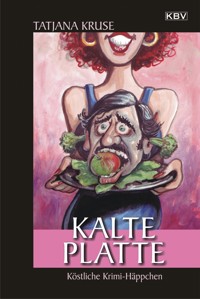Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Haymon Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Pauline-Miller-Krimi
- Sprache: Deutsch
RABENSCHWARZ MIT GLITZER: KRIMIVERGNÜGEN MIT WASSERLEICHE UND STERBENDEM SCHWAN LETZTES STÜNDCHEN FÜR DAS HÜNDCHEN? RADAMES TAUCHT AB UND EINE WASSERLEICHE TAUCHT AUF Der Bodensee gibt seine Toten nicht mehr her? Denkste! Die voluminöse Opernsängerin Pauline Miller hat in Bregenz Quartier genommen. Und wo Pauly ist, ist das Drama nicht weit - denn so gehört es sich für eine wahre Diva nun mal. Statt Männerkummer wird Pauline diesmal von Hundesorgen geplagt: Ein brutaler Dognapper hat ihren Radames entführt - ohne Rücksicht auf Verluste und das zarte Nervenkostüm der exzentrischen Pauline. Und sowie der Hund abtaucht, taucht plötzlich eine Wasserleiche auf. Damit singt Pauline nun statt Arien den Blues und hat keinen Sinn für Proben. Zum spektakulären Showdown kommt es denn auch nicht auf der Seebühne, sondern mitten auf dem Bodensee … KRIMÖDIEN VON TATJANA KRUSE: SCHRILL, LEBENSKLUG UND URKOMISCH! Mit Pauline Miller hat Star-Autorin Tatjana Kruse eine höchst originelle Figur geschaffen. Die ebenso schillernde wie voluminöse Pauly ist sich selbst am nächsten. Aber fast ebenso nahe ist ihr ihr Hund. Denn im Gegensatz zu ihren verflossenen Männern hat der sie noch nie enttäuscht, auch wenn er unter der Schlafkrankheit leidet und immer wieder spontan zu schnarchen beginnt … Tatjana Kruse, Comedy-Liebling der Krimifans, zeigt sich auf der Höhe ihrer Kunst und präsentiert ein Buch voller Drama, Glamour, rabenschwarzem Humor - und Schokolade. *********************************************************** "Tatjana Kruse ist die lustigste Autorin, die ich kenne. Mit keinen anderen Büchern habe ich mich so amüsiert wie mit ihren!" "So schräg sie auch ist - man muss Pauline Miller einfach lieben. Schon wenn ich daran denke, wie sie mit ihrem knallpinken Lagerfeld-Jogginganzug auf die Jagd nach einem Dognapper geht, muss ich schmunzeln …" "Die Krimis von Tatjana Kruse sind nicht nur lustig, sondern auch spannend - das macht sie zu einem morbiden Vergnügen!"
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 268
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Tantjana Kruse
Glitzer, Glamour, Wasserleiche
Ein rabenschwarzer Pauline-Miller-Krimi
Für Django, den echten Boston Terrier.
Blubb
Sie glauben, Sie wüssten, wie der Hase läuft?
Falsch!
Der Hase läuft nicht, er hoppelt.
Und eine Wasserleiche sinkt auch nicht schnurstracks wie ein Stein auf den Gewässerboden, wie man das als noch ungeübter Mörder denken könnte. Als jemand, der zum ersten Mal versucht, eine Leiche, die er in zwei große, mit Paketkleber zusammengeklebte und mit Fahrradketten verschnürte Müllsäcke gesteckt hat, auf den Grund des Bodensees zu befördern.
Bei Nacht und Nebel.
Also, im Grunde war es nur Nacht. Folglich dunkel. Aber nicht neblig. Deswegen sah man in der Ferne drüben am Ufer – an einem der feinen Enden des Sees, wo die teuren Villen stehen – einige Lichter brennen. Aber wirklich nur sehr wenige. Es war ja spät.
Sie waren zu zweit.
Die dümpelnde Leiche nicht mitgezählt.
„Drück sie mit dem Ruder nach unten“, sagte die Frau.
Der Mann atmete genervt aus. „Was glaubst du, was ich die ganze Zeit mache? Ihr mit dem Ruder den Rücken tätscheln?“
Die Leiche dümpelte ungerührt weiter.
Dumm jetzt. Das hätten sich die beiden aber auch vorher überlegen können. Was uns als Hinweis darauf dienen soll, dass es sich nicht um professionelle Vertreter des organisierten Verbrechens handelte.
Wobei auch Laien bei guter Planung zwei und zwei zusammenzählen können. Man muss nämlich nicht im Toten Meer schwimmen, um nicht unterzugehen. Wer sich flach wie ein Bügelbrett auf den Rücken in ein Gewässer legt, geht erst mal nicht unter. Haben wir doch alle als Kinder im Hallenbad am eigenen Leib erfahren. Das gilt folgerichtig auch für Leichen, bei denen die Totenstarre eingesetzt hat.
„Wir müssen sie beschweren“, konstatierte der Mann.
„Womit denn, bitte schön?“ Genervt rollte die Frau mit den Augen. Was man in der Dunkelheit nicht sehen, aber irgendwie hören konnte, als würden die Augäpfel beim Rollen ein knirschendes Geräusch von sich geben.
Stille senkte sich über das Ruderboot.
Die beiden verharrten reglos auf ihrer jeweiligen Sitzbank. Als ob sie dächten, die Leiche würde, wenn sie nur lange genug reglos verharrten, ein Einsehen haben und doch noch von allein untergehen.
Um niemals wieder aufzutauchen.
Das hatten sie schließlich oft genug in der Zeitung gelesen. Was der Bodensee einmal verschlingt, gibt er nicht wieder her. Seit 1947 – das wusste jeder, der hier wohnte – waren fast einhundert Menschen im See ertrunken und nie mehr aufgetaucht.
Eingeweihte kennen die Gründe dafür: Es ist nichts Mysteriöses, der Bodensee ist kein zweites Bermuda-Dreieck, nein, es liegt unter anderem an der niedrigen Temperatur seines Tiefenwassers. Sinkt eine Leiche unter dreißig Meter, bilden sich bei durchschnittlich vier Grad Wassertemperatur keine oder zu wenige jener Fäulnisgase, die nötig sind, um den Körper wieder nach oben zu treiben. Außerdem hält der Wasserdruck den Körper in der Tiefe. Und sobald der Leichnam auf den Grund gesunken ist, decken ihn relativ zügig Sedimente aus den Bodenseezuflüssen Rhein, Bregenzer Ach oder Argen zu. Wenn dieser Fall eintritt, können selbst Taucher mit Unterwasserkameras und Echolot wenig ausrichten. Kurzum: perfekte Bedingungen für eine illegale „Entsorgung“.
Aber diese Leiche hier zeigte ihren Mördern gegenüber kein Entgegenkommen – sie weigerte sich standhaft unterzugehen. War ja auch etwas viel verlangt. Auf die, die einen ermordet hatten, auch noch Rücksicht zu nehmen? Nee, oder? Das konnte nun wirklich keiner verlangen.
„Ich hab doch gesagt, wir sollten es wie einen Selbstmord aussehen lassen“, maulte der Mann. „Mit Steinen in den Manteltaschen ins Wasser gegangen – wie Virginia Woolf. Dann wäre es völlig egal gewesen, ob man sie findet oder nicht.“ In seiner Freizeit las er viel. Vor allem Biografien berühmter Frauen.
„Klar. Weil sie uns zuliebe einfach so in den See spaziert wäre“, hielt die Frau dagegen, die nicht las, aber pragmatisch dachte.
„Wir hätten sie unter Wasser drücken können.“
„Das hätte der Gerichtsmediziner anhand der Handabdrücke und Blutergüsse doch sofort als Tötungsdelikt eingestuft! Und prompt hätte es geheißen: Adiós, schöner Selbstmord!“ Sie las zwar nicht, aber sie schaute dafür leidenschaftlich gern sämtliche CSI-Serien im Fernsehen und war somit auf dem neuesten Stand, was kriminaltechnische Spurenermittlungsuntersuchungen anging.
„Na schön, dann hätten wir sie eben in der Badewanne ertränkt und anschließend in den See geworfen.“
„Mein Gott, sie hat immer nur Schaumbäder genommen. Ihre Lunge wäre voll von sündteuren Badezusätzen gewesen. Meinst du nicht, das hätte irgendwie auffällig gewirkt?“ Sarkasmus war eine ihrer Kernkompetenzen.
Wieder Stille.
„Wenn wir lange genug warten …“, fing der Mann an.
„Lange genug, lange genug – wir haben keine Zeit für lange genug. In zweieinhalb Stunden geht die Sonne auf. Was, wenn sie bis dahin immer noch nicht untergegangen ist?“
Der Mann brummte: „Ich rudere sicher nicht noch mal ans Ufer, um etwas Schweres zu holen.“ Er war nicht sportlich und schon gar kein Ruderer. Wie Michael Jackson gesungen hatte: „I’m a lover, not a fighter.“ Seine Armmuskeln konnten eine Maß Bier halten, mehr nicht. Schon jetzt schmerzten sie fast unerträglich, und von der ungewohnten Anstrengung hatte er Seitenstechen.
Seine Kraft reichte aber – das musste die Verzweiflung sein – noch, um mit dem Ruder jetzt kräftiger zuzuschlagen. Es wirkte ein wenig so, als wolle er der widerspenstigen Leiche den Podex versohlen.
„Was machst du denn da?“, herrschte ihn die Frau an. Nicht etwa, weil sie wegen der Totenschändung moralische Bedenken hatte, einfach nur deshalb, weil sie es nicht ertrug, wenn er Eigeninitiative zeigte. Das ging nämlich immer schief.
Prompt platzte einer der Müllsäcke auf. Man sah ein Stück Knie. Wasser drang ein. Die Leiche bekam leichte Schlagseite.
„Ha!“, rief der Mann. Er rief es triumphierend. Mit stolzem Gesichtsausdruck, wie ein Matador, der dem Stier mit dem Degen den Descabello, den letzten, tödlichen Stoß ins Genick, versetzt. Ruckartig schob er die Leiche mit dem Ruder vom Boot weg.
Das heißt, sie wegzuschieben war seine Absicht, aber das Ruderblatt verfing sich dabei in einer der beiden Fahrradketten, die sie um die Knöchel und den Hals der Leiche geschlungen hatten, um sie besser transportieren zu können.
Jählings wollte er das Ruder zurückreißen, aber es glitschte ihm aus den Händen. Er verlor das Gleichgewicht und fiel schwer nach hinten gegen den Bootsrand, woraufhin das Boot schaukelnd abdriftete.
Währenddessen ging die Leiche – nunmehr mit Müllsackleck und eingehaktem schwerem Ruder – unter. Erstaunlich zügig sogar, wenn man berücksichtigt, dass sie bis gerade eben noch unsinkbar erschienen war. Insofern ähnelte sie der Titantic, nur ohne Eisberg.
„Jetzt tu doch was!“, gellte die Frau.
Der Mann rappelte sich auf und schaute auf die Stelle, an der eben noch die Leiche gedümpelt war. Jetzt sah man nur noch einen Zipfel der oberen Mülltüte …
… und gleich darauf gar nichts mehr. Außer kleinen Wellen, die sich konzentrisch vom Ort des Untergangs fortbewegten.
„Du Idiot!“, kreischte die Frau.
Das war bitter, ließ sich aber nicht leugnen. Der Mann schwieg.
„Du selten blöder, hirnrissiger Idiot!“, setzte sie noch eins drauf.
Das tat noch mehr weh als der Muskelkater, aber er schwieg dennoch stoisch.
„Wie sollen wir denn jetzt zurück ans Ufer kommen, hast du dir das überlegt? Nein, natürlich hast du dir das nicht überlegt. Wenn du überhaupt mal denkst, dann ja immer erst hinterher!“
Er presste die Lippen aufeinander. Sie tat gerade so, als habe er es absichtlich getan.
„Ich sag es dir gleich: Ich helfe dir nicht. Sieh zu, wie du uns ans Ufer paddelst. Und wenn du es mit den Händen tust.“ Sie verschränkte die Arme vor der Brust.
Er ließ sich auf seiner Bank nieder, nahm das verbliebene Ruder aus der Halterung und versuchte, das Boot wie ein Indianer im Kanu mit nur einem Paddel voranzutreiben. Erst links, dann über das Boot heben, dann rechts. Bei jeder Bewegung hätte er seinen Schmerz am liebsten herausgeschrien.
Aber er blieb stumm, sagte kein Wort, hielt einfach nur den Mund.
Denn eins hatte er in seinem Leben als Mann gelernt: Mit einer Frau zu streiten glich den Nutzungsbedingungen zu einem Software-Upgrade auf dem Computer. Es kostete nur wertvolle Lebenszeit, die man nie zurückbekam. Und es brachte nichts. Absolut gar nichts. Darum ignorierte man irgendwann alles, auch das Kleingedruckte, und klickte einfach nur auf „akzeptieren“. Auch wenn er ein klitzekleines bisschen sehnsüchtig mit dem Gedanken spielte, noch eine zweite Person zu versenken …
Erster Akt
Bodensee-Blues für Anfänger
Eine Symphonie aus Blau. Blaues Wasser, blauer Himmel, alles blau. Nicht „Monochrome bleu“ von Yves Klein, sondern ein Meer unterschiedlichster Blautöne. Es handelt sich ja schließlich auch um ein Meer, genauer gesagt um das Mare Suebicum.
Wie herrlich, vom Bodensee an diesem Frühsommertag so phantastisch empfangen zu werden.
Ich sitze an der Spitze der Seeanlage auf einer der Steinstufen, die direkt hinunter zum Wasser führen, und schaue hinaus ins Blau. Ja gut, nicht nur Blau. Mehr so Blau mit silberweißen Sprenkeln. Die Sonne glitzert diamanten auf dem Wasser, vor mir dümpeln majestätisch drei weiße Schwäne, in der Ferne sieht man weiße Segelboote – aber das sind alles nur bloße Tupfer auf intensivem, betörendem Blau.
Radames, mein Boston Terrier, steht kläffend und mit rotierendem Schwänzchen am Rand des Wassers und starrt einen der Schwäne an. Der Schwan starrt zurück. Ich kenne meinen Hund und weiß: Liebe liegt in der Luft. Das Kläffen ist seine Ode an die Geliebte. Er möchte Leda und der Schwan nachstellen, nur statt Leda mit einem Boston Terrier. Ich fürchte allerdings, der Schwan hat kein romantisches Interesse an Radames. Der überlegt sich gerade, ob er auf Fleisch umsteigen und die Töle verschlingen soll. Zumindest guckt er giftig.
Bis ein Mann in einem auffälligen dunkellila Anzug mit hellblauem Fischgrätmuster die Stufen heruntergeschritten kommt und dem Schwan aus einer Papiertüte Brötchenkrümel zuwirft.
So ein Schwan kann ja mit seinem Schnabel nicht wirklich lächeln, aber wenn er es denn könnte, jetzt würde er es tun. Gierig schnappt er nach den Krümeln. Nun guckt mein Radames böse, weil die gefiederte Liebe seines Lebens sich einem anderen zugewendet hat. Ihm dämmert wohl gerade, dass Brotkrumen für Schwäne das sind, was Diamanten für Blondinen sind, und dass seiner Liebsten das Glück ihres Magens über das Glück seines Herzens geht. Er kläfft – diesmal ungehalten.
Ich betrachte den Rücken des Schwanenbeglückers. Schmaler, als ich es normalerweise bei Männern goutiere, mit schulterlangen, graumelierten Haaren.
Aber ganz ehrlich, wenn man tatsächlich Bestellungen beim Universum aufgeben könnte, dann würde ich in diesem Moment gut leserlich auf das Formblatt kritzeln: Bitte einpacken, mit rotem Geschenkband und Schleife verzieren und zu mir nach Hause liefern!
Ich bin weiblich, Mitte dreißig, voller Saft und Kraft und Lebenslust. Aber seit exakt zwölf Monaten und 24 Tagen bin ich „unbesprungen“, lebe keusch wie eine Nonne – will heißen, mein Garten der Liebe wurde nicht bewässert. Oder noch deutlicher: Ich hatte keinen Sex. Null. Nada.
Das hatte Gründe. Zum einen hat mich mein Ex schnöde abserviert. Per SMS. Aus heiterem Himmel. Zum anderen wurde der Mann, mit dem ich mich über meinen Ex hinwegtrösten wollte, geschätzte dreißig Minuten, bevor er mich zu begatten gedachte, von einem heimtückischen Mörder umgebracht. Nicht nur umgebracht, sondern geköpft und geköchelt. Schimpfen Sie mich übersensibel, aber das wirkte sich auf meine Libido aus wie ein Eimer eiskaltes Wasser – sie schrumpelte ein.
Sowohl mein Ex als auch der Mann, der mich über meinen Ex hätte hinwegtrösten sollen, waren Tenöre. Als sich meine Libido nach ein paar Monaten wieder zaghaft zu regen begann, schwor ich mir deshalb: Nie wieder mit einem Tenor! Okay, das schwor ich nicht zum ersten Mal, aber dieses Mal war es mir ernst!
Das war kein Neujahrsvorsatz, keine lose formulierte Absichtserklärung, das war ein Blutschwur! Der allerdings – ich bin Opernsängerin und toure von einem Engagement zum anderen – die Auswahl an potenziellen Betthasen drastisch verringert.
Vermutlich überlegen Sie sich nicht oft, wie der Alltag einer gefeierten Opernsängerin aussieht. Warum auch? Und falls Sie es doch einmal tun, dann stellen Sie ihn sich bestimmt glamourös vor. Voller Glitzer und Luxus und Dolce Vita.
In Wirklichkeit tingele ich von einem Opernhaus zum nächsten – okay, ja, es ist Tingeln auf höchstem Niveau, aber dennoch ein Leben on the road – und kann meine Freundschaften nur über soziale Netzwerke pflegen. Und weil ich rund um die Uhr entweder probe oder auftrete, beschränken sich meine Männerbekanntschaften allein auf das berufliche Umfeld. Es herrscht ein natürlicher Graben zwischen den Leuten hinter den Kulissen und denen im Rampenlicht, was das Feld der möglichen Kandidaten weiter ausdünnt. Und die im Rampenlicht sind gern auch mal schwul.
Langer Rede, kurzer Sinn: Seit über einem Jahr befinde ich mich in einer Trockenphase. Ich will nicht sagen, dass ich jeden genommen hätte, aber die Latte hing schon verdammt niedrig.
Da!
Der Mann im lila Fischgrätanzug hat sämtliche Brotkrumen verfüttert und dreht sich um.
Zackig stütze ich mich mit beiden Händen auf der Steinstufe ab, auf der ich sitze, weil man auf diese Weise dem Betrachter den Brustkorb gefälliger entgegenstrecken kann. Ich benetze mir die Lippen und lächle.
Und ja, er enttäuscht auch von vorn nicht. Leuchtend blaue Augen mit vielen feinen Fältchen drum herum, was entweder davon zeugt, dass er gern und oft lacht oder dass er sich häufig ohne Sonnenbrille in die Sonne begibt und dann blinzeln muss.
Ein wenig ins Schlucken komme ich angesichts seines Vollbarts. Der ist wirklich nicht von schlechten Eltern. Aber egal. Insgesamt überzeugt mich seine Aura. Ein Code für: Er lebt, er ist ein Mann, und ich finde ihn nicht gänzlich abstoßend. Das muss reichen.
Urteilen Sie nicht über mich! Ein Leben ohne Liebe ist wie ein Puzzle, in dem Teile fehlen. Ich habe ja versucht, mir einzureden, dass die Liebe zur Musik und die Liebe zu meinem Hund reichen – und meine Seele war damit auch zufrieden. Aber mein Körper nicht! Da hat es auch nicht geholfen, dass sich meine beste Freundin und Agentin letzten Sommer in Salzburg verliebt hat, und die beiden ihre Liebe – vor meinen Augen – beglückt auslebten. Das will ich auch!
Folglich suche ich den Blickkontakt.
Gleich darauf versenken sich seine blauen Augen in meine braunen. Es macht deutlich hörbar Klick.
Gefällt ihm, was er sieht? Eine rubeneske, brünette Frau mit wilden Locken und einem Tick zu viel Schmuck in einem leuchtend türkisfarbenen Wickelkleid und goldenen Sandalen, die versucht, kokett zu lächeln.
Ja, doch, offenbar schon. Er erwidert mein Lächeln – strahlt förmlich – und kommt auf mich zu.
Das ist der Moment, in dem mich der Mut verlässt. Was bilde ich mir eigentlich ein? Schwupps, lege ich die Hände in den Schoß und überlasse meinen Busen wieder der Schwerkraft.
Das bin ich nicht. Ich reiße keine Männer auf. Ich bin eine Lady. Wenn schon, dann bin ich es, die aufgerissen wird. Flirts erwidere ich nur, ich initiiere sie nicht. Da bekommt er einen völlig falschen Eindruck von meinem Charakter. Und wenn etwas schon so falsch anfängt, dann kann daraus ja nichts werden.
Ich beschließe, mich ab sofort kühl und distanziert zu geben. Ich werde Radames rufen, aufstehen und …
„Hallo“, sagt er und setzt sich neben mich.
„Äh … hallo.“ Seine blauen Augen sind aber wirklich verdammt blau. Prompt habe ich vergessen, was ich tun wollte.
„Was für ein wunderschöner Tag!“
Er lispelt ein wenig. Das ist aber kein Sprachfehler, das ist ein Akzent. Ich tippe auf Skandinavien.
Na toll. Der Wikinger und die Nonne. So könnte der Film über unsere Liebesgeschichte heißen. Ein viriler, bärtiger Kerl aus dem hohen Norden trifft auf eine Frau, die schon so lange keinen Beischlaf mehr hatte, dass sie wieder als Jungfrau gilt.
„W-wirklich w-wunderschön“, stottere ich. Hoffentlich denkt er jetzt nicht, ich würde mich über sein Lispeln lustig machen. In dem unendlichen Meer an Blau mit weißen Tupfen leuchtet nun etwas knallrot auf. Es ist mein Gesicht.
Ehrlich, normalerweise reagiere ich souveräner!
„Sie sind auch sehr schön“, sagt er, und die vielen s-Laute aus seinem Mund klingen entzückend. Bestimmt ist er Däne. Ich kann förmlich spüren, wie ich dahinschmelze.
„Sie auch“, platzt es aus mir heraus. Was ehedem mein Kopf war, geht nun als Leuchtboje durch. Ich könnte Unterricht im Flirten geben: Wie man es nicht macht.
Er lächelt mich an.
Ist es so heiß, oder bin ich das?
Du bist Pauline Miller, gefeierter Opernstar. Du wirst ihn jetzt lässig fragen, ob er mit dir einen Eiskaffee trinken möchte. Wie ein Mantra sage ich diesen Satz innerlich auf. Aber mein Mund bleibt stumm.
Ein Hund kläfft. Wasser spritzt.
Es ist Radames, er ist gerade tollkühn in den See gesprungen, um der Liebe seines Lebens hinterherzuschwimmen.
Noch vor wenigen Minuten wäre ich, mütterlich besorgt, nachgesprungen – wobei man an dieser Stelle nicht von springen reden kann, die Wassertiefe vor den Steinstufen beträgt maximal zehn Zentimeter, man kann die Kieselsteine am Grund sehen –, aber jetzt verharre ich reglos und verliere mich im Blau seiner Augen.
Radames kläfft sich seine Sehnsucht aus dem kleinen Hundeleib. Den Schwan kümmert das nicht. Zügig gleitet er in tieferes Wasser.
„Ist das Ihr Hund?“, fragt mein Adonis. Er schaut auf die Hundeleine neben mir und dann zu Radames. Mein Boston Terrier ist zwar in den Schwan verschossen, aber nicht lebensmüde: Er schwimmt gerade zurück ans Ufer.
Ich nicke nur.
„Süßer, kleiner Kerl“, sagt Adonis. Wie er wohl heißen mag? Bestimmt hat er einen typisch dänischen Vornamen wie … keine Ahnung, wie Dänen heißen. Das einzig annähernd Dänische, was mir einfällt, ist Hägar der Schreckliche aus dem gleichnamigen Comic.
Hägar.
Ich könnte einen Mann lieben, der Hägar heißt.
Mir wird klar: Ich bin schockverliebt.
Hägar lächelt noch breiter, dann greift er nach meiner Hand, zieht sie an seine Lippen und haucht einen Kuss auf meinen Handrücken.
Sämtliche Härchen auf meinem Arm stellen sich auf, ich bekomme Gänsehaut.
„Ich muss leider los … noch einen schönen Tag“, sagt er und steht auf.
NEIN!, gellt es in mir. Aber meine Lippen gehorchen mir nicht.
Mit einem Zwinkern seiner blauen Augen lässt er meine Hand los, steigt die Stufen zur Promenade hoch und schreitet davon.
Meine Hand hängt im luftleeren Raum.
Radames kommt angewackelt, schüttelt sich das Bodenseewasser aus dem Kurzhaarfell und schaut mich aus seinen riesigen Terrieraugen liebeskrank an.
Ich schaue liebeskrank zurück.
Wie konnte ich eine solche Gelegenheit vermasseln? Wie? Wie? Wie?
Frau und Hund überkommt der Bodensee-Blues.
Erst jetzt erwachen auch meine Lippen wieder zum Leben.
„Scheiße“, flüstern sie.
Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne
Ich seufze.
Das Wasser schwappt an die Kaimauer, in der Ferne hört man eine Schiffshupe und das Bimmeln der Schranken an den Bahngleisen. Eigentlich Idylle pur.
Immer noch auf den Steinstufen sitzend, atme ich die milde Bodenseeluft tief ein und aus und wieder ein und aus und denke mir, dass das eben einer dieser unverhofften kleinen Glücksmomente im Leben war, die sich nicht wie Blumen zwischen zwei Buchseiten pressen lassen, um sie für die Ewigkeit zu konservieren, einer der Momente, die man einfach nur genießen soll, solange sie währen – und gut. Gerade will ich wohlig seufzen, als …
„Halsabschneider! Wegelagerer! Weißt du, was die hier für eine Kugel Eis verlangen? Ich spüre die eiserne Kralle des Kapitalismus!“
Ich seufze, aber nicht mehr wohlig.
So etwas wie das Paradies gibt es eben nicht. Weder auf der Erde im Allgemeinen noch in Bregenz im Besonderen. Es gibt immer und überall eine Schlange, die einem einen Apfel reicht.
Oder einen Vater, der einem ein Vanilleeis in die Hand drückt.
„Hier. Bei diesen Wucherpreisen teilen wir es uns. Ich habe meine Hälfte schon auf dem Weg zu dir geschleckt.“
Ich schaue auf die klebrige Waffel, in der angesichts der bereits sommerlichen Temperaturen nur noch ein wenig Vanillesoße mit kleinen Klumpen schwimmt.
In solchen Situationen muss man sich immer ganz bewusst vor Augen halten, dass man seinen Vater liebt – und sei es auch nur deswegen, weil man ohne ihn nicht existieren würde.
Die Sonne ist weitergewandert. Wir sitzen jetzt in der prallen Hitze und nicht mehr im Schatten des großen Baumes hinter uns, den Radames schon dreimal markiert hat, was im Übrigen nicht auf besonderes Alpha-Männchen-Gehabe zurückzuführen ist, sondern auf die Tatsache, dass er kein junger Hund mehr ist und daher unter Prostata-Problemen leidet. Im Grunde bräuchte er eine Windel.
Auch mein Vater ist nicht mehr der Jüngste, was ihn aber nicht davon abhält, seinen inneren Hippie rauszulassen.
Eigentlich arbeitet er als Klavierlehrer. Von ihm habe ich die Liebe zur Musik geerbt. Wenn man ihn allerdings jetzt so sieht – knittrige Leinenhose, Jeansweste über einem weißen Rüschenhemd, Birkenstocksandalen, struppige, lange Haare (wo sie noch wachsen), Vollbart (kein gepflegter Hipster-Bart wie bei meinem Dänen vorhin, sondern ungezähmter Wildwuchs), eine John-Lennon-Gedächtnisbrille mit runden Gläsern und gefühlt eine Million Freundschaftsbänder an beiden Handgelenken –, dann hat man das Gefühl, er sei damals in Woodstock in ein Raum-Zeit-Wurmloch gesogen und jetzt hier in Bregenz wieder ausgespuckt worden. Ich weiß gar nicht, wo das auf einmal herkommt. Er war sonst immer so angepasst und bieder und trug Dreiteiler. Holt er mit Mitte sechzig etwa seine Midlife-Crisis nach?
Verstehen Sie mich nicht miss: Ich schäme mich nicht für meinen Vater. Im Gegenteil, als Künstlerin schätze ich seine Lässigkeit und dass er sich ein Ei darauf pellt, was die Leute von ihm denken. Aber ich bin ja nicht nur eine weltweit gefeierte Opernsängerin, ich bin auch die Tochter meiner Mutter, und als solche schimpfe ich nun: „Papa, dein Bart ist über und über mit Eis verklebt!“
Ich reiche ihm meine Wasserflasche. Als Sängerin hat man immer (!) eine Wasserflasche dabei – die Stimmbänder dürfen unter keinen Umständen austrocknen. „Hier, wasch das aus.“
Mein Vater sitzt im Lotussitz und hat die Hände hinter dem Kopf verschränkt. Wenn er etwas mehr Fett auf den Rippen hätte, würde er in dieser Haltung an einen Buddha erinnern, der gerade seine täglichen Yoga-Übungen absolviert. So ähnelt er aber eher einem spargeligen Knetgummimann, den jemand zu einer Brezel verbiegen wollte, daran aber gescheitert ist.
Papa genießt sichtlich das Hier und Jetzt. Klebrige Barthaare fechten ihn nicht weiter an.
Ich hasse diesen Waldschrat-Bart, den er sich hat wachsen lassen, kaum dass meine Mutter ihm den Rücken gekehrt hat. Nicht für immer, nur für die Dauer eines Töpferkurses. Hoffe ich.
Und als ob seine Barthaare wüssten, dass sie in die Freiheit entlassen wurden, wachsen sie unglaublich schnell. Schon nach drei Wochen wuchert ein Dschungel auf seinem Kinn, in dem – da bin ich mir sicher – Kleingetier aller Art haust.
Bäh.
„Wasser. Zum Auswaschen“, wiederhole ich streng.
„Mach dich locker, Princess Pauline. Iss dein Eis.“
Mein Vater ist Amerikaner. Wenn er, wie er es nennt, auf den good vibrations des Universums surft, dann nennt er mich immer Princess. Wenn er – leicht genervt – merkt, dass ihn die Gravitation auf den Boden der Tatsachen holen will, bekommt die Princess meinen Vornamen Pauline an die Seite gestellt. Und wenn er stinkig ist, weil er sich zu sehr geerdet fühlt, was ihm die Luft zum Leben, Lieben und Lachen raubt, dann bin ich nur noch Pauline für ihn.
Princess Pauline ist also eine Warnung. Ich seufze noch mal, schicksalsergeben, und schaue zu Radames, der jetzt auf der obersten Stufe steht und hinaus auf den See schaut, wo sein Schwan dümpelt. Oder irgendein Schwan. Die sehen doch alle gleich aus. Ich bin sicher, Radames kann sie auch nicht auseinanderhalten. Dass er nicht angelaufen kommt, um etwas vom Eis zu schnorren, lässt tief in seine kleine Hundeseele blicken. Er ist ernsthaft verliebt.
Tja, wir sind beide nicht zum Zug gekommen. So ist das Leben!
Ich stehe auf und werfe die Waffel in den Mülleimer. Dann gieße ich mir etwas Wasser über die Hände, um meine klebrigen Finger zu säubern, und sage: „Okay, Papa, wir müssen jetzt los. In einer Viertelstunde gibt es den Begrüßungscocktail.“
Heute ist der Kennenlerntag für alle Akteure der diesjährigen Bregenzer Festspiele. Aus aller Welt sind Sängerinnen und Sänger angereist, um nach ein paar Probenwochen den Festspielbesuchern ein unvergessliches Opernerlebnis direkt am See zu ermöglichen. Heuer gibt es „Turandot“ von Giacomo Puccini. Ich bin die Turandot.
Waren Sie schon einmal bei den Festspielen in Bregenz? Oder haben sich auf 3Sat eine Übertragung angeschaut? Oder zumindest den James-Bond-Film „Ein Quantum Trost“ gesehen? Dann wissen Sie ja, wie grandios die Kulisse der Festspiele ist. Ein in seiner Größe und Schönheit beeindruckendes Bühnenbild wird in den See hineingebaut, quasi als würde es aus dessen Tiefen herauswachsen. Einfach phantastisch.
Aber das ist gleichzeitig die Krux. Also … nicht, dass es phantastisch ist, sondern dass die Freilichtoper an einem Gewässer ist.
Was glauben Sie, warum eine Joyce DiDonato oder eine Anna Netrebko noch nie in Bregenz mitgesungen hat? Warum es auch eine Maria Callas nie getan hätte, hätte es die Festspiele damals schon gegeben? Am Geld liegt es eindeutig nicht. Es liegt daran, dass die Bedingungen für uns Sänger nicht optimal sind. Auf einer so gewaltigen Bühne brauchen wir eine Kondition wie ein Hochleistungssportler. Außerdem müssen wir immer auftreten, egal, ob es kalt oder warm oder windig oder trocken oder feucht ist. Nur bei andauerndem Starkregen mit Unwetterwarnung wird das Stück nach innen in den Festsaal verlegt.
Kurzum, ich muss Mimi viel zumuten. Mimi, so nenne ich meinen Stimmapparat. Von Mimi hängen mein Wohl und Wehe und meine ganze Karriere ab. Wenn Mimi zickt, habe ich ein Problem.
Mittlerweile bin ich – das finde zumindest ich – eine zu große Nummer für Freilichtopern, aber den Vertrag habe ich schon vor Urzeiten, lange vor meinem Durchbruch an der Met, unterschrieben. Auf Anraten meiner Agentin und Freundin Marie-Luise Bröckinger, kurz Bröcki, der ich diesen Umstand seit unserer Ankunft in Bregenz immer mal wieder vorwurfsvoll unter die Nase reibe.
„Dass du immer so hetzen musst, Princess“, mosert mein Vater. „Das ist die Deutsche in dir.“ Er entknotet trotzdem seine Beine, erhebt sich ächzend und macht mit nach vorn gestreckten Armen ein paar Kniebeugen, weil das gut für die Gelenke ist, wie er immer sagt.
Mit der Deutschen in mir meint er nicht Mimi – ich habe niemandem erzählt, dass ich meinem Stimmapparat einen Namen gegeben habe –, sondern die Gene, die ich von meiner deutschen Mutter abbekommen habe. Gene, die für Pünktlichkeit, Sauberkeit und gutes Benehmen in der Öffentlichkeit zuständig sind.
„Papa, das ist peinlich! Die Leute gucken schon.“
Meinen Vater kratzt es nicht, dass die zahlreich vorhandenen Touristen jetzt nicht mehr auf den majestätischen weißen Zeppelin schauen, der gerade aus Richtung Friedrichshafen am Himmel schwebend an Größe gewinnt, sondern auf den Althippie, der beim Kniebeugen lauthals ruft: „Ein Mick Jagger, zwei Mick Jagger, drei Mick Jagger …“
Papa achtet nicht weiter auf mich, sondern zählt zwanzig Mick Jagger. Dann schüttelt er die Beine aus und strahlt. „Das hält die alten Knochen geschmeidig! Und jetzt los!“
Jedem anderen hätte ich meinen Unmut in deutlichen Worten kundgetan, weil ich sehr darauf bedacht bin, jetzt – wo ich ganz offiziell ein Stern am Opernhimmel bin – keine unschönen Kratzer in meinen glänzenden Ruf zu bekommen, und folglich in der Öffentlichkeit nicht auffallen will. Aber beim eigenen Vater mutiert man zum Kleinkind, egal, wie alt man ist. Folglich sage ich nichts, sondern rufe Radames – und zwar viermal in Folge, erst dann dringt meine Stimme durch den Liebesrausch an seine Öhrchen –, nehme ihn auf den Arm und folge meinem Erzeuger den Kai entlang in Richtung Festspielhaus.
Die Brise, die vom See her weht, spielt mit meinen langen, dunklen Locken. Letzten Sommer in Salzburg musste ich mich noch unkenntlich machen – ohne riesige Sonnenbrille und schattenwerfenden Strohhut verließ ich quasi nie das Haus –, aber hier in Bregenz sind, seien wir ehrlich, nicht wirklich echte Opernfreunde unterwegs, sondern eher Touristen, die einen Urlaub am See mit Genuss für Auge und Ohr am Abend verbinden wollen. Anders ausgedrückt: Niemand wird mich hier erkennen. Wir Opernsänger sind ja keine Filmstars, deren Gesichter jedermann vertraut sind. Nur Eingeweihte merken, wenn sie einem Jonas Kaufmann auf der Straße begegnen. Oder eben einer Pauline Miller.
Wir laufen an der Seepromenade entlang. Uns entgegen kommen Menschen, die zur nächsten vollen Stunde eine Hafenrundfahrt mit einem der Aussichtsboote machen wollen. Viele deutschsprachige Touristen aus Österreich, Deutschland und der Schweiz, aber auch eine erstaunliche Anzahl Araber und Asiaten und Amerikaner. Und dazwischen irrsinnig viele Hunde. Ich bin mir nicht in jedem Fall sicher, ob einfach immer mehr Touristen mit Hund in den Urlaub fahren oder ob es sich nicht auch um Einheimische handelt, die hier mit ihren Lieblingen eine Runde drehen.
Mein Radames zappelt heftig in meinen Armen, weil er abgesetzt werden will, um den anderen Vierbeinen am Hintern zu schnuppern. Das geht jetzt aber nicht, ich will nicht schon zum Kennenlerncocktail zu spät kommen. Auch als Primadonna assoluta kann man Team-Playerin sein. Pünktlichkeit ist die Höflichkeit der Könige. Von mir soll es einmal heißen: Sie ist auch als Weltstar immer ganz Mensch geblieben.
Trotz Gegenverkehr kommen wir gut voran. In Bregenz ist ja nichts wirklich weit. Es ist zwar die Hauptstadt des österreichischen Bundeslands Vorarlberg, hat sich aber seinen anheimelnden Kleinstadtcharakter bewahrt. Was ich persönlich sehr charmant finde.
Ein wenig langsamer werden wir wegen hohen Touristenaufkommens erst vor dem Wirtshaus am See. Angesichts des schönen Wetters sind die Tische im Freien bis auf den letzten Platz belegt. Aussicht in Kombination mit Imbiss – ein unschlagbares Konzept. Links vor dem Wirtshaus stehen im Schatten der Bäume drei Männer im besten Alter mit Kontrabass, Schlagzeug und Trompete und spielen auf. Irgendwas zwischen Volksmusik und Schlager, ich kenne mich da nicht aus.
„Papa, nicht so schnell!“, rufe ich. Gut, dass ich Radames auf dem Arm habe, damit er nicht versehentlich von irgendwelchen Flip-Flops getreten wird.
Mein Vater ist ein hochgewachsener Schlacks von einem Mann und kann sich müheloser durch die Menschenmenge fädeln als ich mit meinen Rundungen. Wenn Papa zu Hause – rasiert und in seinem einzigen Maßanzug – als Klavierlehrer dem Nachwuchs der örtlichen Honoratioren Beethovens „Für Elise“ einbläut, dann ähnelt er dem Schauspieler Dick Van Dyke. Aber im Moment gleicht er eher einem in die Jahre gekommenen Blumenkind auf dem Weg zu einem Sit-in oder zu einem Anti-Wogegenauchimmer-Happening, jedenfalls zu irgendwas Aktivistisch-Politischem, wo gekifft wird. Deshalb schreitet er so unhippiehaft zügig aus.
Ich überlege, warum ich mich einverstanden erklärt habe, dass er seinen Urlaub bei mir verbringt. Dann fällt mir wieder ein, dass er mich gar nicht gefragt hat. Sonst schickt er mir immer Blumen zu meinen Auftritten, diesmal hat er sich selbst geschickt. Und den eigenen Vater kann man ja schlecht wieder vor die Tür setzen.
Ich seufze erneut und habe das Gefühl, dass dies nicht mein letzter Seufzer gewesen sein wird.
Und dann sind wir auch schon da.
Mein Vater bleibt auf dem großzügigen, sonnenbeschienenen Platz vor dem Festspielhaus so abrupt stehen, dass ich beinahe auf ihn auflaufe, und schaut nach oben.
„299 792 458 m/s“, liest er laut vor. So lauten die Ziffern, die auf dem Dach angebracht sind. „Was bedeutet das?“
„Nichts. Das ist Kunst“, halte ich dagegen und schwenke, immer noch mit Radames im Arm, nach rechts zum Durchgang, der zur Seebühne führt.
„299 792 458. Ist das nicht die Lichtgeschwindigkeit?“, ruft er in meinem Rücken.
„Papa, jetzt komm schon!“ Statt direkt zum Eingang zu gehen, schwenke ich wieder nach rechts und bleibe vor der lebensgroßen Nachbildung eines chinesischen Ton-Kriegers am Eingang zum Bühnenbereich stehen. Ich zücke mein Handy.
Mein Vater kommt stirnrunzelnd angeschlappt.
„Es macht mich meschugge, wenn ich etwas nicht weiß“, brummt er.
Als ob ich das nicht wüsste.
„Mach ein Foto von uns vor dem China-Krieger“, bitte ich ihn, weil meine Arme zu kurz sind und ich auf selbstgeschossenen Selfies immer gequetscht aussehe.
„Deine Mutter würde es auf dem Smartphone googeln.“ Er hat mir gar nicht zugehört. Es fuchst ihn gewaltig, wenn ihm eine Antwort versagt bleibt.
Im Gegensatz zu meinem Vater hat meine Mutter ein Händchen für moderne Technik. Man kann sogar sagen, dass ihre Hand und ihr Handy fest miteinander verwachsen sind. Wäre ich ein besserer Mensch, ich würde ihm den Gefallen tun und selbst schnell im Internet nachschauen, warum das Festspielhaus von einer Lichtgeschwindigkeits-Installation gekrönt wird. Aber ich bin kein besserer Mensch.
„Papa, bitte!“
Mein Vater schaut durch den Durchgang auf die Bühne. „Meine Güte, das ist ja toll.“