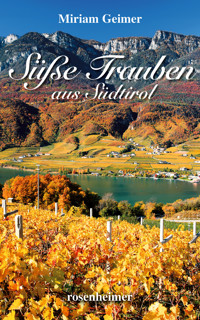Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Der Kleine Buch Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
"Ich malte. Getrieben von Leidenschaft fuhr meine Hand wie in Trance über die Leinwand. Wie ein Dirigent schwang ich mit verzücktem Gesicht meine Arme und tanzte nach meinen eigenen Noten. Jetzt war ich nicht mehr Felizitas, die bemitleidenswerte Versagerin." Glück stand nicht zur Debatte – ein Roman über eine Münchener Jurastudentin im Spannungsfeld zwischen väterlicher Erwartung und eigener Sehnsucht. Ein Roman über eine Halt gebende Freundschaft zweier junger Frauen. Ein Roman über eine Reise nach Kreta, die eine ganze Familie zerstört und darin ihren Frieden finden lässt. Ein Roman über die Liebe, die alles verändert.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 514
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Das Buch
Die Jurastudentin Felizitas soll eines Tages die Anwaltskanzlei ihres auf Karriere und gesellschaftliches Ansehen fokussierten Vaters übernehmen. Als pflichtbewusste Tochter fügt sie sich, obwohl sie allein der Gedanke daran unglücklich macht. Ihr Herz gehört der Malerei, ein Studium an der Münchner Kunstakademie kommt jedoch nicht infrage. Sie kämpft gegen ihr Inneres an, ignoriert die Warnsignale ihres Körpers und gerät in einen Strudel aus Selbstzweifel und Mutlosigkeit.
Innerlich zerrissen fährt sie nach Kreta. Die Schönheit der Insel, die Offenherzigkeit der Menschen und der attraktive Vincent fordern Felizitas’ Überzeugungen heraus. Ein gemeinsamer Ausflug in die Berge wird zu einem lebensgefährlichen Abenteuer, das alle(s) verändert.
»Glück stand nicht zur Debatte« – ein Plädoyer für einen offenherzigen, respektvollen Umgang zwischen Menschen, das Mut machen soll, aus gesellschaftlichen Konventionen auszubrechen.
Die Autorin
Miriam Geimer (*1967) machte ihre große Leidenschaft, das Reisen, zum Beruf und verbrachte als Touristikfachfrau viel Zeit in und mit anderen Kulturen. Die griechische Mittelmeerinsel Kreta mit ihrer mediterranen Lebensart hat es ihr dabei besonders angetan. Ihr Romandebüt ist von Begegnungen mit Menschen inspiriert, die im Konflikt mit den eigenen Sehnsüchten und den Erwartungen anderer stehen.
Miriam Geimer lebt mit ihrem Partner im oberbayerischen Waldkraiburg.
Impressum
© Originalausgabe 2017 Lauinger Verlag | Der Kleine Buch Verlag, Karlsruhe
Projektmanagement, Lektorat, Umschlaggestaltung, Satz & Layout: Beatrice Hildebrand
Korrektorat: Julia Barisic
Umschlagabbildungen: Designed by freepik.com
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes (auch Fotokopien, Mikroverfilmung und Übersetzung) ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Dies gilt auch ausdrücklich für die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen jeder Art und von jedem Betreiber.
ISBN: 978-3-7650-2148-0
Dieser Titel ist auch als Printausgabe erschienen:
ISBN: 978-3-7650-9121-6
www.lauinger-verlag.de
www.derkleinebuchverlag.de
www.facebook.com/DerKleineBuchVerlag
Kapitel 1
»Es wird ein Alptraum, eine Qual! Jeden Tag nichts als Demütigungen, Bevormundungen und beißender Zynismus!«
Der Wind, den die einfahrende U-Bahn vor sich hertrieb, blies durch meine schulterlangen, dunklen Locken und verlieh meinen Worten einen Hauch von Romantik, wodurch der Moment extrem an Dramatik verlor. Also setzte ich noch einmal nach: »Die Gefühlskälte meines Vaters könnte sogar das Gletscherschwinden aufhalten. Vier Wochen mit ihm und meinem versnobten Bruder in einem Büro und ich bin schockgefrostet.«
Aus den Augenwinkeln prüfte ich Sonias Reaktion. Von meiner besten Freundin erwartete ich eine gehörige Portion Mitgefühl, selbst wenn sie nicht ahnen konnte, wie unüberwindlich die Abgründe um mich herum waren.
Sie schmunzelte und schüttelte ihr kurzes rotes Haar. »Mach dir doch das Leben nicht so schwer! Am Ende wird’ s gar nicht so schlimm. Dann hast du dir ganz umsonst so viele Sorgen gemacht.«
Sonias Beharrlichkeit, Optimismus zu verbreiten, war beinahe so hartnäckig wie ihr Akzent, der kaum jemandem auffiel, der sie nicht von klein auf kannte. Nur wir Eingeweihten wussten um ihre spezielle Art, die Worte auszusprechen, und den amerikanischen Rhythmus, den ihr das Land ihrer Geburt mit auf den Lebensweg gegeben hatte. Sonia war zwar erst vier Jahre alt gewesen, als Familie Kelly nach Deutschland übersiedelte, doch diese Besonderheit hielt sich beharrlich. Sonias Mutter hatte damals das Erbe ihrer Tante angetreten, das sich am Ende unserer Straße befand. Ein kleines, renovierungsbedürftiges Gehöft. Die Kellys bauten es mit viel Schweiß und Hingabe zu einem romantischen Landhaus um, dessen Garten bald lebendig erblühte. In jenen Monaten traf man die Familie fast nur auf ihrem Grund an. Ihre abgearbeitete Kleidung zeichnete ein klares Bild des Wirkens: Farben, Terpentin, Mörtel, Kleister, Erde und womit sie sonst noch so in Berührung kamen. Warum das Ganze in Deutschland? »Weniger Waffen!«, war Frau Kellys rasche wie kurze Antwort. Die Fotoreportagen, die ihren Mann beruflich in Krisengebiete brachten, waren schwer genug auszuhalten. Noch mehr Gewalt überstieg das Maß des Erträglichen.
Den Großteil meiner Kindheit verbrachte ich mit Sonia auf ihrem Grundstück. Anders als bei mir zuhause mussten wir bei ihr nicht ruhig durch die Gänge schleichen. Es war beinahe so aufregend wie auf einem Abenteuerspielplatz. Sonias Mutter stellte alte Vorhänge und Tischdecken zur Verfügung, mit denen wir uns in Piraten oder Indianer verwandelten. Unsere Fantasie erschuf Festungen und mächtige alte Segelschiffe, je nach Wetter im Garten oder Haus. Gemeinsam mit ein paar Freunden hielten wir uns für einen wilden Haufen – abenteuerlustig, verwegen und unbesiegbar. Erst mit Alex veränderte sich etwas – zumindest bei mir. Er war anders. Kein Junge, den man wie einen Spielkameraden behandelte. Er kam in der dritten Klasse zu uns. Ich war vom ersten Augenblick an in ihn verliebt, er vom ersten Augenblick an in Sonia. Dieses Schicksal ereilte jedes männliche Wesen, das in ihre Nähe kam. Selbst ihre fehlerhafte Aussprache versetzte die ihr zu Füßen liegende Männerwelt in größte Verzückung. Wäre ihre Augenfarbe braun statt blau, wäre sie eine zweite Molly Ringwald. Sonia war eben eine kleine Sensation, egal wo sie auftauchte. Alle Augenpaare folgten ihren langen schlanken Beinen, bewunderten jede ihrer grazilen Bewegungen und hingen an den vollen Lippen ihres Mundes, dessen perfekte Zähne einen blendeten. Die frechen Sommersprossen auf ihrer kleinen Stupsnase störten ihre zarte Blässe nicht. Sie passten zu ihrem abenteuerlustigen, kecken Wesen.
Leider betonte ihre grazile Erscheinung meine eigene jämmerliche: klein, dick und ungeschickt, die Beine zu kurz, die Nase zu lang, Pickel zu viele und der Bauch zu dick – also das ganze Gegenteil. Hätte Sonia nicht ein Herz aus Gold, wäre sie nicht meine beste Freundin und ich würde mich hüten, mich mit ihr auf der Straße zu zeigen. Aus irgendeinem Grund fand sie mich hübsch. Obwohl ich ihren Geschmack weder teilte noch nachvollziehen konnte, glaubte ich ihr das. Sie sah mich eben durch freundschaftlich verblendete Augen. Als Kind fühlte ich mich geehrt, dass ein so beliebtes Mädchen wie Sonia sich gerade mich als beste Freundin ausgesucht hatte. Und heute war es das Normalste der Welt.
Der Zug rauschte in den Bahnhof und die wartende Menge abgekämpfter, müder Berufstätiger, die sich nach Hause sehnten, geriet träge in Bewegung. Wir visierten die Türen an, um eine davon punktgenau abzupassen und als eine der Ersten eventuell einen Sitzplatz zu ergattern. Die Szenerie erinnerte an den Moment vor dem Sprung auf ein galoppierendes Voltigierpferd.
Die Waggons nicht aus den Augen lassend, erklärte Sonia: »Weißt du, du bist das, was man in den Staaten eine Dramaqueen nennt, besonders in letzter Zeit. Deine Probleme sind nicht schwer, nein, sie sind entsetzlich und sooo schrecklich. Ja, man könnte meinen, deine ganze Familie hätte sich gegen dich verschworen.«
»Warum Konjunktiv?«, witzelte ich.
Wir betraten die vollbesetzte U-Bahn mit der Traube von Menschen, die sich nach der Einfahrt um die Türen gebildet hatte, und automatisch senkte Sonia ihre Stimme. »Denk nach! Die Semesterferien sind lang und du musst nur vier Wochen in der Kanzlei deines Vaters aushalten. Andere müssen weit mehr und härter arbeiten. Freu dich lieber auf die drei Wochen Urlaub auf Kreta! Das kann sich nicht jeder Student leisten, denk nur an Tina und …«
»Von denen hat aber keiner so einen schrecklichen Vater wie ich«, wand ich ein, während ich mich gezwungenermaßen umständlich an einer Stange festhielt, die sich hinter dem Rücken eines von Arbeit und Hitze erschöpften Mitfahrenden befand. Ich war überzeugt davon, dass harte Arbeit für wenig Geld ein Minimum an ausgleichender Gerechtigkeit für das überirdische Glück schufen, ohne Tyrannen aufzuwachsen. Sonia kannte meine Familie seit frühester Kindheit. Wie konnte sie da meine Probleme mit meinem Vater so herunterspielen?
»Die drei Wochen Kreta hab ich mir als untertänigste Tochter nach endlos langen Wochenenden in Vaters Büro mehr als verdient«, fügte ich trotzig hinzu.
»Na, wenn du das überlebt hast …«
»Gerade mal so«, brachte ich hastig hervor, bevor sie die Gelegenheit bekam, mein Schicksal weiter zu bagatellisieren. »Meine Seele ist gezeichnet!« Und das war noch nicht einmal übertrieben – was aber nur ich allein wusste.
Die U-Bahn rauschte mit dem ihr typischen Geheul der nächsten Station entgegen und jeder Fahrgast reckte sein verschwitztes Gesicht in den Fahrtwind, von dem nur ein leichter Hauch durch die schmalen Kippfenster ins Innere des Zuges gelangte. Ich spürte, wie Sonia mich durch die vielen Arme hindurch musterte, die sich von allen Seiten in Richtung Haltestange streckten.
»Würdest du lieber Toiletten schrubben?«
»Wenn ich anschließend meinen Vater in die Kanalisation spülen darf …«
Ein älterer Herr, der meine letzte Bemerkung aufgeschnappt hatte, strafte mich über seine Brille hinweg mit ernsten Blicken. Sicher wegen meines fehlenden Respekts gegenüber dem Familienoberhaupt, was mich aber nicht weiter tangierte. Ich kannte den Mann nicht und er war eine andere Generation. Nur dass Sonia mich auf einmal für eine arbeitsscheue Göre halten könnte, wollte ich auf keinen Fall.
»Um die Arbeit selbst geht es mir nicht, obwohl, jeden Tag zehn Stunden mit Streithähnen Leute verklagen, spricht nicht für eine schöpferische Herausforderung nach meinem Geschmack. Davon mal abgesehen: Du kennst meinen selbstgefälligen Vater. Nichts kann man ihm recht machen. An allem hat er etwas auszusetzen. Besonders wenn es sich um mich handelt.«
Meine eigenen Worte verletzten mich, weil sie der Wahrheit entsprachen. Ausgesprochen erreichte ihr Schmerzpotential neue Dimensionen. Blut schoss mir vor Wut in den Kopf, begleitet vom hämmernden Gefühl der Hilflosigkeit. »Keiner hat so einen Vater verdient! Das ist die Hölle!« Ich verdrängte den Kloß in meinem Hals durch ein Räuspern und fuhr fort: »Sein Herz ist aus Stein und seine Seele an den Teufel verkauft – falls ich nicht doch recht habe und er selbst der Leibhaftige …«
»Dramaqu…«
»Kannst du dir nicht vorstellen, wie grausam es ist, jeden Tag zehn Stunden mit ihm in einem stickigen Büro eingesperrt zu sein, inklusive dieses Schwefelhauchs, und das vier Wochen lang?«
»Natürlich! Aber für dich ist jedes Büro stickig.«
»Warum wohl?«
»Das wirst du überstehen. Du bist stark. Außerdem gewöhnt man sich an alles.«
Sie hatte keine Ahnung. Ich schüttelte den Kopf und seufzte: »Wenn du das sagst.«
Sie würde mich nie verstehen. Wie auch? Sie war nicht mit einem herrischen Vater gestraft. Sie konnte gar nicht nachempfinden, wie ich mich fühlte. Besonders sie, die sich ihren Berufswunsch der Schauspielerin erfüllen durfte. Ihre Sorgen, die ersten sechs Monate Probezeit nicht zu bestehen, waren lächerlich. Natürlich bestand sie. Sie war genial! Wenn sie mir abends ihre neu einstudierten Rollen vorführte oder ich sie Texte abfragte, beeindruckte sie mich mit ihrem Talent. Sie vermochte es, den Figuren eine Seele zu verleihen. »Streckmann!«, rief sie eines Abends nach dem Essen als Gerhard Hauptmanns Rose Bernd: »Du mußt amal sterben dahier! Hierscht es! Denk an dei letztes Stindla! Du mußt amal o vor am Richter stehn!« Verzweifelt und wütend starrte sie mich an, als es an mir war, ihr in der Rolle des Streckmann zu antworten.
Tu mir nichts! Ich bin‘s, Felizitas!, dachte ich ängstlich, je mehr Sonia mit Rose Bernd verschmolz. Eine Woche später flehte sie als Goethes Stella wild um sich blickend: »Fülle der Nacht, umgib mich! Fasse mich! Leite mich! Ich weiß nicht, wohin ich trete! – Ich muss! Ich will hinaus in die weite Welt! Wohin? Ach wohin? Verbannt aus deiner Schöpfung!« Sie stolperte. »Eeeelender!«, schrie Sonia den Läufer an, der sich unter ihren schnellen Schritten zwischen den Füßen aufgeschlagen hatte. Nicht einmal ein Schimpfwort aus der heutigen Zeit schien ihr an dieser Stelle in den Sinn zu kommen.
Sie zauberte uns durch ihr Spiel in einen Garten, der nach Gras und Erde roch, ließ unsichtbare Blätter rauschen und das Grab der holden Mina erscheinen. Ich litt, hasste oder lachte mit jeder ihrer Rollen. Ihre Art zu spielen, erinnerte mich an meine Art zu malen. Sie kreierte eine fremde Welt und zog mich mit hinein. Verschmolz mit den Szenen und Charakteren wie ich mit meinen Bildern. Wir waren seelenverwandt.
Sonia wollte meinen Seufzer nicht unkommentiert lassen: »Wenn du mit dem Studium fertig bist, musst du sowieso jeden Tag mit ihm arbeiten, und bis dahin bist du gegen ihn immun.«
»Du meinst, nachdem meine Gefühle abgestorben sind?« Ich hasste es, wenn sich mein Zynismus Bahn brach, aber meinen Vater hasste ich noch mehr.
»Das ist wie in der Medizin. Meine Tante in Amerika hat sich gegen Bienengift desensibilisieren lassen. Du kennst das doch: Regelmäßig eine kleine Menge Gift und du musst nie wieder Angst vor Stichen haben.«
»Eine KLEINE Menge! Das Einzige, das mein Vater in kleinen Mengen hat, ist Geduld und Mitleid, was tatsächlich viel zu optimistisch ausgedrückt ist oder sogar schon als Lü…«
»Ach Felizitas, einen Versuch ist es doch wert.«
»Na gut, wenn das dein Rezept ist, nimm selbst eine Dosis davon und komm wieder öfter zum gemeinsamen Abendessen bei meinen Eltern!« Ich war gemein.
»Gott bewahre!«, stöhnte sie der grausamen Vorstellung angemessen. »Dann darf ich mir wieder einen Vortrag darüber anhören, wie unseriös und unbedacht mein Berufswunsch ist.«
»Willkommen im Club«, jubelte ich unangemessen laut und durfte mich nicht über die strafenden Blicke der in Hörweite Stehenden wundern.
Sonia schien begriffen zu haben und machte mich erneut zum Opfer. Sie kniff mich entnervt in den Arm. Wehleidig rieb ich die bearbeitete Stelle.
»Schmerz und Leid sind Mittel zu Weisheit und Größe!«
»Dann willst du mich retten, wenn du mich kneifst?«
»Nein, mich! Mich will ich retten! Je mehr wir über deinen Vater reden, desto deprimierter werde ich.«
»Nicht doch, Sonia, man gewöhnt sich an alles!« Der Triumph in meiner Stimme verriet eine gewisse Häme. »Regelmäßig eine kleine Menge Gift …«
Sie unterbrach mich mit einem lauten Seufzer: »Glaubst du etwa, du müsstest mir nach so vielen Jahren erklären, was du durchmachst? Ich kenne deine Familie. Ich weiß, was abläuft. Aber solange du nur jammerst, wirst du immer das Opfer bleiben.«
»Die Rolle hab ich mir nicht ausgesucht.«
»Du behauptest dich nicht. Nimm die vier Wochen als Herausforderung!«
»Der bin ich nicht gewachsen.«
»Nicht, wenn du dir das ständig vorbetest.«
»Das geht dir wohl ziemlich auf den Geist.«
»Darum geht es doch gar nicht!« Jetzt war sie es, die die in einer U-Bahn angemessene Lautstärke überschritt. »Gib mir ’ne Chance, verdammt! Ich versuch dich nur aufzubauen.« Ihre Wut über meine fehlende Bereitschaft, mir helfen zu lassen, freute mich. Sie drückte Verständnis für meine Lage aus. Darum entschuldigte ich mich mit einem mäßig unterdrückten Grinsen.
»Schon gut.« Sie wedelte sich, soweit es das Gedränge zuließ, mit ihrer freien Hand ein wenig Wind zu. Obwohl alle Fenster geöffnet waren, stand die Luft. Vielleicht kam es auch nur mir besonders unerträglich vor. Gerade in den letzten Wochen hatte ich immer häufiger das Gefühl, nicht genug Luft zum Atmen zu haben.
Plötzlich durchschnitt schallendes Gelächter die Stille, die nur hier und da von ein wenig gepflegtem Gemurmel unterlegt war. Wie auf Kommando drehten sich alle Köpfe in Richtung der Störquelle um.
»Nanu? Was war denn das?« Ich verrenkte mich, so gut es ging, konnte die Verursacherin aber nicht entdecken.
»Was denkt die sich? Lautes Lachen in der U-Bahn? Pfui«, raunte mir Sonia augenzwinkernd zu.
Ich nickte. »Verdächtig!« Und stellte entlarvend fest: »Sie ist keine von uns.«
»Ein waschechter Zombie weiß, was sich gehört.«
»Genau! Menschliche Regungen werden hier nicht geduldet.«
»Wir sind doch nicht zum Vergnügen hier. Eine U-Bahn ist kein Spaßmobil! Sollen wir ihr jetzt das Leben aussaugen, was meinst du?«
»Unbedingt«, pflichtete ich ihr eifrig bei. »Aber zuerst zeigen wir mit dem Finger auf sie und quieken.« Ich sah Sonia gespielt pflichtbewusst an, während sie amüsiert noch immer Ausschau hielt. Wir spielten auf den amerikanischen Hollywoodfilm »Die Körperfresser« an, in dem eine außerirdische Spezies Besitz von menschlichen Körpern ergriff und nur durch ihr gefühlskaltes, roboterartiges Wesen von normalen Menschen zu unterscheiden war. Als ausgesprochene Gegner aller Anzeichen von langweiligen Gewohnheiten entdeckten wir nicht nur bei meinem Vater Ähnlichkeiten mit diesen seelenlosen Geschöpfen im grausam eintönigen Alltagstrott, der unserer Meinung nach der vernichtendste Feind menschlichen Glücks war.
Als an der nächsten Station einige Fahrgäste ausstiegen, erhaschte ich einen Blick auf die fröhliche Dame. Sie war mittleren Alters, saß mit vier bis fünf Leuten – vermutlich ihre Freunde – auf einer Sitzbank und unterhielt sich angeregt. Ihr blond gefärbtes Haar war elegant geschnitten und erinnerte mich irgendwie an die Sängerin Gitte. Die Augen leuchteten vergnügt und während sie sprach, glühten ihre Wangen. Hochkonzentriert folgten die anderen ihren leidenschaftlichen Ausführungen, die von einem fantastischen Abenteuer zu handeln schienen. Hier und da ließen sie kurze Bemerkungen ihrer Zuhörer erneut in herzhaftes Gelächter ausbrechen – völlig gleichgültig ob der Tatsache, dass sie die Aufmerksamkeit des gesamten Abteils auf sich zog. Es war nicht nur ihr natürliches Lachen, das sie von uns, dem Rest der Fahrgäste, unterschied, es waren die Souveränität ihres Auftretens und ihr Strahlen. Sie verströmte eine positive Energie, die sie unangreifbar wirken ließ. Eine sonnige Insel inmitten der zerstörerisch rauen See. So frei und unbeschwert, dass sie weder neugierige noch verärgerte Blicke interessierte. Sie war wirklich keine von uns.
Eine unangenehme Erkenntnis begann sich zu formen: Sie war zwar lauter als wir, aber nicht, weil sie sich nicht zu benehmen wusste, nicht um aufzufallen. Das war keine Show. Ihr Lachen wirkte nicht künstlich, es war vergnügt – weil sie lebte. Wir waren die Ertrinkenden, deren Verlorensein erst durch sie bewusst wurde.
Ihre Unbeschwertheit stach in meine innere Leere, deckte mein Elend auf, entlarvte es. Hässlicher Neid keimte auf. Was hatte diese Frau, was mir fehlte? Was machte sie so ausgelassen, so glücklich? Gab es einen mystischen Geheimcode, den man kennen musste, um Zugang zu dieser Leichtigkeit des Seins zu bekommen? Fehlte mir ein Gen, das Glücksgen? Musste man Eingeweihter in Geheimriten oder gar Liebling der Götter sein, um so mit sich und der Welt im Reinen zu sein? Könnte mir das je gelingen? Als Malerin vielleicht – als Anwältin, unter der Fuchtel meines Vaters, nie!
Bleib rational, Felizitas. Schluss mit Selbstmitleid und Fatalismus! Ich hatte doch alles, was man sich wünschen konnte: Gesundheit, ein Zuhause, eine Ausbildung, Aussicht auf Arbeit. Ich muss zufrieden sein, darf mich nicht ständig beschweren. Vielleicht war es meine Schuld, dass Vater und ich nicht miteinander auskamen. Mutter hatte oft gesagt: »Er meint es nur gut«, aber ich … Ich war undankbar. Musste mir Mühe geben, auch mit meinem Studium. Offener sein, alles lockerer sehen … Ich hätte ja doch keine Wahl. Vielleicht … irgendwann … würde doch alles wieder gut, wäre ich nur anders …, wäre alles anders … Warum konnte ich nicht glücklich sein? Was stimmte nicht mit mir?
Meine Beine wurden schwach. Ich zitterte. Die wabernde anonyme Masse um mich herum verschwamm zu einem mächtigen Einheitsbrei, der mich in diesem Gefängnis aus Metall und schwitzenden Leibern zu zermalmen drohte. Es war so voll, wurde immer enger. Keine Luft. All die Menschen. Keine Möglichkeit zu entkommen. Mein Magen … Mir wurde schlecht. Übelkeit breitete sich aus, mein Blut sackte in die Beine. Es war, als ob alle Lebenskraft aus meinem Körper wich. Rauschen übertönte das Gemurmel der Leute. Ich hörte nichts mehr, alles wurde dumpf. Die glückliche Frau mit der Gitte-Frisur war fern. Ihre fröhliche Stimme drang kaum noch zu mir durch. Diese Welt war für Menschen wie sie gemacht. Sie konnte darin leben und glücklich sein. Ich war eine Fehlkonstruktion. Ich würde immer am Abgrund stehen und mich davon abhalten müssen zu springen.
Ich schloss die Augen. Wenn ich an etwas anderes denke und mich zu entspannen versuche … Vielleicht geht es mir dann besser.
Was war los? Ich verzweifelte doch nicht zum ersten Mal an meinem Vater. Oder war das Klaustrophobie? Ich war schon oft in überfüllten U-Bahnen gefahren. Oder war es die Hitze, der Kreislauf? Oder die natürliche Abwehrreaktion eines Körpers, der seine Umwelt nicht mehr verkraftete? Würde ich jetzt vom Schicksal beseitigt? Der Fehler meiner Existenz durch meinen Tod korrigiert?
Ein sanftes Stupsen an meinem rechten Arm machte mir bewusst, dass ich noch nicht am Ende war.
»Träumst du?« Sonia hatte nichts von meinem Schwächeanfall bemerkt. »Wir müssen aussteigen.« Die erlösenden Worte drangen aus der Ferne an mein Ohr. Ich öffnete meine Augen. Raus hier! Raus und diese seltsamen Anwandlungen vergessen. Woher sie kamen, warum sie mich überfallen hatten … Ich wollte es nicht wissen. Nur weg und die Panik hinter mir lassen.
Mein Körper löste sich aus der Erstarrung. Fremd, nicht zu mir gehörig, fühlte er sich an. Meine Knie waren weich und zittrig und das Kleid klebte an mir wie eine zweite Haut. Ich war schweißgebadet.
Was wäre geschehen, wenn die Fahrt noch länger gedauert hätte? Wäre ich von der Masse unbemerkt auf den Boden zwischen die unzähligen Füße gesunken und erstickt? Meine Gedanken trieben mich an, diesem Sarg aus Metall zu entkommen. Doch man machte es Sonia und mir nicht leicht. Mühsam mussten wir uns an Fahrgästen vorbeizwängen, die, ungerührt von unserem offensichtlichen Wunsch auszusteigen, wie festgenagelt an ihren Plätzen verharrten.
»Entschuldigen Sie bitte, darf ich mal?«, rief ich entnervt einer Frau in einem eleganten Zweiteiler ins Ohr, die beharrlich mit ihrer Aktentasche zwischen ihren Füßen ihre Position verteidigte und mir so den Weg ins Freie und damit ins Leben versperrte. Vielleicht war es mein wutentbrannter Blick, dem sie nachgab. Widerwillig bewegte sie sich wenige, aber nicht zu viele Millimeter, ohne eine Miene zu verziehen. Sobald ich mich umgebracht habe, verfolgt dich mein Geist!, schwor ich hasserfüllt in Gedanken und zwängte mich mitsamt meiner Handtasche aus dem überfüllten Zug an ihr vorbei wie aus einem Geburtskanal.
Luft!
Durch die Befreiung wurden auch die Nachwehen meines Schwächeanfalls deutlich: Das flaue Gefühl im Magen, die kraftlosen, schweren Beine und der Kloß im Hals. So leicht würde ich diese Fahrt nicht vergessen.
Ich schämte mich. Meine Schwäche bewies meine angeborene Unfähigkeit, mit Anforderungen umzugehen. Außerdem witterte mein Vater jedes Versagen wie ein Aasgeier den Tod. Es nährte seine finstere Seite, machte ihn mir gegenüber unerbittlich.
Mit dem Betreten des luftigen Bahnsteigs riss uns die Welle der Passagiere, die aus den hinteren Waggons ausstieg, mit sich. Bereitwillig ließen wir uns tragen. Strömten unaufhaltsam mit ihr in Richtung Ausgang. Der leichte Wind und die wiedererlangte Freiheit verdrängten meine Ängste und Beklemmungen mit jedem Atemzug. Das Kleid trocknete und mein Blut begann wieder zu zirkulieren. Meine Beine waren noch weich, gewannen aber deutlich an Kraft. Niemand musste von dieser vorübergehenden Unpässlichkeit erfahren. Sie war Geschichte.
An den Rolltreppen stockte der Fluss wie gewöhnlich und die Drängelei begann von Neuem. Wer würde heute der Sieger des Tages werden? Wer durfte als Erster das rollende Metall betreten? Wir wurden von der Menge auf die Stufen geschoben und ich freute mich über einen weiteren Etappensieg. Ich drehte mich zu meiner Freundin um. Dank der Erhöhung waren wir fast auf einer Augenhöhe.
»So eine Tortur!« Meine Stimme war belegt. »Welch ein Spaß muss dagegen federn, teeren und rädern sein. Gleich nach den Semesterferien werde ich mein altes Fahrrad aus dem Keller kramen, damit ich nie wieder mit der U-Bahn fahren muss.« Den schwächlich heiseren Klang meiner Stimme versuchte ich mit Lautstärke auszugleichen.
Meine Aussage ließ Sonia nur dezent den Mund verziehen. »Davon redest du schon so lange und dann verschiebst du es doch immer wieder aufs nächste Jahr. Nur wegen der paar Viecher im Keller.«
»Nirgends auf der Welt sind die Spinnen so groß und schwarz und dick. Die lauern in jeder Ecke, besonders um mein Fahrrad herum. Die Hälfte davon haben sie bereits verdaut!«
»Das ist Rost.«
»Entstanden durch Spinnenspucke!«
»Kauf dir doch endlich ein Neues. Du hast doch Geld gespart.«
»Das Geld ist nur für den Kreta-Urlaub.« Und einer weiteren Frage vorbeugend, fügte ich hinzu: »Meinen Vater werde ich auf keinen Fall darum bitten. Ich habe keine Lust auf seine selbstgerechten Vorträge über den einzigen Sinn des Lebens, nämlich harte Arbeit. Da rutsch ich lieber jeden Tag auf Knien zur Uni.«
»Abgemacht!« Sie grinste mich herausfordernd an. »Werd dir morgen Knieschoner besorgen.«
Vergebens suchte ich nach wahrer Besorgnis in ihrem schelmischen Blick und seufzte. »Wenn ich dich nicht hätte.«
Die Rolltreppe spuckte uns im Getümmel des Zwischengeschosses aus, wo wir uns vor den schwingenden Aktentaschen in eine ruhige Ecke flüchteten.
»Was hatte Oliver gesagt, wie heißt dieses Restaurant?« Sonia reckte ihren langen schlanken Hals auf der Suche nach einem Anhaltspunkt über die Köpfe der Gehetzten. Das emsige Hasten und Eilen erinnerte an das Gewimmel eines Ameisenhaufens. Auch ihm war von außen weder System noch soziale Struktur anzusehen: Unzählige anonyme Arbeiter, die hektisch, wie von einer unsichtbaren Macht getrieben, stur aneinander vorbeirannten mit nichts als ihrem eigenen Ziel vor Augen. Kein Blick nach rechts oder links, nicht einmal für einen kurzen Moment, nicht das geringste Interesse an den Kollateralschäden, die in diesem Krieg um die eigene Existenz anfielen. Diese Masse an gesichtslosen Menschen konnte nur auf der Flucht vor sich selbst sein.
»Der Name klang ähnlich wie Armani, glaub ich. Aber Oliver hat uns den Weg ja beschrieben.« Ich zog Sonia am Ärmel ihres luftigen, mintgrünen Tops, das wie immer perfekt zum Rest ihres Outfits passte. Ihre schlanke Figur erlaubte es ihr, jedes Kleidungsstück zu tragen, das ihr gefiel, während ich immer darauf achten musste, mich nicht unvorteilhaft zu präsentieren. Die meisten schicken Sachen unterstrichen eher meine überflüssigen Pfunde, anstatt sie zu kaschieren. Sonia bezeichnete diese Probleme als Hysterie und wurde nicht müde zu sagen: »Ich wäre froh, hätte ich ein paar weibliche Rundungen!«
»An den richtigen Stellen wären sie für mich auch kein Problem«, pflegte ich darauf zu kontern. Denn Sonia wusste genau, wie sie auf Männer wirkte. Allein ihre kurzen roten Haare waren ein Blickfang. Sie sahen immer wie frisch vom Friseur aus, selbst morgens nach dem Aufstehen. Mit meinen widerspenstigen Locken und den kläglichen 1,60 Meter ging ich neben ihr sprichwörtlich unter. So wie jetzt zwischen den dem Feierabend zustrebenden Menschen.
Wir schlängelten uns durch das Gewühl, vorbei an verschiedenen Kiosken, die in einem aufdringlichen Orange, dessen Verfallsdatum bereits in den Siebzigern abgelaufen war, leuchteten. Von Souvenirs über Modeschmuck bis hin zu kleinen Imbissen jeglicher Art boten sie allerhand zum Verkauf an und schwängerten die Luft mit Essensgerüchen.
Wir fuhren mit einer weiteren Rolltreppe hinauf in die Fußgängerzone bis vor das ehrwürdige Rathaus. An diesem strahlend heißen Sommertag war auf dem Marienplatz wenig von der Hektik in der U-Bahn zu spüren, obwohl das Gedränge genauso intensiv war. Doch die Hitze lähmte jedes Verlangen nach Schnelligkeit, unterband jeglichen Turboantrieb. Hier war man unterwegs, um Einkäufe zu erledigen. Die riesigen Tüten mit Logos von Kaufhäusern und Boutiquen in den Händen der sommerlich gekleideten Passanten bezeugten dies.
Manche der von Hitze und Stress Erschöpften retteten sich in eines der vielen traditionell bayerischen Gasthäuser, um den müden Beinen bei einer Schweinshaxe mit Sauerkraut und kühlem Bier zu neuer Kraft zu verhelfen. Andere schleckten genüsslich ihr Eis, während sie sich auf einem von der Stadt bereitgestellten Stuhl zwischen riesigen, in Beton gegossenen Blumentrögen die pralle Sonne ins Gesicht scheinen ließen, egal wie gerötet ihre Haut bereits war.
Die Mariensäule mit der goldenen Muttergottesfigur sowie der Fischbrunnen waren umzingelt von Wartenden, die mehr oder weniger geduldig nach ihren Verabredungen Ausschau hielten. Quirlig tummelten sich die Menschenmassen bis in die kleinste Ecke der Fußgängerzone.
»Über den Platz würde sich eine Seilbahn lohnen. Ohne blaue Flecken kommt man sonst hier nicht durch«, murmelte Sonia beim Anblick des bunten Treibens.
Die Schweißperlen, die ich mir von der Stirn wischte, wurden sofort von doppelt so vielen ersetzt. »Wie kann man sich das bei dieser Hitze nur freiwillig antun? Warum haben wir uns mit Oliver nicht woanders verabredet? An einem See oder Gletscher? Das ist, als ob man sich in einen engen Backofen quetscht und es geselliges Beisammensein nennt.« Doch Sonia hörte mein Quengeln nicht, zumindest reagierte sie nicht darauf. Sie hatte sich beim Lesen der Straßennamen an die Wegbeschreibung erinnert und steuerte eine kleine Gasse an.
Es war ein billiger Trost zu sehen, dass ich nicht die Einzige war, der die Sonne kein Lächeln ins Gesicht zauberte. So ziemlich jeder wirkte träge und schlapp. Leider intensivierten die hohen Temperaturen auch jede Art von Körpergeruch, der so manches Hemd als ungewaschen entlarvte und in seine eigene, spezielle Dunstwolke hüllte. Für Geruchsexperten und Deo-Hersteller wäre diese Vielfältigkeit ein ertragreiches Forschungsfeld mit überdimensionalen Herausforderungen gewesen. Ich dagegen wusste dieses Angebot nicht zu schätzen und freute mich, als wir den größten Trubel und den allgegenwärtigen, unausweichlichen Körperkontakt endlich hinter uns gelassen hatten.
In den schmalen, verwinkelten Gassen erreichte die Sonne den Gehweg nicht mehr. Ich atmete auf. Eigentlich war es erst später Nachmittag und ein wenig zu früh fürs Abendessen, aber es gab zwei Gelegenheiten, auf die wir anstoßen wollten, und es sollte nicht in Stress ausarten. Der wichtigste Grund für unser feierliches Treffen war natürlich Olivers Neuanstellung als Stylist bei einer berühmten Modefotografin. Der zweite Grund, weshalb wir uns ausgerechnet in einem griechischen Lokal trafen, war Sonias und meine kurz bevorstehende Reise. Es würde unser erster Aufenthalt in Griechenland sein, also eine Premiere, und Premieren musste man feiern. Alex, mein heimlicher Schwarm, hatte kurzfristig abgesagt, da seine neue Flamme ihn anderweitig verplant hatte. Meine Enttäuschung hielt sich in Grenzen. Den beiden Frischverliebten beim Turteln zuzusehen, hätte mir den gesamten Abend vermiest.
»Da ist es! Ich kann das Schild sehen«, rief Sonia aufgeregt, als sie um die nächste Ecke blickte. »Da steht es: A-R-K-A-D-I«, las sie laut und deutlich zum Beweis.
»Siehst du, ich wusste, es klingt wie Armani«, freute ich mich. Ich legte sofort an Tempo zu. Die Aussicht auf ein kühles Getränk an einem schattigen Platz mit meinen Freunden verdrängte meine Trägheit. Sonia eilte wie immer mit langen Schritten voraus, während ich mit meinen kurzen Beinen hinterher trippelte, als wäre ich ihre vierjährige Tochter.
Die Glastür lud mit einem gemalten Motiv aus rankendem Wein zum Genießen ein. Bevor wir sie öffneten, hielten wir kurz inne und betrachteten unser Spiegelbild. Flink fuhren wir uns mit den Fingern durch die Haare und begutachteten unser Werk. Man konnte ja nie wissen, ob nicht gerade ein hübscher, junger Mann am Nebentisch auf einen wartete. Nicht, dass wir krampfhaft auf der Suche gewesen wären. Man wollte nur nicht unvorbereitet sein.
Wir lehnten uns gegen die schwere Tür und traten ein. Das Dämmerlicht, das für unsere sonnengeblendeten Augen gewöhnungsbedürftig war, verschluckte uns. Sofort entführte leise Bouzoukimusik meinen Geist nach Griechenland. Mediterrane Gerüche, die meinen Magen in hoffnungsvolle Erwartung versetzten, rundeten das Bild ab. Auf den schweren, rustikalen Holztischen sah ich kleine Windlichter, die erahnen ließen, welch anheimelnde Atmosphäre sie allabendlich verbreiteten.
»Urig«, hauchte Sonia andächtig wie in einer Kirche und sah sich um.
Ein junger Ober, kaum älter als wir, kreuzte unseren Weg. Gekleidet in schwarzer Hose und weißem Hemd unter einer dunklen Weste mit perfekt sitzender Fliege balancierte er ein Tablett mit Getränken über seiner Schulter. »Gutten Taag! Willkoomen«, rief er fröhlich und verschwand um die nächste Ecke.
Mein Blick schweifte weiter, bis er hängenblieb. »Sonia«, hatte mein Mund ausgerufen, ohne dass es mir bewusst war. Mein Körper erstarrte. Etwas zog mich in seinen Bann. Es waren Schönheit und Perfektion, gebündelt in einem Gemälde, die mich unvorbereitet in dieser unscheinbaren Taverne trafen.
Sonias Schritte schlurften träge zu mir. Ihre Augen folgten den meinen und sie sahen, was mich fesselte. Es war die Konfrontation mit einer großen alten Liebe: der Malerei. Ein wahrer Künstler hatte etwas erschaffen, nicht nur ein Bild, sondern ein Gefühl. Es war der Schnappschuss eines lebendigen Augenblicks, ein Feuerwerk an Farben und Temperament. Frauen und Männer gaben sich, versunken in ihre Leidenschaft für die Musik, ihrem Tanz hin. Die ausdrucksstarken Gesichter spiegelten eine Intensität und Hingabe wider, die auch der Maler in sich tragen musste, um sie so mitreißend an sein Publikum weiterzugeben. Die tiefe Verbundenheit und Liebe des Künstlers zu dieser Kultur war förmlich greifbar.
»Wär ich doch auch so leidenschaftlich, um so malen zu können«, sagte ich leise und vergaß, dass ich mir seit meiner Immatrikulation geschworen hatte, die Malerei aus meinem Leben zu löschen. Nun hatte sie mich eingeholt, mich mit all ihrer Lebendigkeit und Schönheit mitten ins Herz getroffen. Das Unerwartete war wie eine Waffe. Sie hatte mich in völliger Ahnungslosigkeit erwischt. Es fühlte sich an wie das Wiedersehen einer alten Liebe nach langen Jahren und der schmerzhaften Erkenntnis, dass der Andere ohne einen weiter existiert hatte.
Sonia legte ihre Hand auf meine Schulter. »Leidenschaft ist deine Stärke, gehört zu dir. Sie ist schon immer in all deinen Bildern gewesen!«
Ich bemühte mich zu lächeln, doch meine heisere Stimme verriet mich. »Ist gut gemeint. Aber ich hab das abgehakt. Das war mein altes Leben.«
»Dein schönes Leben.«
»Mein unpassendes Leben.«
»Warum stehst du dann hier?« Sie schüttelte den Kopf. »Wenn die Malerei so unpassend gewesen wäre, würde sie dich jetzt nicht derart bewegen!« Sie baute sich vor mir auf, um ihrer Botschaft noch mehr Gewicht zu verleihen. »So ein Talent kann man nicht einfach abhaken und so tun, als hätte es das nie gegeben. Die Malerei gehört zu dir. Und ich bin nicht die Einzige, die so denkt. Erinnere dich bitte an Müsli! Der hätte dir doch am liebsten gleich eine ganze Ausstellung gewidmet, und der hat das Ganze immerhin studiert.«
Müsli nannten wir unseren ehemaligen Kunstlehrer am Gymnasium, Felix Fridolf. Seinen Spitznamen hatte er sich durch den täglichen Verzehr von Müslijoghurt auf dem Pausenhof verdient. Aber selbst wenn er etwas anderes gegessen hätte, hätte man allein durch seine Erscheinung annehmen müssen, dass er jeden Tag eine Ration Müsli verspeiste. In seinem Gesicht wucherten Haare in Form eines Vollbarts, der um ein obligatorisches Minimum lediglich dann gestutzt wurde, wenn sein Antlitz darunter unterzugehen drohte. Seine naturfarbene Kleidung war weit, wallend und mit Sicherheit biologisch abbaubar. »Du, Felizitas, du, ich würd dir echt total gerne nochmal sagen, dass du des völlige super Talent zum Malen hast, weißt du. Ich find, du musst des total ausbauen und fördern und so, weißt du, ganz echt jetzt. Des wär so eine enorme Schande, wenn du dein Können verkommen lassen würdest, du, echt. In dir schlummert voll des Potenzial«, hatte er am letzten Schultag noch einmal betont und dabei wie ein Truthahn genickt. Er war ein beliebter Lehrer. Uns Schüler hatte er nie herablassend behandelt. Fast schon Kult war seine Art, uns zur Ruhe zu mahnen: »Hey, Leute! Des is total okay, wenn ihr mal so’ n bisschen überschüssige Energie abarbeitet, aber jetzt wird’ s echt wieder Zeit, dass ihr euch wieder auf die Fragen zur Blauen Periode konzentriert, sonst fahr ich mit euch nächste Woche nicht in die Alte Pinakothek! Echt jetzt!« Gern dachte ich an seine Unterrichtsstunden zurück, nicht zuletzt, weil er der erste Erwachsene war, der an mich geglaubt hat.
»Ich weiß, Sonia! Aber Müsli ist bisher der Einzige, der mich für begabt hält. So gut, wie der hier«, ich deutete mit dem Kopf auf das Gemälde an der Wand, »werd ich auch in hundert Jahren nicht. Der hat’ s im Blut!«
»Du doch auch.«
Sonias Worte schmeichelten mir und ich glaubte sogar, auf wundersame Weise ein paar Millimeter gewachsen zu sein, doch mein Realitätssinn gewann schnell wieder die Oberhand. »Schön wär’ s«, seufzte ich und holte tief Luft. »Egal! Mit dem Thema bin ich durch.« Zur Bekräftigung wandte ich mich zum Gehen. Doch Sonia hielt mich zurück.
»Offensichtlich bist du das nicht. Sonst hättest du nicht damit angefangen. Was auch eine Schande wär! Mich überzeugt auch die Tatsache nicht, dass du seit deiner Immatrikulation Staffelei, Farben und Pinsel eingemottet und nie wieder angerührt hast, als wären sie verseucht. Du musst lernen, zu deiner Leidenschaft zu stehen! Die Malerei, das bist du, ihr seid untrennbar.«
Der hübsche Ober zwängte sich mit einem Tablett voll leergegessener Teller an uns vorbei. Möglichst unauffällig, aber eindeutig interessiert, lauschte er, während er seine Last auf der Theke abstellte.
»Jura und Kunst passen nicht zusammen. Genau wie Tiefseefische nicht zu Wüstensand.«
»Tiefseefische?« Sie stöhnte entnervt. »Warum ausgerechnet Tiefseefische? Immer diese Extreme!«
»Jura und Kunst sind Extreme – extreme Gegensätze. So wie Tiefseefische in der Wüste. In Oasen können vielleicht kleine Fische existieren, Tiefseefische aber mit Sicherheit nicht. Genauso wenig gibt es in einer Anwaltskanzlei Platz für Kunst und alles, was damit zu tun hat, du weißt schon, Fantasie, Gefühle und so.«
»Warum gestehst du dir nicht wenigstens diese kleine Oase der Malerei zu, als Ausgleich zum trockenen Wüstensand, deinem Studium?«
»Weil Tiefseefische eben nicht in kleinen Oasen existieren können«, hatte ich doch gerade erklärt.
»Dann ist die Malerei ein Tiefseefisch?«
Nach dem Ober musterten uns nun auch einige Gäste. Bestimmt fragten sie sich, warum wir uns nicht endlich einen Tisch suchten und dort unsere tiefsinnigen Tiefseegespräche weiterführten. Doch es bohrte in mir, dass Sonia mich nicht verstand.
Ich versuchte es mit einem anderen Beispiel: »Stell dir vor, du verliebst dich unsterblich in einen Mann. Du weißt genau: Er ist der Richtige, mit ihm kannst du glücklich werden. Aber dann kommt deine Familie und stellt dir einen langweiligen Hanswurst vor, den du heiraten sollst. Könntest du es ertragen, deine große Liebe jeden Tag zu sehen mit der Gewissheit, niemals mit ihm zusammen sein zu können, ihm nie wieder nah sein zu dürfen? Glaub mir, Sonia, es ist schwierig, wenn du jeden Tag mit deiner Leidenschaft konfrontiert wirst.«
Sie runzelte die Stirn. »Ich würde mir keinen Hanswurst aufzwingen lassen und im Notfall mit meiner großen Liebe durchbrennen. Aber vielleicht kann man das auch gar nicht miteinander verglei…«
»Herzschmerz ist Herzschmerz, auch wenn deine Liebe die Kunst ist. Und einfach abhauen? Das sagt sich so leicht. Würdest du deine Familie aufgeben?«
»Hm, nö.« Sonias Gesichtsausdruck wurde nachdenklicher.
Meine Bemühungen schienen zu fruchten und ich fuhr fort: »Ich muss ein völlig neues Kapitel aufschlagen. Meine Seele neu programmieren. Dann entdecke ich vielleicht sogar an der Juristerei interessante Seiten.«
Mein letzter Satz klang wenig überzeugt, was Sonia gleich bemerkte. Sie überspielte ihre kritische Miene und klopfte auf meine Schulter. »Es ist deine Entscheidung. Ich kann diese Sichtweise nicht nachvollziehen, weil du wirklich großes Talent hast und der Malerei mit Leib und Seele verfallen warst. Aber ich akzeptiere deine Haltung, wenigstens für den Moment, auch wenn ich sie für verkehrt halte. Vielleicht musst du ja den Umweg über Jura gehen, um dich selbst zu finden. Wer weiß?« Und leise, als wollte sie mein Unterbewusstsein beschwören, fügte sie hinzu: »Aber die Malerei ist dein Schicksal, meine Liebe, sie steckt in deinen Genen und die kann man nicht umprogrammieren.«
Ohne auf meinen gerade zum Sprechen geöffneten Mund zu achten, packte sie mich an den Schultern und schob mich durch das Restaurant, vorbei an den einladenden Essecken, die durch gusseiserne Blumenranken voneinander getrennt waren. Ich bekam keine Chance, auf ihr Statement zu reagieren, was mir eigentlich ganz recht war. Mir fiel sowieso kein logisches Gegenargument mehr ein – ganz zu schweigen von Metaphern.
Wir marschierten durch die Taverne, in der zu so früher Stunde nur wenige Tische besetzt waren. In einer der Ecken kuschelte ein verliebtes Pärchen, das sich selbst genug war und nichts um sich herum wahrnahm. Ihre mit Rotwein gefüllten Gläser standen fast unberührt neben der Karaffe. Verschwendung, dachte ich verächtlich. So verliebt kann man doch gar nicht sein.
Ich schritt an einer jungen Familie vorbei, die an einem der großen Fenster saß. Die zwei kleinen Kinder aßen unter den strengen Blicken der Eltern brav ihr Moussaka, eine Art Gemüse-Hackfleisch-Lasagne. Sie unterdrückten mit lauernden Blicken auf die wachsamen Augen der Eltern ihren offensichtlichen Drang, den Teller mit ihren kleinen Wurstfingern zu erkunden.
Der jugendliche Gast an der Theke musste ein Freund des Barkeepers sein. Vertraut unterhielten sie sich auf Griechisch. Nebenbei polierte der Angestellte ein paar frisch gespülte Gläser, bevor er sie in den Hängeschrank über der Bar einordnete. Alles machte einen harmonischen Eindruck: appetitanregende Düfte, einladende Sitzecken und sympathisches Personal. Wenn jetzt noch Essen und Preise stimmten, könnte ich Stammgast werden.
Wir erreichten den hinteren Bereich der Taverne, wo die von Oliver beschriebene große Glasschiebetür weit geöffnet in den Innenhof einlud. Dort wollte unser Freund auf uns warten.
Nur ein Schritt – und wir befanden uns in einer anderen Welt. Einer lebendigen Welt. Kein toter Asphalt, stinkende Abgase und glühendes Blech. Es grünte und duftete wie in einem botanischen Garten. Ich blieb stehen und sog die Atmosphäre in mich auf. Noch ein Künstler, der sich verwirklicht hat, dachte ich. Meine vom steinernen Einheitsgrau abgestumpften Augen erwachten zu neuem Leben. Der Gärtner, der hierfür verantwortlich war, hatte die Häuser, die den Hof einrahmten, hinter lebendigem Grün verschwinden lassen. Malerisch rankte sich Efeu die Wände empor und verdeckte die Härte des tristen Betons. Ein weiteres Kunstwerk, dessen Schönheit gegen die Unterdrückung meiner Künstlerseele kämpfte. Genährt von den Werken Gleichgesinnter erwachte sie aus ihrem Koma. Ich fühlte ihre Regungen am Kribbeln in meinem Bauch. Meine Hände sehnten sich nach Pinsel und Leinwand wie ein Verdurstender nach Wasser. Es war das Aufbäumen eines Chancenlosen. Als Tochter meines Vaters hatte ich dagegen anzukämpfen. Ich hatte verdammt noch mal stärker zu sein als meine Gefühle!
Aus den Augenwinkeln nahm ich eine Figur wahr, die zwischen den Tischen aufsprang. Eine helle, vertraute Stimme lenkte unsere Aufmerksamkeit auf sich. Oliver war unübersehbar. Nicht nur weil er, wie fast jeder in meinem Bekanntenkreis, einen Kopf größer als ich war. Auch das gelbe Hemd, das er heute locker über der weißen Leinenhose trug, stach ins Auge. Seine braunen Kulleraugen mit den schönen langen Wimpern strahlten uns genau wie die vielen übergroßen Zähne fröhlich entgegen. Der leichte Überbiss gehörte wie ein Markenzeichen zu ihm. Oliver trug seine kleinen Makel mit einem Selbstbewusstsein, dass man sich fast schämte, nicht auch solche Zähne oder Pausbacken zu haben.
Der Tisch, den er ausgesucht hatte, befand sich vor einem romantischen, mit Mosaiksteinen versehenen, kleinen Springbrunnen. Auf der anderen Seite war eine niedrige Mauer, die vor lauter saftig grünen Ranken kaum noch als solche auszumachen war.
»Oliver«, jauchzte Sonia und sprang wie eine Gazelle auf ihn zu – als hätten wir ihn nicht erst vor einer Woche in unserer Wohnung zum Frühstück gesehen. Er antwortete mit dem gleichen Jauchzen und begrüßte uns, wie es sich für echte Münchner gehörte: mit Bussi rechts und Bussi links. Sein Gemütszustand spiegelte sich für gewöhnlich in seinen ausdrucksvollen Augen und ich freute mich zu sehen, dass es ihm heute sehr gut ging. Wir setzten uns zu ihm und ich ließ meinen Blick schweifen. Die wenigen Tische waren wie Perlen auf einer Kette T-förmig im Innenhof aufgereiht. Zu meiner Linken wuchs eine mächtige Ulme mit ausladenden Ästen. Ihre Blätter spendeten einen wohltuenden Schatten. Der plätschernde Brunnen verstärkte das Gefühl von Erholung und Erfrischung.
»Hier weht ja sogar ein angenehmes Lüftchen«, stellte ich erleichtert fest und sagte zu Oliver: »Wenn jetzt noch das Essen schmeckt, hast du wirklich einen Volltreffer gelandet. Woher hast du diesen Geheimtipp?«
Oliver grinste und presste seine Lippen zusammen. Verlegen zwirbelte er an seinen zu meinem völligen Unverständnis bewusst eingedrehten Locken.
»Ach, ich weiß«, platzte es aus mir heraus, bevor er es noch spannender machen konnte. »Dieser tolle Typ, von dem du am Telefon geschwärmt hast, dieser …«, ich schnippte ungeduldig mit den Fingern, »… Simon? Ja, Simon! Der hat dich hierher ausgeführt, richtig?«
Sonia horchte auf: »Ach ja, was ist denn mit dem? Hat’ s gefunkt? Seid ihr ein Paar? Erzähl schon! Seht ihr euch regelmäßig?«
Oliver amüsierte sich. »Würdet ihr mich zu Wort kommen lassen, wüsstet ihr schon längst, dass …« Er hielt inne, während seine Augen wie zwei synchron fliegende Pingpongbälle zwischen Sonia und mir hin und her sausten. Sein blasser Teint wich zugunsten eines knalligen Rots. »… dass es gefunkt hat, und wie!« Seine Stimme überschlug sich. »Mein Traummann und ich sind zusammen!«
Mein Versuch, in die Hände zu klatschen, wurde von dem attraktiven Ober unterbunden, der uns, von dieser brandheißen Entwicklung ungerührt, eine Speisekarte reichte.
Sonia drängte. »Erzähl! Ist er aus München oder zugereist? Wie alt ist er?«
Wir konnten es kaum erwarten, mehr zu erfahren. Denn Oliver war nach einer tiefen Enttäuschung sehr lang allein gewesen und endlich wieder offen für eine neue Bekanntschaft. Diesmal sollte es ein Mann sein, der sein großes Herz auch zu schätzen wusste.
»Ein bisschen kann ich euch erzählen, aber er wird heute Abend auch kommen, dann könnt ihr euch selbst ein Bild von ihm machen.« Er begann, von seiner Liebe zu berichten. Doch schon bald nahm seine Begeisterung überhand und sein Redefluss verselbständigte sich. »Die Haare hat er kürzer als ich, also fast wie Brad Pitt, nur dunkler. Naja, eigentlich sind sie sogar ein bisschen heller als meine, aber er hat nicht so käsige Haut wie ich und da wirken sie halt dunkler. Er hat einen tollen Teint, müsst ihr wissen, und dazu die hellblauen Augen, ich sag euch …« Oliver schloss genussvoll die Lider, als ließe er gerade ein Stück edelster Schokolade auf seiner Zunge zergehen. »Jeder Blick geht einem durch und durch. Und auch seine Größe passt. Endlich mal einer, der nicht zu klein ist. Sonst überrag ich die Kerle ja immer, als wär ich der Erziehungsberechtigte!« Er plapperte munter, während unser Ober – ein Auge verträumt auf Sonia gerichtet – unsere Getränkewünsche notierte. »Stellt euch vor, wenn ich die Arbeit als Stylist nicht bekommen hätte … Dann hätt ich doch den Simon niemals kennengelernt.«
»Klar, wenn der dort Model ist. So hast du zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen«, pflichtete ich grinsend bei. Oliver nickte und hauchte andächtig: »Das muss Schicksal sein.«
»Siehst du!« Sonia griff hungrig nach dem bereitgestellten Brot und knabberte an der Kruste. »Es kommt immer alles in Ordnung. Damals hast du mir nicht glauben wollen und jetzt …«, sie zwickte ihm zärtlich in die Wange, »schau dich an, wie glücklich du bist!«
Und wie er aussah! Oliver arbeitete nicht nur als Stylist, er WAR Stylist mit jeder Faser seines Selbst. Es gab keine Trennung zwischen seinem Beruf und seiner Person. Ich dagegen hatte mich dem Willen meines Vaters unterworfen, als ich mich für Jura eingeschrieben hatte. Die goldene Karriere, die er mir »auf dem Silbertablett servierte«, wie er sagte, indem er mich neben meinem, ihm treu ergebenen Bruder Kilian in seiner Kanzlei einplante, empfand ich als Kreuz, das ich zu tragen hatte. Allein die Vorstellung, tagein, tagaus in einem Büro zu sitzen, während draußen vor dem Fenster die Jahreszeiten an mir vorüberzögen, stahl mir die Leichtigkeit meiner Jugend. Die Jahre gingen ins Land – ja, meine Jahre gingen ins Land – und ich täte nichts, als am Schreibtisch zu sitzen und über Fälle und Bücher zu brüten, die mir egaler nicht sein könnten.
Nur ein einziges Mal hatte ich es für einen Moment gewagt, mich ihm entgegenzustellen. Es war nach Vaters Geburtstag im Juli gewesen. Der bevorstehende Kurzurlaub mit Mutter und Segelfreunden nach Frankreich lockerte seine Stimmung und minderte die ihm angeborene Angriffslust. Das Frühstück hatte er sogar auf der Terrasse eingenommen, was beinahe ein Zeichen gewisser Friedfertigkeit war. Ich wusste, es würde die einzige Gelegenheit innerhalb der nächsten sechs Monate sein.
Meine Chance witterte ich vor dem Mittagessen, als wir bei strahlendem Sonnenschein in seinem, durch die schweren Mahagoni- und Ledermöbel düster anmutenden Arbeitszimmer saßen und er mir wegen meiner schlechten Note in Algebra ins Gewissen redete. Es würde höchste Zeit, dass ich mich mehr dahinterklemmte, hatte er mit hochgezogenen, buschigen Augenbrauen und eindringlichem Lehrerblick gefordert, denn schließlich schenke einem niemand etwas im Leben. Wenn ich so weitermachte, würde mich keine Elite-Universität nehmen und das wollten wir ja wohl beide nicht. Seine stahlblauen Augen schauten, dank der Aussicht auf Urlaub, nicht so kalt wie sonst auf mich herab.
Ich hasste diese Momente, aber am meisten hasste ich dieses Büro, das – egal wie viele Türen und Fenster geöffnet waren – für mich nie genug Luft zum Atmen bot. Hier war ich ein Fremdkörper, geduldet, aber nicht zum Verweilen eingeladen. Angespannt und unruhig war ich vor ihm in dem tiefen, klobigen Ledersessel umhergerutscht. Nicht nur mir, sondern jedem darin Sitzenden musste er das Gefühl vermitteln, klein und hilflos zu sein. Selbst die zum Teil in Leder gebundenen Bücher in den Regalen ringsherum befanden sich in einer weitaus besseren Position. Vater hielt sie für achtenswert genug, ihnen einen erhöhten Platz zuzugestehen. Er behandelte sie mit einem Respekt, den er mir nicht zugestand. Sie hatten sich ihm nicht durch Geburt aufgedrängt und so in sein Leben geschlichen.
Gleich würde ich meinem Vater meine geänderten Zukunftspläne gestehen und dass ich tatsächlich keinen Wert darauf legte, ob mich irgendeine Elite-Uni haben wollte oder nicht. Gleich würde sich unser sowieso schon kühles Verhältnis noch mehr abkühlen, wenn nicht sogar zu ewigem Eis gefrieren. Doch meine Entscheidung stand fest: Ich wollte nach der Schule auf die Kunstakademie. Aus mir würde nie eine Anwältin werden. Nichts lag meinem Wesen ferner als dieser Beruf. Vielleicht rannte ich offene Türen ein? In den vergangenen Jahren hatte er keine Gelegenheit gehabt, stolz auf mich zu sein. In den Fächern, auf die es ankam, war ich keine Leuchte. Mit so einem Zeugnis hätte sich eine Fremde niemals bei ihm bewerben dürfen. Vielleicht wäre er sogar froh, wenn ich freiwillig auf meinen Sitz in der Kanzlei verzichtete und seine Nerven schonte? Dieses Argument war meine Chance. Wie auch immer, ich durfte mich auf keinen Fall unterkriegen lassen. Wenn ich hart und überzeugend genug bliebe, würde er meinen Wunsch, Malerin zu werden, akzeptieren oder mich ins Höllenfeuer werfen müssen.
Und so blieb ich an jenem heißen Sommertag nervös und unsicher, sogar ein bisschen zitternd, aber fest entschlossen in dem mächtigen Möbelstück vor meinem Vater sitzen, nachdem er seine Standpauke beendet hatte.
»Ähm«, begann ich zaghaft – meine Entschlossenheit bröselte –, »es gibt etwas, dass ich dir noch sagen muss.«
»Gibt es Probleme? Hast du etwas angestellt?« Sein Ausdruck blieb unverändert.
Ich überlegte, welche Antwort ihm und mir zumutbar wäre. Schließlich würde ich mit dem Echo leben müssen.
»Raus mit der Sprache! Was hast du dieses Mal verkorkst?« Sein rollendes R und seine tiefe Stimme verliehen seinem Münchner Dialekt etwas Anheimelndes, Uriges, und ließen bayerische Gemütlichkeit vermuten, die seinem gefühllosen, rein funktionell eingestellten Charakter zu meinem Bedauern jedoch fehlte.
Mein Herz schlug wie verrückt, pumpte literweise Blut in meinen Kopf und verwandelte mein Atmen in ein zittriges Schnaufen. »Ich wollte eigentlich … also, ich habe mich irgendwie entschlossen …« Ich musste bestimmter klingen: »Ich habe mich fest entschlossen, dass ich mich nicht an einer Universität für ein Jurastudium einschreibe.« Es war ausgesprochen! Öffnete sich schon der Schlund zur Hölle unter meinem Sessel? »Ich möchte, würde gerne, ich … also, ich werde mich lieber bei der Kunstakademie bewerben. Die Malerei ist mein Leben und Jura passt nicht zu mir.« Ich sah ihn kurz an und schob ein versöhnliches: »Leider« hinterher.
Er ließ mich gewähren, also führte ich meine Argumentation weiter aus, hielt meine sorgfältig zurechtgelegte Rede. Scheinbar geduldig wartete er, bis ich sie beendet hatte. Wäre sie nicht so stockend gewesen, hätte sie vielleicht sogar uns beide überzeugt.
Er runzelte seine Stirn – kurz nur, dann war sie wieder wie glatt gebügelt. Fast hätte man glauben können, er lächelte. »Das ist ausgeschlossen. Eine Kunstakademie steht nicht zur Option«, sagte er ruhig und mit einer Selbstverständlichkeit, als ginge es um eine Nebensächlichkeit. »Wenn du in den Ferien einen weiteren Malkurs besuchen möchtest, können wir gerne darüber reden«, er nahm eine der Akten, die sich vor ihm auf dem Tisch stapelten und öffnete sie, »allerdings erst, nachdem sich deine Note in Algebra verbessert hat.« Er zückte seinen Kugelschreiber, klappte seine Lesebrille auf und warf mir einen kurzen, prüfenden Blick zu.
Hatte seine Weisung den Weg in die wirren Gehirnzellen seiner Tochter gefunden? Fruchtete sie? In meinem Blick musste er Entsetzen lesen, konnte somit davon ausgehen, dass sie angekommen war. Zufrieden setzte er sich das silbrig blitzende Gestell auf die Nase. Es war an der Zeit, sich den wichtigen Dingen zu widmen. Das Gespräch war beendet. Für ihn – jedoch nicht für mich.
Noch einmal nahm ich all meinen Mut zusammen: »Also, ähm, ich glaube, du hast mich nicht verstanden.«
Er sah kaum auf, schielte nur über den Rand seiner Brille, ohne den Kugelschreiber beiseite zu legen. »So?«
»Weißt du«, stolperte ich unbeholfen, aber unbeirrt weiter in Richtung des weitgeöffneten Höllenschlunds, »ich will nicht nur einen Malkurs besuchen. Ich will es richtig lernen. Als ich in den Ferien in deinem Büro gejobbt hatte, habe ich gemerkt, dass Anwältin nichts für mich ist. Die Malerei hingegen macht mir so viel Spaß, dass ich sie zu meinem Beruf machen will. Da gibt’ s eine Kunstakademie in München. Da möchte ich mich bewerben. Dazu hab ich mich fest entschlossen.« Eigentlich, so ziemlich, irgendwie …
Stille.
Seine Miene versteinerte und die kurzen, angegrauten Haare wirkten mit einem Mal schlohweiß, was vermutlich am Farbton seines Gesichts lag. Dunkelrot. Es war eine Explosion, eine Gefühlsoffenbarung. Bemüht ruhig nahm er seine Brille wieder herunter und legte sie sorgfältig vor sich auf den Tisch. »Ich war doch deutlich!«
»Ja klar, aber hör doch …«
»Das Problem ist, dass DU nicht hörst!« Ich sah es in ihm brodeln und kochen. Mit harter Stimme fuhr er fort: »Ich habe dir jahrelang deine Malerei finanziert. Die einzige Bedingung, die ich daran knüpfte, war, dass du dich in der Schule anstrengst und eine gute Universität besuchst.«
»Ich weiß, ich bin ja auch für alles dankbar.« Ich wusste, ich spielte nicht nur mit dem Feuer – es war ein Tanz auf dem Vulkan. Aber meine inneren Räder waren in Gang gebracht und rollten unaufhaltsam auf den Abgrund zu. »Das Versprechen zu studieren hab ich gegeben, als ich noch viel zu jung war, um zu wissen, was ich überhaupt werden will. Erst jetzt bin ich mir sicher. So oft hab ich in den Ferien in deiner Kanzlei gearbeitet – jetzt kann ich wirklich mit gutem Gewissen sagen, dass ich auf keinen Fall Anwältin werden will. Beim Malen bin ich glücklich. Nur da bin ich ich selbst. Ich kann mich entfalten – frei sein.« Und die Räder des Verderbens rollten weiter: »Mein Kunstlehrer meint, ich hätte ein besonderes Talent, Gefühle und Leidenschaft auszudrücken. Ich hab schon so viele Ideen! Ich werde viel reisen und fremde Kulturen und Landschaften auf der Leinwand verewigen. Mein Kunstlehrer hat gesagt …«
»Himmel«, unterbrach er mich ungeduldig, »es interessiert mich doch nicht, was dein Kunstlehrer sagt!« Mit einem Donnerknall auf den Schreibtisch setzte er meinem Übermut ein Ende. »Malen kannst du in deiner Freizeit. Das ist kein Beruf, das ist ein Hobby. Und ob dir der Beruf der Anwältin gefällt, kannst du jetzt noch gar nicht beurteilen.«
»Doch! Im Büro versauere ich!«
»Schluss jetzt!« Er sprang auf, dass ich zusammenzuckte. »Das ist das Dümmste, das ich je gehört habe!« Wie ein General vor seinem kleinen, ungehorsamen Soldaten marschierte er vor mir auf und ab. »Malerin, pah! DA versauerst du, das garantier ich dir! Aber als Anwältin in meiner Kanzlei kannst du überhaupt nicht versagen. Ich bin da, ich fördere dich. Ich werde dich schon zum Erfolg führen!«
»Es geht doch nicht nur um Erfolg.«
»Es geht um nichts anderes! Was glaubst du denn, wie ich zu diesem Haus und meiner Stellung in der Gesellschaft gekommen bin? Was werden unsere Freunde und Bekannten sagen …« Darum geht es ihm also! »… wenn meine eigene Tochter sich entscheidet, ein elender Nichtsnutz zu werden?« Er hielt inne, um seinen Worten durch den Nachhall mehr Tiefe zu verleihen. »Man wird mit dem Finger auf mich zeigen und sagen, ich hätte mein Kind verkommen lassen. Man wird von meiner Erziehung auf mein berufliches Können schließen und sagen: ›Wenn die Kinder nichts taugen, kann die Kanzlei auch nichts wert sein.‹ Man wird sich abwenden und tratschen.« Er beugte sich zu mir herunter. »Du bist meine Tochter. Und meine Tochter lernt etwas Anständiges, einen verantwortungsvollen Beruf.« Kopfschüttelnd richtete er sich wieder auf. »Fehlt nur noch, dass du Prinzessin werden willst.« Sein Ton wurde verächtlicher. »Hat dir wohl dein Kunstlehrer eingeredet, diesen Mumpitz!« Er blieb vor der geöffneten Terrassentür stehen und sah hinaus. »Dass du mit einem Mal alles wegwirfst, was dir früher einmal etwas bedeutet hat, das sieht dir gar nicht ähnlich. Hat dich wahrscheinlich auch noch aufgestachelt, dieser elendige …«
»Hat er nicht«, rief ich entsetzt, bevor er seine Beleidigung gegenüber dem einzigen Menschen, der mich und mein Talent je würdigte, aussprechen konnte. »Er hat nur gesagt, dass ich etwas kann. Für meine Pläne bin ich verantwortlich. Ich bin immerhin schon 16! Außerdem hat mir deine Kanzlei nie so viel bedeutet wie dir.«
Gleich würde das Gesagte seine Wirkung zeigen. »Wie bitte?«, donnerte er entsetzt über meinen fehlenden Respekt gegenüber seinen selbstlosen Taten und Leistungen. »Ich habe diese Kanzlei für die Familie unter vielen Entsagungen aufgebaut!« Natürlich!, dachte ich, das musste ja wieder kommen! »Dank ihr hast du ein sorgenfreies Leben. Dank ihr lebst du in einem großen Haus …« Das keine Seele hat! »… besitzt schöne Kleider …« Die ich nicht tragen kann, weil ich vor lauter Kummerspeck keine Figur mehr habe! »… gehst auf eine teure Privatschule …« Mit versnobten Mitschülern! »… und frönst den teuersten Hobbies.« Hoppla! Segeln, Golfen und Tennis sind Hobbies, denen nur mein arroganter Bruder frönt. Mein Vater weiß wirklich gar nichts von mir! »Es hat dir doch wohl an nichts gefehlt?«
Diese Frage war eher eine Drohung. Es galt, genau zu überlegen, um nichts Falsches zu antworten. »Das sag ich doch gar nicht«, wich ich aus, um nicht zu lügen. Ich versuchte, ihn mit leiser Stimme zu beschwichtigen, aber er war bereits in Fahrt: »Diese Kanzlei, die dir dieses schöne, unbeschwerte Leben ermöglicht und dir dennoch so wenig bedeutet, sollst du einmal mit deinem Bruder übernehmen. Nur darum sitze ich bis tief in die Nacht im Büro, obwohl ich das für mich allein schon längst nicht mehr nötig hätte. Und du erklärst mir seelenruhig, dass du – wie sagt man noch gleich in eurem Alter – ›keinen Bock‹ auf mein Lebenswerk hast?« Seine eigenen Worte schienen ihm meine Undankbarkeit und Unverfrorenheit noch bewusster zu machen. Er wurde lauter und ich kleiner: »Nimm in deiner Freizeit deine Pinsel und Farben und mal so viel du willst, aber dein ganzes Leben wirst du nicht darauf verschwenden, mein Kind, dafür werde ich sorgen!« Durch das hochrote Gesicht blitzten seine stahlblauen Augen noch eindringlicher. Die harten, kantigen Gesichtszüge drohten meinem Eigensinn. »All die guten Schulen! Willst du in der Gosse enden? Ist es das, was du in deinem Leben anstrebst? Bravo, dann bist du auf dem besten Weg!«
Wie eine schuldbewusste Angeklagte vor Gericht saß ich kleinlaut im Sessel und versuchte vergeblich, mir ein Minimum an Würde zu bewahren, während er stoßweise seine Verachtung gegen mich abfeuerte. Seine Hände steckten zu Fäusten geballt in den Hosentaschen seines dunklen Maßanzugs. Er presste die Lippen zusammen und spannte die Kiefermuskeln an wie ein Raubtier, das seine Beute fest zwischen seinen Reißern hielt. Außer sich marschierte er vor mir auf und ab.
Die Haustür fiel ins Schloss. Meine Mutter. Sie war von ihrem Friseurtermin zurück, wo man ihr regelmäßig ihren schicken, kastanienbraungefärbten Kurzhaarschnitt erneuerte. Nun stand sie in Vaters Arbeitszimmer. Der Duft von Haarfestiger und Eau de Toilette verbreitete sich im Raum, kaum dass sie die Tür geöffnet hatte. Vater wirbelte zu ihr herum und tönte, ohne sie zu begrüßen, in ihr verwundertes Gesicht: »Weißt du, was deine undankbare Tochter mir gerade eröffnete?« Mutter blieb keine Zeit auch nur zu fragen, worum es in unserer hitzigen Diskussion eigentlich ging. Schon schmetterte er ihr die Antwort entgegen: »Selbstmord! Sie will beruflichen Selbstmord begehen!« Diese Dramatik war sein Mittel der Wahl, wenn etwas gegen seinen Willen verlief.
Überrumpelt starrte sie uns an. Mit Täschchen und Autoschlüssel in den Händen stand sie regungslos in der Tür und blinzelte mit ihren künstlichen Wimpern. Ihr Mund klappte auf und zu – ein jämmerlicher Versuch, sich am Gespräch zu beteiligen. Vater interessierte sich nicht für ihre Meinung. Er hatte sich längst wieder zu mir gewandt: »Wenn du nicht ganz schnell wieder zur Vernunft kommst, Kind«, sein Ton war beschwörend, »streich ich dir alle Hobbies! Hausarrest bekommst du sowieso. Ha – und diesem … diesem … diesem Kunstlehrer … na, dem werd ich ein paar Takte beibringen.« Dazu passend fuchtelte er wie ein Dirigent mit seiner Hand in der Luft herum.
Die gesamte Unterredung musste er als einen gemeinen, hinterhältigen Anschlag auf sein Lebenswerk betrachtet haben: vom Kunstlehrer geplant und von seiner eigenen Tochter ausgeführt. Mit einem befremdeten Gesichtsausdruck blieb er vor mir stehen. Fassungslos darüber, was er da großgezogen hatte, schüttelte er den Kopf: »Gott, Felizitas! Die Welt steht dir mit den größten Chancen und besten Möglichkeiten offen – jeder andere Mensch wäre auf Knien dankbar, aber du …«
»Ich sag doch nicht, dass ich undankbar bin.« Mein Ton hatte an Kraft verloren. Ich sah ihm nicht mehr in die stechenden Augen, als ich leise fortfuhr: »Ich will sagen, dass ich anders bin als du. Du bist sogar gerne in die Schule gegangen. Ich fühl mich nicht einmal als Teil der Gesellschaft – eher wie ein Fremdkörper.«