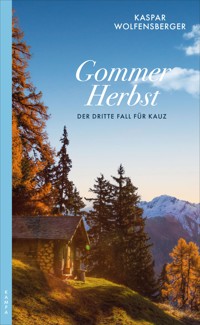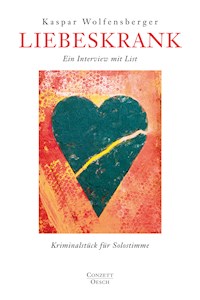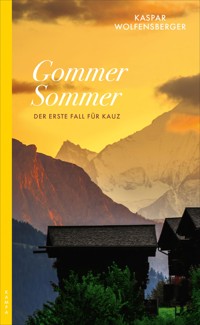
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kampa Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Ein Fall für Kauz
- Sprache: Deutsch
Bislang hat Alois Walpen, besser bekannt unter seinem Spitznamen Kauz, seine Ferien in einem umgebauten Speicher in Münster verbracht. Nachdem er es sich mit der Zürcher Polizeileitung verscherzt hat, zieht sich der Kriminalpolizist a. D. ins Walliser Goms zurück. Gewöhnlich stehen dort Trockenfleisch, Käse und Heidelbeerlikör für ihn bereit, diesmal wird Kauz jedoch von einer Leiche empfangen, die an einem Balken baumelt. Während die Kollegen vor Ort von einem Selbstmord ausgehen, beginnt er auf eigene Faust zu ermitteln. Derweil bearbeitet Immobilienkönig Anton Z'Blatten, der »Gommer Napoleon«, die Dorfversammlung: Das Gommer Highland Resort sei das Herzstück eines neuen Tourismusmodells, das Schule machen werde. Das Wallis, die ganze Schweiz, nein, alle Alpenländer würden auf Münster blicken. Wieso man diesen Mann frei schalten und walten lasse, fragt Kauz und erhält eine deutlich Antwort: »Weil bei uns im Goms, und überhaupt im Wallis, das Recht am Verludern ist.« Genau der richtige Ort für einen Polizisten im Unruhestand.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 498
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Kaspar Wolfensberger
Gommer Sommer
Der erste Fall für Kauz
Kriminalroman
Kampa
Die Handlung dieses Romans ist reine Fiktion. Alle in der Erzählung auftretenden Figuren, auch wenn sie ortstypische Namen tragen, sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit real existierenden Personen und wahren Begebenheiten wären rein zufällig.
Einzelne Gebäude, Örtlichkeiten und Flurnamen, denen im Rahmen dieser Kriminalgeschichte eine Bedeutung zukommt, sind realen Objekten, Orten und Bezeichnungen im Goms nachempfunden, existieren in der beschriebenen Form jedoch nicht.
PrologGommer Sommer
Noch nicht ganz sechs Uhr in der Früh, ein neuer Tag bricht an. Über der Furka beginnt es golden zu leuchten. Wie Scherenschnitte heben sich die schwarzen Bergzacken vor dem heller werdenden Himmel ab. Ein erster Sonnenstrahl trifft auf den Gipfel des Brudelhorns. Gegenüber, hoch über dem Minstigertal, glänzen die Felswände im Morgenlicht. Im Westen, hinter dem nächsten Dorf, steht weiß auf grüner Matte die Feldkapelle. In der Ferne, im milchigen Rosarot des Morgens, das mächtige Weisshorn. Eine Nebelbank liegt über dem Rotten. Die Lärchen und Fichten an den Berghängen ruhen noch im Schatten. Aufrecht, stoisch und friedlich. Die Morgenluft ist frisch und rein. Tautropfen hängen an Blättern und Halmen. Es riecht nach dem am Vorabend gemähten Gras. In der Ferne tönen vereinzelte Kuhglocken. Vögel zwitschern in die Morgenstille hinein.
Die zwei Männer auf dem Parkplatz neben den Bahngleisen haben weder Augen noch Ohren für die Schönheit der Landschaft. Der Große flüstert in sein Handy, steckt es wieder ein, drückt dann lautlos die Beifahrertür zu. Die beiden ziehen los, der Kleine immer einen Schritt voraus. Sie sind wärmer angezogen als es, selbst zu dieser kühlen Morgenstunde, nötig wäre: dicke Jacken, Halstuch, Handschuhe. Der Große trägt einen Schlapphut, der Kleine eine Langläufermütze tief ins Gesicht gezogen. Bei einem Speicher am Dorfrand bleiben sie stehen und gehen in Deckung. Der Kleine steht an der Stallecke, Gasse und Speicher immer im Auge. Der Große lehnt sich gegen die Seitenwand des Nachbarstadels gegenüber und zündet in der hohlen Hand eine Zigarette an. Sie warten schweigend. Eine Viertelstunde später erscheint auf der Gasse ein dritter Mann. Seiner Kleidung nach ein Bauer auf dem Weg in den Stall oder aufs Feld. Er trägt eine papierene Einkaufstasche mit dem Schriftzug des Dorfladens. Vor dem Speicher stellt er die Tasche ab und zieht einen Schlüssel aus der Hosentasche. Er schreckt hoch, als der Mann mit der Skimütze von hinten an ihn herantritt. Der hebt entschuldigend die Hände. Der Bauer lacht, sagt etwas und macht eine Kopfbewegung Richtung Tür. Der Skimützenmann hebt die Schultern und nickt. Der Bauer stößt die Tür auf und lässt den Mann eintreten. Bedächtig greift er nach der Einkaufstasche. Der Große mit dem Schlapphut hat seine Zigarette weggeworfen und ist mit ein paar raschen Schritten bei der Tür. Er drängt den Bauern in den Speicher hinein und stößt mit dem Fuß die Tür hinter sich zu. Kaum zwanzig Minuten später kommen die zwei Männer wieder aus der Speichertür, knöpfen eilig ihre Jacken zu und hasten zum Parkplatz. Sie steigen in ihren Pick-up und brausen davon.
Das Dorf erwacht.
Freitag, 30. Juni
Kauz war schon in Ferienstimmung. Zu Hause in Altstetten stand alles für die Abreise bereit. Auf acht Uhr fünfzehn war er zu seiner obersten Chefin zitiert worden, Punkt Viertel nach acht klopfte er an. Er war darauf gefasst, einen Rüffel, vielleicht sogar einen Verweis einstecken zu müssen. Was dann kam, darauf war er nicht gefasst gewesen.
Die Kommandantin, Frau van Hooch, empfing ihn im Stehen. Sulzer, Leiter der Human Resources, und Senn, Chef der Kriminalpolizei, sein direkter Vorgesetzter, standen neben ihr.
Kauz wurde es mulmig.
Mit eiskalter Miene stellte Frau van Hooch ihn vor die Wahl, in den administrativen Dienst versetzt zu werden oder das Arbeitsverhältnis im gegenseitigen Einverständnis mit sofortiger Wirkung aufzulösen.
Frau Dr. iur. Doris van Hooch, patentierte Rechtsanwältin, ohne jegliche Praxis in diesem Beruf, dafür aber mit einem Master of Business Administration dekoriert und Absolventin eines postdoktoralen universitären Lehrgangs in Applied Ethics, war einst die umstrittene, um nicht zu sagen berüchtigte Reorganisatorin im Volksschulamt gewesen. Seit einem Jahr war sie nun Kommandantin der Zürcher Kantonspolizei. Der graue Businessanzug saß perfekt. Sie war makellos geschminkt, das stylish getönte Haar war flott geföhnt.
Die Vertrauensbasis für eine weitere Zusammenarbeit sei nicht mehr gegeben, eröffnete Frau van Hooch ihm knapp.
Nicht mehr gegeben?, dachte Kauz. Gar nie vorhanden gewesen!
Dass er seine Mitarbeiter gegen sie aufwiegle, fuhr Frau van Hooch fort, könne sie nicht weiter hinnehmen.
In der Tat, Kauz hatte seine neue oberste Chefin nie riechen können. Und er hatte kein Hehl daraus gemacht, was er von ihrer hektischen, von einem McKinsey-Team am Reißbrett ausgeheckten Reorganisation des Polizeikorps hielt. Ohne die Meinung der gestandenen Polizistinnen und Polizisten, Dienstchefs und Offiziere auch nur anzuhören, ohne auf Einwände und Bedenken einzugehen, hatte sie wie ein Wirbelwind das ganze Korps auf den Kopf gestellt. Was sich irgendwie umstrukturieren ließ, wurde umstrukturiert. Bewährtes wurde über den Haufen geworfen, Neues mit großen Worten angekündigt und ohne Rücksicht auf Verluste implementiert. So lautete das Lieblingswort der Kommandantin. Titel, Diplome und CAS zählten mit einem Mal mehr als persönliche Eignung und Berufserfahrung. Die meisten kuschten oder machten die Faust im Sack. Fast alle hatten Familie und konnten es sich nicht leisten, ihren Job zu riskieren. Denn die Kommandantin hatte die Rückendeckung der neu gewählten Regierungsrätin, von der sie auf den Posten gehievt worden war. Aber Kauz hatte den Mund nicht halten können. Frau van Hooch hatte von Insubordination gesprochen, als er sich einmal etwas gar weit aus dem Fenster lehnte, und absolute Loyalität gefordert. Dass Kauz dagegen protestierte, mit seinen Leuten in ein Großraumbüro umzuziehen, und dass einzelne von ihnen sich auch selber dagegen auflehnten, war für Frau van Hooch wohl schon Aufwiegelung. Dass Kauz sich jetzt rundweg weigerte, die Konsequenzen, die sein Protest nach sich zog, zu akzeptieren und Hals über Kopf in eine neue Abteilung zu wechseln, das hatte das Fass für die Kommandantin offenbar zum Überlaufen gebracht.
Und dann erst seine Arroganz, hörte er sie jetzt sagen, seine überhebliche Art … Kauz war, als rede sie hinter einer gläsernen Wand.
Da sie unmöglich mangelnde berufliche Leistung ins Feld führen konnte – er hatte als Kriminalpolizist und als Dienstchef stets nur erstklassige Qualifikationen erhalten –, deutete sie an, dass eine Disziplinaruntersuchung gegen ihn eingeleitet werde, sollte er den Dienst nicht freiwillig quittieren. Dabei werde man natürlich auch seine Spesenabrechnungen, seinen E-Mail-Verkehr und die Festplatte seines Computers unter die Lupe nehmen. Kauz wusste selbst am besten, dass bei einer solchen Nachforschung immer irgendetwas zum Vorschein kam, das sich notfalls aufbauschen und sogar strafrechtlich verfolgen ließ.
Doch er war durch und durch Polizist, der administrative Dienst kam für ihn nicht infrage. Für die Frühpensionierung war er noch zu jung. Und eine Privatdetektei, wie manche ehemaligen Polizisten sie betrieben, war nicht nach seinem Gusto. Zwar war er ein findiger Fahnder und hartnäckiger Kriminalpolizist, mit einer sehr respektablen Aufklärungsquote. Und er war gut vernetzt – keine schlechten Voraussetzungen für einen Privatdetektiv. Aber er wusste, dass er die Polizeiarbeit vermissen würde. Also hatte er darauf spekuliert, dass irgendwann schon offensichtlich würde, welches Chaos die neue Kommandantin im Korps anrichtete und wie demoralisierend sich ihr Führungsstil auswirkte. Er hatte gehofft, dass das Wochenblatt die Sache aufgreifen würde und Frau van Hooch schließlich den Dienst quittieren müsse. Aber da hatte er sich wohl verrechnet.
Kauz stand in verwaschenen Jeans, abgewetztem Kordjackett und kariertem Hemd vor seiner piekfeinen Kommandantin. Frisch rasiert konnte man ihn nicht nennen, und ein Haarschnitt war auch längst überfällig. Doch dass er selbst in dieser Situation einen leicht hochmütigen Blick hatte, dafür konnte er nichts. Er litt an einer genetisch bedingten Ptose, wie ein Augenarzt diagnostiziert hatte: Seine Oberlider hingen immer leicht über die Augen herab. Auch mit größter Anstrengung vermochte er sie nicht ganz zu öffnen. Das verlieh ihm den Ausdruck einer verschlafenen Eule, selbst wenn er hellwach war. Diese Mimik hatte ihm schon bei den Pfadfindern seinen Spitznamen eingetragen. Der war ihm geblieben, und seit er erwachsen war, trug er ihn fast mit Stolz. Und weil ihn jeder als »Kauz« kannte, sah man ihm sein etwas eigenwilliges Sozialverhalten nach. Da das Symptom nicht sehr ausgeprägt war, hatte es bei der Rekrutierung keine Probleme gegeben. Und bei der Aufnahme in die Polizeischule auch nicht. Er war sogar ein ganz leidlicher Pistolenschütze. Aber wenn er seinem Gegenüber in die Augen sehen wollte, musste er ein klein wenig den Kopf heben, damit ihm seine Lider nicht in die Quere kamen. So machte er, wenn man ihn nicht kannte, ganz ungewollt einen hochnäsigen Eindruck.
Kauz fühlte sich wie von der Kommandantin geohrfeigt.
»Das kommt jetzt etwas unerwartet«, murmelte er, »nach dreiunddreißig Dienstjahren. Sie …« Er hatte nicht die Absicht, auf Mitleid zu machen. Vielmehr wollte er darauf anspielen, dass Frau van Hooch gerade mal ein einziges Dienstjahr vorzuweisen hatte. Nur fand er im Schock die Worte nicht.
»Werden Sie jetzt nicht pathetisch, Herr Walpen«, unterbrach ihn die Kommandantin.
»Geben Sie her«, sagte Kauz abrupt, obschon er wusste, dass er sich hatte provozieren lassen und jetzt möglicherweise den größten Fehler seines Lebens beging. Er streckte die Hand aus.
Frau van Hooch nahm Sulzer das Papier aus der Hand, das der von Anfang an für sie bereitgehalten hatte, und reichte es Kauz.
Kauz las die vorbereitete Vereinbarung durch. Nur kurz ging ihm der Gedanke durch den Kopf, dass er einen Rechtsanwalt nehmen und die aufgezwungene Entlassung anfechten müsste.
Dann unterschrieb er.
»Tut mir aufrichtig leid, Herr Walpen«, flüsterte Senn.
Frau van Hooch sah den Kripochef tadelnd an.
Feigling, dachte Kauz. Opportunist.
»Wenn Sie wünschen, können wir Ihnen ein Coaching vermitteln«, sülzte Sulzer.
»Wofür? Ich bin ja entlassen.«
»Nun, für die berufliche Neuorientierung. Sie sind siebenundfünfzig, da …«
»Das weiß ich selber«, fuhr Kauz ihn an.
Sulzer sah ihn bekümmert an. Dann gab er sich einen Ruck: »Sie machen aber keine Dummheiten, nicht wahr, Herr Walpen?«, hakte er nach.
Kauz warf ihm einen verächtlichen Blick zu.
»Ach ja, wenn wir gerade dabei sind«, sagte Frau van Hooch. »Herr Senn wird Sie jetzt an Ihren Arbeitsplatz begleiten. Dort nimmt er Ihnen den Badge und Ihre Dienstwaffe ab.« Mit einer hochgezogenen Augenbraue unterstrich sie den unausgesprochenen Auftrag an Senn, allfällige Dummheiten zu verhindern. »Bis neun Uhr müssen Sie Ihren Platz geräumt haben«, fuhr sie fort. »Danach erlischt Ihre Zugangsberechtigung zum Kommando. Das wars, Herr Walpen. Ich wünsche Ihnen alles Gute«, schloss sie, ohne eine Miene zu verziehen.
So viel Selbstbeherrschung brachte Kauz nicht auf.
»Wissen Sie was?«, fragte er, und jetzt versuchte er tatsächlich, ein bisschen herablassend zu klingen, »ich werde weder mich selbst noch sonst jemanden über den Haufen schießen. Nun, Frau van Hooch, Menschenkenntnis war noch nie Ihre Stärke. Sie sind eben kein Polizist. Nie gewesen. Und von der Polizeiarbeit haben Sie keine blasse Ahnung. Das weiß hier jeder! Vielleicht sogar Sie selber. Ich wünsche dem Polizeikorps alles Gute.«
Damit steckte er die Kopie des unterzeichneten Entlassungspapiers ein und ließ sie stehen.
Seine Mitarbeiter scharten sich um ihn, als er im Büro erschien und unter Senns Augen seinen Arbeitsplatz zu räumen begann. Sie verstanden die Welt nicht mehr.
»Lasst das bloß bleiben!«, raunzte er, als einzelne ankündigten, sie würden bei der Kommandantin vorsprechen und gegen seine Entlassung protestieren. Er fürchtete, es könnte ihnen sonst auch an den Kragen gehen.
Am Freitag, den dreißigsten Juni, Schlag neun Uhr morgens, stand Kauz auf der Straße. Seiner Funktion als Dienstchef Leib und Leben bei der der Zürcher Kriminalpolizei enthoben, per Ende Jahr entlassen und mit sofortiger Wirkung freigestellt.
Es regnete in Strömen, wie schon seit Wochen. Vom Zürcher Regenwetter hatte Kauz die Nase nun so richtig voll. Er schlug den Mantelkragen hoch, packte seine pralle Aktenmappe, die Sport- und die Einkaufstasche, die ihm zwei Kolleginnen mit Tränen in den Augen geliehen hatten, um seine Siebensachen zu verstauen, und ging aufs Tram.
Der Einsatz war zu Ende, was jetzt folgte, war nur noch Bürokram. Auf dem Rückweg von Münster wies Polizeikorporal Ria Ritz den Aspiranten Benjamin Carlen an, den Streifenwagen vor der Bäckerei in Fiesch zu parken. Carlen blieb am Steuer sitzen. Ria Ritz, ihres Zeichens Postenchef in Fiesch – es wäre ihr nie eingefallen, sich als Postenchefin zu bezeichnen –, stieg aus. Sie holte drei frische Brötchen, zwei extra große für Carlen, dick mit Schinken bepackt, und eines mit Kräuterquark für sich selbst. Sie hatten beide noch nicht gefrühstückt. Es war mittlerweile halb zehn Uhr geworden, der Einsatz hatte alles in allem fast drei Stunden gedauert. Sie fuhren zum Polizeiposten, setzten sich an ihre Arbeitsplätze, machten Kaffee und bissen in ihre Brötchen.
Eigentlich wäre die mobile Patrouille für diesen Einsatz zuständig gewesen, aber die war zu einem schweren Carunfall im Pfynwald gerufen worden. Ria hatte Pikettdienst gehabt. Sie war um halb sieben schon auf gewesen, hatte Benjamin per Handy aus den Federn geholt, sich in die Uniform gestürzt und war in ihrem Familienauto zum Posten gefahren.
Benjamin Carlen saß schon im Streifenwagen, als sie dort ankam, stellte Blaulicht und Sirene an und fuhr los. Mitten in der Ausbildung zum Gendarmen – so lautete die offizielle Bezeichnung – absolvierte er ein Praktikum auf dem Posten Fiesch. Als sportlicher Autofahrer war er ganz erpicht auf solche Einsätze. Er liebe Action – Äggschn –, sagte er bei jeder Gelegenheit.
»Schwerverletzter in Münster, mitten im Dorf«, sagte Ria Ritz knapp. »Verkehrsunfall. Vom Unfallfahrzeug keine Spur. Fahrerflucht.«
»Okay, Chef, dann mal Äggschn«, meinte der junge Polizeiaspirant erfreut und fuhr rassig, aber kontrolliert die engen Kurven hinauf.
Korporal Ria Ritz überlegte: Mit Blaulicht dauerte die Fahrt von Fiesch nach Münster zwölf Minuten. Der Zeitpunkt des Unfalls lag bestimmt länger zurück. Wenn der Unfallfahrer talabwärts flüchtete, dann wäre er schon bei Fiesch vorbei, unterwegs Richtung Brig und Visp. Nahm er aber talaufwärts Reißaus, dann wäre er bald über alle Berge. Die dritte Möglichkeit war, dass der flüchtige Fahrer aus dem Goms stammte, sich jetzt irgendwo versteckte oder zu Hause ins Bett legte und seinen Rausch ausschlief. So oder so, sie konnte sich jetzt nicht um die Fahndung nach dem Fluchtwagen kümmern. Das musste sie der Zentrale überlassen. Aber sie hielt die Augen offen. Beni fuhr wie der Teufel, aber gekonnt.
Ria ging davon aus, dass die Rettungssanitäter, die in Münster auf Pikett standen, und auch der Dorfarzt längst auf der Unfallstelle waren.
Benjamin Carlen gab Gas. Er kannte das Goms wie seine Westentasche. Einmal an der Abzweigung Fürgangen vorbei, hatte er freie Fahrt. Die Strecke blieb kurvig, wies aber kaum noch Steigung auf. Niederwald, Beni drückte das Gaspedal durch. Blitzingen, volle Pulle, immer Richtung Galenstock. In Selkingen nahm er den Fuß vom Pedal, in Biel bremste er leicht ab. Ab Ritzingen gab er wieder Vollgas. Jetzt passierte er Gluringen, die reinste Rennstrecke. Reckingen, Endspurt. Erst eingangs Münster lockerte er in der Steigung sein rechtes Bein und schaltete herunter.
»Nicht schlecht«, nickte Ria Ritz anerkennend, als er schließlich mit quietschenden Reifen hielt.
Die Unfallstelle lag tatsächlich mitten im Dorf an einer etwas engen Stelle, gleich nach einer unübersichtlichen Kurve. Ria hatte hier schon mehr als einmal Unfallrapporte erstellen müssen, aber bis anhin war es bloß um Sachschäden gegangen. Die schwereren Unfälle, mit Toten und Verletzten, passierten sonst eher auf den Strecken zwischen den Dörfern, wenn Auto- und Motorradfahrer Überholverbot oder Tempolimite missachteten.
Korporal Ria Ritz erfasste die Situation mit einem Blick: ein Verletzter, bewegungslos neben einer Hausmauer auf der Straße liegend, den Kopf in einer Blutlache; Bremsspuren, Lack- und Glassplitter auf der Straße. Zwei Einwohner, die früh unterwegs waren, hielten den Verkehr auf, der talaufwärts fuhr. Oberhalb stand das Ambulanzfahrzeug, das Blaulicht kreiste. Ritz gab dem Aspiranten Carlen Anweisung, die Unfallstelle comme il faut zu sichern, um Folgeunfällen vorzubeugen. Sie selber ging zum Dorfarzt und den Rettungssanitätern, die sich um den Verletzten kümmerten. Eben wurde entschieden, er müsse per Helikopter ins Spital Visp geflogen werden. Ritz meldete der Zentrale per Funk den Sachverhalt. Sie schaute auf ihre Uhr. Es würde mindestens vierzig Minuten dauern, bis die Spurensicherung aus Brig da war. So lange mussten sie hier ausharren. Sie markierte auf der Straße mit Kreidestrichen die Lage des Verunfallten. Dann beugte sie sich über die Scherben und Lacksplitter, die auf dem Asphalt lagen, ohne etwas anzurühren. Mattgrüne Lacksplitter, stellte sie fest. Ein Armeefahrzeug?, fragte sie sich.
Die Rettungssanitäter hatten die Taschen des Verunfallten durchsucht. Einen Notfallausweis konnten sie nicht finden, aber er trug seine Identitätskarte auf sich: Hubert Trapper war sein Name, achtundvierzig Jahre alt. Ria Ritz schaltete sofort: Das war doch der Gemeindeschreiber von Münster! Der Verletzte wurde auf die Bahre gehoben und ins Ambulanzfahrzeug geladen. Wenig später fuhren die Rettungssanitäter mit dem Bewusstlosen auf das Flugfeld am Rotten hinunter, wo der Rettungshelikopter landen würde.
Nun ging Korporal Ritz zu Doktor Kalbermatten. Er war ein Hüne mit weißem Vollbart und dicker Hornbrille, eine Figur wie aus einem alten Heimatfilm. Neben seinem Auto kniend packte er die Notfalltasche zusammen.
»Überlebt er?«, fragte sie.
Kalbermatten hob die Schultern. »Ich weiß nicht, Meggä«, sagte er. »Schädelbruch. Wahrscheinlich mehrfache innere Verletzungen. Vielleicht auch die Wirbelsäule. Ganz nüchtern ist er übrigens nicht.« Doktor Kalbermatten tippte mit dem Zeigefinger an seinen Nasenflügel, zum Zeichen, wie er den Befund erhoben hatte.
»Wer informiert die Angehörigen?«, fragte Ria.
»Das mache ich. Ich kenne die Familie«, sagte der alte Doktor.
Ria war heilfroh, dass er selbst anbot, die Familie Trapper über das Unglück zu informieren. Erleichtert drückte sie dem Arzt die Hand.
Nach weniger als vierzig Minuten waren die Leute von der Spurensicherung da. Die Unfallstelle wurde aus allen Richtungen fotografiert, die Lage des Verletzten, die Korporal Ritz markiert hatte, die Reifen- und alle übrigen Spuren, auch die an der Hausmauer, gegen die der Bedauernswerte geschmettert worden war, wurden dokumentiert. Was im Labor chemisch oder unter dem Mikroskop untersucht werden musste, wurde mit Wattestäbchen aufgetupft, mit Pinzetten gefasst oder mit Gummihandschuhen eingesammelt, in Reagenzgläser, Plastiktüten oder kleine Container gesteckt und in einem Koffer versorgt. Die Kleidung des Unfallopfers würden sie im Spital untersuchen, sagten die Kriminalisten. Die Rechtsmedizin werde natürlich auch eingeschaltet.
Als die Kriminaltechniker fertig waren, packten auch die zwei Uniformierten ihre Ausrüstung ein und schlugen die Heckklappe zu. Dann setzten sie sich in den Streifenwagen.
»Mach das Blaulicht aus, Beni«, sagte Ria, als Carlen losfahren wollte. »Und keine Sirene, klar?«, sie kannte die Vorlieben ihres Praktikanten.
»Setzt es dir zu?«, fragte sie ihn, als sie unterwegs waren, und sah ihn von der Seite an.
»Geht so«, gab der zu. »Hab nicht so genau hingeschaut.« Tatsächlich hatte er sich ziemlich auf Distanz gehalten und es seiner Chefin überlassen, sich in die Nähe des Verletzten zu begeben. »Was glaubst du«, fragte er. »Wer hat den auf dem Gewissen?«
»Ein Blaufahrer«, meinte Ria knapp.
»So früh am Morgen?«
»Für manche ist früh am Morgen spät am Abend.«
»Blau war wohl auch der Verletzte. Wenn das wirklich der Trapper Hubert war. Der hat alle paar Wochen einen gewaltigen Rausch.« Ä moorts Chischtä, nannte er den Zustand. Benjamin Carlen, gelernter Landwirtschaftsmaschinenmechaniker, war im Obergoms aufgewachsen und kannte hier jeden und jede. Für die Polizeiausbildung hatte er ins Waadtland ziehen müssen, aber während des Praktikums auf dem Posten Fiesch hatte er bei einer Tante im Ort ein Zimmer bezogen.
Für den Rest der Rückfahrt schwiegen beide.
»So«, meinte Korporal Ritz zum Aspiranten Carlen, als sie an ihren Schreibtischen ihr verspätetes Frühstück einnahmen, »für heute haben wir unsere action gehabt. Von mir aus darf der Rest des Tages etwas ruhiger verlaufen.«
Kauz fühlte sich wie ein geprügelter Hund. Er saß an seinem Küchentisch, die Ellbogen aufgestützt, das Kinn auf den geballten Fäusten. Dann rappelte er sich auf und tigerte durch die Wohnung, abwechselnd empört, gekränkt und gedemütigt. Genau wie damals, als Chantal ihn verlassen hatte. Sie hatte ihm ja auch ganz ähnliche Dinge gesagt wie heute die Kommandantin: Es fehle die gemeinsame Basis. Er sei ein schwieriger Mensch. Das Zusammenleben mit ihm sei eine Zumutung.
Muss wohl was dran sein, dachte er resigniert und legte sich im Schlafzimmer auf das frühere Ehebett. Chantal hatte das Möbelstück im dänischen Stil nicht haben wollen. Fast das ganze übrige Mobiliar aus der gemeinsamen Wohnung, lauter Schischi, hatte sie dagegen behalten, aber ihm war es nur recht gewesen.
Die Wohnung war nun eher karg eingerichtet. Er hatte ein paar schlichte skandinavische Möbel hineingestellt und moderne Fotokunst aufgehängt. Eine Sitzgruppe gab es in seinem Wohnzimmer nicht. Wozu auch?, er hatte kaum je Gäste. Dafür besaß er einen zweiteiligen Lounge Chair, auf dem er sich, die Beine auf dem Fußteil hochgelagert, am Feierabend ausstreckte. Dazu Musik aus der neuen, exquisiten Stereoanlage, am liebsten Blues und Jazz.
Sein Handy summte. Kauz ging ins Wohnzimmer, setzte sich an den Esstisch und schaute auf das Display. Es waren mittlerweile haufenweise Anrufe und SMS eingegangen: Das darf doch nicht wahr sein! – Was fällt der da oben bloß ein?! – Wir stehen zu dir, Kauz. Das lassen wir uns nicht gefallen. – Kopf hoch, Kauz, wir kämpfen für dich.
Anders als bei seiner obersten Chefin war Kauz bei seinem Team beliebt, trotz oder vielleicht gerade wegen seiner kauzigen Art. Seine Polizistinnen und Polizisten wären für ihn durchs Feuer gegangen. Die Nachrichten taten ihm gut. Aber sie änderten nichts an der Tatsache, dass er entlassen war.
Vielleicht bin ich der Feigling, dachte er, nicht Senn. Ich hätte mich selbst wehren, nicht auf seine Rückendeckung warten müssen. Für die eigenen Interessen zu kämpfen war noch nie seine Stärke gewesen.
Eine Stunde lang haderte er mit sich und schwankte, ob er seine Ferienpläne fahren lassen, sich ins Bett legen und die Decke über den Kopf ziehen oder sich betrinken solle. Auf die Einladungen seiner Mitarbeiter zu einem Treffen in der Mittagspause oder einem Feierabendbier ging er nicht ein. Er hatte keine Lust, sich bemitleiden zu lassen oder einen Aufstand zu provozieren. Er würde sich mit ihnen treffen, wenn sich die Gemüter beruhigt hatten. Aber er hatte trotzdem das Bedürfnis, mit jemandem zu reden. Chantal wollte er auf keinen Fall anrufen. Und Xaver? Nein, der hatte seine eigenen Sorgen. Mit wem also reden?
Wendel! Ihm würde er sein Herz ausschütten. Heute Abend, bei einem Bier. Im Gommereggä.
Jetzt stand sein Entschluss fest: Er würde trotz allem in die Ferien fahren. Wie geplant, nur eben ein paar Stunden früher. Wieso auch nicht? Gewiss, er musste sein berufliches, nein, sein ganzes Leben überdenken. Aber das konnte er auch im Goms. Sogar besser als hier im Zürcher Regen.
Der Speicher stand für ihn bereit, darauf war Verlass. Den Mietvertrag hatte er vor einem Jahr per Handschlag abgeschlossen. So lief das mit Wendel. Wendelin Imfang war ein Mann etwa in seinem Alter, mit dem er sich bestens verstand. Ein alleinstehender, etwas schrulliger Landwirt mit ein paar Kühen, zwei Dutzend Ziegen, etwas Weideland und einigen gepachteten Wiesen. Er besserte sein Einkommen auf, indem er den alten Speicher, der als solcher längst nicht mehr in Gebrauch war, an Feriengäste vermietete, die keine hohen Ansprüche stellten. Vor Jahren hatte der Dorfschreiner das Dach isoliert, die Innenwände getäfert, Fenster eingebaut und zwei Betten, zwei Nachttische, ein Regal und einen Schrank in den Oberbau gestellt. Die Rosshaarmatratzen waren mit groben Leintüchern bezogen, darauf lagen hohe, karierte Federbetten. Für Kauz war es das höchste der Gefühle, in dieser altväterischen Kammer zu schlafen. Er hatte, als er den schlicht umgebauten Speicher zum ersten Mal betrat, augenblicklich Kindheitserinnerungen gehabt. Im Sommer nach seiner Scheidung war er auf einer mehrtägigen Motorradreise in Münster gelandet, hatte den Speicher entdeckt, an dem »einf. kl. Ferienwhg. zu vermieten, ideal für 1–2 Pers.« stand, und hatte ihn spontan für zwei Wochen gemietet. Fürs folgende Jahr hatte er dann gleich Sommerferien im Goms geplant.
Danach war es um ihn geschehen: Es zog ihn immer wieder in seine alte Heimat zurück. Genau genommen, in die Heimat seiner Vorfahren. Im Zürcher Stadtquartier Altstetten aufgewachsen, hatte er als Kind die meisten Sommerferien und manchmal die Winterferien bei den Großeltern in Reckingen oder bei Onkel und Tante in Ernen verbracht. Bis dann vor mehr als vierzig Jahren, er war gerade fünfzehn gewesen, alles mit einem Schlag zu Ende war. Danach hatte er nie mehr Sommerferien im Goms machen dürfen. Winterferien erst recht nicht. Überhaupt keine Ferien mehr im Goms. Mutter hatte es ihm strikt verboten. Dort hole man sich den Tod, hatte sie gesagt. Im Goms war eine gewaltige Lawine niedergegangen, viele Menschen, darunter einige seiner Verwandten, waren dabei ums Leben gekommen. Das Unglück hatte das ganze Land erschüttert.
Als Mutters Bann Jahrzehnte später seine Kraft verloren hatte, plante Kauz wieder einen Besuch im Goms. Doch diesmal machte ihm seine Frau einen Strich durch die Rechnung. Chantal weigerte sich, je mit ihm in die Berge, geschweige denn ins Goms zu fahren. Sie mochte Strandferien in Italien oder der Türkei. Vier-, lieber Fünfsternehotels, all inclusive, versteht sich.
Aber nun endlich konnte er tun und lassen, was er wollte. Im Wallis herrschte seit zwei Wochen prächtiges Sommerwetter, in Sitten wurden dreißig Grad gemessen, im Goms durfte man mit angenehmen vierundzwanzig Grad rechnen.
Kauz ließ in seiner Wohnung alles liegen und stehen, schnallte die schon gepackten Satteltaschen und den Rucksack auf den Gepäckträger seiner alten BMW. Es hatte endlich aufgehört zu regnen. Er kickte die Maschine an und ließ Altstetten hinter sich.
Wie jedes Mal, wenn das Wetter es erlaubte, nahm er sich für seine Reise viel Zeit. Er mied die Autobahnen. Die Fahrt ging durchs Sihltal, später über die Axenstrasse, dann immer auf der Kantonsstraße durchs Urnerland, die Schöllenen hinauf nach Andermatt. An der Baustelle des zukünftigen Golfplatzes und Luxusresorts vorbei nach Realp. Fast gemächlich tuckerte er über den Furkapass. Nach der Passhöhe hielt er am Straßenrand an und schaute lange ins Goms hinunter.
Gletsch, im Talkessel zwischen dem Grimsel- und dem Furkapass, übte wie immer einen zwiespältigen Reiz auf ihn aus, halb einladend, halb abweisend. Erst jetzt ging es wirklich ins Goms hinunter. Es war mittlerweile vier Uhr nachmittags geworden. Beim Gasthaus im Rank hielt er an. Hier sollte das Ritual stattfinden, mit dem er sich jedes Jahr auf die Sommerferien einstimmte.
Er stellte sein Motorrad neben das Haus, nahm den Helm ab und spazierte in den Wald hinein. Bedächtig sog er die Luft ein: Da war er, der Geruch, den er erwartet, ja erhofft, auf den er sich gefreut hatte. Der Wald stand an dieser Stelle lichter, der Boden war den ganzen Tag von der Sonne beschienen worden. Jetzt wurde der würzige Duft des Waldbodens durch die Wärme freigesetzt und schlug ihm voll entgegen. Warme Erde, Tannenzapfen, Lärchennadeln, Baumrinde, Harz, Kräuter und vielleicht Ameisensäure – ein Bouquet ohnegleichen. Er bückte sich, nahm eine Handvoll der mit Tannen- und Lärchennadeln vermischten Erde, zerrieb sie mit beiden Händen und roch dann an seinen Handflächen.
Nach einer Weile stand er auf, klopfte sich die Hände ab und ging zum Gasthof im Rank zurück. Glücklich stieg er wieder auf seine Maschine und fuhr nach Oberwald hinunter.
Um halb fünf Uhr nachmittags trudelte er in Münster ein. Jetzt überkam ihn endgültig das Gommer Feriengefühl: Er fühlte sich angekommen, ja fast ein wenig zu Hause. All die Zukunftsängste, die ihn am Mittag noch geplagt hatten, waren wie verflogen. Frau van Hooch mitsamt ihrer Führungsclique und der ganze verflixte Polizeikram konnten ihm gestohlen bleiben.
Ausspannen würde er. Abends oder bei schlechtem Wetter würde er lesen; er hatte ein paar Bücher eingepackt. Fotografieren vielleicht, auf alle Fälle hatte er seine Spiegelreflexkamera mitgenommen. Zwei-, dreimal würde er mit Wendel zu Abend essen. Oder sich wenigstens ein Feierabendbier genehmigen, vor dem Speicher oder in einer Dorfbeiz. Bergwandern, aber schön gemächlich. Den Rotten- und den ganzen Höhenweg hatte er sich vorgenommen. Eine Wanderung nach Ernen vielleicht. Oder ins Binntal. Höhenwege und Pässe lagen drin, Gratwanderungen und Berggipfel nicht. Er war weder besonders trittsicher noch schwindelfrei. Und mit seiner körperlichen Fitness stand es auch nicht zum Besten.
Er ließ seine alte BMW ausrollen, deponierte Satteltaschen und Rucksack auf dem Boden, nahm den Helm ab und fuhr mit den Fingern durch sein vom Helmtragen verklebtes Haar. Ein paar Schritte zurücktretend betrachtete er den Speicher.
Ein Prachtstück!, stellte er wieder einmal fest.
Wendel Imfangs Speicher war einer der kleinsten und einer der schönsten im ganzen Dorf, über dreihundert Jahre alt. Der Unterbau war im unteren Drittel gemauert, darüber war mit Holz gebaut. Eine einfache Küche – Schüttstein, Kaltwasserhahn, Campinggasherd mit zwei Flammen, Holztisch und zwei Stühle – war darin eingerichtet. Der Oberbau, der eigentliche Schpiichär, war ein wunderschön gezimmerter, von einem Schindeldach bedeckter Lärchenholzbau. Dieser ruhte, einen guten halben Meter über dem Unterbau, auf acht Steinplatten, die auf hölzernen Stadelbeinen auf dem Unterbau standen. Zwischen Unter- und Oberbau blieb so ein freier Raum. Auf diese Weise waren die Vorräte, die früher im Speicher gelagert wurden, vor den Mäusen sicher gewesen. Durch den Zwischenraum hindurch sah Kauz, auf der Gasse stehend, direkt aufs Weisshorn, das im kräftigen Nachmittagslicht leuchtete. Früher war man über eine Leiter in den Oberbau gelangt. Jetzt waren Unter- und Oberbau mit einer am Blockbau anliegenden, schmalen hölzernen Außentreppe verbunden.
Wendel Imfangs kleiner Speicher, der Ziegenstall und der Stadel vis-à-vis, die beide auch ihm gehörten, und die übrigen an der Langen Gasse liegenden Holzbauten bildeten eine schöne Einheit. Lauter Nutzbauten aus Lärchenholz, von der Sonne über die Jahrhunderte schwarz gebrannt. Die stattlichen Wohnhäuser, ebenfalls Lärchenholzbauten, standen an der Langen Gasse etwas weiter weg. Als Städter hatte er sich an den Ausdruck »Gasse« für diese lichte, von Holzbauten gesäumte Dorfstraße gewöhnen müssen.
Kauz ging zu Wendels Ziegenstall auf der andern Seite. Der Stall war leer und sauber ausgemistet, die Ziegen waren offenbar schon auf der Alp. Er hatte gehört, dass der Sommer heuer drei Wochen früher gekommen war als in anderen Jahren. Kauz griff an der gewohnten Stelle nach dem Speicherschlüssel. Doch der Schlüssel lag nicht auf dem inneren Fensterbrett.
Merkwürdig, dachte er.
Er umrundete den Speicher und blieb vor dem Küchenfenster stehen. Hände und Stirn ans Fensterglas gepresst, versuchte er etwas zu erkennen: Schüttstein, Tisch und ein Stuhl. Wieso stand nur ein einziger Stuhl vor dem Tisch?! Kauz hatte augenblicklich ein mulmiges Gefühl. Weiter im Kücheninneren nahm er einen undeutlichen Schatten wahr. Seine Alarmglocken läuteten. Er ging zur Tür und drückte kräftig auf die angerostete, handgeschmiedete Türklinke. Sie ließ sich ohne Weiteres herunterdrücken.
Er stieß die Tür auf.
Etwas Unheimliches wehte ihm entgegen. Wie ein kalter Hauch. Trotz der Hitze des Tages. Etwas hielt ihn zurück. Doch er wusste, dass er hineingehen musste. Mit einem Mal war er ganz Polizist. Er trat in die Küche. Er schaute nach rechts: Schüttstein, Tisch und Stuhl. Er schaute nach links – da sah er, was er befürchtet hatte. Dutzende Male hatte er das schon gesehen. Aber der Anblick hatte nichts von seinem Grauen verloren: Ein Mensch hing, mit dem Rücken zu ihm, vom Deckenbalken, die Füße baumelten nur wenige Fingerbreit über dem Fußboden.
Kälberstrick, dachte er sofort.
Auf dem Boden lag umgekippt der zweite Stuhl. Daneben eine blaue Schirmmütze, die ihm bekannt vorkam. Kauz ging um den Toten herum und schaute von der andern Seite in das blaue, aufgedunsene Gesicht. Kein Zweifel: Da hing Wendel Imfang.
Bald Feierabend, dachte Ria Ritz. Kurz bei Papa reinschauen, Emma in die Arme nehmen, das Nachtessen fertig kochen, das Mama vorbereitet hat, dann Fernsehabend mit Tomi.
Es war ein voller Tag gewesen. Wann immer ihr neben der eigentlichen Polizeiarbeit noch Zeit blieb, musste sie sich um den Führungskram kümmern. Ria Ritz hatte die Aufgabe des Postenchefs in Fiesch nicht angestrebt – eigentlich hatte sie sich das Ganze nicht mal zugetraut –, sie war da einfach so hineingerutscht. Der alte Postenchef war vor einem Jahr an einem Herzinfarkt gestorben. Sein Stellvertreter war als Nachfolger nicht infrage gekommen, denn er stand kurz vor der Pensionierung. Und unter den Restlichen war Ria die Dienstälteste. Kürzlich war dann der Jüngste, Polizeiaspirant Benjamin Carlen, zur Gommer Mannschaft gestoßen. Wenigstens für ein paar Monate, im Hinblick auf die bevorstehende Sommerferienzeit, war er eine willkommene Verstärkung. Der Kreischef in Brig hatte darauf bestanden, dass Ria als Gommerin den Posten ad interim übernehme, denn fürs Goms wolle man keinen Auswärtigen. Bei dieser Übergangslösung war es bis heute geblieben. Natürlich hatte Ria sich gebauchpinselt gefühlt und sich tüchtig ins Zeug gelegt. Ihr Mann Thomas hatte ihr versprochen, in seinem Job Teilzeitarbeit zu beantragen oder Homeoffice-Tage einzuschalten, um sich um Emma zu kümmern, wenn ihre Mutter nicht konnte. Doch dann war wenige Wochen später das mit dem Gleitschirm passiert und alles war auf einen Schlag anders gewesen. Ihre Mutter hatte einspringen und fast rund um die Uhr für das Kind da sein müssen. Auf Bäuerinnenart hatte sie gesagt: »Das packen wir, Meggä.« Schließlich gebe es jetzt in Fiesch eine Kindertagesstätte. Sie hatte darauf bestanden, dass Ria ihren Job behielt. Sie war mit dem Vater sogar extra von Niederwald nach Fiesch gezogen, um Ria besser unterstützen zu können. Seit drei Monaten war nun Thomas aus Nottwil zurück, und jetzt war wieder alles anders.
Das Telefon klingelte. Notruf, stellte sie fest. Bloß nicht noch einmal Fahrerflucht, dachte sie. Ihr Pikettdienst war noch nicht vorbei.
Die Zentrale in Sitten leitete den Anruf, da er aus dem Goms kam und der Anrufer deutschsprachig war, direkt auf den Posten Goms in Fiesch weiter.
Värdammt!, dachte sie. Aus dem Feierabend wird wohl nichts.
»Kantonspolizei Goms, Korporal Ritz«, meldete sie sich. Sie wartete einen Augenblick, ob am andern Ende Panik herrschte, ob sie Fragen stellen oder jemanden beruhigen musste. Sie hatte schon alles Mögliche erlebt. Dieses Mal war es anders. Sie brauchte bloß hinzuhören. Und sich Notizen zu machen.
Aspirant Benjamin Carlen saß im Büro nebenan, die Tür weit offen, und spitzte die Ohren. Es roch nach Äggschn.
»Gut, Herr Walpen«, sagte Ria Ritz zum Schluss. »Ich hab alles notiert. Rühren Sie bitte nichts an, ja? Bleiben Sie, wo Sie sind! Warten Sie vor dem Speicher auf uns! Wir kommen sofort.«
»Los, Beni. Äggschn!«, rief Ria ihrem Kollegen zu, »AgT in Münster!«
Es war nicht der erste außergewöhnliche Todesfall während seines Praktikums.
»Suizid durch Erhängen«, fügte Ria noch hinzu.
»Wer hat angerufen? Ein Angehöriger?«, fragte Beni und schnappte sich schon seine Jacke.
»Nein, ein Feriengast.«
»Ein Feriengast?«, wunderte sich Beni. »Mit Namen Walpen? Äwa!«
Noch im Stehen hatte Kauz sein Handy gezückt und den Polizeinotruf angetippt. Jetzt stand er im Speicher neben dem Tisch, fasste den Stuhl mit einem Papiertaschentuch an der Lehne, zog ihn unter dem Küchentisch hervor und setzte sich rittlings darauf.
Er konnte es nicht fassen: Wendel Imfang tot?
Dabei hatte er sich so darauf gefreut, mit ihm heute Abend ein Bier zu kippen und ein bisschen zu plaudern – doorffä, sagte Wendel dazu. Das taten sie jedes Jahr zu Beginn seiner Ferien.
Beklommen sah er auf den am Kälberstrick hängenden Toten: Ein nicht besonders groß gewachsener Mann, mindestens einen Kopf kleiner als er. Dunkelbrauner, krauser Haarkranz, an den Schläfen leicht ergraut. Stallhosen, blaue Jacke, an den Füßen alte Militärschuhe. Die Hände von der Arbeit gezeichnet, die Arme schlaff aus den Ärmeln hängend. Der Kopf unnatürlich abgeknickt – das war für Kauz schon immer das Grässlichste am Anblick eines Erhängten gewesen.
Was hat Wendel bloß zu dieser Verzweiflungstat getrieben?, fragte sich Kauz. Schulden? Eine Frauengeschichte? Eine unheilbare Krankheit? Oder hat er an Depressionen gelitten?
Fragen nach dem Motiv einer Tat gehörten zum Arsenal des Kriminalpolizisten. Betroffenheit, Mitleid, Trauer und Schmerz nicht. Die waren für die Arbeit eher hinderlich. Aber das hier war etwas anderes. Hier hing ein Toter, den er persönlich gekannt hatte. Recht gut gekannt sogar, obschon sie sich nur alle Jahre zwei, drei Wochen lang gesehen hatten. Sie hatten sich gemocht. Mit den Jahren waren sie so etwas wie Freunde geworden, auch wenn beide sich gescheut hatten, den anderen einen Freund zu nennen. Kauz hatte sich Wendel irgendwie seelenverwandt gefühlt. Wendelin Imfang, je nach Stimmung wortkarg und mürrisch, handkehrum aufgeschlossen und redselig, oft witzig, manchmal auch bissig, aber im Herzen ein lieber und treuer Kerl, war auch ein Kauz gewesen.
Kauz sah sich um. Beim Küchenregal stand eine papierene Einkaufstasche. Er konnte es nicht lassen, die Dinge, die darin waren, mit dem Taschentuch hochzuheben und genau anzusehen. Schließlich waren sie für ihn bestimmt, das wusste er. Ein Stück Alpkäse, ein Glas Honig, ein kleine Flasche mit Drahtbügelverschluss und ein Sechserpack Bier. Unter dem Bier kam ein Kassenzettel zum Vorschein. Er ließ ihn auf dem Boden der Einkaufstasche liegen und bückte sich. Seine Augen waren scharf wie eh und je. Das Bier war am neunundzwanzigsten Juni gekauft worden. Am Vortag also, extra für ihn. Der Sechserpack war aufgerissen, drei Dosen fehlten. Merkwürdig, dachte Kauz. Ob er sich Mut antrinken musste? Er sah sich um. Auf den ersten Blick sah er keine leeren Bierdosen. Die Glasflasche mit Drahtbügelverschluss war ohne Etikett, aber Kauz wusste, was drin war: hausgemachter Heidelbeerlikör. All die Dinge, die Wendel jeweils am Ankunftstag für ihn bereitstellte. Es fehlte bloß der kleine Laib Roggenbrot und der Mocken Trockenfleisch, die bisher immer zu diesem Willkommensgruß gehört hatten.
Aufgewühlt setzte er sich wieder hin.
Wie konnte Wendel bloß so rücksichtslos sein? Er musste doch gewusst haben, dass er, Kauz, ihn hier finden würde. War er so verzweifelt gewesen, dass er überhaupt nicht an ihn, seinen Feriengast und Freund, gedacht hatte? Doch, sagte sich Kauz. Er musste an ihn gedacht haben, er hatte ja die Willkommensgaben für ihn bereitgelegt. Das heißt, bereitgelegt hatte er sie nicht wirklich, aber am Vortag eingekauft und in den Speicher gestellt. In anderen Jahren waren die Sachen immer hübsch aufgetischt worden: Das Brot in ein Tuch eingeschlagen, Käse und Trockenfleisch samt Messer auf einem Holzbrett, Honig und Heidelbeerlikör daneben auf dem Küchentisch, der Sechserpack Bier im winzigen Kühlschrank, der unter dem Schüttstein stand.
Da stimmt etwas nicht, dachte Kauz.
Er stützte sich wieder auf die Stuhllehne und starrte vor sich hin. Dann auf die Leiche, die bewegungslos über dem Boden hing. Lange sah er sich im Raum um. Nach einer Weile dämmerte es ihm: Das war kein Selbstmord. Wendel Imfang war ermordet worden. Kauz wusste bloß noch nicht, wieso er das wusste.
Bald musste die Polizei hier sein. Kauz zückte sein Handy und begann zu fotografieren.
Dann verließ er den Speicher und ging zum Ziegenstall hinüber. Bevor er sich auf die Außentreppe setzte, ging er auch um den Stall und den danebenliegenden Stadel herum. Gewohnheitsmäßig nahm er die Umgebung genau in Augenschein. Gewisse Dinge stachen ihm ins Auge, ob er wollte oder nicht. Aber er hielt sich zurück, er hatte hier keinen Auftrag.
Korporal Ria Ritz stellte sich Kauz mit Namen vor. Als Erstes wollte sie wissen, ob er der Anrufer sei.
Ja, sagte Kauz, er habe angerufen. Walpen sei sein Name.
»Walpä«, nickte sie. »Aber nit va hiä?«
Es war mehr Feststellung als Frage.
Nein, bestätigte Kauz, aus Zürich. »Üsserschwiiz«, lachte er. »Aber där Name ischt va hiä.«
»Woll äppä«, bestätigte sie.
Auch wenn er das Wallissertitsch problemlos verstand – schließlich hatte sein Vater sein Lebtag dieses Idiom gesprochen –, es war ihm klar, dass er selber nur radebrechte und dass sie sofort hörte, dass er kein Gommer war. Sondern ein »Ausserschweizer«. Aber es freute ihn, dass sie unbekümmert Wallissertitsch mit ihm sprach, noch dazu im Gommer Dialekt.
Sie bat ihn, vor dem Ziegenstall auf ihn zu warten. Er werde noch einige Fragen beantworten müssen. Kauz dachte gar nicht daran, sich als Polizist zu erkennen zu geben. Er wusste, dass er sich nicht einmischen durfte. Da hielt er sich am besten von Anfang an heraus. Soweit er es von seiner Warte aus beobachten konnte, inspizierte die Polizistin den Speicher ohne Aufregung und ohne Spuren zu verwischen. Als Erstes hatte sie sich vergewissert, dass der Erhängte längst tot war und dass es sich erübrigte, den Strick zu kappen. Sie würde den Toten erst zusammen mit Aspirant Carlen herunternehmen, wenn alle andern da waren und der Fundort der Leiche fotografiert worden war. Sie nahm ihr Funkgerät zur Hand und rief heute schon zum zweiten Mal die Einsatzzentrale an.
Dann gab Korporal Ritz dem Aspiranten Carlen Anweisungen und widmete sich ihrer Auskunftsperson. Sie ging mit Kauz in den leeren Ziegenstall. Als wolle sie ihm den Anblick des Toten nicht zumuten.
Das Erscheinen der Polizei war nicht unbemerkt geblieben. Einen Streifenwagen auf Patrouille oder mit Blaulicht und Sirene auf der Furkastrasse zu einem Unfall fahren zu sehen, war nichts Außergewöhnliches. Dass das Polizeifahrzeug ins Dorf hineinfuhr und Uniformierte ausstiegen, um ein Haus zu inspizieren, war etwas ganz anderes. Schon tauchten erste Neugierige auf, die sich bei dem vor dem Speicher postierten Polizisten erkundigten, was los sei. Er forderte sie freundlich, aber bestimmt auf, weiterzugehen. Was sie natürlich nicht taten. Einen oder zwei Stadel weiter blieben sie stehen, tuschelten und beobachteten neugierig die Szene.
Korporal Ritz wollte von Kauz einiges wissen. Wann er die Leiche gefunden habe, war ihre erste Frage.
Er nannte die Uhrzeit.
Ob die Speichertüre geschlossen gewesen sei – »Isch d Poort züä gsi?« –, ihre nächste. D Poort, wie Kauz dieses Wort liebte!
Zu, bestätigte er, aber nicht abgeschlossen.
»Nicht abgeschlossen?«, fragte sie und runzelte die Stirn. Wo denn der Schlüssel sei? Schlussel, sagte sie, nicht Schlüssel, und Kauz musste unwillkürlich schmunzeln. Hüüs, nicht Huus, sagten die Gommer. Dafür Schlussel statt Schlüssel. Kauz und seine Schwester hatten den Vater jedes Mal geneckt, wenn er Schlussel sagte. Ihn hatte es nicht gekümmert.
»Keine Ahnung«, sagte Kauz.
»Im Türschloss steckt er nämlich nicht«, stellte sie fest.
Ob er den Toten kenne und in welcher Beziehung er zu ihm stehe.
»Ich kenne ihn. Er heißt Wendelin Imfang. Ihm gehört dieser Speicher, ich bin sein Mieter.«
»Dann wohnt er selber also gar nicht hier«, stellte sie fest. Wieder runzelte sie die Stirn, schüttelte verwundert den Kopf.
Sie hat noch kein Pokerface, dachte Kauz.
»Nein, er wohnt weiter weg«, antwortete er, zeigte mit dem Arm die Richtung und beschrieb das Bauernhaus der Imfangs.
»Aha, auf dem Milifäld«, quittierte sie seine Beschreibung. »Sagen Sie, sind Sie ein Angehöriger?«
»Nein, ein Feriengast. Ich bin bloß Mieter dieses Speichers.«
»Ich weiß. Aber Sie heißen Walpen. Sie könnten ein Angehöriger sein, ein Verwandter.«
»Nein, bin ich nicht.«
»Würden Sie mir bitte Ihren Ausweis zeigen?«
»Klar.«
Kauz klaubte seine Identitätskarte hervor. Korporal Ritz schrieb die Details sorgfältig ab.
»Beruf?«
»Kantonaler Beamter«, sagte er. Immerhin stand er noch ein halbes Jahr auf der Lohnliste. »Zur Zeit im Urlaub.«
»Alles klar«, sagte die Polizistin. »Adresse?«
Er gab sie ihr.
»Wissen Sie, ob der Tote Angehörige hat?«
»Er war ledig. Er lebt bei den Eltern. Oder vielmehr mit den Eltern. Sie leben bei ihm, auf dem Hof, der früher ihnen gehört hat. Geschwister hat er, glaube ich, keine.«
»Sind Sie ganz sicher, dass es sich beim Toten um Wendelin Imfang handelt?«, fragte sie, leisen Zweifel in der Stimme. »Tote sehen manchmal anders aus als im Leben. Besonders – entschuldigen Sie – besonders Erhängte und Ertrunkene.«
»Ich weiß«, sagte Kauz.
Sie sah überrascht auf.
»Wie geht es jetzt weiter?«, fragte er schnell, um sie abzulenken.
»Der Bezirksarzt muss kommen. Vielleicht kommt der Staatsanwalt persönlich, wenn er es für nötig hält. Vielleicht die Spurensicherung, je nachdem, was der Bezirksarzt feststellt. Und der Bestatter. Wie bei jedem AgT«, erklärte Korporal Ritz. »Wie bei jedem außergewöhnlichen Todesfall, meine ich. Ein Selbstmord ist ein außergewöhnlicher Todesfall.«
»Ach so«, spielte Kauz den Naiven. »Und dass es Selbstmord ist, ist sicher?«
»Sicher ist man nie«, sagte sie. Das gefiel Kauz natürlich. »Aber nach einem Verbrechen sieht es mir nicht aus. Keine Kampfspuren, soweit ich es beurteilen kann. Keine Anzeichen von Fremdeinwirkung«, und das gefiel ihm jetzt weniger. »Ich will dem Bezirksarzt ja nicht vorgreifen. Aber wenn Sie mich fragen, ist es ein klassischer Selbstmord.«
Darauf sagte Kauz nichts.
»Obwohl …«
»Was?«
»Obwohl im Speicher kein Abschiedsbrief lag.«
Auch der junge Uniformierte, der sich mit ihr zusammen unten im Speicher umgesehen hatte, hatte keinen gesehen. Er hatte die Speichertür mittlerweile zugezogen, mit einem Polizei-Klebeband versiegelt und stand bei ihnen im Ziegenstall.
Ob ein Brief in der Kleidung des Toten stecke, werde man untersuchen, sobald Bezirksarzt und Staatsanwalt da seien.
Kauz betrachtete die recht groß gewachsene Frau. Sie mochte Ende dreißig, vielleicht auch Anfang vierzig sein. Ihr dunkelblondes Haar war zu einem Pferdeschwanz zusammengebunden. Sie machte einen nicht unsportlichen Eindruck, war aber nicht dieser spindeldürre Triathletentyp. Eher kräftig gebaut. Langläuferin?, fragte er sich. Oder Radsportlerin?
»Wie gesagt«, nahm sie den Faden wieder auf, »der Bezirksarzt wird die Legalinspektion vornehmen. Die Leichenschau, wissen Sie. Danach muss der Staatsanwalt entscheiden.«
»Was entscheiden?«, fragte Kauz. Er fand es selbst etwas fies, sich so unwissend zu stellen.
»Ob weiter ermittelt wird oder nicht.«
»Aha. Ja, dann. Brauchen Sie mich noch?«
»Nein. Sie dürfen gehen. Hier bleiben dürfen Sie leider nicht. Wäre wohl auch nicht unbedingt Ihr Wunsch, oder? Der Zutritt zum Speicher ist einstweilen verboten.«
»Verstehe. Ich werde mir vorübergehend ein Hotelzimmer nehmen. Was ist mit den Angehörigen?«
»Die werden wir jetzt aufsuchen. Wir müssen den Eltern sagen, dass ihr Sohn tot ist. Hätten Sie mir Ihre Karte, falls ich noch etwas von Ihnen wissen muss?«
Beinahe hätte er die offizielle Visitenkarte gezückt, die er noch im Portemonnaie hatte. Die hatte ihm Frau van Hooch nicht wegnehmen lassen. Stattdessen nannte er Korporal Ria Ritz seine Handynummer.
»Hier ist meine«, sagte sie und gab ihm ihre Visitenkarte. »Falls noch irgendetwas ist. Wir warten jetzt auf den Staatsanwalt und den Bezirksarzt.«
Kauz fasste das als Aufforderung auf, zu gehen. Er belud seine alte BMW mit den Satteltaschen, packte den Rucksack auf den Gepäckträger, kickte die Maschine an und machte sich auf die Suche nach einem Hotelzimmer.
Am frühen Morgen hatte sie sich noch davor drücken können – Doktor Kalbermatten hatte die Angehörigen des Verunfallten Hubert Trapper benachrichtigt –, jetzt musste Korporal Ritz nach Rücksprache mit der Staatsanwältin selbst diese Aufgabe übernehmen: Während der Bezirksarzt im Speicher die Legalinspektion vornahm, fuhr sie zusammen mit Benjamin Carlen zum Bauernhof im Milifäld, um den Eltern Imfang die Nachricht vom Tod ihres Sohns Wendelin zu überbringen.
Das Überbringen der traurigen Nachricht war das eine. Das andere war, dass sie die noch völlig unter Schock stehenden alten Leute auch noch befragen mussten. Die beiden Polizisten erfuhren, dass der Sohn am frühen Morgen das Haus verlassen hatte, als die Eltern noch schliefen. Sie hatten gewusst, dass ihr Sohn an diesem Tag den Speicher für einen Feriengast bereit machen würde. Wie gewohnt hatte er vorgehabt, ein paar Lebensmittel als Willkommensgabe in die kleine Ferienwohnung zu bringen. Die Sachen habe Frau Imfang, seine Mutter, für ihren Sohn eingekauft und in einer Einkaufstasche bereitgestellt. Die Tasche sei, als sie aufstanden, schon weg gewesen. Danach habe Wendelin die Wiese vor seinem Speicher und später einzelne weiter wegliegende Wiesenparzellen mähen wollen.
»Ist er zu Fuß zum Speicher?«, fragte die Polizistin behutsam. »Oder mit dem Traktor?«
»Zu Fuß«, antwortete Frau Imfang und fuhr sich mit dem Handrücken über die Augen. »Ist ja nicht weit. Den Jeep hat er gestern auf der Alp stehen lassen. Dort oben brauchen sie manchmal ein Fahrzeug. Wenn es etwas zu transportieren gibt.«
Wendel sei am Vorabend wortkarg gewesen wie fast immer, aber nichts habe darauf hingedeutet, dass er verzweifelt gewesen sei.
Ria Ritz begleitete die weinenden Eltern ins Zimmer des Toten, um nachzusehen, ob ein Abschiedsbrief oder sonst ein Hinweis für seine Verzweiflungstat zu finden sei. Nichts dergleichen kam zum Vorschein.
Dann ging man gemeinsam in den Kuhstall und in die Scheune. Der Stall war ebenso sauber ausgemistet, stellte Ria Ritz fest, wie der Ziegenstall, in dem sie den Feriengast Walpen befragt hatte. In der Scheune standen Traktor, Mähmaschine und Heuwender.
Korporal Ritz schickte sich an, mit den beiden Alten wieder ins Haus zu gehen. Carlen dagegen ging hinter die Scheune. Dort stand ein alter, armeegrüner Jeep. Benjamin Carlen war entzückt. Ein Military, stellte er fest, Pick-up-Modell! Mit Kennermiene ging er um den Oldtimer herum. Er spähte durch die Fensterscheiben ins Innere. Der Zündschlüssel steckte. Plötzlich stutzte Carlen.
»Chef«, raunte er, an der Scheunenecke stehend, seiner Vorgesetzen zu, »chumm, lüeg ämal.« Komm, sieh dir das an!
Ritz ließ die beiden Alten weitergehen, sie hatten nichts von Carlens Abstecher mitbekommen, und kam näher. Der rechte Kotflügel des mattgrünen Jeeps war demoliert, die Stoßstange eingedrückt und der rechte Scheinwerfer arg beschädigt. Das Scheinwerferglas fehlte.
»Sie haben doch gesagt, dass der Jeep auf der Alp steht«, flüsterte Carlen.
»Fotografier das!«, raunte Ria Beni zu, »aber ja nicht berühren«, und war mit ein paar Schritten wieder bei den Eltern.
Carlen zückte sein Handy.
»Jetzt haben wir das Motiv für den Selbstmord«, sagte Ria, als sie zum Speicher zurückfuhren. »Bewiesen ist zwar noch nichts, aber ich wäre sehr überrascht, wenn die Lacksplitter und die Glasscherben, die wir heute früh am Unfallort gesehen haben, nicht von Imfangs Jeep stammen. Wenn das stimmt, dann müssen wir annehmen, dass Wendelin Imfang heute nicht zu Fuß ging, sondern mit dem Pick-up zu seinem Speicher gefahren ist. Dass er auf der Rückfahrt den Hubert Trapper über den Haufen fuhr und ohne anzuhalten davonraste. Als er realisierte, dass er einen schweren Unfall verursacht und dass er ausgerechnet den Gemeindeschreiber erwischt hatte, geriet er in Panik. Er stellte sein Fahrzeug zu Hause hinter der Scheune ab, holte sich einen Kälberstrick und erhängte sich. Eine Verzweiflungstat. Im Schock, vielleicht.«
»Aber wieso ist er in den Speicher auf der andern Seite des Dorfs gegangen, um sich zu erhängen? Wieso nicht im Stall oder in der Scheune im Milifäld?«
Ria Ritz antwortete nicht sofort. »Ich weiß es nicht. Vielleicht wollte er es nicht in der Nähe seiner Eltern tun«, meinte sie dann. »Quasi um sie zu schonen. Ich bin ja keine Psychologin, aber ich weiß, dass sich Menschen in einem psychischen Schock manchmal von den seltsamsten Motiven leiten lassen.«
»Vielleicht war es aber so«, mutmaßte Carlen: »Er war sich nicht sicher, wie schwer der Unfall war, den er verursacht hatte. Er ging, nachdem er den Jeep hatte stehen lassen, zu Fuß zum Unfallort zurück. Als er dann die Ambulanz, den Arzt und uns Polizisten sah, das Blaulicht und die Blutlache auf der Straße, geriet er in Panik. Den Strick hatte er vielleicht im Jeep. Oder er hatte einen im Speicher. Jedenfalls ging er in den Speicher, der näher am Unfallort liegt als sein Hof, und erhängte sich.«
»Könnte auch sein«, stimmte ihm seine Chefin halbherzig zu.
»Armer Kerl«, schloss Benjamin Carlen.
»Arme Eltern«, meinte Ria Ritz. »Auf alle Fälle geben wir das alles der Staatsanwältin weiter. Dann soll sie entscheiden, ob weiter ermittelt wird oder nicht.«
Kauz hatte die Wahl: Relais et Auberge du Sauvage oder eines der Hotels am Dorfrand. Witzbolde im Dorf nannten das feudale Haus, den französischen Namen verballhornend und das Vornehme ins Gegenteil kehrend: där Sauwagä. Die Auberge, wie man das weitherum bekannte Hotel sonst kurz nannte, stand mitten in Münster. Kauz hatte erfahren, dass Goethe einst darin logiert hatte, als er durch die Schweiz reiste. So viel Prominenz passe nicht zu ihm, entschied er. In dieser Hinsicht war er ein Proletarier. In den Schickimicki-Hotels, welche Chantal ausgewählt hatte, hatte er sich nie wohl gefühlt. Sobald die Gäste extra fein angezogen waren oder sich sonst wie in Szene setzten, fühlte er sich wie im Kostümfilm. Vier- und Fünf-Sterne-Schick hatte er im Goms allerdings nicht zu befürchten. Und nach Schickimicki sah die Auberge auch nicht aus. Kein Gommer Hotel sah danach aus. Aber zur Sicherheit nahm er ein Zimmer in der Alpenrose, die bloß einen Stern hatte. Hätte er seinen Speicher, so würde er sich jetzt dort einrichten. Aber die Zeit im Hotelzimmer totzuschlagen, darauf hatte er keine Lust. Er deponierte sein Gepäck und schlenderte zu Fuß durchs Dorf, in Gedanken immer wieder bei Wendel. Von der Kirche aus ging er ins Oberdorf hinauf.
Zu verkaufen, stand an einem Stall. Darunter das Logo von Z’Blatten-Immobilien. Bewilligung vorhanden, hieß es weiter. Damit musste die Baubewilligung für den Umbau in ein Ferienhaus gemeint sein. In den letzten paar Jahren florierte im Goms der Verkauf und der Umbau von Ställen und Speichern. Von Wendel hatte er einiges über diesen Boom erfahren. Er war erstaunt gewesen, dass sich Wendel nicht darüber aufregt hatte.
»I bi uberhöpt nit dergägä«, er sei überhaupt nicht dagegen, hatte er versichert.
Wenn man die Ställe, Stadel und Speicher sorgfältig umbaue, so sei ihm das lieber, als wenn sie zerfielen und verrotteten. Die meisten dieser Nutzbauten würden nicht mehr gebraucht, und sie auf eigene Kosten instand zu stellen und zu unterhalten, dafür fehle den meisten ortsansässigen Eigentümern das Geld. Die schlichte Art Umbau, wie er ihn vor zwanzig Jahren habe machen lassen, sei allerdings nicht mehr gefragt. Heute werde luxuriöse Ausstattung mit allem Komfort erwartet. Verpackt in eine schöne alte Hülle. Deshalb seien solche Holzbauten gesuchte Objekte.
»Bis keeni me hät«, bis es keine mehr gebe, hatte Wendel trocken bemerkt.
Schlimmer seien die andern, hatte er sich in einem Anfall von Redseligkeit ereifert. Die, die ganze Ferienkolonien rund um die Dörfer bauten und damit die Landschaft verschandelten.
»Nummä wägäm Gääld«, hatte er gesagt und den Kopf geschüttelt. Nur des Geldes wegen würden diese geldgierigen Siächä Land an schönster Lage zusammenkaufen und mit hässlichen Wohnblöcken überbauen. Alles Zweitwohnungen, deren Fensterläden die meiste Zeit geschlossen seien. Von dieser Welle sei Münster bis anhin verschont geblieben. Andere Dörfer seien weniger gut davongekommen.
»Äs ischt ä Schand!«, hatte Wendels Fazit gelautet.
Kauz stieg zur Antonius-Kapelle hinauf. Die Verwüstungen, die der Minstigerbach ein oder zwei Jahre zuvor mitten im Sommer angerichtet hatte, waren kaum mehr zu sehen. Dass das Dorf nicht viel mehr in Mitleidenschaft gezogen wurde und dass es keine Toten gegeben habe, das habe man dem Heiligen Antonius zu verdanken, hatte Wendel gesagt.
In der Kapelle zündete Kauz für Wendel eine Kerze an. Er war kein Kirchgänger, längst hatte er sich von der Kirche entfremdet. Vielleicht hatte er auch gar nie wirklich dazugehört. Wäre ich im Goms aufgewachsen, dachte er manchmal, so wäre es wohl anders gekommen. Vielleicht wäre ich dann Schweizergardist geworden statt Polizist.
Es war ein Widerspruch, das wusste er, aber die Kerze für Wendel musste sein. Das war er ihm schuldig. Er war allein und blieb eine ganze Weile in der Kapelle stehen. Die Vorstellung, dass Wendel vielleicht immer noch am Kälberstrick in seinem eigenen Speicher hing, würgte ihn im Hals. Der Gedanke an Wendels Eltern, die vielleicht noch gar nichts von der Tragödie wussten, zog ihm das Herz zusammen. Wendelin, dachte er, du arme Seele! Was ist bloß passiert?
Das Unglück ließ ihm keine Ruhe.
Er nahm einen andern Weg zurück ins Dorf. Noch fünfmal kam er an einem Stall oder einem Stadel vorbei, der zum Kauf angeboten wurde. Immer mit dem Logo von Z’Blatten-Immobilien. Zuerst empfand er diesen Ausverkauf der Heimat als deprimierend, aber dann dachte er, es sei ja ganz in Wendels Sinn: Schöne alte Ställe und Stadel wurden zwar verkauft – an Üsserschwiizer!, also fast an Ausländer –, aber immerhin, sie blieben erhalten. Wenn sie sorgfältig umgebaut wurden, trugen sie zur Erhaltung des Ortsbilds bei. Und wurden dazu noch genutzt. Zu Wohnzwecken zwar, nicht für Vieh und Heu, aber dagegen war nichts einzuwenden. Wieso auch? Er gehörte ja auch zu den Nutznießern.
Er stieg ins Unterdorf hinab und ging in den Gommereggä, unweit der Langen Gasse.
Das Grüezi mitenand, das ihm auf der Zunge lag, konnte er gerade noch unterdrücken.
»Güätän Abänd«, sagte er stattdessen laut und vernehmlich.
Einige der Männer, die um den Stammtisch saßen, hoben den Kopf, andere blickten mürrisch in ihr Glas.
Zwei, drei, die schon etwas intus hatten, erwiderten seinen Gruß. Einer schien ihn zu erkennen – Kauz ging jedes Jahr im Gommereggä ein und aus –, hob die Hand und sagte: »Salü!«. Aber er lud ihn nicht ein, sich zu ihnen an den Stammtisch zu setzen.
Kauz kannte die knorrige Art der Gommer Männer. Er war ja selbst aus diesem Holz geschnitzt. Er setzte sich an einen separaten Tisch und gab der Serviertochter einen Wink: »Schtangä!«
Die Serviertochter stellte das Bier vor ihn auf den Tisch: »Gsundheit!«
Er fühlte sich hundeelend beim Gedanken daran, dass er jetzt ohne Wendel hier sitzen musste. Trotzdem nahm er einen großen Schluck. Bhüeti!, dachte er und stieß innerlich mit ihm an. Oder was soll man einem Toten wünschen?
Eine Weile war es still im Lokal. Dann wurde das Gespräch, das wohl seinetwegen unterbrochen worden war, wieder aufgenommen. Es drehte sich um einen Verkehrsunfall, der sich am Morgen zugetragen hatte. Der Fahrer war abgehauen. Man überbot sich mit Vorschlägen, wie man mit dem Flüchtigen verfahren müsste. Offenbar hatte der flüchtige Fahrer einen Einwohner namens Hubert angefahren und schwer verletzt. Hubert liege im Spital Visp im Koma, wusste der eine. Ach was, er sei nach Bern ins Inselspital geflogen worden, meinte ein anderer. Nein, er sei tot, behauptete ein Dritter.
Nach einer Weile betrat ein weiterer Gast die Gaststube. Er blieb neben dem Stammtisch stehen.
»Hedär keert?«
»Was?«
Der neue Gast sah sich mit einem misstrauischen Blick nach Kauz um. Dann raunte er denen am Stammtisch etwas zu.
»Was? Schandarmä? Bim Wändel schim Schpiichär?«
»Gwiss!«
»Wägä was?«
Kauz hörte wieder ein Raunen.
»Was?! Toot? Bischt sichär?«
»Fiiwoll!«
»Dr Gottswillä!«
Die traurige Nachricht machte also schon die Runde. Sie würde sich wie ein Lauffeuer durch das Dorf und das ganze Tal verbreiten. Kauz blieb sitzen. Mit halbem Ohr schnappte er Dinge auf, die am Stammtisch gesprochen wurden. Alle zeigten sich schockiert. Es war klar, dass niemand Wendels Tod erwartete hatte, schon gar nicht einen Selbstmord. Keiner sprach ein böses Wort. Offensichtlich war Wendel ein respektierter und geschätzter Minstiger gewesen. Seine Eltern, wollte man den Worten glauben, taten allen schrecklich leid.
Es hielt Kauz nicht länger. Er legte das Geld für das Bier auf den Tisch, stand auf und wandte sich zum Gehen.
»Was ischt das fär eenä«?, hörte er einen in seinem Rücken tuscheln, ehe sich die Tür hinter ihm schloss.
Er nahm den Weg durch die Lange Gasse.
Der Streifenwagen stand immer noch auf der mit einem Fahrverbot belegten Straße, daneben ein beiger Subaru. Der Bezirksarzt ist da, vielleicht auch der Staatsanwalt, schloss Kauz. Ein Leichenwagen fuhr eben vor. Die Umstehenden wichen zurück und verzogen sich zwischen die Ställe und Stadel auf der andern Straßenseite. Jetzt bereute Kauz, dass er beim Warten auf die Polizei nicht aufgelesen hatte, was er auf der Erde hatte liegen sehen. Langsam näherte er sich Wendels Ziegenstall und hob die nur halb gerauchte Zigarette, die immer noch zwischen Stall und Stadel auf dem Boden lag, mit einem Papiertaschentuch auf. Darin eingewickelt steckte er sie ein.
Die Speichertür ging auf, zwei Männer trugen einen hölzernen Sarg heraus und luden ihn in den Leichenwagen. Die Menschen ringsum hörten auf zu tuscheln. Eine alte Frau schlug das Kreuz und murmelte ein Gebet. Eine andere schluchzte auf und hielt sich die Hand vor den Mund, wieder eine wischte sich Tränen aus dem Gesicht. Ein Greis nahm die Mütze ab und senkte den Kopf.
Auch Korporal Ria Ritz trat heraus. Sie sah Kauz sofort und kam auf ihn zu. Aller Augen richteten sich auf ihn.
»Tut mir leid, Herr Walpen, Sie können Ihre Ferienwohnung noch nicht beziehen«, sagte sie.
»Das ist mir klar.«
Wieso sind Sie dann zurückgekommen?, fragte ihr Blick.
»Ist die Leiche freigegeben?«, fragte Kauz. Er wusste genau, dass ihm eine Antwort nicht zustand, aber er konnte es ja versuchen. Er hoffte, dass sie Nein sagen würde.
»Wie Sie sehen, transportiert der Bestatter sie soeben ab. Mehr darf ich nicht sagen, Herr Walpen. Sie sind ja kein Angehöriger.«
»Ich möchte bloß wissen, wann ich den Speicher beziehen kann«, gab er vor. In Wirklichkeit eilte es ihm damit gar nicht.
Vielleicht um ihn loszuwerden, antwortete sie dennoch: »Der Bezirksarzt hat den Toten untersucht. Und die Staatsanwältin in Visp hat entschieden, dass es keine weiteren Ermittlungen braucht. Das heißt, wenn nichts Unerwartetes zum Vorschein kommt, wird der Speicher morgen oder übermorgen freigegeben. Oder sagen wir: spätestens am Montag.«
Kauz verkniff sich einen Einwand. Habe ich mich wirklich getäuscht, fragte er sich. War es doch Selbstmord?
Er ging auf sein Zimmer in der Alpenrose.
Lust auf ein Nachtessen verspürte er keine.
Wenn nichts Unerwartetes zum Vorschein kommt, hatte die Polizistin gesagt. Nun ja, vermutlich wurde Wendels Leiche nach der Legalinspektion vor Ort noch rechtsmedizinisch untersucht. Dann würde man Verdacht schöpfen oder Gewissheit haben und den AgT Imfang als Tötungsdelikt behandeln. Vielleicht mahlten die Mühlen der Justiz hier einfach etwas langsamer.