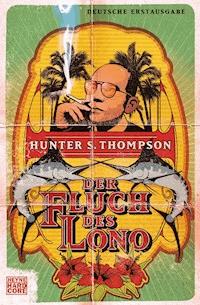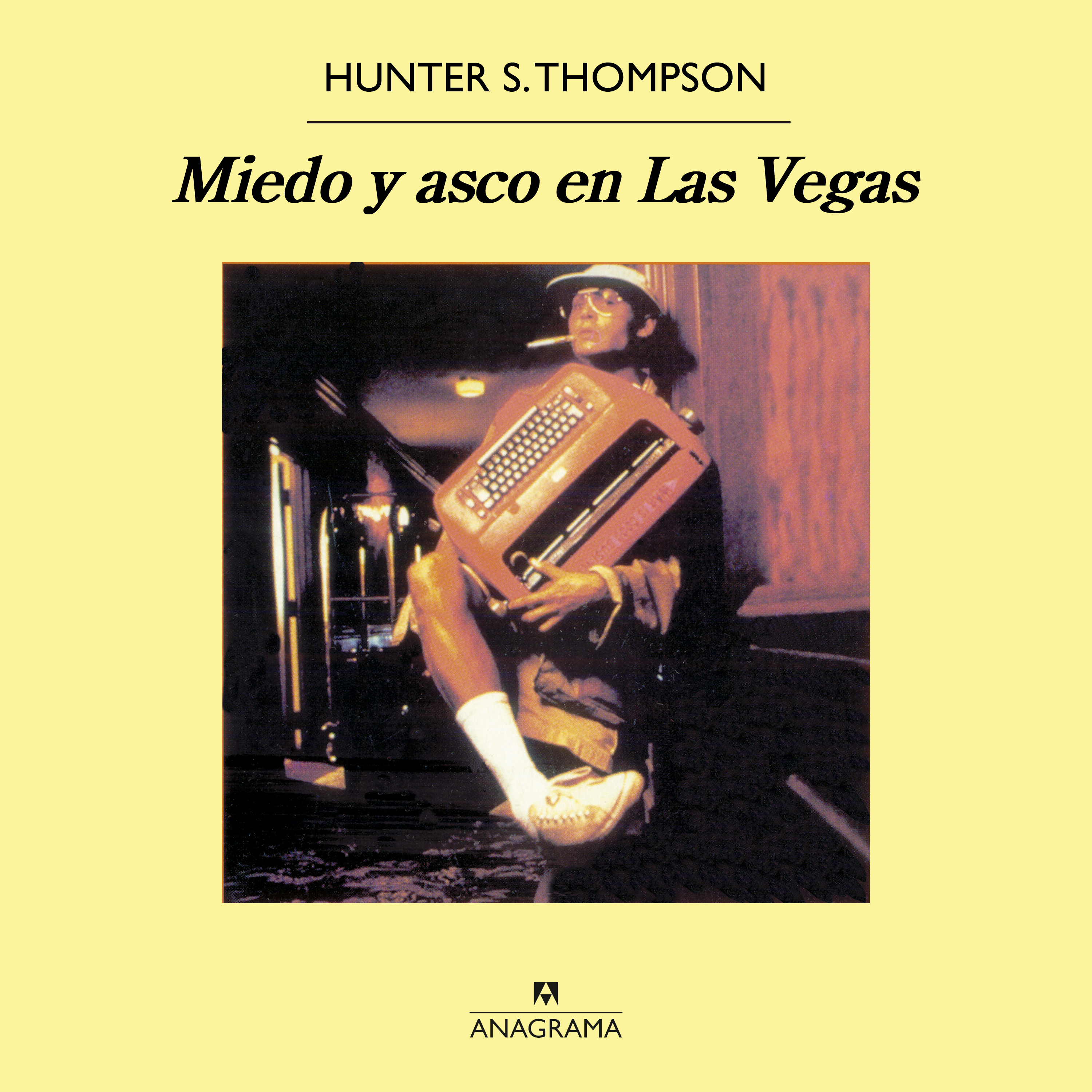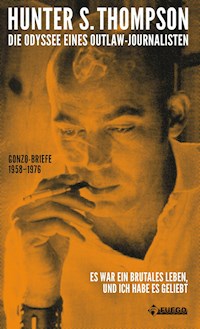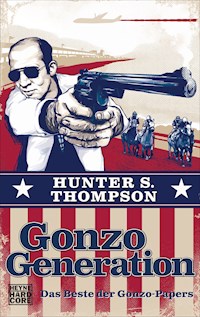
14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Die legendären Gonzo-Reportagen erstmals auf Deutsch
Mit seinen Gonzo Papers wurde Hunter S. Thompson zu einem der bedeutendsten Schriftsteller Amerikas. Dieser einmalige Band versammelt jetzt erstmals die besten Reportagen und Artikel aus vier Jahrzehnten schonungslosem Journalismus. Ein absolutes Muss für alle Thompson-Fans!
Mit dem Tod von Hunter S. Thompson verlor die Welt nicht nur ihren wohl unbestechlichsten, schonungslosesten und scharfzüngigsten Reporter, sondern auch einen Schriftsteller, der zu den ganz Großen der amerikanischen Literatur gezählt werden muss. Wie niemand vor ihm ging er mit den Verfehlungen, der Doppelmoral und der bigotten Heuchelei der westlichen Gesellschaft ins Gericht. Dieser Band vereint die besten Reportagen des genialen Erfinders des Gonzo-Journalismus aus vier Jahrzehnten unermüdlichen Kampfes gegen ein korruptes, verlogenes System. Von vorderster Front aus berichtet Thompson über die Missstände, denen er auf seinen unzähligen Reisen begegnet. Drogen, Politik, Armut – seine Nachrichten vom Rande des Abgrunds sind aufrüttelnd, erschütternd, aber auch hellsichtig, ätzend komisch und der Beweis für Thompsons großes schriftstellerisches Können.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 732
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Das Buch
Mit Hunter S. Thompson verlor die Welt nicht nur ihren wohl unbestechlichsten, schonungslosesten und scharfzüngigsten Reporter, sondern auch einen Schriftsteller, der zu den ganz Großen der amerikanischen Literatur zählt. Wie niemand vor ihm ging er mit den Verfehlungen, der Doppelmoral und der bigotten Heuchelei der westlichen Gesellschaft hart ins Gericht.
Dieser Band vereint die besten Reportagen des genialen Erfinders des »Gonzo-Journalismus« aus vier Jahrzehnten unermüdlichen Kampfs gegen das korrupte, verlogene System. Von vorderster Front berichtet Thompson über die Missstände, denen er auf seinen unzähligen Reisen begegnete. Drogen, Politik, Armut – seine Nachrichten vom Rand der Gesellschaft sind erschütternd, aber auch scharf beobachtet, gnadenlos komisch und der unschlagbare Beweis für Thompsons großes schriftstellerisches Können.
Der Autor
Hunter S. Thompson wurde 1937 in Louisville, Kentucky, geboren. Er begann seine Laufbahn als Sportjournalist, bevor er Reporter für den Rolling Stone und als Begründer des »Gonzo-Journalismus« zu einer Ikone der Hippiebewegung wurde. Eines seiner wichtigsten Werke, Angst und Schrechen in Las Vegas, wurde 1998 von Terry Gilliam mit Johnny Depp und Benicio Del Toro verfilmt. Die Verfilmung von Hell’s Angels ist in Vorbereitung. Hunter S. Thompson nahm sich am 20.02.2005 in seinem Wohnort Woody Creek, Colorado, das Leben.
Inhaltsverzeichnis
Der Anarchist im roten Kabrio
Nimmt man Google als Indikator für die Beliebtheit oder zumindest für die Popularität eines Autors, dann kann niemand mithalten. Weder Tom Wolfe noch Philip Roth, weder John Updike noch John Irving. Auch nicht der aktuelle Literaturnobelpreisträger Orhan Pamuk, und weit abgeschlagen ist auch der Literaturbetriebsintrigant Günter Grass. Das ist umso erstaunlicher, als Hunter S. Thompson die Welt der Literatur nicht mit dickleibigen und schwerst bedeutenden Romanen überschwemmt hat. Sein Werk ist im Vergleich zu dem der Großschriftsteller schmal und überschaubar. Seinen ersten Roman The Rum Diary, ein Jugendwerk, das erst 36 Jahre später veröffentlicht wurde, und Fear and Loathing in Las Vegas hat man bequem jeweils in ein paar Stunden durch. Das war’s.
Die auf den ersten Blick verblüffende Tatsache ist jedoch kein undurchschaubares Rätsel. Im Unterschied zu seinen Kollegen war Thompson nicht einfach nur ein Schriftsteller, der hinter der Schreibmaschine in aller Ruhe und Abgeschiedenheit Zeilen schrubbte, sondern auch Journalist, und zwar einer, der tief in die Realität eintauchte, über die er schreiben sollte. Unter den Journalisten war er der beste Schriftsteller und unter den Schriftstellern der beste Journalist, schrieb mal jemand, der damit allerdings noch untertrieben hat.
Hunter S. Thompson war ein Meister der Selbstinszenierung, der sich selber als literarische Figur erfand, die auf der Suche nach dem amerikanischen Traum am Abgrund entlangraste und volles Risiko ging. Er inszenierte sich als Drogen fressender Paranoiker, als betrunkener Rabauke, als vor sich hin fluchendes Großmaul, als panisch Getriebener, der ein feines Gespür für die in den Sechzigern aufbrechenden Risse im Gefüge der amerikanischen Gesellschaft hatte und der den Irrsinn zum Sprechen brachte, der ihn umgab.
Er erwies sich dabei als glänzender Stilist, der den Lebensnerv einer ganzen Generation traf, und für viele wurde er zu einem der letzten Freiheitshelden, die er immer wieder besungen hat, er wurde zum Outlaw, der vom Gesetz gejagt wird, zum Anarchisten, der auf seiner Maschine dem Sonnenuntergang entgegendonnert, zum Sinnbild all dessen, was das Amerika Nixons für abartig und dement hielt, für etwas, das hinter Schloss und Riegel gehört, weil es die klassischen Werte des good old America verhöhnt. Hunter S. Thompson repräsentierte diese Figur, und der Leser merkt, dass da einer schrieb, dem es um mehr ging, als irgendwelche Figuren auf dem Schachbrett einer konstruierten Handlung hin- und herzuschieben. Hunter S. Thompson wurde zum Rock-’n’-Roll-Star unter Amerikas Autoren, der in einer Stretch-Limousine von einem Auftrittsort zum nächsten chauffiert wurde und sich mit großen Schlucken aus einer Flasche Wild Turkey für seine Auftritte in Stimmung brachte.
Hunter S. Thompson arbeitete hart an seinem Mythos, der bereits in den Siebzigern ein Eigenleben in der populären Kultur Amerikas zu führen begann. Er tauchte als »Uncle Duke« in Doonesbury von Garry Trudeau auf, einem Comic in der Washington Post, dem Hunter S. Thompson es verdankte, dass er auf den Pressekonferenzen während des Präsidentschaftswahlkampfs 1976, über den er berichten sollte, mehr Autogramme geben musste als die Kandidaten. In »Where the Buffalo Roam« spielte der junge Bill Murray 1980 die Rolle des »Dukes«, der seinen Dobermann auf eine lebensgroße Nixon-Puppe hetzt und sein »Mojo Wire«, wie er sein Faxgerät nennt, das ihn an die Deadline für einen abzuliefernden Artikel erinnert, mit einer .45er erledigt.
Hunter S.Thompson steht als Kobold und Unruhestifter immer selbst im Zentrum seiner Geschichten. Er ist Bestandteil der Erinnerung vieler Amerikaner an unruhige Zeiten, als noch alles möglich schien, bevor Nixon den amerikanischen Traum zerstörte und dafür sorgte, dass es »keine Dope rauchenden Anarchisten mit wildem Blick mehr geben wird, die in feuerroten Kabrios durch das Land rasen«.
1970 erschien in Scanlan’s Monthly der Artikel »Das Kentucky-Derby ist dekadent und degeneriert«, der zu den besten zählt, die Hunter S. Thompson je verfasst hat. Damals lernte er den Zeichner Ralph Steadman kennen, der vom Chef der Scanlan’s Monthly, Warren Hinckle, engagiert worden war, um »das größte Spektakel, das dieses Land zustande bringt«, zeichnerisch festzuhalten. In einem Interview, das Hunter S. Thompson 1977 der High Times gab, erzählt er, wie er von der Pressetribüne eine Dose des chemischen Kampfstoffs Mace, der jede Auseinandersetzung schnell beendet, in die Box des Gouverneurs sprühte, »ein Neo-Nazi-Schwein namens Louie Nunn«, und sich anschließend schleunigst aus dem Staub machte.
Im Artikel selbst ist es nur ein Kellner, den er mit der chemischen Keule außer Gefecht setzt, aber er befeuerte damit ein wenig den Wahnsinn, den dieses Pferderennen ausstrahlte, wenn einige tausend volltrunkene Trottel »schreien, heulen, kopulieren, sich gegenseitig niedertrampeln und sich mit zerbrochenen Whiskeyflaschen angreifen.« Eine fantastische Szenerie, in der Hunter S. Thompson mitmischen wollte. Viel interessanter als darüber zu berichten, welches Pferd in welchem Rennen gewonnen hatte, war es, sich selber an der Pressebar volllaufen zu lassen und sich auf der Suche nach dem rattengesichtigen Menschen, der typisch für das Derby war, am Ende selber zu entdecken.
Hunter S. Thompson fuhr anschließend nach New York, wo er im Royalton Hotel die Titelstory schreiben sollte. Aber er litt an einer totalen Schreibblockade. Jede Stunde kam ein Botenjunge vorbei, was den Druck noch erhöhte, bis sich Hunter S. Thompson am dritten Tag schließlich in die Badewanne legte und White Horse aus der Flasche trank. »Schließlich riss ich einfach die Seiten aus meinen Notizbüchern – ich schreib andauernd in Notizbücher – und die Sachen waren sogar leserlich. (…) Als ich dem Botenjungen die erste gegeben hatte, dachte ich, das Telefon würde jede Minute läuten und jemand, der das Ding im New Yorker Büro zu redigieren hatte, würde einen Sturzbach von Beschimpfungen über mich loslassen.« Stattdessen war Warren Hinckle »glücklich wie zwölf junge Hunde«, und er sagte am Telefon, dass »das Zeug phantastisch« sei und »er noch mehr Seiten haben wolle«.
Von Tom Wolfe gibt es eine ganz ähnliche Geschichte. Sie erzählt die Geburtsstunde des New Journalism. Beide Geschichten dürften nur einen rudimentären Wahrheitskern haben, denn das Kentucky-Derby-Stück ist alles andere als eine auf einen Schmierblock hingekritzelte Skizze, und selbst die Stellen, an denen Thompson aus seinen »Notizen« zitiert, machen einen durchaus elaborierten Eindruck. Aber zu jeder Erfindung eines literarischen Genres gehört ein Gründungsmythos. Tom Wolfe ruft in einer nächtlichen wilden Schreibsession mit seiner Geschichte über »Das bonbonfarbene tangerin-rot-gespritzte Stromlinienbaby« den New Journalism ins Leben, Hunter S. Thompson entdeckt ein paar Jahre später seinen eigenen unverwechselbaren Stil: Gonzo.
Bill Cardoso vom Boston Globe Sunday Magazine, ein Kollege und Freund, mit dem er später zusammen über den Jahrhundertkampf Muhammed Ali gegen Joe Frazier berichten sollte, außer Spesen aber nichts zustande brachte, sagte ihm: »Vergiss all den Mist, den du bisher geschrieben hast. Das hier ist es, das ist purer Gonzo. Falls das der Anfang ist, mach weiter so!« 1979 übernahm das Webster’s New Twentieth Century Dictionary den Begriff: »Adjektiv (Herkunft unbekannt): bizarr, hemmungslos, bezeichnet besonders eine Form von subjektivem Journalismus, daher Gonzo-Journalismus.« Cardoso präzisierte Gonzo als einen Begriff, der im irischen Slang in Boston denjenigen bezeichnet, der nach einem Saufgelage als Letzter aufrecht am Tresen steht. Gonzo war für Hunter S. Thompson, der in dieser Kampfsportart häufig genug als Sieger hervorgegangen war, genau der richtige Ausdruck, um gierig »wie ein ausgehungerter Hund« danach zu grapschen und »wegzurennen« (Ralph Steadman). »Gonzo ist das, was ich mache«, lautete nunmehr die knappe Antwort auf die immer wieder gestellte Frage, was damit gemeint sei.
Gonzo wurde zu seinem Markenzeichen, die Gonzo-Faust mit den zwei Daumen und dem Stilett sein Logo. Gonzo bewahrte ihm seine Selbstständigkeit und Eigenheit. Als Tom Wolfe 1973 anfragte, ob er einen Auszug von Hell’s Angels in eine Anthologie aufnehmen könnte, in der Arbeiten des New Journalism vorgestellt wurden, meinte Hunter S. Thompson, »er sei nicht Teil einer Gruppe. Er schreibe Gonzo. Er sei ein Fall für sich. Und das war er tatsächlich.« Um genau zu sein: Gonzo war die bösartige, verantwortungslos lustige und radikale Variante des New Journalism.
Ein Unterschied, in dem es ums Ganze geht und den Tom Wolfe selbst beschrieben hat. Wolfe hatte Hunter S. Thompson 1976 zum Abendessen in einem schicken Restaurant in Aspen eingeladen. Hunter S. Thompson bestellte Unmengen von Banana-Daiquiris, und als die beiden anschließend auf eine Designkonferenz gehen wollten, verwehrten die Türsteher Hunter S. Thompson den Zutritt, weil er ein Glas Wild Turkey in der Hand hielt. Wolfe wollte den Whiskey auf die Veranstaltung hineinschmuggeln, aber Hunter S. Thomspon ging es nicht darum, ein Verbot trickreich zu umgehen, sondern Scherereien zu machen und offen gegen die Konventionen zu verstoßen. Und als er es geschafft hatte, dass sie hinausgeschmissen wurden, war Hunter S. Thompson glücklich. Während Wolfe einfach »alles aufschrieb«, was er »gesehen« hatte, ging es Thompson um mehr. Um wie viel mehr erfährt man aus seinen endlich wieder zugänglich gemachten Gonzo-Schriften.
Klaus Bittermann, Januar 2007
Die große Haifischjagd
Anmerkung des Autors
Die Kunst ist lang, das Leben kurz, und der Erfolg ist weit entfernt.
Joseph Conrad
Na … ja, dann mal wieder los.
Doch bevor wir uns an DAS WERK machen, möchte ich doch erstmal gewiss sein, dass ich mit dieser eleganten Schreibmaschine umgehen kann – (und, ja, scheint so, als könnte ich es) – also warum dann nicht auf die Schnelle mein Lebenswerk auflisten und dann aus dieser Stadt verschwinden, und zwar mit der Maschine um 11 Uhr 5 nach Denver? Ja. Warum eigentlich nicht?
Aber einen Augenblick mal, ich möchte nämlich für die Nachwelt hier festhalten, dass es ein sehr seltsames Gefühl ist, in diesem Jahrhundert ein vierzigjähriger amerikanischer Schreiber zu sein und allein um ein Uhr morgens in der Nacht vor Weihnachten in diesem Riesengebäude an der Fifth Avenue in NewYork zu sitzen, 2000 Meilen von Zuhause entfernt, und ein Inhaltsverzeichnis für ein Buch mit meinen eigenen Gesammelten Werken zu erstellen, in einem Büro mit einer großen Glastür, die auf einen weitläufigen Balkon hinausführt, von dem man hinunter auf den Plaza Fountain blickt.
Sehr seltsam.
Ich habe das Gefühl, ebenso gut könnte ich hier sitzen und die Worte zurechtzimmern, die ich auf meinem Grabstein haben möchte … und wenn ich fertig bin, dann bleibt mir als einzig passender Abgang der direkte Weg hinunter von diesem verdammten Balkon, hinein in den Brunnen, 28 Stockwerke tiefer und mindestens 200 Meter durch die Luft über die Fifth Avenue hinüber.
Das würde mir niemand nachmachen.
Nicht mal ich selbst … und in der Tat kann ich mit dieser unheimlichen Situation überhaupt nur fertig werden, indem ich ganz bewusst die Entscheidung fälle, dass ich schon einmal gelebt habe und dass dieses Leben, welches ich zu leben geplant hatte, abgeschlossen ist – (es ist sogar dreizehn Jahre länger geworden) –, und von jetzt an wird alles ein Neues Leben sein, etwas anderes, ein Auftritt, der heute Abend endet und morgen früh beginnt.
Wenn ich mich also für den Sprung in den Brunnen entscheide, nachdem ich diese Anmerkungen beendet habe, möchte ich, dass eins absolut klar ist – ich würde den Sprung wahrhaft gerne machen, und wenn ich es nicht tue, werde ich es immer für einen Fehler halten und eine verpasste Gelegenheit, einen der wenigen schweren Fehler meines Ersten Lebens, das jetzt endet.
Aber was, zum Teufel, soll’s? Ich werde es wahrscheinlich nicht tun (aus lauter falschen Gründen), und ich werde dieses Inhaltsverzeichnis fertigstellen und Weihnachten zu Hause verbringen und noch mal hundert Jahre mit diesem gottverdammten Kauderwelsch leben, das ich zusammenschwätze.
Aber, Gott noch mal, es wär schon ein wunderbarer Weg abzutreten – und wenn ich’s mache, dann schuldet ihr Hundesöhne mir einen mörderischen 44-Kanonen-Sarut (es muss »Salut« heißen, verdammt noch mal – und es kommt mir so vor, als könnte ich mit dieser eleganten Schreibmaschine doch nicht so gut umgehen, wie ich dachte) …
Aber ihr wisst, dass ich könnte, wenn ich nur ein bisschen mehr Zeit hätte.
Stimmt’s?
Ja.
HST #1, R. I. P. 23/12/77
Das Kentucky-Derby ist dekadent und degeneriert
Gegen Mitternacht stieg ich aus dem Flugzeug, und niemand sagte einen Ton, als ich die dunkle Landebahn überquerte, um zum Abfertigungsgebäude zu kommen. Die Luft war zum Schneiden und heiß, als wanderte man geradewegs in ein Dampfbad. Drinnen umarmten sich Leute und schüttelten Hände … breites Grinsen und hier und da ein Begrüßungsjuchzer: »Mein Gott! Du alter Hundesohn! Gut, dich zu sehen, Junge! Verdammt gut … das kannst du mir glauben!«
In der vollklimatisierten Wartehalle lernte ich einen Mann aus Houston kennen. Er sagte sein Name sei soundso – »aber nenn mich einfach Jimbo« –, und er war hier, um so richtig einen loszumachen. »Ich bin zu allem bereit, bei Gott! Zu allem. Yeah, was trinken wir?« Ich bestellte eine Margarita mit Eis, aber davon wollte er nichts wissen: »Nee, nee, was zum Teufel soll denn das für ein Drink sein? Beim Kentucky-Derby?! Mit dir stimmt was nicht, Junge!« Er griente und zwinkerte dem Barkeeper zu: »Verflucht, dem Jungen hier müssen wir wohl erst Manieren beibringen. Gib ihm ’nen guten Whiskey …«
Ich zuckte mit den Achseln. »Okay, einen doppelten Fitz mit Eis.« Jimbo nickte seine Zustimmung.
»Hör mal zu.« Er tippte mir auf den Arm, um sicherzugehen, dass ich auch hinhörte. »Ich kenn die Derby-Meute. Ich komm jedes Jahr her, und lass dir eins gesagt sein, was ich gelernt hab: In dieser Stadt darfst du bei den Leuten nicht den Eindruck machen, du wärst schwul. Jedenfalls nicht in aller Öffentlichkeit. Scheiße, die barbieren dich in Sekundenschnelle, ziehn dir einen über den Schädel und nehmen dir jeden verdammten Cent ab.«
Ich bedankte mich bei ihm und steckte mir eine Marlboro in die Zigarettenspitze. »Sag mal«, wandte er sich wieder an mich. »Du siehst aus, als seist du im Pferdegeschäft … hab ich recht?«
»Nein«, sagte ich, »ich bin Fotograf.«
»Oh ja?« Er beäugte meine zerschlissene Ledertasche mit frischem Interesse. »Und was hast du da drin, Kameras? Für wen arbeitest du?«
»Playboy«, sagte ich.
Er lachte. »Mann, ich will verdammt sein! Wovon willst du denn Bilder machen … von nackichten Pferden? Hoho! Ich schätze, du wirst reichlich zu schuften haben, wenn sie das Kentucky-Oaks starten. Das is’n Rennen nur für junge Stuten.« Er lachte unmäßig. »Zur Hölle, ja! Und die sind obendrein noch alle nackicht!«
Ich schüttelte den Kopf und sagte nichts, starrte ihn nur einen Augenblick an und versuchte, grimmig auszusehen. »Es wird Ärger geben«, sagte ich. »Ich hab den Auftrag, Fotos von dem Krawall zu machen.«
»Von welchem Krawall?«
Ich zögerte, quirlte das Eis in meinem Drink. »Auf der Rennbahn. Am Derbytag. Die Schwarzen Panther.« Ich starrte ihn wieder an. »Lesen Sie keine Zeitungen?«
Das Grinsen war von seinem Gesicht verschwunden. »Wovon, zum Teufel, redest du da eigentlich?«
»Nun … vielleicht sollte ich Ihnen nichts davon erzäh…« Ich zuckte mit den Achseln. »Aber was soll’s, es scheint doch sowieso schon jeder zu wissen. Die Bullen und die Nationalgarde bereiten sich schon seit sechs Wochen drauf vor. Die haben 20 000 Leute in Fort Knox in Alarmbereitschaft. Man hat uns ausdrücklich geraten – allen Journalisten und Fotografen –, Schutzhelme zu tragen und Splitterschutzwesten. Man hat uns gesagt, dass wir uns auf Schießereien gefasst machen sollten …«
»Nein!«, schrie er, und seine Hände fuchtelten in der Luft, blieben einen Augenblick zwischen uns, als wolle er die Worte abwehren, die er von mir zu hören bekam. Dann schlug er mit der Faust auf die Theke. »Diese verdammten Bastarde! Allmächtiger Gott! Das Kentucky-Derby!« Er schüttelte fortwährend den Kopf. »Nein! Jesus! Das darf doch nicht wahr sein!« Nun schien er auf dem Barhocker in sich zusammenzusinken. Als er aufblickte, waren seine Augen tränenfeucht. »Warum? Warum hier? Haben die denn vor nichts mehr Respekt?«
Wieder zuckte ich mit den Achseln. »Es sind nicht nur die Panther. Das FBI sagt, Busse voller weißer Verrückter kommen aus allen Teilen des Landes – um sich unter die Menge zu mischen und dann alle gemeinsam anzugreifen, aus allen Richtungen. Die werden so angezogen sein wie alle anderen auch. Sie wissen schon – Jacketts und Schlipse und all das. Aber wenn der Ärger losgeht … nun, deswegen machen sich die Cops auch echte Sorgen.«
Er saß einen Moment da, sah angeschlagen aus und verwirrt und nicht ganz im Stande, diese schrecklichen Neuigkeiten zu verdauen. Dann schrie er laut: »Oh … Jesus! Was in Gottes Namen geht in diesem Lande vor? Wie kann man alledem nur entrinnen?«
»Hier und so jedenfalls nicht«, sagte ich und schnappte mir meine Tasche. »Danke für den Drink … und alles Gute, viel Glück.«
Er griff nach meinem Arm, bat mich, noch einen mit ihm zu trinken, aber ich sagte, ich käme schon zu spät zum Presseclub. Dann machte ich mich eilig auf den Weg, denn schließlich hatte ich noch allerhand zu regeln, bevor das schreckliche Spektakel begann. Am Flughafenkiosk griff ich mir ein Courier Journal und überflog die Schlagzeilen auf der Titelseite : »Nixon schickt GIs nach Kambodscha, um die Roten zu schlagen« … »B-52-Luftangriff, danach 20-Meilen-Vormarsch von 2000 GIs« … »4000 U. S.-Soldaten bei Yale aufmarschiert, da die Spannung wegen Panther-Protest wächst«. Unten auf der Seite war ein Foto von Diane Crump, die bald die erste Frau sein würde, die jemals im Kentucky-Derby mitgeritten war. Der Fotograf hatte einen Schnappschuss von ihr gemacht, als sie gerade »bei der Scheune stehen blieb, um ihr Reittier ›Fathom‹ zu streicheln«. Der Rest der Zeitung war angefüllt mit hässlichen Kriegsnachrichten und Geschichten über »studentische Unruhen«. Dass sich eventuell an einer Universität in Ohio namens Kent State etwas zusammenbraute, wurde nicht erwähnt.
Ich ging zum Hertz-Schalter, um meinen Leihwagen abzuholen, aber der mondgesichtige junge Flottberger dort sagte, sie hätten keinen Wagen. »Sie werden nirgends ein Auto mieten können«, versicherte er mir. »Vor sechs Wochen haben wir die letzten Derby-Reservierungen akzeptiert.« Ich erklärte ihm, mein Agent habe bestätigt, dass rechtzeitig ein weißes Chrysler-Kabrio für mich reserviert worden sei, aber er schüttelte nur den Kopf. »Eventuell, wenn bei uns jemand abbestellt. Wo übernachten Sie?«
Ich zuckte mit den Achseln. »Wo übernachtet die Texas-Bande? Ich will bei meinen Leuten sein.«
Er seufzte. »Mein Freund, Sie haben schlechte Karten. Diese Stadt ist total voll. Beim Derby immer.«
Ich lehnte mich zu ihm hinüber und flüsterte: »Hören Sie, ich bin vom Playboy. Wie wär’s mit ’nem Job?«
Er wich eilig zurück. »Was? Also hörn Sie mal. Was für’n Job denn?«
»Schon gut«, sagte ich. »Sie haben’s sich selbst verdorben.« Schwungvoll griff ich mir meine Tasche vom Schalter und ging los, ein Taxi suchen. Die Tasche ist bei derartiger Arbeit ein wertvolles Requisit, und ich habe eine Menge Sticker und Gepäckscheine an meiner – SF, LA, NY, Lima, Rom, Bangkok und dergleichen. Der auffälligste Anhänger von allen ist jedoch ein sehr offiziell wirkendes, mit Plastik überzogenes Ding, auf dem »Photog. Playboy Mag.« zu lesen steht. Ich habe ihn einem Zuhälter in Vail, Colorado, abgekauft, und der instruierte mich auch, wie ich ihn benutzen sollte. »Erwähne niemals Playboy, bis du sicher bist, dass die Leute den Anhänger schon gesehen haben«, sagte er. »Genau dann, wenn du siehst, dass sie ihn bemerken, ist es Zeit zuzuschlagen. Die machen Kniefälle vor dir, jedes Mal. Dies Ding hat Zauberkraft, sag ich dir. Unheimliche Zauberkraft.«
Nun … vielleicht. Ich hatte den armseligen Typen an der Bar damit reingelegt, und jetzt, da ich in einem Yellow Cab auf dem Weg in die Stadt war, kamen mir leichte Schuldgefühle, dass ich dem armen Heini das Hirn mit jenen bösartigen Visionen vollgequasselt hatte. Aber was zum Teufel!? Jeder, der durch die Welt rennt und lauthals verkündet:
»Zum Teufel, ja, ich komm’ aus Texas«, hat’s nicht anders verdient. Und er war schließlich hier wieder aufgetaucht, um inmitten eines abgeschmackten atavistischen Freak Out, das mit nichts anderem als einer überaus »kommerziellen« Tradition renommieren kann, einen Arsch aus dem neunzehnten Jahrhundert aus sich zu machen. Zu Beginn unseres Gesprächs hatte mir Jimbo eröffnet, er habe seit 1954 nicht ein einziges Derby versäumt. »Meine kleine Lady kommt nicht mehr mit«, sagte er. »Sie knirscht nur noch mit den Zähnen und lässt mich allein abziehen. Und wenn ich abziehen sage, dann meine ich abziehen! Ich schmeiße mit den Zehnern um mich, als seien sie längst ungültig! Pferde, Whiskey, Frauen … Scheiße, in dieser Stadt gibt es Frauen, die für Geld einfach alles machen!«
Warum nicht? Geld zu haben, ist in diesen verdrehten Zeiten nicht das Schlechteste. Sogar Richard Nixon ist geil darauf. Gerade erst ein paar Tage vor dem Derby sagte er: »Wenn ich Geld hätte, würde ich’s an der Börse investieren.« Aber die Börse blieb weiter auf böser Talfahrt.
Der nächste Tag wurde heftig. Nur noch dreißig Stunden bis zum Start, und ich hatte keine Presseakkreditierung und – nach Aussagen des Sportredakteurs vom Louisville Courier Journal – auch nicht die geringste Aussicht, eine zu bekommen. Schlimmer noch, ich brauchte sogar zwei Presseausweise; einen für mich selbst und den anderen für Ralph Steadman, den englischen Illustrator, der aus London angereist kam, um ein paar Zeichnungen von dem Derby zu machen. Von ihm wusste ich nur, dass dies sein erster Besuch in den Vereinigten Staaten war. Und je länger ich darüber nachdachte, desto mehr Angst bekam ich. Wie würde er mit dem grauenerregenden Kulturschock fertig werden, einfach aus London abzuheben und plötzlich inmitten der trunkenen Meute beim Kentucky-Derby zu landen? Keinen Schimmer. Hoffentlich kam er wenigstens einen oder gar zwei Tage früher, um sich ein bisschen zu akklimatisieren. Vielleicht ein Ausflug ins Bluegrass-Land um Lexington. Mein Plan war, ihn am Flughafen in dem riesigen Pontiac Ballbuster abzuholen, den ich von einem Gebrauchtwagenhändler namens Colonel Quick geliehen hatte, und ihn dann gleich in irgendeine friedvolle Landschaft zu entführen, die ihn an England erinnerte.
Colonel Quick hatte das Autoproblem gelöst, und Geld (viermal mehr als normal) hatte zwei Zimmer in einer schmutzigen Absteige am Stadtrand beschafft. Der letzte Haken war nur, wie es gelingen sollte, die Mogule von Churchill Downs davon zu überzeugen, dass Scanlan’s eine Sportzeitschrift von derartigem Prestige sei, dass schon der gesunde Menschenverstand sie dazu zwingen musste, uns zwei der allerbesten Pressetickets zu geben. Leichter gedacht als getan. Mein erster Anruf im Publicitybüro erwies sich als totaler Fehlschlag. Der Pressemensch war geradezu schockiert, dass jemand so dumm sein konnte, zwei Tage vor Beginn des Derbys noch um Presseakkreditierung nachzusuchen. »Mann, das ist doch wohl nicht Ihr Ernst«, sagte er. »Der letzte Termin war vor zwei Monaten. Die Pressetribüne ist voll besetzt; da ist kein Platz … und was für eine Zeitung ist Scanlan’s Monthly überhaupt?«
Ich stieß einen Laut schmerzhaften Ingrimms aus. »Hat das Londoner Büro Sie denn nicht angerufen? Die fliegen extra einen Künstler ein, der die Gemälde machen soll. Steadman. Ist ’n Ire. Glaube ich. Sehr berühmt drüben. Ja. Ich bin gerade von der Küste eingeflogen. Das Büro in San Francisco hat mir bestätigt, dass alles vorbereitet sei.«
Er schien interessiert, ja sogar voller Mitgefühl, aber er konnte einfach nichts machen. Ich schmierte ihm mit allerhand Geseire noch mehr Honig um den Bart, und schließlich bot er mir einen Kompromiss an: Er könne uns zwei Pässe für die Umgebung des Clubhauses verschaffen, aber das Clubhaus selbst und besonders die Pressebühne, das käme nicht infrage.
»Kommt mir reichlich seltsam vor«, sagte ich. »Ist absolut inakzeptabel. Wir müssen uneingeschränkten Zugang haben. Uneingeschränkt. Sie glauben doch nicht, wir sind von so weit hergekommen, um uns die ganze Chose im Fernsehen anzusehen, oder? Es muss einen Weg geben, dass wir reinkommen. Vielleicht müssen wir einen von den Wachposten bestechen – oder jemanden mit Mace außer Gefecht setzen.« (Ich hatte mir eine Sprühdose mit dem Reizgas besorgt. In einem Drugstore in der Stadt hatte ich 5,98 Dollar dafür bezahlt, und plötzlich, mitten in diesem Telefongespräch, kam mir der hinterhältige Gedanke, die »Chemische Keule« tatsächlich auf der Rennbahn zu benutzen. Die Platzanweiser mit Mace außer Gefecht setzen, direkt vor den schmalen Toren des inneren Heiligtums, direkt am Zugang zum Clubhaus, und dann schnell reinschlüpfen, eine gewaltige Ladung Mace in die Loge des Gouverneurs feuern, kurz bevor das Rennen beginnt. Oder hilflose Besoffene auf der Toilette des Clubhauses mit Mace anzugreifen, zu ihrem eigenen Wohl …)
Freitagmittag hatte ich immer noch keine Pressepapiere, und außerdem war es mir noch immer nicht gelungen, Steadman ausfindig zu machen. Ich konnte mir nur vorstellen, dass er kurzentschlossen nach London zurückgeflogen war. Nachdem ich Steadman schließlich aufgegeben hatte und es mir nicht gelungen war, meinen Mann im Pressebüro zu erreichen, entschied ich mich, dass meine einzige Hoffnung auf Akkreditierung darin bestand, auf die Rennbahn zu fahren und den Mann persönlich heimzusuchen, ohne Vorwarnung – jetzt nur einen Pressepass zu verlangen, anstatt zwei, und sehr schnell zu sprechen mit einem seltsamen hohen Tonfall, wie ein Mann, der mit aller Kraft versucht, irgendeinen inneren Wahn unter Kontrolle zu halten. Auf dem Weg machte ich Station am Empfangsschalter des Motels, um einen Scheck einzulösen. Und dann kam mir der sinnlose Gedanke, einfach mal nachzufragen, ob rein zufällig ein gewisser Mr Steadman eingecheckt habe.
Die Lady am Empfang war ungefähr fünfzig und sah höchst merkwürdig aus. Als ich Steadmans Namen erwähnte, nickte sie, ohne ihren Blick von dem zu lassen, was sie gerade schrieb, und sie sagte mit tiefer Stimme: »Und ob er hat.« Dann bedachte sie mich freundlicherweise mit einem breiten Lächeln. »Ja, tatsächlich. Mr Steadman ist gerade zur Rennbahn gefahren. Ist er ein Freund von Ihnen?«
Ich schüttelte den Kopf. »Ich soll mit ihm zusammenarbeiten, aber ich weiß noch nicht mal, wie er aussieht. Und jetzt, verdammt noch mal, muss ich ihn in der Meute auf der Rennbahn finden.«
Sie kicherte. »Da werden Sie keine Schwierigkeiten haben. Den Mann können Sie in keiner Menschenmenge verfehlen.«
»Warum?«, fragte ich. »Was ist denn mit ihm? Wie sieht er aus?«
»Also …«, sagte sie und grinste noch immer, »so einen komisch aussehenden Menschen habe ich seit langem nicht gesehen. Er ist … äh … zugewachsen, sein ganzes Gesicht ist zugewachsen. Ja, man kann eigentlich sagen, sein ganzer Kopf ist bewachsen.« Sie nickte. »Sie werden ihn schon erkennen, wenn Sie ihn sehen; da brauchen Sie sich keine Sorgen zu machen.«
Mannometer, dachte ich. Damit ist die Presseakkreditierung am Arsch. Und ich hatte eine Vision, in der ein hergelaufener Nervgeier mit ’ner Wahnsinnsmatte und jeder Menge Warzen im Pressebüro auftauchte und die Presseinformationen für Scanlan’s verlangte. Aber … was zum Teufel! Wir konnten schließlich jede Menge Acid einwerfen und den Tag damit verbringen, ums Clubhaus rumzurennen, riesige Skizzenblöcke unterm Arm, und die Eingeborenen hysterisch auszulachen und Mint Juleps zu trinken, damit die Bullen uns nicht für anormal hielten. Vielleicht könnten wir sogar Kohle mit dieser Vorstellung machen: eine Staffelei mit großem Schild aufbauen, auf dem stehen könnte: »Lassen Sie Ihr Porträt von einem ausländischen Künstler malen – für nur 10 Dollar! Greifen Sie zu!«
Ich nahm die Schnellstraße hinaus zur Rennbahn, raste wie irre und wechselte mit dem Monsterschlitten immer wieder abrupt die Fahrspur. Ich lenkte mit einer Hand, weil ich ein Bier in der anderen hatte, und ich war so geistesabwesend, dass ich beinahe einen Volkswagen voller Nonnen plattgewalzt hätte, als ich nach rechts in die Ausfahrt schleuderte. Es bestand eine geringe Chance, sagte ich mir, den hässlichen Großbritannier aufzugabeln, bevor er eingecheckt hatte.
Aber Steadman war schon in der Pressekabine, als ich dort ankam, ein bärtiger junger Engländer mit Tweedjackett und Royal-Air-Force-Sonnenbrille. Er hatte nichts besonders Eigenartiges an sich. Keine blauen Venen im Gesicht und auch keine Warzenfelder mit Haarborsten. Ich erzählte ihm, wie die Frau im Motel ihn mir beschrieben hatte, und er schien verwirrt. »Aber machen Sie sich nichts draus«, sagte ich. »Vergessen Sie nur in den nächsten paar Tagen nicht, dass wir uns in Louisville, Kentucky, befinden. Wir sind nicht in London. Nicht mal in New York. Das hier ist eine irre Gegend. Sie können von Glück sagen, dass die Geistesgestörte im Motel keine Pistole unter der Kasse rausgeholt hat, um ein großes Loch in Sie zu pusten.« Ich lachte, aber er sah etwas konsterniert aus.
»Stellen Sie sich einfach vor, dass Sie sich hier in einer riesigen Freiluft-Klapsmühle befinden«, sagte ich. »Wenn die Insassen außer Kontrolle geraten, dann schwingen wir halt die chemische Keule.« Ich zeigte ihm die Dose »Chemical Billy« und konnte gerade noch mein dringendes Bedürfnis unterdrücken, sie quer durchs Zimmer auf den rattengesichtigen Mann abzufeuern, der in der »Associated Press«-Sektion emsig am Tippen war. Wir standen an der Bar, schluckten den Scotch, den das Management kredenzte, und gratulierten einander, dass wir das plötzliche und unerklärliche Glück gehabt hatten, jeweils eine Handvoll hervorragender Presseausweise erwischt zu haben. Die Dame am Schalter habe sich ihm gegenüber sehr freundlich gezeigt, sagte er. »Ich habe ihr nur meinen Namen gesagt, und sie gab mir den gesamten Kram.«
Im Laufe des Nachmittags gelang es uns dann, alles unter Kontrolle zu bringen. Von unseren Plätzen aus konnten wir die Ziellinie einsehen, wir hatten Farbfernsehen, im Presseraum stand eine Bar mit freien Getränken zu unserer Verfügung, und wir besaßen eine Auswahl von Pressepässen, die uns überall Zugang verschafften, vom Dach des Clubhauses bis zu dem Raum, in dem sich die Jockeys aufhielten. Fehlen tat uns nur der unbegrenzte Zugang zum inneren Heiligtum des Clubhauses, zu den Sektionen »F&G« … und ich war der Meinung, dass wir gerade den brauchten, um den Whiskey-Adel in Aktion zu sehen. Der Gouverneur, ein Neonazischwein namens Louie Nunn, war bestimmt in »G«, zusammen mit Barry Goldwater und Colonel Sanders. Ich war der Ansicht, dass es uns absolut zukam, eine Loge in »G« zu beziehen, wo wir uns ausruhen konnten und an Juleps nippen, wo wir ein bisschen von der Atmosphäre schnüffeln konnten und die ganz spezielle Stimmung des Derbys kosten.
Bars und Esssäle befanden sich ebenfalls in »F&G«, und die Clubhausbars sind schon eine ganz spezielle Szene. Zusammen mit den Politikern und den Society Belles und den lokalen Wirtschaftskapitänen taucht dort jeder halbirre Fuzzi auf, der jemals in einem Radius von fünfhundert Meilen um Louisville irgendwelche Ambitionen hatte, um sich einen flotten Rausch anzusaufen, auf eine gehörige Menge Schultern zu klopfen und sich ganz allgemein in Augenschein zu bringen. Die »Paddock Bar« ist wahrscheinlich der beste Platz auf der Rennbahn, um sich hinzusetzen und sich Gesichter zu betrachten. Niemandem macht es etwas aus, angestarrt zu werden: Das ist ja genau der Grund, warum sie alle da sind. Manche Leute verbringen den Hauptteil ihrer Zeit im »Paddock« – da können sie sich an einen der hölzernen Tische hocken, sich auf einem bequemen Stuhl gemütlich zurücklehnen und die sich ständig verändernden Quoten auf der großen Totalisator-Anzeigetafel draußen vor dem Fenster aufblitzen sehen. Schwarze Kellner in weißer Livree bewegen sich in der Menge mit Tabletts voller Drinks, während die Experten über ihren Rennlisten brüten und die Amateurwetter sich Glückszahlen aussuchen oder die Startlisten nach Glück versprechenden Namen durchforsten. Es herrscht ein ständiges Kommen und Gehen zwischen dem »Paddock« und den Schaltern für die Dreierwetten, die sich draußen auf den holzgetäfelten Fluren befinden. Wenn der Augenblick eines Starts gekommen ist, zerstreut sich die Menge, denn die Leute begeben sich in ihre Logen.
Klar, wir müssen uns irgendwas ausdenken, damit wir morgen mehr Zeit im Clubhaus verbringen können. Aber die Pressepässe, die »freien Zugang« zu »F&G« gewähren, sind nur jeweils für dreißig Minuten gültig – wahrscheinlich um es den Zeitungstypen zu ermöglichen, mal kurz reinzuschauen, um Fotos zu machen oder ein knappes Interview. Ganz sicher sollen sie Streuner wie mich und Steadman davon abhalten, den ganzen Tag im Clubhaus herumzuhängen, die hohen Herrschaften zu nerven und die eine oder andere Handtasche zu durchstöbern, während man von Loge zu Loge driftet. Oder gar den Gouverneur mit der chemischen Keule zu malträtieren. Freitag war diese zeitliche Beschränkung kein sonderliches Problem, aber am Derbytag würde bestimmt schwer Nachfrage nach diesen Pässen bestehen. Und da es ungefähr zehn Minuten dauerte, von den Presselogen zum »Paddock« zu gelangen, und noch mal zehn Minuten wieder zurück, würde kaum genügend Zeit bleiben, sich ernsthaft dem Vergnügen zu widmen, die Leute zu begutachten. Schließlich waren wir nicht wie die meisten anderen in der Pressekabine – uns interessierte es nicht die Bohne, was auf der Rennbahn geschah. Wir waren gekommen, um uns die wahren Viecher in Aktion anzusehen.
Freitag spätnachmittags standen wir auf dem Balkon der Pressekabine, und ich versuchte den Unterschied zu beschreiben zwischen dem, was wir heute sahen, und dem, was uns morgen erwartete. Dies war das erste Mal seit zehn Jahren, dass ich das Derby besuchte, aber früher, als ich noch in Louisville lebte, war ich jedes Jahr hingegangen. Als wir aus der Pressekabine hinunterblickten, wies ich auf die gigantische Grasfläche, die von der Rennbahn umschlossen war. »Das alles da«, sagte ich, »wird von einer riesigen Menschenmenge angefüllt sein; fünfzigtausend oder so, und die meisten von ihnen sturzbetrunken. Eine fantastische Szenerie – Tausende von Leuten, die in Ohnmacht fallen, schreien und heulen, kopulieren, sich gegenseitig niedertrampeln und mit zerbrochenen Whiskeyflaschen angreifen. Wir müssen auf jeden Fall da mal mitmischen, aber es ist schwer, da durchzukommen, einfach zu viele menschliche Körper.«
»Ist es da draußen sicher? Kommen wir jemals heil zurück?«
»Klar«, sagte ich. »Wir müssen nur aufpassen, dass wir niemandem auf die Wampe treten und dadurch eine Schlägerei anzetteln.« Ich zuckte mit den Achseln. »Aber zum Teufel, die Clubhausszene hier direkt unter uns ist fast so schlimm wie die da draußen auf dem Rasen. Tausende krakeelender, stolpernder Trunkenbolde, die immer wütender werden, je mehr Geld sie verlieren. Nachmittags sind sie so weit, dass sie die Mint Juleps mit beiden Händen halten müssen, um sie sich reinzuschütten, und sie bekotzen sich gegenseitig, wenn kein Rennen läuft. Der ganze Laden hier wird randvoll sein von diesen Kadavern, Schulter an Schulter werden sie stehen. Man kann sich kaum rühren. In den Gängen rutscht man auf der Kotze aus, die Leute straucheln und fallen, halten sich an deinen Hosenbeinen fest, damit sie nicht totgetrampelt werden. Betrunkene bepissen sich, während sie vor den Wettschaltern anstehen. Lassen das Geld aus der Hand fallen und prügeln sich, wenn sie sich bücken, um den Kram wieder aufzuheben.«
Er sah inzwischen so nervös aus, dass ich zu lachen anfing. »Ist doch nicht mein Ernst«, sagte ich. »Machen Sie sich keine Sorgen. Beim ersten Anzeichen, dass es Ärger gibt, treib ich die Meute mit meinem ›Chemical Billy‹ auseinander.«
Er hatte schon ein paar gute Skizzen gemacht, aber bisher war uns noch nicht jenes ganz spezielle Gesicht begegnet, das wir meiner Ansicht nach als Aufmacher brauchten. Ein Gesicht, das ich tausendfach bei allen Derbys gesehen hatte, die ich je besuchte. Ich sah es vor meinem geistigen Auge als die Maske des Whiskey-Adels – eine anmaßende Mischung aus Schnaps, unerfüllten Träumen und unheilbarer Identitätskrise: das unausweichliche Ergebnis von übermäßiger Inzucht innerhalb eines ebenso begrenzten wie ignoranten Kulturkreises. Eines der genetischen Schlüsselgesetze bei der Zucht von Hunden, Pferden oder irgendeiner anderen Art Hochleistungslebewesen ist, dass krasse Inzucht sowohl die schwachen wie die starken Eigenschaften in einer Vererbungskette noch zusätzlich verstärkt. In der Pferdezucht zum Beispiel ist es absolut riskant, zwei schnelle Tiere miteinander zu kreuzen, die beide ein wenig verrückt sind. Die Nachkommenschaft wird wahrscheinlich sehr schnell, aber auch sehr verrückt sein. Bei der Vollblutzüchtung besteht der Trick darin, dass man die guten Eigenschaften erhält und die schlechten ausfiltert. Aber die menschlichen Zuchtvorgänge werden leider nicht entsprechend sorgfältig überwacht, besonders nicht in einer bornierten Südstaatengesellschaft, in der möglichst starke Inzucht nicht nur als akzeptabel und als guter Stil gilt, sondern auch – für die Eltern – weitaus bequemer ist, als den Nachkommen die Freiheit zu lassen, sich selbst die Geschlechtspartner auszuwählen, nach eigenen Vorstellungen und auf die eigene Weise. (»Gottverdammich, hast du das von Smittys Tochter gehört? Die ist letzte Woche in Boston total ausgerastet und hat ’nen Nigger geheiratet!«)
Und daher war das Gesicht, das ich an jenem Wochenende in Churchill Downs finden wollte, für mich das Symbol der ganzen dem Untergang verfallenen, atavistischen Kultur, die das Kentucky-Derby zu dem macht, was es ist.
Nach den Freitagsrennen warnte ich Steadman auf dem Rückweg zum Motel vor einigen weiteren Problemen, mit denen wir rechnen mussten. Keiner von uns hatte irgendwelche seltsamen und illegalen Drogen mitgebracht, und daher mussten wir mit Schnaps auskommen. »Sie sollten sich vor Augen halten«, sagte ich, »dass fast jeder, mit dem Sie sich von jetzt an unterhalten, betrunken sein wird. Leute, die anfangs sehr angenehm und freundlich wirken, könnten urplötzlich ohne den geringsten Anlass zuschlagen.« Er nickte, starrte jedoch geradeaus. Er schien etwas von seiner Wahrnehmungsfähigkeit zu verlieren, und ich versuchte, ihn aufzuheitern, indem ich ihn zum Abendessen einlud. Mein Bruder würde auch kommen.
Im Motel unterhielten wir uns eine Zeit lang über Amerika, die Südstaaten, England – entspannten uns ein wenig vor dem Abendessen. Keiner von uns konnte zu dem Zeitpunkt wissen, dass es sich um das letzte normale Gespräch handeln sollte, das wir führen würden. Von diesem Moment an wurde das Wochenende zu einem bösartigen und trunkenen Albtraum. Wir beide gingen total kaputt. Das Hauptproblem waren meine ehemaligen Verbindungen mit Louisville, die natürlich dazu führten, dass ich alte Freunde, Verwandte und dergleichen traf, von denen viele langsam am Arsch waren, wahnsinnig wurden, Scheidungen planten, unter dem Druck schrecklicher Schulden zusammenbrachen oder sich gerade von fürchterlichen Unfällen erholten. Und mitten drin in dieser wahnsinnigen Derbyaktion musste ein Mitglied meiner eigenen Familie vorgestellt werden. Dadurch spannte sich die Situation noch weiter an, und da dem armen Steadman gar nichts anderes übrig blieb, als einfach hinzunehmen, was mit ihm geschah, erlebte er einen Schock nach dem anderen.
Zu einem weiteren Problem entwickelte sich seine Angewohnheit, jene Leute auf der Stelle zu skizzieren, mit denen ich ihn in den verschiedensten gesellschaftlichen Situationen zusammenbrachte – und ihnen dann die Skizzen auszuhändigen, die er von ihnen gemacht hatte. Das Ergebnis war ausnahmslos katastrophal. Ich hatte ihn mehrere Male gewarnt, seine fiesen Darstellungen den Abgebildeten zu zeigen, aber aus irgendwelchen perversen Gründen ließ er sich nicht davon abhalten. Folglich wurde er von allen, die seine Arbeiten gesehen hatten oder auch nur von ihnen hörten, mit Abscheu und Schrecken betrachtet. Das konnte er wiederum nicht verstehen. »Ist doch nur ein Spaß«, sagte er immer wieder. »Also, in England ist das ganz normal. Die Leute dort fühlen sich überhaupt nicht beleidigt. Die verstehen, dass ich sie nur ein bisschen auf die Schippe nehme.«
»Scheiß auf England«, sagte ich. »Das hier ist die schweigende Mehrheit in Amerika. Diese Leute hier empfinden das, was du ihnen antust, als brutale, gemeine Beleidigung. Denk doch nur daran, was gestern Abend passiert ist. Ich fürchtete schon, mein Bruder würde dir den Kopf abreißen.«
Steadman schüttelte traurig den Kopf. »Aber ich mochte ihn doch. Mir kam er vor wie ein richtig anständiger Kerl von der Sorte, die offen und geradeaus ist.«
»Nun hör mir mal zu, Ralph«, sagte ich. »Machen wir uns doch nichts vor. Die Zeichnung, die du ihm gegeben hast, war echt schauderhaft. Das Gesicht eines Monsters. Das ist ihm schwer an die Nieren gegangen.« Ich zuckte mit den Achseln. »Warum zum Teufel, glaubst du, haben wir das Restaurant so schnell verlassen?«
»Ich dachte, das war wegen dem Mace«, sagte er.
»Welches Mace?«
Er grinste. »Das du auf den Oberkellner abgefeuert hast, erinnerst du dich nicht mehr daran?«
»Scheiß, das war doch gar nichts«, sagte ich. »Ich hab’ ihn doch gar nicht getroffen … und außerdem wollten wir sowieso gerade gehen.«
»Trotzdem hast du uns völlig eingenebelt«, sagte er. »Der ganze Raum war voll von dem verdammten Gas. Dein Bruder musste niesen und seine Frau weinen. Mir taten zwei Stunden lang die Augen weh. Ich konnte noch immer nicht zeichnen, als wir ins Motel zurückgekommen waren.«
»Stimmt auch«, sagte ich. »Sie hat was aufs Bein bekommen, nicht?«
»Sie war wütend«, sagte er.
»Na … ja, … Sagen wir mal, in der Sache haben wir beide so ziemlich gleichen Scheiß gebaut«, meinte ich. »Aber von jetzt an sollten wir versuchen vorsichtig zu sein, wenn wir mit Leuten zu tun haben, die ich kenne. Du machst keine Skizzen von ihnen, und ich setz’ die chemische Keule nicht ein. Wir versuchen einfach, ganz cool zu bleiben und uns zu besaufen.«
»Genau«, sagte er, »wir machen’s wie die Eingeborenen.«
Es war Sonnabendmorgen, der Tag des Großen Rennens, und wir frühstückten in einem Hamburger-Palast namens Fish-Meat Village. Unsere Zimmer befanden sich auf der anderen Seite der Straße im Brown Suburban Hotel. Da gab’s zwar auch einen Speisesaal, aber das Essen war so schlecht, dass wir’s einfach nicht mehr schlucken konnten. Die Kellnerinnen schienen alle an Wadenkrämpfen zu leiden; sie bewegten sich höchst bedächtig, stöhnten und moserten über die »Dunkelhäutigen« in der Küche.
Steadman mochte den Fish-Meat Laden, weil es dort Fish and Chips gab. Ich zog den »French Toast« vor, der eigentlich nichts anderes war als Pfannkuchenteig, auf die angemessene Dicke aufgebraten und dann mit so ’ner Art Keksform so ausgestochen, dass es wie Toastscheiben aussah.
Außer unserem Kater und Mangel an Schlaf bestand unser einziges wirkliches Problem zu dem Zeitpunkt eigentlich darin, wie wir Zugang zum Clubhaus erlangen konnten. Schließlich entschieden wir uns, einfach loszufahren und, wenn nötig, zwei Pässe zu stehlen, statt auf diesen Teil der Action zu verzichten. Und das war die letzte überlegte Entscheidung, die wir innerhalb der nächsten achtundvierzig Stunden zu treffen in der Lage waren. Von diesem Augenblick an – fast demselben Moment, als wir uns auf den Weg zur Rennbahn begaben – verloren wir jegliche Kontrolle über die Ereignisse und verbrachten den Rest des Wochenendes in einem Taumel trunkenen Horrors. Meine Notizen und Erinnerungen an den Derbytag sind jedenfalls reichlich zerfranst.
Aber jetzt, da ich mir das große rote Notizbuch ansehe, das ich damals mit herumschleppte, sehe ich wieder mehr oder weniger, was sich ereignete. Das Buch selbst ist ziemlich aus der Fasson und angeschlagen: Einige Seiten sind zerrissen, andere zerknüllt und voller Flecken, die anscheinend von Whiskey stammen, aber insgesamt betrachtet, scheinen mir die Notizen – zusammen mit gelegentlichen Erinnerungsfetzen – die Geschichte wiederzugeben. Ungefähr so:
Die ganze Nacht bis zum Morgengrauen Regen. Kein Schlaf. Jesus Christus, das ist es, ein Albtraum aus Schlamm und Wahn … Aber nein. Gegen Mittag brennt sich die Sonne durch die Wolken – ein perfekter Tag, nicht mal feucht.
Steadman macht sich jetzt Sorgen, dass es Feuer geben könnte. Jemand erzählte ihm, dass das Clubhaus vor zwei Jahren in Flammen aufging. Könnte das abermals passieren? Furchtbar. Eingeschlossen in der Pressekabine. Holocaust. Hunderttausend Leute, die sich prügeln, um ins Freie zu gelangen. Besoffene, die in Flammen und Modder kreischen, angsterregte Pferde, die durchbrennen. Blind vom Rauch. Die große Tribüne, die mit uns auf dem Dach in den Flammen zusammenbricht. Der arme Ralph steht kurz vorm Nervenkollaps. Schüttet sich vom Haig & Haig rein bis zum Gehtnichtmehr.
Zur Rennbahn im Taxi, um das blöde Parken im Vorgarten von irgendwelchen Leuten zu vermeiden, 25 Dollar für einen Parkplatz, zahnlose alte Männer auf der Straße mit großen Schildern, HIER PARKEN, und sie weisen die Leute auf den Hof. »Ist schon okay, Junge, kümmer’ dich nicht um die Tulpen.« Wilde Haare auf seinem Kopf, die aufragen wie Schilfbüschel.
Gehwege voller Leute, die sich alle in dieselbe Richtung bewegen, nach Churchill Downs. Kids mit Kühltaschen und Decken schleppend, Teenyboppers in engen rosa Shorts, viele Schwarze … schwarze Typen mit weißen Filzhüten und Leopardenfell-Hutbändern, Cops, die den Verkehr dirigieren.
Die Meute war in sich verkeilt, viele Blocks um die Rennbahn; es ging langsam voran in der Menge, war sehr heiß. Auf dem Weg zum Fahrstuhl in die Pressekabine trafen wir auf eine Reihe Soldaten, die alle lange weiße Knüppel dabeihatten. Ungefähr zwei Züge, mit Helmen. Ein Mann, der neben uns ging, sagte, sie warteten auf den Gouverneur und seine Begleitung. Steadman beäugte sie nervös. »Warum haben sie diese Knüppel?«
»Schwarzer Panther«, antwortete ich. Dann erinnerte ich mich an den guten alten »Jimbo« auf dem Flughafen und fragte mich, was er jetzt wohl dächte. Wahrscheinlich war er sehr nervös: Schließlich wimmelte es hier von Cops und Soldaten. Wir drängten uns durch die Menge, durch so manches Eingangstor, am Sattelplatz vorbei, wohin die Jockeys die Pferde bringen und sie eine Weile vorführen, damit die Wetter vor jedem Rennen einen prüfenden Blick auf sie werfen können. Fünf Millionen Dollar werden heute gewettet werden. Viele Gewinner, mehr Verlierer. Aber was zum Teufel soll’s? Vor dem Presseeingang ballte sich eine Menge von Leuten, die versuchten, Einlass zu finden, den Wärtern irgendwas zuriefen, mit den seltsamsten Pressemarken winkten: Chicago Sporting Times, Pittsburgh Police Athletic League … sie wurden allesamt abgewiesen. »Beweg dich schon fort, Freundchen, mach’ Platz für die Presseleute, die auch wirklich arbeiten.« Wir bahnten uns den Weg durch die Menge und in den Fahrstuhl, dann schnell zu der Bar mit den Freigetränken. Warum nicht? Nun mal voran. Sehr heiß heute, geht nicht sonderlich gut, muss an diesem schauderhaften Klima liegen. Die Pressekabine war kühl und luftig, viel Platz rumzulaufen und Balkonplätze, von denen man das Rennen ansehen oder hinunter auf die Menge blicken konnte. Wir besorgten uns eine Wettliste und gingen nach draußen.
Rosa Gesichter mit stilvollen Südstaatler-Hängebacken, alter »Ivy«-Stil, Seersucker-Jacketts und angeknöpfte Hemdkragen. »Maiblüten-Senilität« (Steadmans Bezeichnung) … früh ausgebrannt oder vielleicht von vornherein nicht genug Substanz, um überhaupt ausbrennen zu können. Nicht viel Energie in diesen Gesichtern, nicht viel Neugier. In Schweigen leidend, keine Aussicht in diesem Leben nach dreißig, einfach nur bei der Stange bleiben und die Kinder bei Laune halten. Lasst doch den jungen Leuten ihr Vergnügen, solange sie’s noch haben können. Warum nicht?
Der Sensenmann taucht früh auf in dieser Liga … Todesfeen des Nachts auf dem Rasen, und sie heulen ihr Lied gleich neben dem kleinen eisernen Nigger in Jockeyklamotten. Vielleicht ist er es auch, der heult. Schlimmste Säuferdelirien und zu viele biestige Kommentare im Bridgeclub. Genießt die Baisse zusammen mit dem Aktienmarkt. Oh, Himmel, der Bengel hat den neuen Wagen zu Schrott gefahren, hat ihn um die Steinsäule unten an der Ausfahrt gewickelt. Gebrochenes Bein? Angeknackstes Auge? Schick’ihn rauf nach Yale, da kriegen sie alles wieder hin.
Yale? Hast du heute schon Zeitung gelesen? In New Haven ist Belagerungszustand. InYale wimmelt es nur so von Schwarzen Panthern … Ich kann Ihnen sagen, Colonel, die Welt ist aus den Fugen geraten, absolut aus den Fugen. He, ich habe gehört, eine gottverdammte Frau würde vielleicht heute das Rennen mitreiten.
Ich ließ Steadman in der »Paddock-Bar« beim Skizzieren zurück und ging los, um unsere Wetten für das vierte Rennen zu platzieren. Als ich zurückkam, starrte er unverwandt auf eine Gruppe junger Männer, die nicht weit entfernt an einem Tisch saßen. »Jesus, sieh doch die Korruption in dem Gesicht!«, flüsterte er. »Sieh doch den Wahnsinn, die Furcht und die Gier!« Ich sah hin, drehte mich aber dann abrupt mit dem Rücken zu jenem Tisch, den er gerade skizzierte. Das Gesicht, das er sich herausgesucht hatte, war das eines alten Schulfreundes von mir. Damals in den guten alten Tagen war er ein Footballstar in der Schulmannschaft gewesen, fuhr ein schnittiges rotes Chevy-Kabrio und hatte geschickte Hände, so sagte man ihm jedenfalls nach, wenn’s darum ging, an BH-Verschlüssen zu fummeln.
Aber jetzt, ein Dutzend Jahre später, hätte ich ihn nirgendwo anders wiedererkannt als hier, wo ich erwarten konnte, ihn zu treffen, in der »Paddock-Bar« am Derbytag, fast zugewachsene Schlitzaugen und das Lächeln eines Zuhälters, blauer Seidenanzug, und seine Freunde sahen aus wie Bankkassierer, die sich vom unterschlagenen Geld eine Sauftour gönnen …
Steadman wollte ein paar Kentucky Colonels sehen, aber er wusste nicht so recht, wie diese »Ehrenbürger« aussahen. Ich riet ihm, auf die Herrentoilette des Clubhauses zu gehen und sich nach Männern in weißen Leinenanzügen umzusehen, die in die Pissbecken kotzten. »Die haben gewöhnlich große braune Whiskeyflecken vorne auf ihren Anzügen«, sagte ich. »Aber achte auf ihre Schuhe, daran kannst du sie auf jeden Fall erkennen. Die meisten von ihnen schaffen es, nicht auf ihre Klamotten zu kotzen, aber auf ihre Schuhe reihern sie immer.«
In einer Loge, nicht weit von unserer entfernt, saß Colonel Anna Friedman Goldman, Vorsitzender und Siegelbewahrer des Ehrenwerten Ordens der Colonels von Kentucky. Nicht alle der ungefähr 76 Millionen Colonels aus Kentucky hatten es dieses Jahr geschafft, beim Derby zu erscheinen, aber viele waren doch dem alten Geist treu geblieben und hatten sich einige Tage vor dem Derby zu ihrem jährlichen Dinner im Seelbach Hotel versammelt.
Das Derby, das eigentliche Hauptrennen, war für den Spätnachmittag angesetzt, und als sich die magische Stunde näherte, schlug ich Steadman vor, doch eine Weile auf dem Gelände innerhalb der Rennbahn zu verbringen, in jener brodelnden Menschenmenge auf der anderen Seite. Ihn schien der Gedanke ein bisschen nervös zu machen, da jedoch keine der anderen furchtbaren Voraussagen eingetroffen war, mit denen ich ihn bis dahin verunsichert hatte – keine Rassenunruhen, keine Feuersbrünste und keine heimtückischen Attacken von Trunkenbolden – zuckte er mit den Achseln und sagte: »Also gut, geh’n wir.«
Um dorthin zu gelangen, mussten wir durch so manches Tor, und jedes von ihnen bedeutete einen weiteren Statusverlust. Schließlich durchquerten wir einen Tunnel, der unter der Rennbahn hindurchführte. Der Austritt aus der Unterwelt bedeutete einen derartigen Kulturschock, dass wir eine Weile brauchten, bis wir uns akklimatisiert hatten. »Allmächtiger Gott!«, stammelte Steadman. »Dies ist ein … Jesus!« Dann stürzte er sich mit seiner winzigen Kamera ins Getümmel, über Körper stolpernd, und ich folgte, bemüht darum, meine Notizen zu machen.
Totales Chaos, keine Chance, das Rennen zu sehen, nicht mal die Rennbahn … aber niemanden schien das zu kümmern. Lange Schlangen vor den Wettschaltern im Freien, dann zurückgetreten, um die Gewinner auf der großen Anzeigetafel als Zahlen aufleuchten zu sehen – wie bei einem gigantischen Bingospiel.
Schwarze Opas, die sich über Einsätze stritten; »Bleib hier, ich mach das schon« (mit einer Whiskeyflasche winkend, die Faust voller Dollarnoten); ein Mädchen huckepack, ein T-Shirt mit der Aufschrift »Gestohlen im Gefängnis von Fort Lauderdale«. Tausende von Teenagern, eine Gruppe singt »Let The Sunshine In«, zehn Soldaten bewachen die amerikanische Fahne, und ein gigantisch fetter Säufer in einem blauen Football-Jersey (No. 80) taumelt durch die Menge mit einem Bier in der Hand.
Deutsche Erstausgabe 05/2007
Copyright © 1979 THE GREAT SHARK HUNT,
Estate of Hunter S.Thompson Copyright © 1988 GENERATION OF SWINE, Estate of Hunter S.Thompson Copyright © 1990 SONGS OF THE DOOMED, Estate of Hunter S.Thompson Copyright © 1994 BETTER THAN SEX, Estate of Hunter S.Thompson Copyright © 2007 dieser Ausgabe by Wilhelm Heyne Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH Redaktion: Alexander Wagner Umschlaggestaltung: © Nele Schütz Design, München Satz: Greiner & Reichel, Köln
eISBN 978-3-641-10252-4
www.heyne.de
www.randomhouse.de
Leseprobe