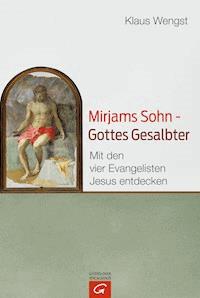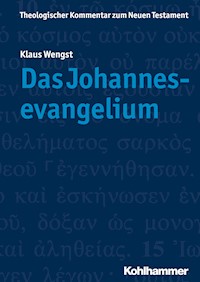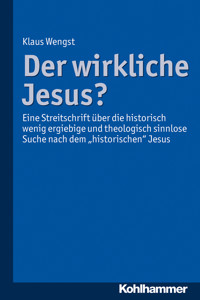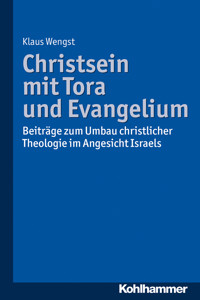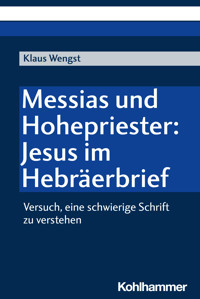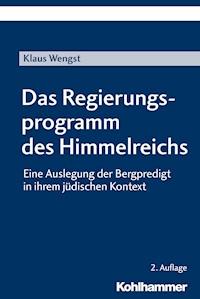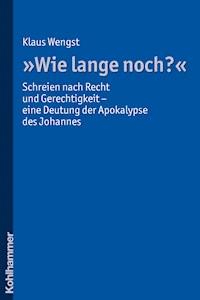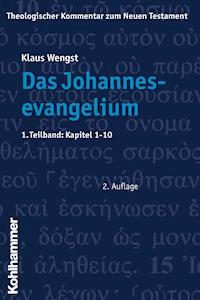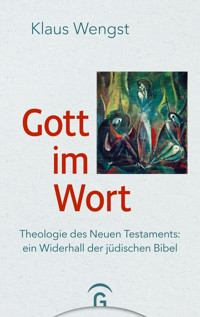
24,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Gütersloher Verlagshaus
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Was heißt "Auferstehung"?
Der Tod Jesu verschlug denen, die ihm gefolgt waren die Sprache. Sie mussten erfahren, dass all die Hoffnung, die sie gehegt hatten, zunichte wurde. Sie waren stumm, doch nicht ohne Worte, denn sie hatten die Texte der jüdischen Tradition, der hebräischen Bibel und deren griechische Übersetzung.
Klaus Wengst zeichnet nach, wie die Jesusanhänger hier die Worte finden, mit denen sie die Ereignisse um Jesus deuten können und wie sich daraus die Texte des Neuen Testaments entwickeln. Im Zentrum steht dabei als grundlegende Botschaft: "Gott hat Jesus von den Toten aufgeweckt." Woher kam diese Überzeugung und wie ist sie auf dem Hintergrund des Judentums gemeint?
Aus der Perspektive der Auferstehung war Jesu Tod nicht mehr Zeichen eines endgültigen Scheiterns, sondern konnte positiv gedeutet werden. Zum Beispiel als Ereignis der Versöhnung und Sühne. Dieser Spur folgt Wengst in einem zweiten Kapitel.
Auferstehung und Versöhnung sind eingebettet in die gesamtbiblisch zentrale Frage nach Recht und Gerechtigkeit. Wie dieses Thema die Verkündigung des Reiches Gottes durch Jesus in den ersten drei kanonischen Evangelien prägt, entfaltet das dritte Kapitel dieses Werkes.
Das vierte Kapitel fragt nach der Antwort, die das Neue Testament darauf gibt, dass das Unrecht in der Welt nicht verschwindet. Hier zeigt Klaus Wengst, dass die biblische Rede vom letzten Gericht, das die Welt wieder ins Recht setzt, einen nach wie vor guten Sinn hat.
Im fünften Kapitel versucht Wengst, neutestamentlichen Texten zur Auferstehung der Toten verstehend zu folgen. Dabei spielt auch die Kategorie des Surrealen eine Rolle – jenseits der Alternative von real oder irreal.
Angesichts dessen, dass wir nichts als Worte haben, fragt der Schluss danach, was bleibt.
Ein Werk, dass auf beeindruckende Weise die zentralen Botschaften des Neuen Testaments entfaltet und in seiner Bedeutung für heute erkennbar macht.
- Die hebräische Bibel als Quelle der Theologie des Neuen Testaments
- Die biblischen Wurzeln der Leitbegriffe des Christentums
- Erhellend, verständlich und spirituell bereichernd
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 423
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Die hebräische Bibel als Quelle der Theologie des Neuen Testaments
Der Tod Jesu verschlug denen, die ihm gefolgt waren, die Sprache. Sie mussten erfahren, dass all die Hoffnung, die sie gehegt hatten, zunichte wurde. Sie waren stumm, aber nicht ohne Worte, denn sie hatten die Texte der jüdischen Tradition, die hebräische Bibel und deren griechische Übersetzung.
Klaus Wengst zeichnet nach, wie die Jesusanhänger hier die Worte finden, mit denen sie die Ereignisse um Jesus deuten können und wie sich daraus die Texte des Neuen Testaments entwickeln.
Im Zentrum steht dabei als grundlegende Botschaft: »Gott hat Jesus von den Toten aufgeweckt.« Woher kam diese Überzeugung und wie ist sie auf dem Hintergrund des Judentums gemeint?
Klaus Wengst, geboren 1942 in Remsfeld (Bezirk Kassel); 1961–1967 Studium der evangelischen Theologie in Bethel, Tübingen, Heidelberg und Bonn; 1967 Promotion und 1970 Habilitation in Bonn; 1981 Professor für Neues Testament in Bochum; infolge der Studentenbewegung und daraus resultierender politischer Betätigung sozialgeschichtlich orientierte Exegese; seit Ende der 80er Jahre Begegnung mit dem Judentum, 1991 Studienaufenthalt an der Hebräischen Universität in Jerusalem; seit August 2007 pensioniert; Er war langjähriger Vorsitzender und Mitarbeiter der Arbeitsgemeinschaft Juden und Christen beim Deutschen Evangelischen Kirchentag und des Evangelischen Studienkreises Kirche und Israel in Rheinland und Westfalen.
Klaus Wengst
Gott im Wort
Theologie des Neuen Testaments: ein Widerhall der jüdischen Bibel
Der Verlag behält sich die Verwertung des urheberrechtlich geschützten Inhalts dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Wir haben uns bemüht, alle Rechteinhaber an den aufgeführten Zitaten ausfindig zu machen, verlagsüblich zu nennen und zu honorieren. Sollte uns dies im Einzelfall nicht gelungen sein, bitten wir um Nachricht durch den Rechteinhaber.
Copyright © 2025 Gütersloher Verlagshaus, Gütersloh,
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
(Vorstehende Angaben sind zugleich
Pflichtinformationen nach GPSR)
Umsetzung eBook: Greiner & Reichel, Köln
Umschlagmotiv: Herman Stenner (1891–1914) »Auferstehung«, 1914, Öl auf Leinwand, 167 x 143 cm, Privatsammlung; mit freundlicher Zustimmung des Freundeskreis Hermann Stenner e.V., Bielefeld; © der Vorlage: Archiv für Kunst und Geschichte, Berlin, www.akg-images.de
ISBN 978-3-641-33468-0V002
www.gtvh.de
In Erinnerung an meine Frau Helga Wengst geb. Litschke (1944–2023)
Inhalt
Vorwort
Einleitung: Wie eine »Theologie des Neuen Testaments« aufgebaut sein könnte
I. Die Auferweckung Jesu von den Toten: die zentrale Aussage des Neuen Testaments
1. Eine wahrhaft unglaubliche Aussage
2. Was die Aussage von der Auferweckung Jesu voraussetzt: Auferstehung der Toten in biblisch-jüdischer Tradition
3. Was die Aussage von der Auferweckung Jesu veranlasste
4. Wie von Auferweckung geredet werden kann
5. Die Erzählungen über Erscheinungen Jesu nach seinem Tod – »wirkliche Gleichnisse«, »wahre Geschichten«
6. Woran den Erscheinungsgeschichten liegt und worauf sie hinweisen
a) Der Auferweckte, der sich einstellt und sich entzieht – loslassen und sich erinnern
b) Betonung der Identität des auferweckten mit dem irdischen Jesus
c) Die Identität des Auferweckten mit dem Gekreuzigten
d) Der Hinweis auf »die Schrift(en)«
7. Konsequenzen aus dem Glauben an Jesu Auferweckung für das Verstehen seiner Person: Gesalbter (»Messias«) – Davidssohn – Gottessohn
8. Jesus als Gleichnis Gottes
a) »Der ist das Bild Gottes.« (2. Korinther 4,4)
b) »Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen.« (Johannes 14,9)
c) Nicht sehen und doch glauben?
d) Das biblische Reden von Gott – anders als das philosophische
e) Am Anfang des neutestamentlichen Kanons stehen vier Evangelien
9. »Gott wirkt durchs Wort oder überhaupt nicht.« (Martin Luther) Gott wurde nicht Mensch und Jesus ist nicht Gott
II. Zum Verstehen des Todes Jesu am Kreuz im Neuen Testament
1. Einleitendes: Gottes Gegenwart – auch im Tod Jesu?
2. »Mein Gott, mein Gott, warum hast Du mich verlassen?« Das Mitsein Gottes in den Erzählungen von der Passion Jesu
3. »Musste das nicht der Gesalbte leiden …?« Wider den Triumph faktischer Gewalt
4. »Ich bin’s.« Jesus als Souverän des eigenen Geschicks in der Passionsgeschichte des Johannesevangeliums
5. »… für uns gestorben« Die Deutung des Todes Jesu als stellvertretende Sühne oder: Über den in Mitleidenschaft gezogenen Gott
6. Jesus als Hohepriester im Hebräerbrief
7. »Die Rede vom Kreuz« als »Dynamit Gottes« – und die Einheit und Einzigkeit der Unterschiedenen
III. Was dringlich ansteht: Gottes Herrschaft und Reich
1. Perspektive und Schwerpunkt der Darstellung in den ersten drei Evangelien
2. Dass Gott zur Herrschaft komme!
3. Aspekte des Reiches Gottes
a) Auf dass Arme nicht arm bleiben
b) Der Messias Jesus im Dienst für Israel
c) Wenn das Reich Gottes Ereignis wird, ist es ein Wunder
4. Die zentrale Signatur des Reiches Gottes: Recht und Gerechtigkeit
5. Gerechtigkeit und Erbarmen
6. Die Betonung des Rechts in der Hochschätzung der Tora
7. Reich Gottes und politische Macht
8. Die Bedeutung des Judeseins Jesu
9. Noch einmal: Schreien nach Recht und Gerechtigkeit
IV. Das letzte Gericht
1. Einige Bemerkungen vorab
2. Visionen vom Gericht in der Offenbarung des Johannes
a) Gottes Gericht und der Strom von Blut
b) Die letzte Schlacht oder: die Macht des Wortes
c) »… der Seufzer der bedrängten Kreatur«?
3. Erzählungen vom Gericht in den Evangelien
a) Noch einmal: Warum vom Gericht Gottes geredet wird und geredet werden muss
b) Die Betonung der Dringlichkeit des Kommenden – und wie man sich darauf einstellen soll
c) Die Aussagen über das Endgericht im Matthäusevangelium
V. Auferstehung der Toten
1. Einleitendes: Auferweckung Jesu und Auferstehung der Toten
2. Das Unvorstellbare skizzieren: eine surreale Notiz (Matthäus 27,51–53)
3. Noch nicht mit dem Messias Jesus auferweckt, dennoch »gleichsam aus den Toten Lebende« (Römer 6,1–14)
4. Ein »geistiger Leib«?! (1. Korinther 15)
5. Spatzen, die zur Erde fallen oder: Vom Wert des Geringen und Alltäglichen oder: Von der Kostbarkeit vergehender Zeit
6. Im Himmel eingeschrieben …
7. Ein neuer Himmel und eine neue Erde …
8. »Lachen werd ich ja …«
9. Vom kommenden Gott
Schluss Was bleibt …
Anmerkungen
Stellenregister
Vorwort
Beim Übergang von der aktiven Berufstätigkeit in die Pensionszeit habe ich überlegt, an welchen Projekten ich gerne weiterarbeiten möchte, um sie für mich in Buchform abzuschließen. Es waren fünf. Vier davon waren 2021 abgearbeitet. Zusätzlich kam einiges dazwischen, wozu ich Lust hatte oder dem ich mich nicht entziehen konnte. Übrig blieb eine »Theologie des Neuen Testaments«. Dazu war die Vorarbeit gering. Aber ich wusste, wie ich sie aufbauen wollte. Was unter diesem Titel gängig war und ist, sind Theologiegeschichten der neutestamentlichen Schriften. Aber ist so etwas eine »Theologie des Neuen Testaments«? In meinen Augen nicht. Ich hatte damals die Idee, mir den Aufbau von der christlichen Tradition vorgeben zu lassen: von dem im evangelischen Gottesdienst gemeinsam gesprochenen »Apostolischen Glaubensbekenntnis«. Nicht, um dessen dogmatisch geronnene Aussagen biblisch zu legitimieren. Sie sollten vielmehr in der Auslegung neutestamentlicher Texte sozusagen wieder verflüssigt und die Leerstellen in ihm ausgefüllt werden. Als ich nach dem Tod meiner Frau unsere gemeinsame Geschichte für meine Enkelkinder aufgeschrieben hatte, wollte ich dieses Projekt aufnehmen. Aber ich traute es mir nicht mehr zu, das in der geplanten Form zu tun. Ich wollte nicht etwas beginnen, bei dem ungewiss war, wann ich es würde abschließen können. Ich suchte nach einem anderen Aufbau. Der ergab sich recht schnell, nachdem mir klar geworden war, wovon ich auszugehen hätte. Darüber gebe ich Rechenschaft in der kurzen Einleitung.
Mein Buch über die Entstehung des Christentums war der Versuch, zusammenfassend darzustellen, was ich meinte, exegetisch-historisch gelernt zu haben. Hier nun versuche ich eine zusammenfassende Darstellung in exegetisch-theologischer Hinsicht. Im Blick auf mein Alter ist deutlich, dass mein Lebensweg sich dem Ende zuneigt. Es war ein langer Lernweg. Auf ihm wurde ich von einem distanziert historisch-kritisch arbeitenden Exegeten, ohne das aufzugeben, zu einem Theologen, der immer mehr auch mit dem Herzen bei der Sache war und ist. Auf diesem Weg hat mich meine Frau Helga als Gegenüber im Gespräch bis zu ihrem Tod ständig begleitet. Das war schon der Fall, als ich gegen Ende des Studiums meine Dissertation schrieb und wir noch nicht verheiratet waren. Dieses hilfreiche Miteinander war nur noch eingeschränkt gegeben bei der Arbeit an meinem Büchlein zum Hebräerbrief. Dieses Buch nun musste ich ganz ohne ihre persönliche Gegenwart abfassen. Dennoch war sie immer »dabei«, besonders intensiv beim Schreiben des fünften Kapitels.
Ich war aber auch diesmal nicht ohne Hilfe. Als ich Ende Mai vorigen Jahres bei einer schönen Veranstaltung in Bochum Prof. Dr. Dieter Beese traf und ihm von meinem Projekt erzählte, bot er mir an, mein Manuskript, wenn es vorläge, gegenzulesen. Das hat er dann mit kritischen Augen getan und zahlreiche Anmerkungen gemacht. Vieles habe ich aufgenommen. Bei Einwänden, die mir nicht einleuchteten, habe ich versucht, klarer zu formulieren. Im Blick auf beides danke ich ihm sehr.
Mit tatkräftiger Hilfe des Pfarrers unserer Gemeinde St. Katharinen, Werner Busch, habe ich in fünf Sitzungen ein »Laien-Seminar« über die fünf Kapitel dieses Buches gehalten. Den Teilnehmenden war mein Manuskript vorher zugegangen. Dieses Seminar war im Blick darauf, dass das Buch für nicht theologisch Ausgebildete gut lesbar sein sollte, außerordentlich hilfreich. Es hat zu nicht gezählten Klarstellungen und Umformulierungen geführt. Dafür gilt allen Teilnehmenden mein herzlicher Dank.
Besonders intensiv hat mir meine Tochter Urte Wengst geholfen. Mit großer Sorgfalt hat sie die erste Niederschrift gelesen. Es gab danach kaum eine Seite, auf der nicht zumindest eine Korrektur oder Anmerkung stand. Und sie hat dann noch einmal das mehrfach überarbeitete Manuskript einer wiederum gründlichen Durchsicht unterzogen, bevor ich es für den Druck an den Verlag geschickt habe. Danke!
Ich danke Diedrich Steen, Programmleiter im Gütersloher Verlagshaus, nicht nur für die Annahme des Manuskripts. Im Gespräch miteinander haben wir den Untertitel dieses Buches gefunden. Und besonders erfreut hat mich sein Vorschlag, das Cover mit dem faszinierenden Bild »Auferstehung« von Hermann Stenner aus dem Jahr 1914 zu gestalten. Diesen Vorschlag habe ich umso lieber aufgenommen, als das Bild für meine – laienhafte! – Wahrnehmung in seiner Uneindeutigkeit ein Stück weit den Surrealismus vorwegnimmt und mir die Kategorie des Surrealen in diesem Buch als hilfreich erschienen ist. Ich danke Götz Keitel vom »Freundeskreis Hermann Stenner e.V.« in Bielefeld für seine freundlichen Erläuterungen zu diesem Bild. Ich danke Beate Nottbrock für die ansprechende Gestaltung des Covers. Und Gudrun Krieger danke ich einmal mehr dafür, dass sie das Manuskript zügig zur Drucklegung gebracht und die letzte Korrektur hilfreich begleitet und umgesetzt hat.
Und schließlich: Den Titel »Gott im Wort« habe ich – mit seiner Erlaubnis – Jürgen Ebach »geklaut«: »Gott im Wort. Drei Studien zur biblischen Exegese und Hermeneutik, Neukirchen-Vluyn 1997.« Dass ich ihm viel mehr als diese Überschrift verdanke, vermehrt meine Dankbarkeit ihm gegenüber.
Braunschweig, April 2025
Klaus Wengst
Einleitung:
Wie eine »Theologie des Neuen Testaments« aufgebaut sein könnte
»Gott wirkt durchs Wort oder überhaupt nicht.«1 Diese Aussage hat Martin Luther eher nebenher in einer Tischrede gemacht. Für mich ist sie eine seiner treffendsten und wichtigsten. Ich stelle sie als Motto diesem Buch voran. Menschen haben Worte. Aber manchmal gibt es Situationen, da hat man keine Worte mehr. So dürfte es der Anhängerschaft Jesu nach seiner Hinrichtung an einem römischen Kreuz ergangen sein. Alle in ihn gesetzten Erwartungen schienen zunichtegemacht. Blieb also für diejenigen, die Jesus gefolgt waren, nichts als Resignation? Gegen das harte historische Faktum seiner Hinrichtung konnten sie kein anderes historisches Faktum ins Feld führen. Aber obwohl es ihnen die Sprache verschlagen hatte, waren sie nicht ohne Worte. Zwar zu eigenem Sprechen nicht fähig, hatten sie doch die Worte ihrer jüdischen Bibel und Tradition. Worte, die den lebendigen Gott bezeugen, der Himmel und Erde geschaffen hat, der verheißt, einen neuen Himmel und eine neue Erde zu schaffen, der gepriesen wird als derjenige, der die Toten lebendig macht. Und so bezeugten sie aufgrund bestimmter nach Jesu Tod gemachter Erfahrungen Gott auch als den, der Jesus aus den Toten aufgeweckt hat. Darüber erzählten sie Geschichten, wirkmächtige Geschichten.
Ich versuche, eine Theologie des Neuen Testaments als Widerhall der jüdischen Bibel zu schreiben. In der Gemeinschaft, die sich auf Jesus bezog und ihn als Messias bekannte, entstanden Schriften, die als Lesetexte in ihren Versammlungen gebraucht wurden. Dadurch gewannen sie zunehmend Autorität. Sie glich der Autorität der im Judentum der Zeit als »heilig« geltenden Schriften. Aus ihnen wird in den neutestamentlichen Schriften immer wieder zitiert und auf sie angespielt. Diese jüdische Bibel – im Zusammenhang mit ihrer weitergehenden Auslegung – ist die Grundlage der neutestamentlichen Schriften; sie bildet ihren Sprach- und Deutungsraum. Deshalb ist der beständige Bezug auf sie kenntlich zu machen. Und deshalb gilt es auch, jüdische Auslegungen mit einzubeziehen. Es geht dabei um nichts Geringeres als die Selbigkeit Gottes, um Israels Gott als den Einen.
Dass eine Theologie des Neuen Testaments eine in diesem Sinn biblische sein muss, ergibt sich von einem weiteren Gesichtspunkt her. Wahrscheinlich um die Mitte des 2. Jahrhunderts wurden in der eigenen Gemeinschaft entstandene Schriften zusammengestellt. Das so entstandene Buch erhielt den Titel »Neues Testament« / »Neuer Bund«. Dadurch wurden die bisher und auch weiterhin als heilig geltenden und gebrauchten Schriften, also die jüdische Bibel, in dieser Gemeinschaft zum »Alten Testament« / »Alten Bund«. Dabei muss man sich vor Augen halten: »alt« qualifiziert in der Antike nur dann etwas negativ, wenn das ausdrücklich kenntlich gemacht wird. Das Alte ist das Ehrwürdige, selbstverständlich in Geltung Stehende. Der Anspruch des als »Neues Testament« zusammengestellten Buches, gleichsam kanonische Geltung zu haben, ergibt sich aus der Zusammenstellung mit der – nun »Altes Testament« genannten – jüdischen Bibel, die diese Geltung längst schon hatte. Die kanonische Autorität des Neuen Testaments ist also eine von der jüdischen Bibel sozusagen geborgte. Auch von daher verbietet sich eine isolierte Betrachtung und ein isolierter Gebrauch des Neuen Testaments.
Diese Theologie des Neuen Testaments erhebt nicht den Anspruch, umfassend zu sein. Nicht alle Themen und Aspekte, die angeführt werden könnten und vielleicht auch müssten, werden angeführt. Längst nicht alle neutestamentlichen Stellen, die zu den herangezogenen Themen und Aspekten etwas beitragen, werden besprochen. Ich suche einen grundlegenden Ausgangspunkt, von dem aus sich weitere Bereiche erschließen und in einem sinnvollen Aufbau darstellen lassen. Dieser Bezugspunkt ist das Glaubenszeugnis: »Gott hat Jesus aus den Toten aufgeweckt.« Das ist die Grundaussage des Neuen Testaments. Ohne sie wäre keine einzige seiner Schriften verfasst worden und wüssten wir nichts von einem Jesus aus Nazaret. Wie redet das Neue Testament davon? Wie kann davon geredet werden? (Kapitel I)
Der Satz, dass Gott Jesus aus den Toten aufgeweckt hat, ist nicht zuerst eine Aussage über Jesus, sondern eine Aussage über das Handeln Gottes an dem am Kreuz hingerichteten Jesus. Sie ist Lob Gottes, des in Israel bekannten Gottes. Nicht Gott wird von Jesus her bestimmt, sondern von diesem Bekenntnis her wird Jesus mit seinem Leben und Sterben in der Perspektive des Handelns Gottes an und mit ihm und durch ihn gesehen. Deshalb versuche ich, eine Theologie des Neuen Testaments zu schreiben.
Aus der Perspektive dieses Glaubenszeugnisses erschien der Tod Jesu an einem römischen Kreuz in einem anderen Licht. Er war nicht mehr Zeichen endgültigen Scheiterns, sondern wurde positiv gedeutet. Wie reden die neutestamentlichen Schriften in Bezug darauf von Sühne und Versöhnung? Warum von solcher Rede nicht Abschied zu nehmen ist, soll gezeigt werden. (Kapitel II)
Ein in diesen beiden ersten Kapiteln enthaltenes Thema ist die gesamtbiblisch zentrale Frage nach Recht und Gerechtigkeit. Sie prägt die Verkündigung des Reiches, der Herrschaft Gottes durch Jesus in den ersten drei kanonischen Evangelien. Das gilt es zu entfalten. (Kapitel III)
Angesichts des weiterhin ausgeübten Unrechts in der Welt stellt sich die Frage nach einem letzten Gericht. Im Neuen Testament ist häufig vom Endgericht die Rede. Das darf nicht beiseitegeschoben werden. Aber wie kann man davon reden? (Kapitel IV)
Mit der Vorstellung vom letzten Gericht ist unmittelbar die von der Auferstehung der Toten verbunden. Sie gilt es schon im 1. Kapitel anzusprechen. Sie soll ausführlicher anhand unterschiedlicher neutestamentlicher Texte bedacht werden. Wie kann man von etwas sprechen, das in unserer Erfahrungswelt nicht vorkommt? Warum ist es gut, das dennoch zu tun? (Kapitel V)
Nachdem Goethes Faust den Beginn des Johannesevangeliums: »Im Anfang war das Wort« gelesen hat, meint er: »Ich kann das Wort so hoch unmöglich schätzen.«2 In der Bibel jedoch erfährt »das Wort« allerhöchste Wertschätzung. Immer wieder geht es in ihr darum, dass und wie in dem von Menschen formulierten Sprechen Gott zu Wort kommt. Dem Sprechen Gottes wird viel, ja alles zugetraut, von der Schöpfung (1. Mose 1) bis zur Neuschöpfung (Jesaja 65,17–25; Offenbarung 21,1–5). Deshalb gebe ich diesem Buch den Titel: »Gott im Wort« und stelle ihm als Motto die schon zu Beginn zitierte Aussage Luthers voran: »Gott wirkt durchs Wort oder überhaupt nicht.« Wir haben nichts als Wörter. Aber es lohnt sich, in den Wörtern der Bibel immer wieder nach »dem Wort« zu suchen.
I.
Die Auferweckung Jesu von den Toten: die zentrale Aussage des Neuen Testaments
1. Eine wahrhaft unglaubliche Aussage
Jesus wurde an einem römischen Kreuz vor der Stadtmauer Jerusalems hingerichtet. Das ist die historisch gewisseste Aussage, die man über ihn machen kann. Der römische Präfekt Pontius Pilatus verurteilte ihn zu diesem Tod. Als oberster Mandatsträger Roms residierte er von 26 bis 36 d.Z. (der Zeitrechnung) in Cäsarea am Meer und verwaltete die kleine Unterprovinz Judäa. In dieser Funktion unterstand er dem Prokonsul der Provinz Syrien. Er begründete sein Todesurteil gegen Jesus damit, dass er in ihm einen Aufrührer gegen die von Rom gesetzte Ordnung erblickte. Das zeigt die von ihm veranlasste Aufschrift an Jesu Kreuz, die in allen vier Evangelien in gleicher Weise angeführt ist: »Jesus aus Nazaret, der König der Juden«. Damit verspottete er Jesus und zugleich auch das jüdische Volk. Zudem war das eine Drohung: So würde enden, wer immer gegen die römische Herrschaft opponiert. Es bedurfte nicht gerade viel, dass die römische Macht in solcher Weise reagierte. »Auflauf« verursacht zu haben, war ein hinreichender Grund. Der jüdische Historiker Josephus berichtet für das 1. Jahrhundert d.Z. bis zum Beginn des jüdischen Aufstands im Jahr 66 von einer Reihe prophetisch-messianischer Gestalten. Sie machten Heilsversprechen und gewannen jeweils eine Anhängerschaft. War sie sichtbar genug geworden, schritt die römische Macht mit ihren Soldaten ein und machte – aus ihrer Sicht – dem Spuk ein schnelles Ende.
Nach dem Bericht aller Evangelien war bei Jesus der Fall des Erregens von Auflauf klar gegeben. Bei seinem Kommen nach Jerusalem vor und zu einem Pessachfest empfing und begleitete ihn eine größere Menschenmenge. Lautstark brachte sie dabei königlich-messianische Erwartungen zum Ausdruck. Das war ein Einzug in Analogie zu dem von Herrschern. Zu den Wallfahrtsfesten in Jerusalem traf die römische Verwaltung Sicherheitsvorkehrungen. Und das besonders zum Pessachfest, das die Befreiung aus der ägyptischen Sklaverei erinnert und feiert – und künftige Befreiung erhofft. Zu diesen Sicherheitsvorkehrungen gehörte es, dass der Statthalter Roms mit militärischer Begleitung von Cäsarea nach Jerusalem hinaufstieg. Dort wachte er darüber, dass die römische Herrschaft unangetastet blieb. In diesem Kontext wurde Jesus nach seinem Einzug in Jerusalem – der historisch wahrscheinlicheren Chronologie des Johannesevangeliums gemäß – noch vor dem Pessachfest festgenommen, von Pontius Pilatus zum Tod am Kreuz verurteilt und unmittelbar anschließend hingerichtet.
Mit dieser Hinrichtung war für die römische Provinzverwaltung die Akte Jesu geschlossen, seine Sache erledigt. »Erledigt« war Jesus aber auch in den Augen seiner Landsleute, sowohl derjenigen, die nichts von ihm gehalten hatten und sich nun bestätigt sahen, als auch derjenigen, die ihm in irgendeiner Weise zugetan waren. Die mit ihm verbundenen messianischen Erwartungen mussten durch seine Hinrichtung auf außerordentlich drastische Weise als solche erscheinen, die man zu Unrecht gehabt hatte. Das gilt auch für seine Schülerschaft; sie hielt sich offenbar versteckt. Der Schüler Simon Petrus, der sich nach Jesu Festnahme als Einziger zunächst noch in Jesu Nähe aufhielt, wollte dabei jedoch – auf eine Verbindung mit Jesus angesprochen – auf keinen Fall mit ihm in Zusammenhang gebracht werden und stritt es ab, ihn überhaupt zu kennen.
Unter den gegebenen Bedingungen wäre nach Jesu Tod normalerweise über »die Sache Jesu« Gras gewachsen. Niemand hätte etwas über ihn überliefert; zu offensichtlich war durch die Kreuzigung sein Scheitern. Er wäre dann einer von den ungezählt vielen Namenlosen gewesen, die unter Roms Herrschaft gekreuzigt wurden. Dass es nicht so geschah, dazu bedurfte es einer schier unglaublichen Aussage. Sie kam bald nach Jesu Tod auf: Gott habe ihn von den Toten aufgeweckt; er lebe. Das ist eine »unglaubliche« Aussage. Sie hat keine historische Analogie. Der als auferweckt Ausgesagte lässt sich auch nicht vorführen, um andere davon zu überzeugen. Wie kommt es zu dieser Behauptung, dem grausigen Anblick eines am Kreuz Verreckten zum Trotz?
Es gab Menschen, die nach Jesu Tod bezeugten, ihn als Lebendigen gesehen zu haben. Paulus erinnert seine Gemeinde in Korinth an eine Tradition, die er ihr zuerst und hauptsächlich mitgeteilt und die er seinerseits empfangen habe. (1. Korinther 15,1–5) Er setzt sie an dieser Stelle nicht nur sachlich, sondern sogar dem Wortlaut nach mit dem von ihm verkündigten »Evangelium«, der guten Botschaft, gleich. Auf sie bezieht er sich, wenn er sich mit anderen, die vor ihm »Gesandte«, »Botschafter« (apóstoloi / »Apostel«) waren, zusammenschließt und schreibt: »Sei es nun ich, seien es jene, so verkündigen wir und so seid ihr zum Glauben gekommen.« (1. Korinther 15,11) Was er hier zitiert, gilt ihm also als gemeinsame verbindliche Tradition. Sie gibt den Inhalt seiner Verkündigung an und sagt somit aus, was seine Gemeinde glaubt, nämlich:
»dass der Gesalbte gestorben ist für unsere Sünden gemäß den Schriften
und dass er begraben worden ist
und dass er auferweckt ist am dritten Tag gemäß den Schriften
und dass er dem Kephas erschien, danach den Zwölfen.«
Als Subjekt steht im griechischen Text christós. Das wird meist mit seiner Latinisierung »Christus« wiedergegeben und als Name verstanden. Aber christós ist kein Name, sondern die zutreffende Übersetzung des hebräischen maschíach (»gesalbt«) und des aramäischen meschichá (gräzisiert messías). Selbstverständlich ist mit diesem Subjekt Jesus gemeint. Aber er wird hier nicht mit Namen angeführt, sondern als der »Gesalbte« bezeichnet, als der königliche Messias. Von ihm werden in einer Ereignisfolge vier Aussagen gemacht: gestorben, begraben, auferweckt, erschienen. Die erste und dritte Zeile sind hervorgehoben, wie ihre Länge und der gleichlautende Schluss zeigen. Dadurch wird diese viergliedrige Tradition in zwei Hauptabschnitte geteilt. Sie beziehen sich auf den als stellvertretende Sühne gedeuteten Tod Jesu und auf seine Auferweckung. Beide Aussagen begegnen in den Briefen des Paulus an einer Reihe von Stellen je für sich in – wie es scheint – fest geprägten Sätzen. Ein Vergleich der Stellen, an denen Paulus die Auferweckungsaussage anführt, macht es wahrscheinlich, dass der Auferweckte in ihr ursprünglich allein mit dem Namen »Jesus« genannt wurde. Die traditionellen Sätze von der Auferweckung Jesu hat es schon vor Paulus in zwei Formen gegeben. Einmal als Aussagesatz: »Gott hat Jesus von den Toten aufgeweckt.« (Römer 10,9) Zum anderen wird Gott in einer partizipialen Wendung, deren wörtliche Übersetzung kein gutes Deutsch ergibt, als »der Jesus von den Toten aufgeweckt Habende« bezeichnet. (Römer 4,24; 2. Korinther 4,14; Galater 1,1) An mehreren Stellen ist im Zusammenhang dieser Aussagen von »glauben«, von »vertrauen« die Rede. (Römer 4,24; 10,9; 2. Korinther 4,13–14; vgl. Kolosser 2,12) Es erscheint daher berechtigt, in der Aussage von der Auferweckung Jesu durch Gott den ältesten Glaubenssatz zu erblicken. Er ist das erste Bekenntnis derjenigen, die nach und trotz Jesu Tod sich doch wieder und weiter an ihm orientierten. Sie setzten ihr Vertrauen darauf, dass Jesus eben nicht endgültig erledigt war, sondern dass Gott ihn von den Toten aufgeweckt hat. Das ist die Grundaussage des Neuen Testaments. An ihr hängen sozusagen alle seine Schriften wie die Tür in der Angel; ohne sie wären sie nicht geschrieben worden.
Die in deutschen Übersetzungen übliche Unterscheidung von »aufwecken« und »auferwecken« findet sich nicht in den damit wiedergegebenen griechischen und hebräischen Wörtern. Dort handelt es sich schlicht um Worte der Alltagssprache, die die Bedeutungen »aufwecken«, »aufrichten«, »aufstehen lassen« haben.
Die Aussage von der Auferweckung Jesu ist in erster Linie eine theologische, eine Aussage über Gott. Gott ist das handelnde Subjekt, Jesus das Objekt seines Handelns. Der tote Jesus ist nicht von sich selbst aus aufgestanden. Sodann ist diese Aussage kein dogmatischer Glaubenssatz; sie ist Lob Gottes. Gott wird gelobt, weil er das getan hat, Jesus von den Toten aufzuwecken. Und dieser Gott ist kein unbekannter Gott, der sich erst mit dieser Tat bekannt machen würde. Er ist der in Israel längst bezeugte und bekannte Gott, Israels Gott. Die Menschen, die dieses Bekenntnis zuerst sprechen, sind Jüdinnen und Juden, die zuvor schon Gott lobten und es auch weiterhin tun. Sie lobten und loben Gott als den, der Himmel und Erde gemacht, der Israel aus der ägyptischen Sklaverei befreit hat, der Bund und Treue mit seinem Volk hält.
2. Was die Aussage von der Auferweckung Jesu voraussetzt: Auferstehung der Toten in biblisch-jüdischer Tradition
Die Aussage, dass Gott Jesus von den Toten aufgeweckt hat, konnte nur im Kontext biblisch-jüdischer Tradition gemacht werden, genauer: in pharisäischer Tradition. »Und Abraham verschied und starb in gutem Alter, alt und lebenssatt; und er wurde versammelt zu seinen Stammesgenossen.« So heißt es 1. Mose 25,8 und ähnlich wird an weiteren Stellen von anderen Menschen gesprochen. »Ein gutes Alter« erreicht haben, »alt und lebenssatt« sein – wenn das gesagt werden kann, ist es gut. »Lebenssatt« meint nicht: des Lebens überdrüssig. Wörtlich übersetzt heißt es: »satt an Tagen«; das meint: gesättigt von hinreichender Zeit, ein volles Maß gehabt haben, zur ganzen Reife gekommen sein. So kann im Buch Hiob der Alterstod mit einem Erntebild verglichen werden: »Du wirst im Alter zu Grabe kommen – wie das Einbringen der Garbe zu ihrer Zeit.« (Hiob 5,26). Dementsprechend heißt es auch am Schluss dieses Buches: »Und Hiob starb alt und lebenssatt.« (Hiob 42,17)
Der Alterstod kann als eine Gegebenheit des begrenzten menschlichen Lebens nüchtern akzeptiert werden. Er ist ein definitives Ende. Aber weil es sich so verhält, dass es für den Menschen nach seinem Tod keine Hoffnung gibt, wird der unzeitige Tod als bedrohlich und schrecklich empfunden. Dementsprechend werden in den Psalmen eindringliche Bitten laut, vor solchem Tod bewahrt, aus lebensbedrohender Krankheit errettet zu werden.
Kehre um, Ewiger, errette mein Leben!
Hilf mir um Deiner Güte willen!
Denn im Tode gedenkt man Deiner nicht.
Wer wird in der Unterwelt Dich preisen? (Psalm 6,5–6)
Dass der Bereich der Toten von Gott getrennt gedacht wurde, zeigt eindrücklich ein Ausschnitt aus Psalm 88:
Fürwahr, mit Leiden gesättigt ist meine Kehle,
mein Leben reicht an die Unterwelt.
Ich werde zu denen gerechnet, die zur Grube hinabsteigen;
ich bin wie ein Mann, der keine Kraft mehr hat.
Unter den Toten bin ich hingestreckt,
Erschlagenen gleich, die im Grabe liegen,
derer Du nicht mehr gedenkst
und die von Deiner Hand geschieden sind. (Psalm 88,4–6)
Die Bitte um Lebenserhaltung in bedrohlicher Situation ist nicht vom Wunsch der Menschen her formuliert, dass sie doch noch so gern leben möchten. Natürlich möchten sie das. Aber die Psalmisten denken von Gott her. An seine Treue, an seine Zusage wird appelliert. Die Geltung von Gottes Verheißung steht auf dem Spiel:
»Nicht uns, Ewiger, nicht uns,
sondern Deinem Namen gib Ehre
um Deiner Güte, um Deiner Treue willen!
Warum sollen die Völker sagen:
Wo ist denn ihr Gott?« (Psalm 115,1–2)
Wird Israel niedergemacht – hier ist nicht der Einzelne im Blick, sondern das ganze Volk –, stehen Gottes Zusagen infrage. Angesichts erfahrenen Leidens, angesichts drohender Niederlagen, die doch zugleich Niederlagen Gottes wären, wird hier eindringlich an Gottes Verheißungstreue appelliert.
Auf dem Hintergrund des bisher Dargestellten konnten folgende Fragen entstehen: Was ist, wenn Menschen nicht »alt und lebenssatt« aus dem Leben scheiden? Wenn sie jung an Jahren dahingerafft werden? Wenn sie gewaltsam sterben? Wenn sie dabei nicht verruchte Frevler waren, die sich um Gottes Gebote nicht kümmerten, sondern wirklich Fromme, die treu zu Gott standen? Ja, wenn sie gerade deshalb sterben mussten, weil sie am Bekenntnis zu Israels Gott unverbrüchlich festhielten? Im Zusammenhang von Erfahrungen, die hinter solchen Fragen stehen, taucht an zwei Stellen der hebräischen Bibel die Auferstehungshoffnung auf.
Das ist zuerst der Fall in einem Abschnitt des Buches Jesaja: Dort liegt ein Klagelied des Volkes vor. Die hier sprechende Gemeinschaft hat schlimme Erfahrungen gemacht. Sie nimmt sie an als Gericht Gottes. Deshalb hält sie auch in der Not an Gott fest: »Auch auf dem Pfad Deiner Gerichte, Ewiger, harren wir Dein.« (Jesaja 26,8) Im Blick auf Israels Feinde in der Vergangenheit, die das Gericht Gottes schon eingeholt hat, heißt es in alter Weise: »Tote werden nicht leben, Schatten nicht aufstehen. Daher hast Du sie heimgesucht und vernichtet und jedes Gedenken an sie schwinden lassen.« (Jesaja 26,14) Auf die Klage des Volkes über seine bedrängte Gegenwart, in der es unfähig ist, sich selbst und dem Land zu helfen, folgt dann aber ein Heilsorakel, zunächst als Gottesrede formuliert:
Leben sollen deine Toten,
meine Leichen werden aufstehen.
Wacht auf und jubelt, Bewohner des Staubes!
Dann folgt als Anrede an Gott:
Denn Tau der Lichter ist Dein Tau,
und die Erde wird die Schatten herausgeben. (Jesaja 26,19)
Da hier keinerlei Hinweise auf bildliche Rede vorliegen, bezeichnen diese Aussagen nicht nur in übertragener Weise eine glückliche Wendung im Ergehen des Volkes, sondern meinen wirkliche Totenauferstehung. Zumindest konnte es nicht ausbleiben, dass der Text in seiner weiteren Überlieferung so gelesen wurde. Dass sich die Verheißung der Auferstehung besonders auf die gewaltsam Umgekommenen bezieht, legt die dann folgende Begründung nahe:
Denn siehe, der Ewige wird herausgehen aus seinem Ort, um die Schuld der Erdbewohner an ihnen heimzusuchen.
Und die Erde wird das auf ihr vergossene Blut aufdecken und nicht mehr verbergen die auf ihr Erschlagenen. (Jesaja 26,21)
Den ihm treu Gebliebenen, die deshalb bis zum Tod leiden mussten, erweist Gott seinerseits seine Treue, indem er sie zum Leben erweckt.
In diesem biblischen Text ist die Auferstehungshoffnung nur kurz angesprochen. Aber es ist aus dem Zusammenhang und den Umständen doch deutlich genug, um was es bei ihr geht und um was nicht, was zum Entstehen dieser Hoffnung treibt und was nicht. Es treibt zu ihr nicht der Wunsch von Menschen, ihr Leben ins Unendliche zu verlängern; das liegt der israelitischen Tradition fern. Die Hoffnung auf Auferstehung ist nicht das Wunschbild Etablierter, dass es immer so weitergehen möge. Sie entspringt vielmehr dem Verlangen Bedrängter, dass es doch endlich anders werde. Auch wird nicht in der Weise von Menschen her gedacht, dass etwas Unsterbliches in ihnen entdeckt würde; von einer unsterblichen Seele etwa weiß die hebräische Bibel nichts. Es geht bei der Auferstehungshoffnung nicht um die Vergöttlichung von Menschen, sondern darum, dass sich Gott als Gott erweise – als ein Gott des Lebens. In den hier gemachten Erfahrungen steht Gottes Bundeszusage, steht seine Verheißungstreue auf dem Spiel: Wird Gottes Zusage, dass er seinem Volk die Treue halten wird, nicht von den mächtigen Gewalthabern widerlegt? Sie können ja mit denen, die Gott treu dienten, machen, was sie wollen – bis hin zu ihrer Tötung. Nein, lautet die Antwort, Gott hält treu an seiner Zusage fest, auch über den Tod hinaus. Er hat Macht auch über den Tod; er wird sie aufwecken und lebendig machen.
In dieser Tradition steht auch das zweite Makkabäerbuch, besonders deutlich in seinem siebten Kapitel. Es schildert, wie sieben Brüder und ihre Mutter vor den König Antiochos IV. geführt werden und Schweinefleisch essen sollen. Das ist biblisch verboten. (3. Mose 11,7–8; 5. Mose 14,8) Mit dessen Verzehr würden sie die ihnen gebotene Lebensweise aufgeben und sich der von König Antiochos befohlenen Hellenisierung anpassen. Schweinefleisch nicht zu essen wird in dieser Situation zum Bekenntnisfall. Im Stil der pathetisch-rhetorischen Geschichtsschreibung wird erzählt, wie sie sich alle weigern und wie sie einer nach dem anderen, zuletzt die Mutter, bestialisch umgebracht werden. Die Alternative, vor die sich die Brüder und ihre Mutter gestellt sehen, formuliert und entscheidet der jüngste Bruder so: »Nicht gehorche ich der Anordnung des Königs; ich höre auf die Weisung, die unseren Vorfahren durch Mose gegeben worden ist.« (2. Makkabäer 7,30)
Ein in diesen Reden häufig wiederkehrender Punkt ist die Gerichtsdrohung gegen den König: »Für dich wird es keine Auferstehung zum Leben geben.« Ihn wird das Gericht noch in der Geschichte ereilen: »Warte du nur ab und nimm Gottes großartige Macht daran wahr, wie er dich und deine Nachkommenschaft martern wird!« »Du aber glaube nur nicht, ungestraft davonzukommen, nachdem du gegen Gott zu kämpfen unternommen hast!« (2. Makkabäer 7,14.17.19) Entsprechend wird das Ende des Antiochos als Gericht Gottes für seine Untaten beschrieben. (2. Makkabäer 9) Gott erwirkt es, dass sein schlimmes Tun auf ihn zurückfällt; er muss das an sich erleiden, was er anderen antun ließ. Die Intention dieser Darstellung ist klar: Es gibt keinen Triumph des Gewalttäters; er setzt mit seinem Morden keine letzten Fakten. Gott ist der Herr. Wie es von dieser Intention her auch zur Aussage von der Auferstehung für die Gewalttäter kommt, liegt auf der Hand. Nämlich dann, wenn ihr Leben nicht so dargestellt werden kann, dass Gottes Gericht sie noch bei Lebzeiten eingeholt hätte.
An Gottes Gerechtigkeit gegen den Augenschein festzuhalten ist auch die Intention der Auferstehungsaussagen im Blick auf die Märtyrer. Der König hat hier Macht, Menschen umbringen zu lassen, die sich seinem Befehl widersetzen. Diese Macht scheint Gott selbst ins Unrecht zu setzen, unter Berufung auf dessen Gebot die Märtyrer den Befehl des Königs verweigern. Es sieht so aus, als unterliege mit ihnen, deren Tod offenkundig ist, auch Gott. Dem wird die These von der Auferstehung entgegengesetzt. Nur zwei Aussagen seien zitiert.
So spricht der zweite Bruder: »Du Unhold nimmst uns zwar jetzt das Leben, aber der König der Welt wird uns, die wir für seine Weisungen sterben, zum ewigen Leben aufstehen lassen.« Und die Mutter sagt zu ihren Söhnen: »Ich weiß nicht, wie ihr in meinem Leib entstanden seid; und nicht ich habe euch den Atem und das Leben geschenkt. Auch habe nicht ich die Grundform eines jeden kunstvoll hergerichtet. Darum wird auch der Schöpfer der Welt, der den Ursprung des Menschen gebildet und den Ursprung aller Dinge erdacht und bewirkt hat, euch den Atem und das Leben in seinem Erbarmen wieder zurückgeben, so wie ihr jetzt über euch hinwegseht um seiner Weisungen willen.« (2. Makkabäer 7,9.22–23)
Nach diesen Aussagen gilt der Tod der Brüder und ihrer Mutter als Protest. Er ist einmal Protest als Verweigerung und Widerspruch: Sie sterben, weil sie sich der Anordnung des Königs widersetzen. Mit ihrem Tod halten sie ihren Widerspruch bis zuletzt durch. Ihr Tod ist aber zum anderen und zugleich auch Pro-test als Zeugnis: Sie sterben für die Weisungen Gottes. In unverbrüchlicher Treue stehen sie mit ihrem Tod bis zuletzt ein für die Wirklichkeit Gottes. Auf ihn vertrauen sie gegen die Macht des Königs. Beugten sie sich dessen Macht, blieben sie zwar am Leben. Aber ihr Protest wäre erloschen; ihr Widerspruch und ihr Zeugnis gebendes Einstehen für die Wirklichkeit Gottes wären hinfällig. Das ist der Sieg, den der König will. Aber den bekommt er nicht.
Der Tod der Märtyrer ist also als doppelter Protest begriffen. Diesen Protest haben sie vollzogen im Vertrauen auf die Treue Gottes. Gott wird seinerseits einstehen für diejenigen, die für seine Wirklichkeit bis zum Tod eingestanden sind. Er lässt nicht zu, dass sie mit der Hinrichtung ins Unrecht gesetzt werden – und damit auch er selbst. Er wird sie vielmehr trotz ihrer Hinrichtung und über den Tod hinaus ins Recht setzen durch die Auferstehung. Die Auferstehung ist somit die Entsprechung zum Protest der Märtyrer aufseiten Gottes. Sie ist der Protest Gottes: Widerspruch gegen die ihm sich entgegensetzende Macht des Königs, die auch vor grausamen Hinrichtungen nicht zurückschreckt. Und sie ist Zeugnis für die sich schließlich und endlich durchsetzende Gerechtigkeit Gottes; sie ist Erweis seiner Solidarität.
Die bisherigen Ausführungen lassen sich somit in folgender Weise zusammenfassen: Auferstehung der Toten – das ist der im Namen und in der Kraft Gottes erfolgende Aufstand der Getöteten gegen die gewalttätigen Sieger der Geschichte, die über Leichen gegangen sind. Auferstehungshoffnung bestreitet, dass den Gewalttätern die Zukunft gehört. Es geht ihr darum, dass vielmehr Gott zum Recht kommt und sich durchsetzt.
Im Laufe der Zeit hat die Auferstehungsvorstellung im Judentum an Boden gewonnen. Im ersten Jahrhundert ist die Hoffnung auf eine allgemeine Auferstehung der Toten weitverbreitet. In der zweiten Benediktion des Achtzehnbittengebetes, des jüdischen Gebetes schlechthin, wird Gott angeredet und gepriesen als der, »der die Toten lebendig macht«. Eine auf dem Friedhof zu sprechende Benediktion lautet: »Gesegnet, der die Zahl von euch allen kennt. Er wird euch künftig Recht sprechen, er wird euch künftig aufstehen lassen im Gericht. Gesegnet, der treu ist in seinem Wort, der die Toten lebendig macht.« (Tosefta B’rachot 7,6) Das Bekenntnis zu Gott als dem, »der die Toten lebendig macht«, wurde im Judentum der Zeit Jesu nicht von allen Gruppen geteilt. Von den Sadduzäern, der konservativen Priesteraristokratie, wurde es bestritten. Dass das gewiss nicht von ungefähr so ist, dass also dem Unterschied in der Theologie auch ein Klassenunterschied entspricht, wird deutlich, wenn man sich die Entstehung der Auferstehungshoffnung aus dem Protest gegen erlittene Gewalt in Erinnerung ruft. Zu solcher Hoffnung ist kaum geneigt, wer selbst als Nutznießer an der Gewalt partizipiert.
In den Evangelien wird von einer Auseinandersetzung Jesu mit den Sadduzäern über die Auferstehung erzählt. (Matthäus 22,23–33 / Markus 12,18–27 / Lukas 20,27–40) Die hier gegebene Antwort Jesu zeigt, wie im Judentum die Hoffnung auf die allgemeine Auferstehung der Toten begründet werden konnte. Dafür soll nun die Fassung des Markus-Evangeliums besprochen werden. In der Einleitung werden die Sadduzäer ausdrücklich als solche charakterisiert, »die behaupten, eine Auferstehung gäbe es nicht«. Ausgangspunkt ihrer Argumentation ist eine Vorschrift aus 5. Mose 25,5–10 über die sogenannte Leviratsehe: Stirbt ein Ehemann kinderlos, soll sein Bruder die Witwe heiraten. Der erste Sohn aus dieser Verbindung gilt dann als Sohn des Verstorbenen. Auf diesem Hintergrund konstruieren die Gesprächspartner Jesu einen Fall, dass sieben Brüder nacheinander dieselbe Frau hatten, die schließlich als Letzte von allen starb. Daraus folgern sie die Absurdität der Auferstehungsvorstellung, die sich damit zugleich als im Widerspruch zur Schrift stehend erweise. Ihre Folgerung kleiden sie in die Form einer ironischen Frage: »Bei der Auferstehung, wenn sie denn aufstehen, wem wird sie dann zur Frau sein? Alle sieben haben sie ja zur Frau gehabt!« Die Antwort Jesu darauf ist komplex: »Steckt ihr nicht deshalb im Irrtum, weil ihr weder die Schriften kennt noch die Kraft Gottes? Wenn sie nämlich von den Toten aufstehen, heiraten sie nicht, noch werden sie verheiratet, sondern sind wie Engel im Himmel. Betreffs der Toten, dass sie aufgeweckt werden, habt ihr nicht gelesen im Buch des Mose an der Stelle vom Dornbusch, wie Gott ihm sagte: Ich bin der Gott Abrahams und der Gott Isaaks und der Gott Jakobs? Er ist kein Gott von Toten, sondern von Lebenden. Ihr steckt tief im Irrtum.«
Jesu Antwort ist umschlossen vom Vorwurf des Irrtums. Zunächst bezieht er sich auf den von ihnen konstruierten Fall. Diese Konstruktion soll die Auferstehung grundsätzlich infrage stellen. Zwar ist Auferstehung auch angesichts eines solchen Falles denkbar, wenn es in der kommenden Welt kein Eheleben gibt wie in der jetzigen. Doch die Wirklichkeit der Auferstehung selbst ist damit noch nicht erwiesen. Sie legt Jesus anschließend mit der Selbstvorstellung Gottes in der Schrift dar.
In der Begründung des gegenüber den Sadduzäern erhobenen Vorwurfs, sie irrten sich, beruft sich Jesus zunächst pauschal auf die Schriften und die Macht Gottes. Die entscheidende Antwort gibt er mit einer bestimmten Schriftstelle. Darauf weist schon die erneute Einführung: »Betreffs der Toten aber, dass sie aufgeweckt werden.« In der Formulierung im Passiv ist Gott als logisches Subjekt gedacht. Er ist es, der die Toten aufweckt. So geht es auch bei dem dann vorgenommenen Bezug auf die Schrift zugleich um die Macht Gottes. Jesus bezieht sich auf 2. Mose 3,6, wo sich Gott Mose gegenüber als Gott der Väter vorstellt. In den bisher in den Blick genommenen Texten der hebräischen Bibel, in denen die Auferstehungshoffnung in wenigen Sätzen begegnete, und im siebten Kapitel des zweiten Makkabäerbuches wurde nicht von den Menschen her gedacht, von Wünschen, die sie haben könnten, sondern von Gott her. Das ist auch in der Argumentation Jesu der Fall. Wenn Gott als Gott Abrahams, Gott Isaaks und Gott Jakobs vorgestellt wird, dann ist damit der mit diesen Vätern geschlossene und ihre Nachkommenschaft einbeziehende Bund im Blick. Gott hat sich in seiner Bundeszusage als Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs sowie ihrer Nachkommenschaft bestimmt. Um seiner eigenen Leben schaffenden Gottheit willen lässt er diejenigen nicht in der Wesenlosigkeit des Todes, an die er sich gebunden, an denen er sich – in der gemeinsamen Bundesgeschichte mit ihnen – als Gott erwiesen, nur mit denen zusammen er sich als Gott erwiesen hat. Jesus kann und will es nicht mit der Gottheit Gottes zusammendenken, dass die menschlichen Bundespartner Gottes ihm durch den Tod auf immer entzogen wären. Und so ist ihm Gott nicht nur Gott der jeweils Lebenden, sondern der Lebenden – derer, denen Gott in seiner Zuwendung Leben gibt und denen er seine Treue bewahrt und bewährt in ihrer Auferweckung. In der Volksreligiosität des Judentums der Zeit Jesu gelten die Stammväter und Stammmütter, die Prophetinnen und Propheten nicht als Tote. Sie erweisen ihre Lebendigkeit als Fürsprecherinnen und Fürsprecher bei Gott und in Wundern, die von ihren Gräbern ausgehen. Die Antwort Jesu hat aber ihr sachliches Gewicht in ihrem Bezug auf den Bund.
Es zeigt sich also: Die Auferstehungsvorstellung im Judentum ist bei ihrem Aufkommen kein eigenständiges theologisches Thema, das isoliert für sich Interesse beanspruchen könnte. Sie nimmt vielmehr eine Funktion wahr im Zusammenhang der Frage nach der Gerechtigkeit Gottes. Und zwar geht es dabei um die von Gott zu erweisende Treue und Solidarität zunächst gegenüber denen in seinem Bund, die in ihrem Lebensrecht verletzt worden sind, ja, gerade aufgrund ihres Festhaltens am Bund sterben mussten. Die Vorstellung von der allgemeinen Auferstehung der Toten kann dann verstanden werden als Ausweitung dieser Treue und Solidarität Gottes auf alle seine menschlichen Bundespartner über deren Tod hinaus. Gott lässt sich seine menschlichen Bundespartner auch durch den Tod nicht wegnehmen. Und er lässt auf der anderen Seite die Mörder nicht auf immer über ihre Opfer triumphieren. Was Max Horkheimer im Interview mit Helmut Gumnior 1970 über Theologie sagte, gilt somit zugespitzt für die theologische Aussage von der Auferweckung der Toten: »Theologie ist – ich drücke mich bewußt vorsichtig aus – die Hoffnung, daß es bei diesem Unrecht, durch das die Welt gekennzeichnet ist, nicht bleibe, daß das Unrecht nicht das letzte Wort sein möge. […] Ausdruck einer Sehnsucht, einer Sehnsucht danach, daß der Mörder nicht über das unschuldige Opfer triumphieren möge.«3
3. Was die Aussage von der Auferweckung Jesu veranlasste
Die von Paulus in 1. Korinther 15,3–5 angeführte Tradition wurde schon zitiert. Sie sagt von dem gestorbenen und begrabenen und auferweckten Messias Jesus in ihrer Fortsetzung, dass er »dem Kephas erschien«. Mit dem Beinamen »Kephas« (»Fels«) wurde der Schüler Jesu namens Simon bezeichnet. Die Erfahrung, die dieser Schüler alsbald nach Jesu Tod gemacht hat, liegt also im Bereich optischer Wahrnehmung. Er hat den kurz zuvor hingerichteten Jesus so wahrgenommen, so »gesehen«, dass er zu der Überzeugung gelangte: Jesus lebt; Gott hat ihn von den Toten aufgeweckt und zum Gesalbten, zum Messias gemacht. Entsprechend lässt die Tradition Jesus als Lebendigen Subjekt seines Erscheinens sein. Nach Kephas führt diese Tradition als weitere Personen an, denen solches »Erscheinen« widerfuhr: »danach den Zwölfen«. Ob schon Jesus einen Zwölferkreis von Schülern um sich geschart hatte oder ob erst Simon sich aufgrund dieser Erfahrung veranlasst sah, einen solchen Kreis zu bilden, sei dahingestellt. In jedem Fall sind »die Zwölf« als Repräsentanten der zwölf Stämme und also des Volkes Israel in seiner endzeitlich wiederherzustellenden Ganzheit verstanden. Die Überzeugung, dass Gott Jesus aufgeweckt und zum Messias gemacht habe, führt zu einer kleinen messianischen Gruppe in Israel, die sich auf Israel als Ganzes bezogen sieht.
Aus eigener Kenntnis führt Paulus an dieser Stelle des 1. Korintherbriefes über die Tradition hinaus weitere Personen an, die analoge Erfahrungen machten: »Danach erschien er mehr als 500 Geschwistern auf einmal. Von ihnen sind die meisten bis jetzt am Leben, einige jedoch entschlafen. Danach erschien er dem Jakobus, dann allen Ausgesandten.« (1. Korinther 15,6–7) Mit Jakobus ist ein Bruder Jesu gemeint, der noch nicht zum Kreis um Jesus vor seinem Tod gehörte. Er kam wohl erst durch das an dieser Stelle gemeinte Ereignis hinzu, das von ihm als Begegnung mit dem auferweckten Jesus verstanden wurde. Das hier mit »Ausgesandte« wiedergegebene Wort lautet im Griechischen im Singular apóstolos (latinisiert: apostolus). Im Deutschen ist es als »Apostel« aufgenommen, beschränkt auf Personen im Auftrag Jesu. Das griechische Wort bezeichnet allgemein einen mit einer Sendung Beauftragten: »Sendboten«, »Gesandten«, »Botschafter«.
Bei allen an dieser Stelle des 1. Korintherbriefes genannten »Erscheinungen« ist ein Vorgang im Blick, der in mehr als einem Sinn »nicht zu fassen« ist: etwas höchst Erstaunliches, das über alles Erwartbare hinausgeht. Es lässt sich auch nicht mit den Mitteln historischer Kritik verifizieren. Es wird etwas ausgesagt, was außerhalb allgemein zugänglicher menschlicher Erfahrung liegt. Als auf eine historische Person bezogen, beansprucht diese Aussage dennoch Wirklichkeit. Darüber wird noch zu reden sein. Das Gemeinschaftserlebnis der »über 500« könnte von Außenstehenden auch als Massenhysterie abgetan werden. »Nicht zu fassen« ist aber auch der »Gegenstand« dieses Sehens. Der als auferweckt Bezeugte kann von seinen Zeuginnen und Zeugen nicht an die Hand genommen und demonstrativ vorgeführt werden. Für Kelsos im 2. Jahrhundert, den ersten uns überlieferten Christenbestreiter, ist er »erbärmlicher als selbst die wirklichen Gespenster und nicht einmal mehr ein Gespenst, sondern ein tatsächlich Toter«. (Kelsos, Wahre Lehre; bei Origenes, Contra Celsum VII 36)
Schließlich führt Paulus sich selbst als Zeugen an: »Zuletzt von allen – gleichsam als einer Fehlgeburt – erschien er auch mir.« (1. Korinther 15,8) »Fehlgeburt« nennt er sich, weil er vor dieser Erfahrung nicht zur Anhängerschaft Jesu gehörte, weder vor dessen Tod noch danach, als sie sich neu bildete. Er agierte im Gegenteil gegen sie. Erst diese Erfahrung, die ihn Jesus als Messias »sehen« ließ, hat ihn zu dessen Sendboten gemacht. Unter denen, die eine solche Erfahrung gemacht haben, ist Paulus der Einzige, der darüber auch selbst schreibt. An dieser Stelle vermerkt er lediglich, dass »der Gesalbte« ihm »erschienen« sei. Ihm schreibt er in Fortführung der Tradition die Initiative zu. Von sich aus wäre er ganz und gar nicht darauf aus gewesen, Jesus in solcher Weise zu sehen.
An zwei weiteren Stellen erwähnt er in kurzen Skizzen diese Erfahrung, die sein künftiges Leben als Sendbote des Messias Jesus bestimmte. Der korinthischen Gemeinde gegenüber stellt er rhetorische Fragen: »Bin ich nicht frei? Bin ich nicht Sendbote? Habe ich nicht Jesus, unseren Herrn, gesehen? Seid nicht ihr mein Werk im Herrn?« Was er hier rhetorisch verneint, gilt ihm und seiner Leser- und Hörerschaft in Korinth selbstverständlich als zu bejahen. Er stellt damit seine Sendung als rechtmäßig dar. So fährt er fort: »Wenn ich auch für andere kein Sendbote bin, für euch jedenfalls bin ich es. Das Siegel meiner Sendung nämlich seid ihr im Herrn.« (1. Korinther 9,1–2) Als entscheidenden Punkt für die Legitimität seiner Sendung führt er an, dass er »Jesus, unseren Herrn, gesehen« habe. Jesus vor dessen Tod hat er nicht gesehen. Das wäre auch keine ausreichende Legitimation für seine Sendung. Diesen Jesus hatten viele gesehen. Er muss also ein Sehen Jesu nach dessen Tod meinen, ein Sehen, das ihn Jesus als »Herrn« erkennen ließ. Er bekam also durch dieses Sehen eine andere »Sicht« Jesu, als er sie vorher von ihm hatte. Und die veranlasste ihn, für diesen Herrn fortan als Sendbote tätig zu werden und durch die auf ihn bezogene Verkündigung Gemeinden hervorzurufen.
Dasselbe Geschehen hat Paulus in einem autobiografischen Abschnitt im Galaterbrief im Blick. Dass er Sendbote Jesu geworden ist, beschreibt er dort so: »Als es aber dem gefiel, der mich von meiner Mutter Leib an ausgesondert und durch seine Gnade berufen hat, mir seinen Sohn zu offenbaren, damit ich ihn unter den Völkern verkündige (…).« (Galater 1,15–16) Was Paulus widerfahren ist, woran er als Sehender beteiligt war, versteht er hier als von Gott bewirkt. Das »Sehen« betraf etwas, das ihm erst offengelegt, aufgedeckt werden musste, nämlich Jesus als »Sohn Gottes«. Und das heißt in der jüdischen Tradition als den von Gott beauftragten Gesalbten, den Messias. Paulus beschreibt hier also den Wendepunkt in seinem Leben als ein Handeln Gottes an ihm. Dass ein Handeln Gottes vorliege, bringt er durch die Umschreibung des handelnden Subjekts zum Ausdruck. Das tut er besonders dadurch, dass er dieses Handeln in Anspielungen auf die Schrift formuliert, und zwar in Anspielungen auf zwei prophetische Berufungen. Es sind die einzigen beiden prophetischen Berufungen der Bibel, in denen die Völker in den Blick kommen. »Hört auf mich, ihr Inseln! Merkt auf, ihr Völker von ferne! Der Ewige hat mich berufen von Mutterleib an, vom Mutterschoß her meines Namens gedacht.« So heißt es in Jesaja 49,1. Und in Jeremia 1,5 lautet die Anrede Gottes in der Berufung des Propheten: »Bevor ich dich bildete im Mutterleib, habe ich dich gekannt; bevor du ausgingst aus dem Mutterschoß, habe ich dich geheiligt: Zum Propheten für die Völker habe ich dich gesetzt.« Das nimmt Paulus auf und lässt es bei der Beschreibung seiner eigenen Erfahrung anklingen, deutet sie also mit dem überlieferten Sprachmuster prophetischer Berufungen. Auch nach dieser Stelle bekommt er dadurch eine andere Sicht Jesu, als er sie vorher hatte. Die herangezogenen Bibelstellen machen deutlich, dass er sich von vornherein als Sendbote des Messias Jesus für die Völker verstand.
Festzuhalten ist: Sehr bald nach Jesu Tod machten durch seinen Tod enttäuschte Anhänger – und im Fall des Paulus ein Gegner von dessen Gemeinde – im visuellen Bereich liegende Erfahrungen. Auf dem Hintergrund biblisch-jüdischer Tradition brachten diese Erfahrungen sie zu der Überzeugung: Gott hat Jesus von den Toten aufgeweckt. Jesus ist damit nicht in sein Leben vor dem Tod zurückgekehrt; er lebt nicht ein Leben, das noch einmal den Tod vor sich, sondern das ihn ein für alle Mal hinter sich hat. Seine Kreuzigung sollte es als lächerlich und als erledigt erscheinen lassen, dass er »der König der Juden« sei. Der Glaube an seine Auferweckung eröffnet eine andere »Sicht«; er sieht in ihm den Gesalbten, den messianischen König.
4. Wie von Auferweckung geredet werden kann
Auferweckung der Toten – sie hat nicht den mindesten Anhalt an unserer Wirklichkeitserfahrung. Man kann Toten noch so gut zureden, sie noch so sehr wachrütteln wollen, sie werden die Augen nicht öffnen und nicht wieder aufstehen. Wie kann man dann von Auferweckung reden?
Vor dem Parlamentsgebäude in Jerusalem steht ein großer siebenarmiger Leuchter, geschaffen von dem Bildhauer Benno Elkan. Unter seinen zahlreichen Reliefs findet sich in zentraler Stellung am Schaft über einer Darstellung des Aufstands im Warschauer Ghetto ein Relief, das von Kapitel 37 des Buches Ezechiel inspiriert ist: Aus seinem linken oberen Teil wehen die vier Winde und bauschen das Gewand eines jungen Mannes auf, der sich, kraftvoll vorwärts schreitend, aus dem Bild heraushebt. Er blickt auf menschliche Skelette zu seinen Füßen, überspannt von seinen im Gehen weit ausgebreiteten Armen. Von seinen Händen scheint Segen auszugehen, der den Skeletten Fleisch und Geist vermittelt und sie dazu bringt, sich aufzurichten. An dieser Stelle und in diesem Kontext symbolisiert das Relief die Rückkehr des jüdischen Volkes ins Land Israel. Es qualifiziert sie als Auferstehung der Toten, als erneute Einlösung der im biblischen Text gegebenen Verheißung, als Zeichen der Treue Gottes.
Der biblische Text in Ezechiel 37,1–14 bietet in seinem ersten Teil eine eindrückliche Visionsschilderung. Der Prophet wird vom Geist Gottes in ein Tal geführt, das von zahlreichen, völlig ausgedorrten menschlichen Gebeinen bedeckt ist. Auf die Frage Gottes, ob diese Gebeine leben werden, antwortet er: »Mein Herr, Ewiger, Du weißt es.