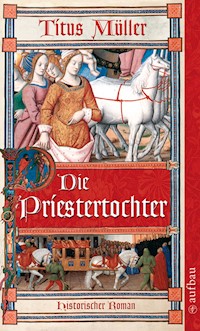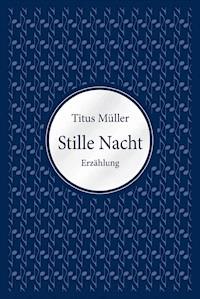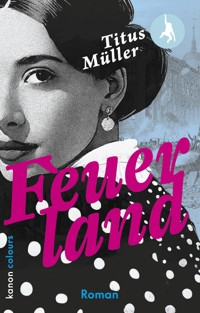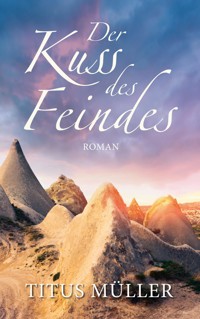Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: adeo
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
"Wir leiden darunter, dass das Leben an uns vorbeirauscht. Wir arbeiten, schlafen, essen, arbeiten, schlafen, essen - und wünschen uns, wieder zu hören, wie am Morgen eine Amsel singt. Wir wünschen uns, die Ameise zu sehen, die eine Tannennadel schleppt. Wir wollen den Wind spüren, der über unsere Wangen streicht. All das ist jeden Tag da, die Amsel, die Ameise, der Wind. Nur wir sind blind geworden durch unsere Lebensgeschwindigkeit." Titus Müller Es gibt eine Kraftquelle, die nur wenige kennen. Obwohl sie jederzeit erreichbar ist. Es ist gut, sich im Trubel des Alltags Zeit zu nehmen. Zeit für die kleinen und unscheinbaren Dinge. Titus Müller zeigt, wie wir längst verlorene Schätze wieder neu entdecken. Die Kunst des Wartens. Die Kunst der Gelassenheit. Die Kunst, sich keine Sorgen zu machen. Die Kunst, einen Augenblick bewusst zu erleben.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 157
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Inhalt
Perfektion im Alltag
Barfuß im Regen
Meine Welt wird Bio
Von den Massai lernen
Die Kunst des Wartens
Waldrappentraining
Einen Tag lang herumlümmeln
Die Kunst, sich keine Sorgen zu machen
Das Leben gestalten
Blickwechsel mit einem Grashüpfer
Ich kann fliegen, wenn ich mich nicht so schwernehme
Leben als Wettlauf
Ziele bewusst wählen
Glücklich mit wenig
Vertrauen
Teilen wie ein guter König
Die Kunst, einen Augenblick zu erleben
Die Kunst, in der Freizeit Ruhe zu finden
Zufrieden sein
Die Nacht ist mein Freund
Üben wie van Gogh
Mut
Perfektion im Alltag ↵
Unglaublich, wie gut ich es habe. Ich sitze im Dachzimmer eines kleinen Häuschens und darf etwas in den Computertippen, das später durch Druckerpressen läuft und in Buchhandlungen geliefert wird. Dort gehen die Leute hin, um es mit nach Hause zu nehmen und zu lesen. Mein Traumberuf! Das Getippte bezahlt mir die Miete, den Urlaub, den Kinobesuch … Und ich genieße es nicht allein: Vor acht Wochen habe ich meine Traumfrau geheiratet. Ich freue mich jeden Morgen, neben ihr aufzuwachen.
So habe ich’s mir immer gewünscht. Ich wollte Autor werden, ich wollte in einem urigen Dachzimmer sitzen und schreiben und wollte eine Familie gründen mit der tollsten Frau der Welt. Bin ich also überglücklich? Ist das gerade ein perfekter Moment?
Nein.
Mir ist kalt. Obwohl ich das warme Sweatshirt angezogen habe. Außerdem bin ich verspannt, und die Ärztin hat mir keine Massagen verschrieben, sondern mich wissend angelächelt und gesagt, ich solle mehr Sport treiben. Ich weiß schon, ich müsste schwimmen gehen. Aber ich habe keine Lust dazu. In der Schwimmhalle haben sie nämlich über Jahre allmählich die Wassertemperatur gesenkt; die dachten, das merkt keiner. Ich merke es sofort, weil ich nach drei Minuten zu zittern anfange. Das Eiswasser im Becken halten nur noch durchtrainierte Profischwimmer aus. Ich jedenfalls nicht.
Lena ist heute nicht da. Das Haus ist still. Ich vermisse sie. Niemand singt unten oder spielt Klavier. Ich müsste Mails beantworten und habe keine Lust darauf. Ich müsste mir etwas zu essen kochen. Darauf habe ich noch weniger Lust.
Obwohl ich tausend Gründe hätte, glücklich zu sein, gibt es auch ein paar Gründe für Unzufriedenheit. Seltsamerweise konzentriere ich mich auf die und bin niedergeschlagen.Ich warte darauf, dass sich auch der Rest verbessert: dass mir warm wird, dass sich die Verspannung löst und dass Lena heimkehrt.
Ist das eingetreten, wird mir etwas anderes nicht mehr passen. Ich werde vielleicht Kopfweh haben oder müde sein, oder in der Küche wird sich der Abwasch türmen. Irgendwas stört immer.
Was ist mit den perfekten Momenten, die mir die Werbung vorgaukelt? Am Frühstückstisch lacht die Familie, die Kinder sind gut drauf und brav – sie freuen sich scheinbar einfach nur, dass sie etwas zu essen bekommen –, alle sind gekämmt und hellwach und genießen den Tag. Wo gibt’s das?
Die Werbung verschweigt den Abwasch hinterher und das Nörgeln der Kinder, wenn sie ihren Teller abräumen sollen.Sie verschweigt die Nutellaflecken auf dem Tischtuch, den stinkenden Hund, die Steuererklärung und die überfüllte Mülltonne. Die Kreditraten fürs Haus fehlen, und das Bad muss auch mal wieder geputzt werden, aber das wird nicht gezeigt, damit die perfekte Familie länger in die Kamera lächeln kann.
Noch nie habe ich in der Autowerbung LKWs auf der Landstraße gesehen, die man wegen der kurvenreichen Strecke nicht überholen kann. Die Werbestraße ist frei; man hat sie für sich allein. Zeitdruck gibt es nicht, einfach nur Freude am Fahren.
Das Traumhaus, das sich das Werbepaar mit seinem Bausparvertrag kauft, hat viel Platz drumherum, und obwohl sie gerade erst eingezogen sind, begrüßen die Nachbarn sie wie langjährige Freunde. Es ist alles fertig und es gibt keine Baumängel.
Im Urlaub hat das Werbepärchen den Strand und den Pool für sich. Scheinbar buchte zufällig niemand sonst dieses Hotel, was die Angestellten aber nicht weiter zu bekümmern scheint; sie sind überglücklich, dass sie sich um das Pärchen kümmern dürfen. Ununterbrochen scheint die Sonne.
Diese Filmteams sollten mal in mein Leben kommen! Da muss man sich im Urlaub eincremen, mehrmals täglich, bis es eine klebrige Mischung aus Salz, Sand und Creme ist, die man sich da über den Körper reibt. Und weil ich die Unterschenkel für ungefährdet gehalten habe – es wachsen ja genug Haare dort –, habe ich nach dem Schnorcheln einen schmerzhaften Sonnenbrand an den Beinen. Am Traumstrand. In den Flitterwochen.
Ich sollte die Perfektion vergessen, die ich aus der Werbung gelernt habe. Nicht erwarten, dass alles stimmt. Dann kann ich den Frühstückstisch genießen, auch wenn der Abwasch hart werden wird. Der Tisch steht voller köstlicher Sachen. Gut, dass Lena und ich die Zeit haben, sie zu schmecken und uns satt zu essen.
Ich kann hinter dem LKW herzuckeln und trotzdem die schöne Landschaft bewundern. Ich will auch mal im leeren Haus glücklich sein und mich auf Lenas Heimkehr freuen. Wie schlimm wäre das, wenn ich denken würde: Endlich ist sie weg! Lieber vermisse ich sie, das zeigt nur, wie sehr ich sie schätze.
Die Werbung trimmt mich darauf, meine Bedürfnisse sofort zu erfüllen. Nachdem sie viele dieser Bedürfnisse überhaupt erst erzeugt hat. Die schlauen Marketingleute wissen genau, wie sie mir einreden können, dass ihr Produkt mich klug, schön und vergnügt machen wird.
Viele Werbespots enden mit: „Jetzt zugreifen!“ Muss ich Glück immer sofort haben? Ist ein Glück, das Wartezeiterfordert oder erst durch längeren Einsatz möglich wird, nicht besser? Liebe, die allmählich wächst, weil wir uns vertraut werden. Ein Sonnenaufgang, für den ich an einen schönen Platz wandern muss. Briefmarken zu sammeln, anstatt eine komplette Sammlung zu kaufen.
Lena hat Basilikum ausgesät. Jeden Morgen gilt ihr erster Blick den kleinen Pflanzen. „Guck mal, wie schön der Basilikum wächst!“, sagt sie begeistert. Jetzt haben wir zum ersten Mal davon geerntet. Wir essen ihn mit Mozzarella und frischen Tomaten, und ich schmecke all die Liebe, die sie den Pflanzen gewidmet hat. Jeder Bissen ist mir kostbar.
Barfuß im Regen ↵
Meine Nachbarn halten mich vermutlich für verrückt. Ich gehe im Regen spazieren. Barfuß. Aber ich habe nachmittags an einem Jugendbuch gearbeitet, in dem kriechen die frühmittelalterlichen Romanfiguren durch eine unterirdische Stadt, überleben einstürzende Höhlen, Schwertkämpfe und reißende Flüsse, also muss ich doch wenigstens mal im Regen spazieren gehen.
Die Wiese steht schon unter Wasser. Es macht Spaß,durch das weiche Gras zu stapfen und sich die Füße umspülen zu lassen. Niemand ist unterwegs, die Straße ist leer. Es ist still draußen, natürlich, der Regen plätschert, aber davon abgesehen ist es still, die Leute sind in ihre Häuser geflohen. Ich komme mir vor wie ein Kind und genieße die kindliche Freiheit.
Die Luft riecht sauber, als würde sie gerade ein Erfrischungsbad nehmen. Amseln hocken in den Bäumen, ihnen tropft Wasser vom Schnabel. Sie warten, bis der Regenguss vorüber ist. Kein Hund bellt, nur der Regen tippelt ausdauernd auf meinen Kopf.
Ich patsche in die Pfützen. Es fühlt sich verboten an, barfuß zu laufen. Meinen Füßen gefällt’s. Zum ersten Mal seit langer Zeit spüren die Fußsohlen den Gehweg, seine Platten und die Ritzen dazwischen.
Ich lausche. Auf den dickfleischigen Blättern der Gartenpflanze vor unserem Haus macht der Regen satte, tiefe Laute, die Tropfen rollen daran herunter. Das Garagendach klingt hohl wie eine Trommel.
Unsere Nachbarn haben einen Swimmingpool. Ich spaziere hin und stecke den Fuß hinein. Das Wasser ist warm, viel wärmer als das in den Pfützen. Auf der Oberfläche des Pools glitzern kleine Ringe, die Regentropfen tanzen ein Ballett.
Was für eine schöne Pause!
Ich kehre ins Haus zurück, trockne mir die Haare, die Füße und das Gesicht. Ich hänge die Regenjacke auf und setze mich wieder an den Schreibtisch. Die nackten Füße wärmen sich in den Hausschuhen auf und ich höre den Regen draußen. Er ruft mich, er ist einsam.
Lena kommt herein und fragt: „Wovon handelt das neue Buch, das du gerade beginnst?“
„Vom Glück“, sage ich. „Und von mehr Gelassenheit und Ruhe im Leben.“
Sie antwortet mit Sarkasmus in der Stimme: „Da spricht ja der Richtige.“
Ich bin kein gelassener Mensch. Wenn ich irgendwo in der Schlange anstehe, beim Einkaufen oder am Fahrkartenschalter,suche ich mir markante Personen in den benachbarten Warteschlangen, um zu sehen, ob es an der anderen Kasse schneller vorangeht. Ich tröste mich mit geschafften Warte-Etappen. Nur noch fünf Leute vor mir, nur noch vier. Mist, der Mann mit der roten Jacke in der Nachbarschlange stand vorhin noch hinter mir. Wieso ist es dort schneller gegangen? Ah, jetzt rücken wir nach. Kann ich schon irgendwas vorbereiten? Ich schätze den Preis, den ich bezahlen muss, und suche das Geld heraus. Dabei habe ich es nicht wirklich eilig, mir ist nur unerträglich, zum nutzlosen Herumstehen verurteilt zu sein.
Auch im Restaurant warte ich ungern. Ich belauere den Kellner. Wann bringt er endlich die Karte? Haben wir sie,dauert es noch mal eine Ewigkeit, bis Lena sich entschieden hat, was sie essen will. Ich kenne niemanden, der so eingehenddie Speisekarte studiert wie sie. Der Kellner kommt, um zu helfen, aber sie schickt ihn weg, weil sie Zeit zum Überlegen braucht. Ich sitze daneben und täusche Geduld vor, während mir der Magen knurrt. „Oder soll ich doch lieber den Salat nehmen?“, murmelt sie. Ich hatte nach fünf Sekunden entschieden, was auf meinen Teller soll. Lena braucht eine gefühlte Stunde.
Endlich bestellt sie und wir warten erneut. Ich beobachte die anderen Tische, misstrauisch, ich rechne mit einer Ungerechtigkeit. „Hatten die vor uns bestellt?“, frage ich Lena, wenn jemand sein Essen bekommt. Den anderen auf die Teller zu schauen ist eine Inspiration, wenn man Hunger hat. Ich habe mich erst wieder im Griff, als auch vor mir eine dampfende Mahlzeit steht und ich essen kann.
Eigentlich hat es schon zu Hause begonnen, beim Aufbruch. Ich darf nicht den Fehler machen, als Erster Jacke und Schuhe anzuziehen. Dann stehe ich nämlich an der Tür und will los, während Lena Dinge einfallen, die sie unbedingt noch erledigen muss. Der Müll kann mit raus. Sie sucht ihr Handy. Sie geht auf die Toilette. Es sind nur Minuten, aber ich leide furchtbar. Mit den Straßenschuhen kann ich nicht zurück in die Wohnung. Was soll ich machen, ich stehe an der Tür herum und versuche, nicht überzukochen. Ungenutzte Minuten kommen mir wie ein Verbrechen vor. Bei Brettspielen zum Beispiel sage ich immer dem Nächsten, dass er an der Reihe ist – ich kann den Moment nicht ertragen, wenn keiner seinen Spielzug macht. Ich will, dass es straff vorangeht.
Ist das die Art, wie ich leben möchte? Straff voran? Eigentlich nicht. Es ist plötzlich 2011, dabei war gerade erst 2001, 2007, 2009 … Die Monate und Jahre ziehen an mir vorüber wie ein zu schnell abgespulter Film. Ich verpasse mein eigenes Leben.
Als Kind habe ich seelenruhig Legobausteine sortiert. Ich konnte das, ich war gelassen. Obwohl ich wusste, dass es Stunden dauern würde, schüttete ich den Inhalt der großen Legokiste auf den Wohnzimmerteppich und begann, die Steine zu ordnen.
Nachmittags hockte ich draußen auf dem Gehweg und beobachtete Feuerwanzen. Die roten Tierchen tippelten geschäftig ihrer Wege, sie saugten an Samen oder suchten Beute in den Ritzen der Bordsteinkante. Nie sah man sie allein, wo eine Feuerwanze war, lebten auch andere. Dass ich da kauerte und sie beobachtete, merkten sie nicht.
Ich legte mich auf die Wiese vor dem Haus und schaute in die Wipfel der Pappeln, wo das Blättermeer bei jedem Windstoß hell aufleuchtete. Ich hörte zu, wie die Blätter rauschten. Kann ich als Erwachsener diese Ruhe wiederfinden?
Heute fange ich an. Ich will versuchen, den einzelnen Tag zu lieben. Den Mittwoch, den Donnerstag. Das ist mein Leben. Zu viele Tage sind mir schon im tosenden, hektischen Meer ersoffen.
Meine Welt wird Bio ↵
Vor vier Jahren stellte ich im Münchner Literaturhaus meinen Roman „Das Mysterium“ vor, und auf der Bühne standen mit mir vier junge Musikerinnen, die den Abend untermalten. Vielleicht sah es so aus, als würde ich aufmerksam ihrer Musik folgen, aber in Wirklichkeit starrte ich die ganze Zeit eine von ihnen an. Ich wusste nichts von ihr, nicht mal ihren Namen. Ich konnte nicht anders, als zu ihr hinzusehen, sie zu beobachten und zu bewundern.
Weil mein Lektor und befreundete Autoren anwesend waren, die mich im Blick hatten, wagte ich nicht, nach der Lesung zu ihr zu gehen und mit ihr zu reden. Der Abend ging zu Ende, ich schlief im Hotelzimmer und kehrte am nächsten Tag nach Hause zurück.
Immerzu dachte ich an sie. Nach einer halben Woche hielt ich es nicht mehr aus. Ich kannte die Musikprofessorin, die den Auftritt der vier organisiert hatte, und bat sie, die junge Frau zu fragen, ob ich ihr schreiben dürfe.
Endlich erfuhr ich ihren Namen: Lena. (Später fand ich heraus, dass sie sich ebenfalls in mich verliebt hatte. Während der halben Woche hatte sie wieder und wieder das Foto in meinem Buch angeschaut und wehmütig gedacht: Den sehe ich nie wieder.) Wir schrieben uns, telefonierten, verabredeten uns. Lena und ich wurden uns immer vertrauter; wir passen wunderbar zusammen. Nur in einem sind wir grundverschieden: Lena liebt Bioprodukte. Ich liebe Aldi.
Essen hat in meinem Leben nie eine besonders große Rolle gespielt. Ich esse, was ich ohne viel Aufwand zubereiten kann. Oder was es fertig und warm zu kaufen gibt. Während einer Amerikareise aßen mein Freund Basti und ich drei Wochenlang täglich bei McDonald’s. Es hat mir vom ersten bis zumletzten Tag geschmeckt. In Lenas Familie hingegen ist McDonald’s tabu.
Als sie vorschlug, wir sollten gemeinsam Pizza machen, und anfing, aus Mehl, Milch und Hefe den Teig zuzubereiten, fielen mir die Augen aus dem Kopf. Auf Lenas Pizzateig musste man warten! Zwei Stunden lang! Er stand einfach herum, mit einem Handtuch zugedeckt, und die Hefe ließ ihn wachsen. Ich hatte die vergangenen zehn Jahre ein Junggesellendasein genossen mit Tiefkühlpizza, Tiefkühlgemüse und Kartoffeln. Da dauerte ein Gericht höchstens eine halbe Stunde.
Mir fällt immer erst bei knurrendem Magen ein, Mittagessen zu kochen, deshalb sind dreißig Minuten das Maximum an Zeit, das ich auf ein Gericht zu warten bereit bin. Ich gebe zu, dass Lenas Pizza besser schmeckt. Nur hat der gute Geschmack seinen Preis: Er erfordert Geduld.
Lena verlangt, dass ich mir nach dem Rasieren die Schaumreste aus dem Gesicht wasche, anstatt sie mit dem Handtuch abzutrocknen. Wegen der „Chemie“. Sie spült nach dem Abwaschen jeden Teller und jedes Glas zusätzlich mit klarem Wasser ab, dabei verwenden wir nicht mal normales Spülmittel, sondern ein Ökoprodukt, das mir anfangs ziemlich suspekt war.
Alles ist Chemie, versuche ich ihr zu erklären, selbst eine Erdbeere besteht aus Molekülen! Aber Lena unterscheidet streng zwischen Waren mit Biosiegel (die sind gut) und Waren ohne Biosiegel (die sind „giftig“). Vor unserer Hochzeit gingen wir manchmal gemeinsam einkaufen. Sie bezahlte an der Kasse immer doppelt so viel wie ich, weil sie Bio- und Fairtrade-Produkte kaufte.
Ich habe schon immer den Müll getrennt und war sparsam mit Wasser und Strom. Ist ja nicht so, als wäre mir die Umwelt egal. Nur wozu brauchen Mohrrüben, Kartoffeln oder Äpfel ein Biosiegel?
Mit Lena einen Salat zu schnippeln, das genieße ich inzwischen. Frische Tomaten, knackige Gurken – so schmackhaft habe ich früher nicht gegessen. Das Zubereiten braucht mehr Zeit. Und jede Minute davon lohnt sich.
Neulich habe ich eine Gurke durchgeschnitten und sah, wie kurz darauf Abertausende von kleinen Tropfen an der Schnittstelle glitzerten. Wie Diamantenstaub. Ich lerne, Stangensellerie von Lauch zu unterscheiden. Ich bin dem Essen näher und schätze es von Tag zu Tag mehr.
Von den Massai lernen ↵
Ole Ronkei ist Massai, hat aber auch in den USA gelebt und war Berater der Weltbank. Heute lebt er wieder in Kenia, er wollte seine Kinder in der Kultur der Massai aufziehen. Ole Ronkei kennt beide Welten, den Westen und Afrika.
Ich interviewe ihn und Andreas Malessa für meine Literatursendung „Auserlesen“, weil Andreas ein Buch über ihn geschrieben hat. Bevor die Kameras laufen, stelle ich Ole Ronkei Fragen zu seinem Leben in Kenia. Er ist vergnügt und freundlich. Kühe sind für die Massai sehr wichtig, und so frage ich ihn aus Neugier, wie viele Kühe er besitzt.
Da wird er ernst, auch seine Frau sieht mich streng an. Bin ich in ein Fettnäpfchen getreten? Er will nicht antworten. Ihn das zu fragen, erklärt er mir streng, ist, als würde er mich fragen, wie viel Geld ich auf dem Konto habe.
Zum Glück hat die Sendung noch nicht begonnen. Ich entschuldige mich und wir nehmen das Gespräch wieder auf. Ole Ronkei verzeiht rasch, er ist ein gutherziger Mann, es braucht nur wenige Minuten, und ich habe ihn ins Herz geschlossen.
Ich frage ihn, was wir Deutschen von den Massai lernen können. Er lobt unsere Effizienz, sagt, er könne nicht fassen, dass ein Zug bei uns nur anderthalb Minuten hält, und die Leute steigen aus und ein, und dann fährt er weiter, und wer zwei Minuten zu spät kommt, hat den Zug verpasst. Unsere Produkte seien in der ganzen Welt beliebt, lobt er.
Ich wiederhole meine Frage: Was können wir von den Massai lernen?
In einer Kultur, antwortet er, in der die Tagesaufgabe darin besteht, seine Kühe zu hüten, hat man es nicht eilig. Man hat Zeit, mit den Nachbarn zu sprechen. Die hohe Effizienz in Deutschland setzt uns unter Druck, wir sind gestresst. Vielleicht können wir von den Massai einen anderen Umgang mit der Zeit lernen.
Das Gespräch geht mir noch lange nach. Ich frage mich, was der Zeitdruck mit mir anstellt, ob er mich verändert. Zeitdruck macht mich ungnädig, und ich mag mich selbst nicht, wenn ich unwirsch zu anderen bin. Meine schönsten Fähigkeiten verkümmern: die Fähigkeit zu staunen, die Fähigkeit zu genießen, das Mitgefühl.
An der Princeton University führten die Psychologen John Darley und Daniel Batson Einzelgespräche mit Theologiestudenten. Sie forderten sie auf, einen kurzen, spontanen Vortrag über ein biblisches Thema vorzubereiten und anschließend zum Nachbargebäude hinüberzugehen, um den Vortrag dort zu halten. Unterwegs begegnete jeder Student einem Mann, der stöhnend auf der Straße lag, als wäre er soeben zusammengebrochen.
Die Studenten mussten zu Beginn des Experiments einen Fragebogen ausfüllen, in dem sie erklären sollten, warum sie sich entschieden hatten, Theologie zu studieren. Ging es ihnen um persönliche spirituelle Erfüllung? Oder wollten sie anderen Menschen helfen?
Zusätzlich probierten die Psychologen verschiedene Szenarien aus, durch die sie die Studenten auf die Begegnung mit dem zusammengebrochenen Mann vorbereiteten. Einigen wurde als Thema für den Vortrag das Gleichnis vom barmherzigen Samariter vorgegeben, eine Geschichte, die Jesus erzählte: Ein Reisender wird überfallen, zusammengeschlagen und von den Räubern halbtot am Straßenrand liegen gelassen. Ein Priester und ein Levit, die ihn sehen, gehen tatenlos vorüber. Erst ein Samariter – Angehöriger einer Bevölkerungsgruppe, die von den Juden verachtet wurde – hilft dem Verletzten, verbindet seine Wunden und bringt ihn in eine Herberge.
Die Psychologen setzten die Studenten unter Druck. Sie sahen auf die Uhr, als die Studenten ihre Vorbereitungen beendet hatten, und sagten: „Sie sind spät dran, Sie werden schon seit einigen Minuten drüben erwartet. Beeilen Sie sich.“