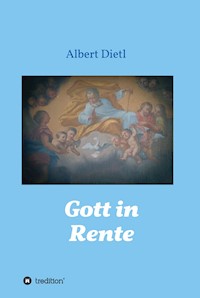
5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der Glaube an Gott und die Lehre der katholischen Kirche sollten nicht im Widerspruch zueinander stehen, aber gerade aktive Christen verspüren zunehmend ein Spannungsfeld. Die kirchliche Einstellung zu vielen Themen ist nicht einmal mehr für viele gläubige Mitglieder nachvollziehbar, umso weniger für Menschen, die außerhalb oder am Rand der Kirche stehen. Ist das ein Thema, das Menschen interessant finden? Definitiv, wenn es nur gelingt, mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Sobald man zu Punkten gelangt, die sie für sich persönlich als relevant empfinden, wird der Gedankenaustausch plötzlich spannend. So geht es auch Klaus, ein mitten im Leben stehender Projektmanager und Familienvater aus München. Er kommt in seinen Geburtsort und trifft dort Sebastian, einen Rentner Ende sechzig, der weit in der Welt herumgekommen ist. Aus der zufälligen Begegnung wird eine Folge intensiver Gespräche. Darf die Kirche entscheiden, was gut und was böse ist? Wie ist das mit der Dreifaltigkeit? Hilft die Kirche den Menschen bei ihrem Versuch, sich Gott anzunähern oder stellt sie für viele eher ein Hindernis dar? Eingerahmt werden die Gespräche durch Beobachtungen in der ländlichen Heimat von Klaus. Dabei wird, manchmal mit etwas Schmunzeln, die bayerische Lebensart skizziert. Es fließen aber auch weitere Spannungsfelder wie das Zusammenspiel von Bodenständigkeit und moderner Lebensart oder die Landflucht und die damit verbundenen Probleme in den ländlichen Regionen mit ein. Und da sind dann auch noch die Mutter von Klaus und Tante Trude, die nicht nur für gutes Essen, sondern immer wieder auch für unterhaltsame Situationen sorgen, und am Schluss noch für eine faustdicke Überraschung gut sind. All diese Elemente sorgen hoffentlich dafür, dass schwierige, die menschliche Existenz und den Glauben betreffende Themen in einer Weise transportiert werden, die unterhaltsam genug ist, um flüssig und mit Freude gelesen zu werden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 196
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Gott in Rente
Albert Dietl
Gott in Rente
tredition GmbH
Hamburg
© 2021 Albert Dietl
Autor: Albert Dietl
Umschlaggestaltung, Illustration: Albert Dietl
Lektorat, Korrektorat: Helmut Haunreiter
Verlag & Druck: tredition GmbH, Halenreie 40-44, 22359 Hamburg
ISBN: 978-3-347-20704-2 (Paperback)
978-3-347-20705-9 (Hardcover)
978-3-347-20706-6 (e-Book)
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.
Sonntagvormittag um halb zehn
Es war schön, wieder mal zu Hause zu sein. Wohnhaft bin ich seit vielen Jahren in München, genauer gesagt am Rand von Allach, wo es einerseits ruhig ist und man mit ein paar Schritten im Grünen ist, und von wo aus man andererseits in gut zwanzig Minuten im Zentrum sein kann. Es ist gut, so zu wohnen, und ich bin gern dort. Aber wenn ich „zu Hause“ sage, meine ich in aller Regel Hockhausen, den Ort, von dem ich herkomme, wo ich aufgewachsen bin und die ersten neunzehn Jahre meines Lebens verbracht habe.
Zugegebenermaßen sind es eher Erinnerungen, die mir in Hockhausen das Gefühl von Heimat geben. Die meisten Freunde sind weggezogen und die drei Kramerläden, der Metzger, der Schuhladen und der Schmied haben längst zugemacht. Nur einen Bäcker gibt es noch. Im einzigen Gasthaus am Ort trifft man sich regelmäßig zum Stammtisch und eigentlich sitzen da ganz bodenständige Männer und, ab und zu, auch Frauen zusammen. Aber spätestens, wenn die Rede auf die Politik kommt, wird es für jemanden, der eine eher tolerante, weltoffene Sicht vertritt, schwierig, sich nicht zu sehr aufzuregen.
Aber meine Mutter wohnt noch da und Tante Trude. Beide sind inzwischen Mitte achtzig und leben gemeinsam in meinem Elternhaus. Mein Vater und auch Onkel Herbert sind seit vielen Jahren tot, und so führen die zwei älteren Damen einen männerfreien Haushalt, freuen sich aber trotzdem, oder vielleicht gerade auch deshalb, wenn ich drei- oder viermal im Jahr für ein Wochenende zu Besuch komme. Es gibt dann oft Suppenfleisch mit Wirsinggemüse und nachmittags gedeckten Apfelkuchen. Ich habe irgendwann angefangen, beides ganz ausdrücklich zu loben und habe so die eingeschränkte Abwechslung in der Speisenfolge vermutlich selbst verursacht. Wir erzählen uns dann gegenseitig alte Geschichten von früher, schauen uns manchmal auch alte Fotos an und es fühlt sich ein bisschen so an wie früher. Meine Frau und meine beiden Töchter sind nur gelegentlich dabei, weil sie meine Mutter und meine Tante zwar auch gerne mögen und diese Art von Heimatgefühl schon verstehen, aber natürlich nicht die gleiche intensive Bindung dorthin haben wie ich.
Sonntags gehen die beiden Damen in den Gottesdienst. Nur krank zu sein und nicht aus dem Bett zu können, wäre ein akzeptabler Grund, dies nicht zu tun. Ohne den Kirchgang wäre der Sonntag unvollständig, hätte sozusagen eine Lücke, die anderweitig nicht sinnvoll zu füllen wäre. Ich will dies auch nicht als reine Gewohnheit bezeichnen, die beiden sind so tief verwurzelt in ihrem Glauben, dass es ihnen vermutlich seelische oder sogar körperliche Schmerzen bereiten würde, aus einem nichtigen Grund den Sonntagsgottesdienst zu versäumen.
Und es geht natürlich um den katholischen Gottesdienst, schließlich sind wir ja in Bayern. Es gibt schon auch ein paar Protestanten im Ort, aber wenn man hier Kirche sagt, ist jedem vollkommen klar, was gemeint ist. Hockhausen hat eine kleine Barockkirche mit vielen Figuren und Bildern, die reichlich Stoff zum Schauen und Nachdenken bieten, umrahmt von zahlreichen Schnörkeln und goldenen Verzierungen, was in Summe einen sehr weichen Gesamteindruck ergibt. Wie in vielen anderen Dörfern auch, ist die Zahl der Gottesdienstbesucher nicht mehr so hoch, wie dies vor vierzig oder fünfzig Jahren der Fall war. Damals war ich Ministrant und zumindest am Sonntag war die Kirche gut gefüllt, an Festtagen wie Weihnachten oder Ostern sogar brechend voll. Aber das ist auch hier längst vorbei. Zu einem normalen Sonntagsgottesdienst kommen nicht einmal mehr hundert Gläubige und als Fünfzigjähriger senkt man den Altersdurchschnitt gleich ganz wesentlich.
Wenn ich übers Wochenende da bin, gehe ich meist mit in den Gottesdienst, mindestens aber fahre ich die beiden Damen zur Kirche und hole sie wieder ab. Sie können schon noch ganz gut zu Fuß gehen, aber, wie sie schmunzelnd gestehen, genießen sie es doch, mit einem schönen Auto vorgefahren zu werden, und hoffen insgeheim, dass möglichst viele der anderen Hockhausener das auch sehen. Nun kann man mit einem Auto der oberen Mittelklasse heute niemanden mehr beeindrucken, aber die beiden haben trotzdem ihre Freude, die ich ihnen gerne bereite.
Zu Hause in Allach gehe ich sonntags auch immer wieder mal in den Gottesdienst, aber bei Weitem nicht so regelmäßig wie meine Mutter und meine Tante. Ich möchte meinen Draht zu Glaube und Kirche nicht abreißen lassen, aber es gibt eben auch viele Wochenenden, an denen wir auf Reisen oder anderweitig unterwegs sind, und bei Bedarf ist eine Ausrede, weshalb man am Sonntagvormittag lieber zu Hause bleiben möchte, ja auch schnell gefunden. Hier in Hockhausen fühlt sich das dann doch eher wie früher an, das heißt, nicht in die Kirche zu gehen wäre ein bisschen wie Schule schwänzen.
Und so war es auch an diesem Sonntag im September. Ich fuhr die beiden zur Kirche, ließ sie galant und gleichzeitig publikumswirksam am Aufgang zur Kirche aussteigen und parkte dann hundert Meter weiter an dem für Kirchenbesucher vorgesehenen Parkplatz. Auf dem Weg zurück zur Kirche war ich ohne Eile, denn wir waren wie jeden Sonntag früh genug dran, weil die Damen vor dem Gottesdienst noch ein paar Minuten Zeit für ein stilles Gebet haben wollten. Auch die Sorge, keinen Platz mehr zu bekommen, wäre weit an der Realität vorbei gegangen. Und ich saß – obwohl sich die Trennung in Männer und Frauen in der gottesdienstlichen Sitzordnung auch hier inzwischen weitgehend aufgelöst hat – in der Kirche gewohnheitsmäßig doch immer noch rechts, also auf der gefühlten Männerseite und nicht neben Mutter und Tante. Insofern konnte ich mir getrost Zeit lassen.
Es war ein warmer Septembermorgen, nicht mehr so heiß wie im Juli und August, aber noch sehr angenehm, und ich hatte das Bedürfnis, noch ein paar warme Sonnenstrahlen zu genießen, bevor die diesigen Herbsttage kamen. Auf dem Kirchplatz unterhalb des Aufgangs zur Kirche stand eine riesige, uralte Eiche und um die Eiche gab es eine Metallbank, die durch die kreisrunde Form den Vorteil bot, dass man sich immer in die Sonne setzen konnte.
Es waren noch ein paar Minuten Zeit und so steuerte ich auf diese Bank zu, auf der bereits ein älterer Mann saß. „Älterer Mann“ hört sich ziemlich alt an, er war aber geschätzt Mitte oder Ende sechzig, also kaum fünfzehn Jahre älter als ich. Offensichtlich nehme auch ich, wie die meisten Menschen, mein eigenes Älterwerden nur widerwillig wahr.
Ich kannte den Mann vom Sehen und wusste, dass er, so wie ich auch, in Hockhausen aufgewachsen war und beruflich viel in der Welt herumgekommen war. Nach dem Ende seiner aktiven Berufslaufbahn hatte er mit seiner Frau das ein wenig außerhalb von Hockhausen gelegene elterliche Gehöft umgebaut und lebte nun dort. Eigentlich hätte ich auch wissen müssen, wie er heißt, aber mit Namen war ich noch nie besonders gut, und diese kleine Mangelerscheinung scheint sich mit dem Älterwerden signifikant zu verstärken. Wenn ich mit meinen Freunden beim vierteljährlichen Stammtisch sitze, ist die Vergesslichkeit das Thema der meisten Witze in der Runde, was deutlich zeigt, dass es nicht nur mir so geht.
„Guten Morgen“, sagte ich wenig einfallsreich, mit Namen konnte ich ihn ja nicht ansprechen.
„Guten Morgen, Klaus“, kam es zurück, was mich spontan etwas in Verlegenheit brachte. Offensichtlich gab es doch Menschen, die mit Namen wesentlich sattelfester waren als ich.
„Na, auch wieder mal in der alten Heimat?“, fragte er.
„Ja“, antwortete ich höflich, „solange meine Mutter lebt, versuche ich mich regelmäßig blicken zu lassen. Wer weiß, wie lange ich sie noch habe.“
Er nickte und lächelte wohlwollend. „Deine Mutter ist ja noch recht gut beieinander, aber die Allerjüngste ist sie trotzdem nicht mehr.“
Schweigend saßen wir einige Minuten und ließen uns die Sonne ins Gesicht scheinen. „Bam, bam“, ertönte die Kirchturmuhr, es war halb zehn. Man konnte durch die Kirchentür hören, wie die Orgel ertönte, der Pfarrer anfing, das Eröffnungslied zu singen und die Gemeinde mit einstimmte. Der Durchschnitt aller Stimmen ergab dann in etwa die gewünschte Melodie.
Eigentlich hatte ich erwartet, dass wir uns spätestens jetzt gemeinsam erhoben und auf die Kirche zugingen, aber mein Sitznachbar machte nicht die geringsten Anstalten aufzustehen. Nun war das ja kein Grund für mich, ebenfalls sitzen zu bleiben. Aber irgend etwas in mir schien mich auf der Bank festzuhalten, so, als ob wir nur gemeinsam gehen oder gemeinsam bleiben konnten. So verrückt mir der Gedanke damals wohl erschienen wäre, aber im Nachhinein betrachtet war das ein sehr prägender Moment in meinem Leben.
Einige Augenblicke hielt ich es aus, dann musste ich ihn einfach fragen: „Gehen Sie denn nicht hinein in die Kirche?“
„Kannst ruhig Sebastian zu mir sagen – oder Wast, wie mich die Leute hier im Dorf nennen. Weißt du, ich fühle mich ganz wohl hier. Hier zu sitzen mit Blick auf die Kirche, dabei zu sein, ohne sich zu sehr vereinnahmen zu lassen, das fühlt sich nach einem Gleichgewicht an, das zu mir passt. Ich gehe schon auch gern in Kirchen hinein, aber ehrlich gesagt, am liebsten, wenn sie leer sind.“
Verblüfft fragte ich ihn: „Glaubst du denn nicht?“ und war im selben Moment selbst überrascht über die Offenheit meiner Frage.
Er lächelte: „Ich glaube schon, aber halt nicht alles. Weißt, ich glaube an Gott, und ich bin auch Mitglied in der Kirche, aber in der Reihenfolge. An Gott zu glauben, fällt mir leicht, aber meine Kirche macht es mir schon oft recht schwer, mit ihr zurechtzukommen.“
„Ah“, hakte ich ein, „du sprichst sicher von den Missbrauchsfällen, oder von der goldenen Badewanne in Limburg, oder was sonst noch so alles schiefläuft.“
„Für mich sind das nur Symptome, die in den Griff zu bekommen wären“, erklärte er nachdenklich. „Wenn man aufhört, Missbrauchsfälle zu vertuschen und alle, die gegen Recht und Gesetz verstoßen, bestrafen würde ohne Rücksicht auf kirchliche Würdenträger und vor allem ohne Rücksicht auf kirchlichen Imageschaden, dann ließen sich zwar auch in Zukunft Missbrauchsfälle nicht hundertprozentig vermeiden, aber es wäre kein Sonderthema der Kirche mehr. Auch aus dem Ruder laufende Baukosten für die Renovierung kirchlicher Gebäude ließen sich mit der notwendigen Transparenz zu einem finanziellen Thema machen, für das in der Kirche die Verantwortlichen genauso zur Rechenschaft gezogen werden sollten wie außerhalb der Kirche. Leider werden aber noch nicht einmal diese Themen in der Kirche konsequent angegangen, aus Furcht, die eigene Position zu schwächen. Und dann werden daraus eben hoch emotionale Themen mit Gerüchten wie das von der goldenen Badewanne, die es in Wirklichkeit gar nicht gab, die aber als Sinnbild für die Verschwendung kirchlicher Finanzmittel herhalten musste und als solches auch bestens funktionierte.“
„Aber, wenn das nur Symptome sind, wie sehen denn dann die wirklichen Probleme erst aus? Warum treten die Leute denn scharenweise aus der Kirche aus, wenn nicht wegen solcher Themen?“
„Oha“, entfuhr es ihm, „jetzt machst du aber ein großes Fass auf. Ich fürchte, das ist nicht in zwei, drei Sätzen zu beantworten und schon gar nicht von mir. Ich bin weder Theologe noch steht es mir zu, anderen Leuten wie dir die Welt zu erklären.“
So leicht ließ ich aber nicht locker. „Ich möchte keine wissenschaftliche Abhandlung hören und auch keine allgemein gültige Gesamtanalyse der aktuellen Situation der Kirche, ich möchte nur ein bisschen mehr über deine Sicht der Dinge erfahren. Jetzt hast du mich einfach neugierig gemacht.“
„Nun ja“, begann er, „dann lass mich versuchen, wenigstens kurz zu erklären, aus welcher Richtung ich denke. Was meinst du, ist Aufgabe der Kirche?“
Ich musste kurz überlegen. „Vielleicht Menschen zu helfen, sich Gott anzunähern.“
„Eine sehr gute Antwort!“, erwiderte er. „Die spannende Frage ist, ob die Kirche das auch macht.“
„Wie?!“, entgegnete ich. „Die Gottes- und Nächstenliebe in der Nachfolge Christi ist doch das Top-Thema in der Kirche.“
Sebastian schüttelte den Kopf. „Eigentlich schon, aber schau dir doch mal an, wie dieses Thema transportiert wird. Jesus hat uns viel über Gott erzählt und das Gottesbild im Vergleich zum Alten Testament ziemlich stark verändert. Als Christen glauben wir, dass er das konnte und durfte. Aber er hat natürlich so gedacht und gesprochen, wie Juden vor gut zweitausend Jahren eben gedacht und gesprochen haben. Das war auch völlig richtig so, sonst hätten ihn die Menschen damals gar nicht verstanden. Es war für seine Zeitgenossen sowieso schon schwierig genug, weil er so ganz anders war.“
Ich verstand noch nicht so recht, was er mir sagen wollte, also hakte ich nach: „Aber wenn wir akzeptieren, dass Jesus uns so von Gott erzählt hat, dass wir besser über Gott Bescheid wissen, ist es doch richtig, die Botschaft der Bibel als Grundlage unseres Lebens anzusehen, oder?“
„Ja und nein“, hielt er mir entgegen. „Die Botschaft der Bibel oder besser gesagt die Botschaft des Neuen Testaments ist auch für mich der beste Zugang zu Gott, den ich kenne. Aber wir können die Botschaft doch nicht genau so erzählen wie vor zweitausend Jahren.“
„Aber“, warf ich ein, „ich höre von den Bischöfen immer, der Glaube darf nicht dem Zeitgeist unterworfen werden.“
Sebastian konterte sofort: „Aber die Evangelien sind doch dem Zeitgeist unterworfen, nämlich dem der Juden vor zweitausend Jahren. Stell dir vor, Jesus hätte mit dem Wissen, mit den Bildern und der Sprache von heute gesprochen. Kein Jude hätte ihn damals verstanden.“
„Ah, und du meinst, uns geht es heute umgekehrt genauso.“
„Ja, natürlich! Wer kann denn zum Beispiel heute noch etwas mit dem Begriff Messias etwas anfangen. Für die Juden von damals dagegen war dieser Ausdruck völlig geläufig, und Jesus war ja nicht der Einzige, der von sich gesagt hat, dass er der Messias sei und die losen Enden des Alten Testaments zusammenführen muss.“
So ganz war ich nicht überzeugt. „Aber die Priester in ihren Predigten versuchen doch regelmäßig, die Inhalte auf unsere Zeit zu übertragen und betonen, wie aktuell das alles ist.“
„Das ändert nichts daran, dass die Geschichten immer noch erzählt werden wie vor zweitausend Jahren, ohne den Versuch, sich auf die wesentlichen Kernbotschaften zu konzentrieren und sie so in die heutige Zeit zu bringen, dass die Menschen etwas mit ihnen anfangen können.“
„Aber wollen denn die Menschen überhaupt etwas damit anfangen?“, fragte ich zurück. „Was ich meine, ist … sind die Menschen heute noch religiös?“
Sebastian zuckte mit den Schultern. „Nenn es, wie du willst. Ich kenne viele Menschen, die sich immer wieder mit den grundlegenden Fragen beschäftigen. Wo kommen wir her? Was wird aus uns nach dem Tod? Gibt es ein höheres Wesen, das für uns als Einzelne wichtig ist? Und ich kenn auch ganz viele Menschen mit einer gehörigen Portion Gottvertrauen, und wenn es nur das Zutrauen ist, dass ein Schutzengel auf sie aufpasst.“
„Okay – und du meinst also, die Menschen verstehen die Kirche nicht mehr?“, fragte ich und war gleichzeitig verblüfft darüber, wie schnell sich unser Gespräch vertiefte. Immerhin, wir kannten uns ja kaum.
„Die Kirche – das ist sehr pauschal formuliert. Natürlich gibt es in der Kirche sehr viele modern denkende Menschen und natürlich gibt es in vielen Ortskirchen Menschen, die Gottes- und Nächstenliebe so leben, dass die Botschaft des Glaubens lebendig wird und leicht zu verstehen ist. Sie tun das zum Beispiel durch caritative Aufgaben, über Jugendarbeit oder, indem sie alte oder benachteiligte Menschen unterstützen. Aber wenn du in den Gottesdienst gehst oder die offiziellen kirchlichen Verlautbarungen liest, dann scheint vor allem wichtig zu sein, dass sich nichts verändert, und das heißt, dass alles möglichst so bleiben soll, wie es schon vor zweitausend Jahren war.“
„Übertreibst du jetzt nicht etwas?“, warf ich ein. „Es hat sich doch immer wieder auch etwas bewegt, zum Beispiel mit dem zweiten vatikanischen Konzil.“
Sebastian war damit offensichtlich gar nicht einverstanden: „Wenn ich übertrieben formulieren würde, würde ich sagen, die Kirche hat gerade einmal zähneknirschend akzeptieren müssen, dass die Erde keine Scheibe ist. Und mit der Zeit wurden über die Evangelien noch zusätzlich kirchliche Dogmen und theologische Lehrmeinungen gehäuft, die, einmal beschlossen, auch nie mehr geändert werden dürfen.“
„Aber“, warf ich ein, „Gott verändert sich doch auch nicht.“
„Schau, wenn ich Gott als Schöpfer dessen betrachte, was wir alles wahrnehmen und was sich über Jahrmilliarden entwickelt hat, dann kann ich nur gläubig staunen. Wenn ich aber im Alten Testament lese, wie Gott sich variantenreich mit seinem Volk Israel gestritten hat, dann passt das für mich einfach nicht zusammen.“
„Aber Jesus hat doch an diesem Gottesbild ganz wesentliche Dinge verändert“, hielt ich dagegen.
„Ja, das hat er, aber er hat auch vieles nicht verändert, weil es dem Wissen der damaligen Welt entsprach. Und so wird es bis heute überliefert. Und anstatt zu entrümpeln und die wichtigen Botschaften in den Vordergrund zu stellen, wird der Berg dessen, was den Kern verschleiert, immer größer“, kam er wieder auf den vorherigen Punkt zurück.
„Und du denkst, deshalb verstehen die Leute die Kirche nicht mehr?“
„Über Jahrhunderte hinweg ging es der Kirche meiner Meinung nach vor allem darum, die Leute in die Kirche zu bringen, anstatt zu versuchen, ihnen zu helfen, Gott näher zu kommen. Wenn die Menschen aber nicht mehr verstehen, was ihnen die Kirche zu sagen hat, müssen sie sich selbst auf die Suche nach Gott machen.“
„Bedeutet das dann nicht, dass sich jeder seinen Gott selbst zurecht schnitzt?“
Das ließ Sebastian nicht gelten. „Den Vorwurf hör ich zwar immer wieder, aber ich empfinde das nur als den Versuch abzublocken. Wenn sich Menschen ehrlich auf die Suche nach Gott machen, und diese Suche in der Kirche ja scheinbar sehr befürwortet wird, dann muss die Kirche doch auch akzeptieren, dass jemand, der sucht, auch findet – zumindest ein Stück weit. Die Kirche möchte aber, dass bei allen Menschen die Suche an demselben Punkt endet, nämlich bei der Lehre der Kirche. Das halte ich für extrem inkonsequent, um nicht zu sagen für überheblich.“
Es kehrte ein bisschen Stille ein. Ich musste erst verarbeiten, was Sebastian mir gesagt hatte. So hatte ich das bisher noch nie gesehen, aber irgendwie hatte er recht. Wenn man wie ich fünfzig Jahre in und mit der Kirche gelebt hat, dann hinterfragt man so manches nicht mehr und arrangiert sich mit vielem. Aber auch wenn man nicht immer über alles genau nachdenkt, entwickelt sich aus den vielen Berührungspunkten mit religiösen Inhalten doch einiges, das einen im Denken und im täglichen Leben beeinflusst.
Wenn ich aber auf Menschen schaue, die um einiges jünger sind als ich, oder auf Leute, die nicht in der gleichen Weise mit dem Glauben aufgewachsen sind wie ich, weil das im Elternhaus keine so große Rolle gespielt hat, dann verstehe ich schon, dass viele Themen in der Kirche, gerade theologische Fragen, eher ein leichtes Kopfschütteln auslösen als eine ernsthafte Auseinandersetzung mit ihnen.
Bisher dachte ich, dass dieses sich distanzieren von der Kirche in erster Linie an fehlendem religiösem Grundstock, den Menschen mitbekommen oder aufgebaut haben, liegt. Nach dem, was Sebastian sagte, lag der Grund aber eher an der Verpackung der Botschaften, oder besser gesagt daran, dass die Botschaften hinter all den Umrahmungen und Schleifchen kaum mehr zu erkennen sind.
„Aber Sebastian“, wendete ich mich ihm wieder zu, „haben sich in der Kirche auf der Grundlage der Kernbotschaften nicht doch Leitlinien entwickelt, die dem Christenmenschen zu unterscheiden helfen, was er tun und was er besser lassen sollte?“
Sebastian lachte. „Ich bitte dich, Klaus, wenn die Kirche im Laufe der Jahrhunderte irgendwo versagt hat, dann als Instanz für Gut und Böse.“
„Ja, ich weiß“, gab ich zu, „du meinst sowas wie die Hexenverbrennungen, aber solche Dinge sind doch längst vorbei.“
„Die Reihe der spektakulären Schauerlichkeiten ist ziemlich lang. Denk nicht nur an die Hexenverbrennungen, denk an die Kreuzzüge, denk daran, wie wild es manche Päpste getrieben haben, denk an die Glaubenskriege zwischen Katholiken und Protestanten, denk an den Ablasshandel, den die Kirche als Gelddruckmaschine genutzt hat, denk …“.
„Es reicht, ich habe es verstanden“, sagte ich, „ich bin ja schon ruhig. Aber all das ist doch wiklich schon einige Zeit vorbei, oder?“.
„Die Kirche hat an Macht und Einfluss verloren und damit sind auch die Gelegenheiten zu solchen extremen Auswüchsen weniger geworden. Denk aber auch an die weniger spektakulären Untaten. Wie viele Menschen wurden seelisch zerstört, weil die Kirche über sie geurteilt hat. Wie viele Menschen wurden durch Exorzismen gequält, wie viele Menschen wurden auf Wege gezwungen, die nicht die ihren waren. Und schau nur hin, das ist heute nicht anders. Wenn du hörst, wie kirchliche Obere über Homosexuelle reden, wie Angestellte behandelt werden, die es wagen, ein zweites Mal zu heiraten, wie mit Priestern umgegangen wird, die sich zu einer Frau bekennen – das Grundmuster ist immer noch dasselbe.“
„Was genau meinst du mit Grundmuster?“, hakte ich ein, weil ich angesichts des Tempos unserer Unterhaltung langsam schwindlig wurde.
„Das Grundmuster ist, dass sich die Kirche nach wie vor als Instanz für Gut und Böse sieht, per Definition festlegen will, was gut und richtig ist, und damit eine ungeheure Machtposition beansprucht. Auf der anderen Seite passen die kirchlichen Lehrmeinungen in vielen Themen nicht mehr mit dem ethischen Grundverständnis der meisten Menschen zusammen. Nimm nur zum Beispiel die Rolle der Frau in der Kirche. Wenn für dich als gebildeter, weltoffener Mensch die Gleichberechtigung von Mann und Frau als ethischer Grundsatz gesetzt ist, und du dann siehst, wie das in der katholischen Kirche gehandhabt wird, dann wirst du entweder schizophren oder du hast ein inhaltliches Problem.“
„Aber“, entgegnete ich etwas unsicher, „in der evangelischen Kirche gibt es doch das Mann-Frau-Thema in dieser Form nicht, und trotzdem wenden sich auch hier so viele Menschen von der Kirche ab.“
„Ja, weil das eben nur eins von vielen Themen ist, die inzwischen an die Oberfläche kommen. Das grundsätzliche Problem für mich ist, dass die Kirche nicht versucht, den Kern des Glaubens an Gott zu vermitteln, sondern die Schale um den Kern immer dicker und immer unverständlicher macht und nicht einmal faule Stellen entfernt. Und dann bekommt man noch das Gefühl vermittelt, wer die Schale nicht mag, ist es nicht wert, an den Kern zu kommen, und damit hab ich halt mein Problem.“
Das alles war doch ziemlich viel auf einmal und so saß ich etwas erschlagen neben ihm.
Er schien das sehr schnell zu spüren. „Jetzt war ich ein wenig heftig, gell, aber du hast mich ja danach gefragt.“
„Nein, nein“, antwortete ich. „Ich bin es nur nicht gewohnt, so offen über Glaubensdinge zu sprechen, und dann auch noch mit dir, also mit jemandem, den ich eigentlich bisher nur ganz flüchtig gekannt habe. Komisch eigentlich, über so viele frühere Tabuthemen können wir heute ziemlich unbefangen sprechen, aber mit dem eigenen Glauben ist es immer noch schwierig.“
„Ja“, sagte er, „ich bin mit meinen Gedanken meistens auch allein.“
Die Zeit war wie im Flug vergangen und schon öffnete sich die Kirchentür und die Besucher des Gottesdienstes strömten heraus. Manche kamen gemächlich heraus, die meisten aber bestrebt, möglichst schnell ins Freie zu kommen.
Unvermittelt erinnerte ich mich daran, als ich vor einigen Jahren zusammen mit einer Freundin beim Schifahren war. Wir hatten uns am Skilift angestellt und sie war um einiges schneller vorwärtsgekommen





























