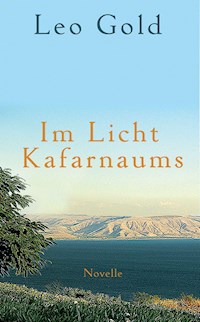Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Julius möchte sich seiner Arbeitswelt anpassen. Es glückt ihm nicht. Und so erinnert er sich an sein altes Hobby: Geschichten zu schreiben. Hierbei fühlt er sich wohl. Es bannt ihn und wird zu einer verlockenden Alternative seines Berufsalltags. Dank einer frohen Nachricht kann er schließlich hauptberuflich 'Gottes kleiner Partner' werden.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 360
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Leo Gold
Gottes kleiner Partner
Roman
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
Vorbemerkungen
Einleitung
1
1a
2
2a
3
3a
Schluss
Impressum neobooks
Vorbemerkungen
Die Figuren und die Handlung sind erfunden.
„Und es kam der Tag, da das Risiko, in der Knospe zu verharren, schmerzlicher wurde als das Risiko, zu blühen.“ Anaïs Nin
Einleitung
Nur noch eine Nacht trennte Julius vor dem Anfang eines neuen Lebensabschnitts. Schon als Kind mochte er diese Abende nicht. Er fragte seine Eltern, was auf ihn zukommen würde, was er können, was er machen müsse. Seine Eltern, die keine Hellseher waren, konnten ihm keine abschließende Antwort geben. Sie sagten einfach:
„Du wirst das schaffen!“
Als Julius älter wurde, in die Pubertät kam, später die Volljährigkeit erlangte, an diesen Abenden begleitete ihn immer die Sorge vor dem Unbekannten. So rätselte er beispielsweise, wie er sich angemessen kleiden solle.
Bei seinem neuen Arbeitgeber wollte er nicht zu schick erscheinen. Das hätte für die Kollegen bedeuten können, er sei ein Streber. Zu sportlich wollte er aber auch nicht wirken. Bis vor kurzem hatte er sich darüber keine Gedanken machen müssen. Traf er im Architekturbüro oder auf der Baustelle Kunden, trug er einen Anzug und ein weißes Hemd. Ansonsten war er leger gekleidet.
So betrachtete er sich an diesem Abend mit und ohne Krawatte. Was passte besser? Für eine brauchbare Antwort hätte er seine neuen Kollegen schon kennen müssen. Seine Frau Rosa konnte ihm ebenfalls keinen verlässlichen Rat geben. Also verschob er seine Entscheidung auf den kommenden Morgen.
Nach dem Aufstehen ließ er den Schlips im Schrank hängen. Froh, diese erste Hürde genommen zu haben, goss er in der Küche heißes Wasser auf lösliches Kaffeepulver, schmierte ein Marmeladenbrot, halbierte eine Kiwi und schaltete das Radio an. Als er sich an den kleinen Tisch vorm Küchenfenster setzte, hörte er eine Eilmeldung: Osama bin Laden sei bei der Erstürmung einer Villa in Pakistan getötet worden. Der Leichnam werde noch am selben Tag auf See bestattet. Ein Video der Aktion sei gedreht worden. Der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika, der Vizepräsident, die Außenministerin wie enge Berater und Vertreter des US-amerikanischen Militärs hätten das Geschehen live aus dem Weißen Haus mitverfolgt.
Julius war noch schläfrig und brauchte länger als die Nachrichten dauerten, um das Gehörte zu verstehen. Er hatte nicht mehr daran geglaubt, dass sie bin Laden fassen würden. Dass sie ihn gleich wieder einer anderen Instanz unterstellten, kam ihm vor, als fürchteten sie, mit ihm als Gefangenem überfordert zu sein. Seit beinahe zehn Jahren war ihre Suche missglückt. Und jetzt an Julius erstem Arbeitstag töteten sie bin Laden, der die freie Welt mit dem Attentat auf das World Trade Center in Schrecken versetzt hatte.
„War die Welt nun freier? Oder handelte es sich um ein Hydra-Phänomen? Wurde ein Kopf abgeschlagen, wuchsen zwei neue nach.“
Es war zu früh am Morgen, darüber nachzudenken. Julius musste zum Bahnhof gehen.
Drei Wochen vor seinem ersten Arbeitstag hatte er den Wohnort gewechselt. Er zog vom Süden in den Norden Deutschlands. Endlich wollte er den Alltag wieder mit Rosa verbringen. Ein gutes Jahr lang musste er zwischen München und ihrer Heimatstadt pendeln, wo sie eine Grundschule leitete.
Sein Umzug und beruflicher Neuanfang stieß in seinem Familien- und Freundeskreis auf ein geteiltes Echo. Die Eltern fanden es bisher schön, sagen zu können, ihr Sohn arbeite beim Architekturbüro Schulz & Adler. Auch schon vor seiner Anstellung als Architekt konnten seine Eltern zufrieden über seine aktuelle Beschäftigung erzählen.
Seine künftige Anstellung bei einem kirchlichen Verband hingegen, die zunächst auf zwei Jahre befristet war, konnte sie neuerdings in eine Bredouille bringen. Die meisten Bekannten erkundigten sich nicht extra nach Julius Beruf. Sie gingen davon aus, dass er den gut dotierten Posten nicht gegen einen schlechter bezahlten und zeitlich begrenzten aufgeben würde.
Es gab aber auch ‚Inquisitoren‘. Dies waren Eltern, die es schon lange vermieden, über den Beruf ihrer Kinder zu sprechen. Aus Scham und Neid hofften sie, dass auch die Eltern, die bislang mehr Glück mit ihren Kindern gehabt hatten, eines Tages ihre Situation ertragen müssten. Vor diesen ‚Inquisitoren‘ führten Julius Eltern die Gründe für seine Entscheidung an, die sie selbst nicht für vernünftig hielten, die sie ihm zu Liebe jedoch so geschickt wie möglich darstellten.
Nach ungefähr fünf Jahren wollte Julius einfach nicht mehr für das Architekturbüro arbeiten. Alles war zu Routine geworden. Zusätzlich belastete ihn das Verhalten zweier Kollegen. Er meinte, sie nützten seine Nachsicht aus. Die Respektlosigkeiten machten ihn dünnhäutig. Immer öfter schweiften seine Gedanken in Tagträume ab und sammelten sich bei einem Bedürfnis, das er in der jüngeren Vergangenheit verdrängte:
Nachdem sich Julius in eine Frau verliebt hatte, prüfte er geduldig das Für und Wider heraus. Das kostete Zeit. So viel, dass sich in der Regel die Selbstzweifel der davon betroffenen Frauen vergrößerten, bis sie früher oder später nicht mehr warten wollten. Die erste Ausnahme seiner Mitschülerinnen bildete Bea. Ihre Selbstsicherheit ertrug den Siebvorgang bis zum Schluss. Sie führte aber letztlich auch dazu, dass sie nach dem Abitur die dreijährige Beziehung beendete. Denn sie hatte für sich erkannt, was von manchen Feministinnen wie folgt formuliert wurde: „Frauen brauchen Männer wie Fische ein Fahrrad.“
Aus Liebeskummer flüchtete sich Julius ins Studium. Er genoss es, sich dabei selbst zu vergessen. Diesem Zustand, den einige Liebschaften unterbrachen, blieb er auch während seines Promotionsstudiums treu. Erst anschließend reihte er sich wieder in den lustigen Reigen ein. Sechs Monate vergingen, bevor die lose Bekanntschaft zu Melissa eine feste Form annahm. Und nur anderthalb Jahre später versprachen sie vor Gott, füreinander da zu sein. Jetzt hoffte er, dass sie sich in Ruhe aneinander gewöhnen und mit der Zeit ein passables Ehepaar abgeben würden. Stattdessen löste sich ihre Verbindung auf tragische Weise auf: Melissa starb an Krebs.
So eine tiefgreifende Erfahrung hatte Julius bis dato nicht bewältigen müssen. Es fehlte nicht viel und er hätte einen Psychologen konsultiert. Aber etwas, das im Verborgenen blieb, hielt ihn davor zurück. Er zog es vor, über Melissas Tod zu schreiben und sich das Schicksal selbst zu deuten. Es klappte. Und deshalb ließ sich das schmerzhafte Kapitel seiner Biographie am Schluss der Aufzeichnungen schließen. Erleichtert setzte er seinen Weg fort, der ihn zu einer neuen Frau führte.
Rosa hieß ihr Name. Julius saß in einem Flugzeug, in das die letzten Passagiere einstiegen, ehe es von Frankfurt nach Palma de Mallorca abhob. Stumm bat er, dass sich kein Fluggast neben ihn setzen möge. Erst als Rosa in sein Sichtfeld trat, kehrte sich sein Wunsch ins Gegenteil.
Mit jedem Schritt, den sie sich näherte, wurde sein Zeitgefühl verlangsamt. Sie trug einen weißen Rock. Die Flip-Flops aus braunem Leder wie die geflochtene Badetasche passten, anders als ihre schwarze Hornbrille, zu ihrem Sommeroutfit. Rosa blieb eine Reihe vor ihm stehen und sagte zu dem Mann, der am Fenster saß:
„Schade. Ich dachte, ich hab einen Fensterplatz. Naja, muss ich mich halt hier hin setzen“, worauf der Mann bereitwillig seinen Platz mit ihr tauschte. Sie bedankte sich für sein Entgegenkommen, streckte sich, um ihre geflochtene Tasche in die Gepäckablage zu legen, und setzte sich ans Fenster.
Rosas Sitznachbar, den Julius auf Anfang sechzig schätzte, redete während des gesamten Flugs auf sie ein. Er erzählte viel und stellte viele Fragen. Auch bei der Ankunft hatte Julius keine Chance, Rosa anzusprechen. Der Sitznachbar umlagerte sie wie ein eifersüchtiger Ehemann. Er begleitete sie zum Gepäckband, schaute ihn streng an und winkte am Ausgang ein Taxi für sie herbei.
Julius rechnete nicht damit, dass er Rosa wieder sehen würde. Doch drei Tage später betrat sie ein Restaurant in Santa Ponça, in dem er an einem Fensterplatz zu Abend aß.
Ihren weißen Rock hatte sie mit weißen kurzen Hosen getauscht. Ihren Oberkörper bedeckte ein marineblaues Top. Die Flip-Flops aus Leder wie die Hornbrille zerstreuten seine restlichen Zweifel, ob es sich um Rosa handelte. Zögerlich lief sie zu seinem Tisch.
„Hallo. Ich hab sie grad von draußen hier essen sehen. Kann ich mich zu ihnen setzen?“
„Gerne. Nehmen sie Platz!“, antwortete er und fuhr ironisch fort: „Jetzt haben sie ja schon wieder einen Fensterplatz bekommen“, worauf sie lachte und konterte:
„Man muss einfach die richtigen Männer kennen.“
Und so begann sich zwischen den beiden ein fröhliches Gespräch zu entwickeln, in dessen Verlauf Julius schwer verbergen konnte, wie gut sie ihm gefiel.
Als er bei der Verabschiedung keine Anstalten machte, ein weiteres Treffen zu vereinbaren, nahm Rosa das Zepter in die Hand.
Wie üblich dauerte es, weit über diesen Mallorca-Urlaub hinaus, bis sich Julius auf das Wagnis einer Beziehung einließ. Es vergingen zwei Jahre mit Höhen und Tiefen und kleineren Enttäuschungen. Und ein Jahr darauf wurde ihre Verbindung in einem Münchner Standesamt rechtskräftig geschlossen. Nach einem weiteren Jahr erhielt sie den Segen der römisch-katholischen Kirche.
Schon vor der Hochzeit deutete sich an, dass Rosa lieber in ihrer Geburtsstadt als in München wohnen würde. Ein Anruf nach den Flitterwochen stärkte ihren Wunsch. Eine alte Schulfreundin sagte ihr, die Stelle der Grundschuldirektorin sei frei geworden. Sie solle sich doch einfach auf den Posten bewerben. Vielleicht habe sie Glück. Sie hatte Glück. Doch damit gerieten sie und Julius in die Verlegenheit, wenige Monate nach der Hochzeit eine Wochenendbeziehung zu beginnen. Da sich auch bei Julius ankündigte, dass er nicht lange bei Schulz & Adler weiterarbeiten wolle, fiel es ihm leicht, Rosa zu ermutigen, die Chance in ihrer Heimatstadt zu ergreifen. Er wollte bald nachkommen.
So begann das Jahr, in dem sie sich nahezu ausschließlich an den Wochenenden sahen, und an dessen Ende Rosa ein Stellenangebot in der Zeitung fand, das sie Julius weiterleitete. Ein katholischer Wohlfahrtsverband suchte einen Leiter für die Bauabteilung. Als Voraussetzungen nannten sie eine „mehrjährige Berufserfahrung als Architekt“ sowie die „Identifikation mit der Lehre der katholischen Kirche“. Zwar erschienen Julius viele moralische Haltungen der apostolischen Kirche lebensfremd. Aber da er die Kirche für einen zuverlässigen Arbeitgeber hielt, bewarb er sich auf die Stelle und wurde zum Vorstellungsgespräch eingeladen.
Dort konnte er Direktor Saalfeld und Herrn Molitor von sich überzeugen. Und deren Not, sobald wie möglich die Stelle zu besetzen, ließ nur drei Tage später bei Julius das Telefon klingeln. Die Direktionssekretärin Frau Wolkow meldete sich und teilte ihm mit, er sei zum zweiten Vorstellungsgespräch eingeladen. Bei diesem werde neben Direktor Saalfeld statt Herrn Molitor der Vorsitzende des Verbands, Pfarrer Schatz, anwesend sein.
Direktor Saalfeld war äußerlich ein unauffälliger Mann. Seine Glatze wurde von einem weißen Haaransatz bekränzt. Dunkle Ränder untermalten seine Augen, ein Bauchansatz lugte aus seinem Jackett hervor und auf den einander zugewandten Innenseiten seines linken Zeige- wie Mittelfingers lag eine vom Kettenrauchen nikotingelbe Patina. Er lief etwas gebeugt und schaute oft skeptisch über den Rand seiner Lesebrille.
Pfarrer Schatz, dessen Hochdeutsch durch den in dieser Gegend verbreiteten Dialekt gefärbt wurde, war hochgewachsen, besaß eine stattliche Figur, graue, akkurat geschnittene Haare, markante Gesichtszüge und einen Schnurrbart. Lebensfroh, mit einem breiten Lachen hieß er Julius willkommen. Zur Begrüßung reichte er Julius seine rechte Hand und klopfte ihm mit seiner linken aufmunternd auf den Rücken, indes Direktor Saalfeld von seinem Schreibtisch zu ihnen gelaufen kam. So viel Leutseligkeit kannte Julius von seinen Kollegen bei Schulz & Adler nicht. Vielleicht liege es an den unterschiedlichen Mentalitäten oder an der unterschiedlichen Berufsgruppe, versuchte er sich den Unterschied zu erklären.
Nachdem er auch von Direktor Saalfeld begrüßt worden war und sie sich an einen Tisch in dessen Arbeitszimmer gesetzt hatten, bestimmte Pfarrer Schatz das weitere Gespräch. Julius ließ ihn reden und wartete ab, wann er ihm eine Frage stellte. Er hingegen schien darauf aus zu sein, dass ihn Julius bei seinem Monolog unterbrechen würde. Als er merkte, dass er Julius nur durch eine Aufforderung zum Sprechen bewegen könne, bat er ihn, ihm von seinen Eindrücken aus dem ersten Vorstellungsgespräch zu erzählen.
Julius antwortete ausführlich, abwägend und vermied, Ansatzpunkte zum Nachhaken zu setzen. Mit seiner Reaktion konnte Pfarrer Schatz wenig anfangen. Er liebte klare Worte. Akademische Differenziertheit und höfliche Zurückhaltung waren nicht seine Welt. Um Fahrt ins Gespräch zu bringen, fragte er:
„Lieber Dr. Zey, lassen sie es mich mal anders probieren. Sagen sie mir bitte, welche Aufgabe, die mit ihrer Tätigkeit als Leiter der Bauabteilung verbunden wäre, würden sie besonders gern, welche besonders ungern machen?“
Beim ersten Gespräch hatte Direktor Saalfeld Julius bereits die Aufgaben näher erläutert, die in der Stellenanzeige aufgelistet waren. Er sollte sich im Wesentlichen um alles kümmern, das mit dem Neu- und Umbau bzw. Abriss von Gebäuden des Wohlfahrtsverbands zu tun hatte. Und das hieß auch, die Entscheidungen darüber nicht selbst zu treffen, sondern sie in den verschiedenen Gremien durch Beschlüsse herbeizuführen. Zu der Abteilung, die er leiten sollte, gehörten ein weiterer Architekt, ein Bauzeichner wie eine Sekretärin.
„Wie ich schon im Gespräch mit Direktor Saalfeld und Herrn Molitor angedeutet habe, liegt mir die inhaltliche Arbeit sicher mehr als die Verwaltungstätigkeiten.“
Direktor Saalfeld, der sicher gehen wollte, dass Pfarrer Schatz am Ende des Gesprächs nichts gegen Julius Einstellung einwenden konnte, unterstützte ihn:
„Genau. Darüber haben wir ja schon gesprochen. Der Anteil an Verwaltungsarbeiten wird zu Beginn ihrer Tätigkeit vielleicht mehr als 30% ihrer Stelle betragen. Aber spätestens nach einem halben Jahr werden sie Routine sein und sie können sich verstärkt auf die bauliche Arbeit konzentrieren.“
Pfarrer Schatz spürte, dass Direktor Saalfeld bereits seine Entscheidung für Julius getroffen hatte und das Bewerbungsverfahren zügig abschließen wollte. Dadurch fühlte er sich herausgefordert. Den Personalvorschlag einfach abzusegnen, das war nicht seine Art:
„Schön und gut. Denken sie, sie können sich Direktor Saalfeld und den Gremien unterordnen, ihm und ihnen zuarbeiten, akzeptieren, wenn andere Entscheidungen getroffen werden, als sie sie für richtig halten? Oder wollen sie nicht lieber selbst der Direktor sein?“
„Es stimmt, dass ich bisher größtenteils eigenständig arbeiten durfte. Aber ich war weisungsgebunden und musste mich mit anderen absprechen. Klar, es gab Entscheidungen meiner Vorgesetzten, denen ich mich beugen musste. Da ist mir aber auch kein Zacken aus der Krone gefallen. Insgesamt haben wir kollegial zusammen gearbeitet. Die Hierarchie war mehr eine Formalität. Wenn es um die Sache ging, zählte das beste Argument, unabhängig davon, ob es vom Praktikanten, Bauzeichner, Kollegen, einem meiner Chefs oder mir kam. – Das Bild vom Staatsanwalt und Richter passt ganz gut. Ich bereite die Entscheidungsgrundlage vor und Direktor Saalfeld beschließt sie mit den anderen Gremienmitgliedern.“
„Der Vergleich gefällt mir“, sagte Pfarrer Schatz, um gleich darauf eine weiterführende Frage zu stellen, weil er weiterhin den Anschein vermeiden wollte, er würde Julius Anstellung zu früh seine Zustimmung geben:
„Wenn Direktor Saalfeld der Richter ist, welche Rolle schreiben sie mir zu?“
„Bei manchen Prozessen ist es ja üblich, dass es mehrere Richter gibt, von denen einer der Vorsitzende ist. Dieser wären dann sie.“
Da Pfarrer Schatz auf diese Antwort nicht gleich eine Reaktion einfiel, wechselte er das Thema:
„Wie sie sicherlich wissen, überschneiden sich die Sphären von Staat und Kirche in vielen Bereichen. Was denken sie darüber?“
Mit dieser Frage wollte Pfarrer Schatz Julius kirchliches Wissen testen. Dieser hatte wenige Monate zuvor einen Zeitungsartikel gelesen, der von dem Thema handelte, nach dem er nun gefragt wurde. Es wurde dargelegt, weshalb die Kirche überzeugt sei, mit weltlichen Gruppen nicht vergleichbar zu sein. Sie verstehe sich als Gemeinschaft ‚sui generis‘ (eigener Art). Julius verstand, dass die Kirche ihre Stellung durch die Betonung der Unterschiedlichkeit zu anderen Vereinen und Gruppen zu sichern versuchte.
Er wunderte sich aber, weshalb sich einige Verantwortliche der Kirche von der Welt abkehrten, anstatt auf sie zuzugehen und sich auf die Gemeinsamkeiten mit ihr zu konzentrieren und so unter Beweis zu stellen, dass sie die wahre Kirche Jesu Christi sei, wie es in dem Artikel hieß. Auf der Basis der Zusage Jesu Christi, die Kirche gehe nicht unter, könne sie doch gelassener auftreten, dachte Julius. Direktor Saalfeld schaute zu ihm und sagte:
„Pfarrer Schatz möchte ihre Kirchlichkeit testen. Passen sie auf!“
Pfarrer Schatz mochte es nicht, dass Direktor Saalfeld seinen Vorstoß entschärfte und entgegnete ihm:
„Sie brauchen unseren möglichen Kollegen nicht warnen! Er wird sich selbst verteidigen können.“
Julius erzählte den beiden, was er in dem Artikel gelesen hatte, ohne dessen Quelle zu nennen. Da er die Arbeitsstelle bekommen wollte, verwies er auf die Eigenständigkeit der Kirche gegenüber dem Staat und ließ bei der Zusammenfassung auch den Fachbegriff ‚sui generis‘ fallen.
„Sie sind ein aufmerksamer Zeitungsleser“, stellte Pfarrer Schatz fest, bevor er wissen wollte: „Ab und zu kann die Tätigkeit des Abteilungsleiters für Bauangelegenheiten auch stressig sein. Wie gehen sie mit Stress um?“
„Wenn es Stress gibt, bekomm ich hohen Blutdruck und versuch, das Problem, das ihn verursacht, so schnell es geht zu lösen.“
Pfarrer Schatz lachte. Er war froh, dass es seinen Provokationen endlich gelungen war, Julius die spontane Reaktion mit dem ‚hohen Blutdruck‘ zu entlocken. Er hakte nach:
„Und können sie abends abschalten und ruhig schlafen? Wir wollen nicht, dass sie wegen uns krank werden.“
Julius antwortete und log dabei:
„Ich schlafe wie ein neugeborenes Baby.“
Es war eine seiner Schwächen, dass er eben nicht abschalten konnte und mehrmals in der Nacht aufwachte, wenn ihn beruflicher Ärger belastete. Aber da Pfarrer Schatz genaue Antworten liebte und Julius in dieser Situation, hätte er die Wahrheit gesagt, diese hätte erklären müssen, zog er die Unwahrheit vor.
„Hoffentlich wie ein Neugeborenes ohne Koliken, lieber Dr. Zey! Jetzt lasse ich es dabei bewenden. Keine Sorge. Müssen wir noch mehr wissen?“, fragte Pfarrer Schatz Direktor Saalfeld, der kurz überlegte, bis er sagte:
„Ist es dabei geblieben, dass sie in zwei Monaten zum 1. Mai ihren Dienst antreten können? Die nächsten zwei Monate können wir überbrücken. Aber dann warten eine Menge Termine, für die wir Unterstützung brauchen.“
„Ja, der 1. Mai ginge.“
„Prima. Dann hab ich von meiner Seite keine weiteren Fragen mehr. Sobald wir unsere Entscheidung getroffen haben, ruf ich sie an.“
Noch am selben Abend, Julius saß gerade mit Rosa im Kino, klingelte sein Handy und Direktor Saalfeld teilte ihm mit, dass er sich auf die Zusammenarbeit mit ihm freue und im Namen von Pfarrer Schatz freundliche Grüße ausrichten solle.
1
Die Einfahrt des Zuges, der aus der nahen Großstadt kam, verzögerte sich. Aufgeregt schaute Julius auf die Uhr. Er wippte auf der Stelle hin und her, bis er die Spannung nicht mehr ertrug und anfing, den Bahnsteig entlang zu laufen.
Eine Frau fiel ihm auf. Sie trug einen beigen Frühlingsmantel. Aus einer Plastikflasche, die mit Wasser gefüllt war, trank sie einen kräftigen Schluck. Sodann schob sie die Flasche in ihre Umhängetasche und strich mit der Hand über ihren Mund. Sie passierend konnte Julius ihr Gesicht genauer erkennen. Es war schmal, hatte kaum sichtbare Lippen und kleine Augen, die in tiefen Augenhöhlen ruhten.
Nachdem der verspätete Zug an Julius Wohnort gestoppt und die Reisenden aufgenommen hatte, setzte er sich an ein Fenster. Er zog die Schuhe aus, stellte seine Tasche links neben sich, warf den Mantel darüber und legte seine Beine auf die Sitzfläche gegenüber.
Die Sonne bewegte sich noch hinterm Horizont. Julius hätte die zunehmende Geschwindigkeit des Zuges am liebsten gedrosselt. Eilig, nicht aufzuhalten, verließ er die Stadt. Die Gegend, durch die die Schienen führten, wurde weitläufiger. Die vorbeiziehenden Häuser der Kleinstädte und Dörfer standen hingegen zusehends dichter beieinander, je tiefer der Zug in die Provinz vordrang. Liebevoll hatten die Besitzer ihre Grundstücke gepflegt, Obstbäume, Gemüse und bunte Blumen gepflanzt.
Die Entfernung zur Bischofsstadt verringerte sich. An den Bahnhöfen mit ihren pastellfarben angestrichenen Gebäuden, dessen Fensterbretter Blumenkästen mit ausladenden Geranien schmückten, warteten laute Schülergruppen, die zum Gymnasium in der Bischofsstadt fahren wollten.
Vorbeugend nahm Julius seine Beine von der Sitzfläche und zog die Schuhe wieder an. Obgleich sich schon vereinzelt Schüler in den Gängen aufhielten, traute sich keiner von ihnen, sich neben ihn zu setzen. Sie musterten ihn in einer Mischung aus kindlichem Zutrauen wie zweifelndem Argwohn. Die Sorge überwog das Vertrauen. So suchten sie lieber weiter nach freien Plätzen. Am vorletzten Halt kam ein weiterer Schwung Schüler herein. Eine Jugendliche taxierte Julius. Dann fragte sie ihn, ob die Plätze noch frei seien und setzte sich mit ihrer Freundin dazu. Die zwei unterhielten sich wieder und beachteten ihn nicht mehr.
Als der Zugführer an der Endstation schließlich die Türen freigab, steigerte sich der Lärmpegel zum Höhepunkt. Johlend strömten die Schüler auf den Bahnsteig, indes die Berufspendler, die mit demselben Zug in gegensätzlicher Richtung zurück in die Großstadt fuhren, unruhig darauf warteten, ihre Lieblingsplätze zu besetzen.
Unweit des Bahnhofs war der Verband zusammen mit den Büros von Rechtsanwälten, Steuerberatern und Arztpraxen in einem mehrstöckigen Haus untergebracht. Seine rund 100 Angestellten arbeiteten in den obersten drei Stockwerken, Etage acht bis zehn.
Ein Drittel der Fläche des zehnten Stockwerks umfassten die beiden Büros von Pfarrer Schatz und Direktor Saalfeld sowie die zwei Vorzimmer, in denen die Chefsekretärinnen arbeiteten. Dieser Bereich war mit dunkelblau getönten Glaswänden uneinsehbar abgegrenzt. Auf dem verbleibenden Raum der Etage verteilten sich die Büros der anderen Direktionsmitarbeiter, die durchsichtige Glaswände voneinander trennten. Diese wurden in der Schallschutzversion eingebaut, so dass die Mitarbeiter akustisch ungestört arbeiten konnten.
Damit sie zudem optisch unbehelligt blieben, entwickelten manche Mitarbeiter einen beachtlichen Einfallsreichtum: Sie stellten im richtigen Winkel Flipcharts auf, um die Bildschirmfläche von fremden Blicken zu schützen. Bücherregale hielten ihnen den Rücken frei, was ihre Konzentration erleichterte, weil es ihren Fluchtreflex beruhigte. Hochwachsende, buschige Pflanzen positionierten sie zweckdienlich. Oder sie befestigten Poster von Verbandskampagnen mit Tesafilm an den Glaswänden.
Allein in den drei Büros der Abteilungsleiter waren silberne Jalousien installiert, die heruntergelassen waren. Auf der rückwärtigen Seite des Aufzugs, der sich in der Mitte der Etage befand, lag die sogenannte ‚Insel‘. In ihr befanden sich eine Küchenzeile, ein Tisch mit sechs Stühlen und das Damen- wie Herren-WC, die einzigen zwei Räume des Stockwerks, deren Wände aus Betonbausteinen gemauert waren.
Der Aufzug stoppte. Von einer freundlichen Frauenstimme wurde Julius informiert, in welchem Stockwerk er angekommen war. Die Lifttüren öffneten sich und sogleich schaute Direktor Saalfelds Sekretärin Frau Wolkow Julius ins Gesicht, die ihn willkommen hieß.
Julius folgte ihrer Lockenmähne ins Vorzimmer, wo sie ihm ausrichtete, dass sich Direktor Saalfeld verspäten werde. Julius solle sich inzwischen einfach ins Büro setzen, sie bringe ihm gleich einen Kaffee.
Von seinem Platz konnte er auf die Kathedrale blicken. Auf der anderen Seite des Büros eröffnete sich der Blick durch eine breite Fensterfront über die Bischofsstadt. Aus dem schlichten, funktionalen Büromobiliar stach ein Humidor in einem der Bücherregale hinterm Schreibtisch hervor. Dort lagerten diverse Utensilien, die Direktor Saalfeld für die fachmännische Zubereitung der Zigarren benötigte. Sie ähnelten chirurgischem Werkzeug, mit dem es die richtigen Schnitte zu machen galt, um die Zigarren so zu präparieren, dass sie den vollen Geschmack entfalteten und den sorgenreichen Alltag Direktor Saalfelds zeitweise ausblendeten.
„Guten Morgen, Dr. Zey!“
Direktor Saalfeld kam mit einem Rucksack auf dem Rücken und einem Fahrradhelm in der Hand kurzatmig in sein Büro gelaufen.
„Ich nehm immer die Treppen, damit ich fit bleibe. Sie haben schon einen Kaffee. Fein! Ich geh mir noch eben die Hände waschen. Dann bin ich wieder bei Atem. Und wir können loslegen.“
Julius hörte, wie Direktor Saalfeld Frau Wolkow bat, Kaffee zu bringen. Bevor er wieder zurück war, hatte sie seinen Wunsch erfüllt. –
„Jetzt hab ich wieder genug Luft. Das ist der einzige Nachteil meiner Raucherei. Hat mit dem Zug alles geklappt?“
„Ja, vielen Dank.“
Aus seiner Tasche holte er eine Aktenmappe, auf der Julius Nachname stand. Er ging zu der Fensterfront, von der er über die Stadt blicken konnte, atmete tief durch und sagte:
„Was für ein schöner Morgen!“
Er setzte sich zu Julius, trank einen Schluck Kaffee und begann, ihm das Wesen und die Funktion der wichtigsten Gremien des Verbands zu erklären: Hierzu zählten neben dem Vorstand das Verbandskollegium sowie die Sektions- und die Bereichsleiterkonferenz.
An einem Flipchart skizzierte Direktor Saalfeld die Hierarchie und Beziehungen der Gremien zueinander. Der Vorstand, dem Fachausschüsse wie der Bauausschuss zugeordnet seien, bestehe aus zwei hauptamtlichen Mitgliedern, Pfarrer Schatz und ihm selbst, und zwei ehrenamtlichen Mitgliedern, Frau Weißbart und Herrn Göbbels.
Das Verbandskollegium trage die Funktion eines Aufsichtsrats. In ihm seien alle für die regionalen Verbände sowie für den Diözesanverband wesentlichen Entscheidungsträger vertreten. Auf ihm, der zwei Mal im Jahr tage, träfen sich der Vorstand des Diözesanverbandes, die Sektions- und alle Bereichsleiter sowie pro Regionalverband zwei haupt- und ehrenamtlich Delegierte.
Unterhalb der Direktion mit ihren drei Abteilungen (Presse, Sozialpolitische Grundsatzfragen, Bau) sei die Verbandsverwaltung in sechs Sektionen eingeteilt, denen jeweils ein Sektionsleiter vorstehe. Sie versammelten sich jeden Freitag auf der Sektionsleiterkonferenz (kurz: SLK). Julius könne einfach an das gleichnamige Cabrio von Daimler Benz denken, um sich die Abkürzung zu merken, riet ihm Direktor Saalfeld. Frau Eichhorn führe die ‚Sektion Wirtschaft‘, Herr Molitor die ‚Sektion Personal‘, Herr Sonnenzweig die ‚Sektion Fortbildung‘, Frau Larson die ‚Sektion Kinder- und Jugendhilfe‘, Herr Karstrop die ‚Sektion Familienhilfe‘ sowie Herr Dankmeier die ‚Sektion Alten- und Behindertenhilfe‘.
In der Bereichsleiterkonferenz (kurz: BLK) kämen alle zwei Monate die Bereichsleiter der Regionalverbände in die Bischofsstadt und tagten mit Pfarrer Schatz und ihm. Sie fungierten zwar als Geschäftsführer eigenständiger Verbände, die aber als kirchliche Verbände in die kirchliche Hierarchie eingebunden seien.
Direktor Saalfeld sah, dass Julius Mühe hatte, die Informationen zu verarbeiten.
„Am Anfang ist es ein Sprung ins kalte Wasser. Davor kann ich sie nicht schützen. Sie müssen schauen, wie sie mit der Flut an neuen Namen und Aufgaben zu Recht kommen. Am besten sie nehmen sich in den ersten zwei Monaten abends und am Wochenende nicht viel vor und nutzen auch ihre Freizeit, um mit den ganzen Aufgaben vertraut zu werden. Je zügiger sie sich einarbeiten, desto lieber kommen sie ins Büro.“
„Ja, wie sie sagen, je schneller ich mich auf die Umstände einlasse, umso eher kann ich mich orientieren“, versuchte Julius etwas Verbindliches zu sagen.
Direktor Saalfeld fuhr fort, nachdem er das erste Blatt des Flipcharts nach hinten umgeklappt hatte, Julius von den Verbänden zu erzählen, mit denen der Verband zusammenarbeite. Als Direktor Saalfeld sagte, seine Ausführung zur Kooperation mit anderen Verbänden sei lediglich zur allgemeinen Information, ließ Julius Aufmerksamkeit nach. Er legte seinen Stift auf sein Notizheft und schaute Direktor Saalfeld nur noch interessiert an.
Wie stark Direktor Saalfeld den Konventionen des Verbandes wie den Denk- und Sprachmustern seines Umfelds anhing, zeigte seine Präsentation. Von den vielen Fachbegriffen und Abkürzungen, die er benutzte, fühlte sich Julius überfordert. Und in der Kürze der Zeit konnte er die eigentümliche Sprache nicht entschlüsseln.
„Ich hoffe, ich konnte ihnen einen ersten Überblick über unsere Kooperationspartner, den Aufbau des Verbands und die Gremien geben. Beim Bauausschuss müssen sie darauf achten, dass die Einladung mit der Tagesordnung rechtzeitig versandt, der Raum für die Sitzung gebucht und die Bewirtung sichergestellt wird. Welche Besonderheiten darüber hinaus berücksichtigt werden müssen, lernen sie peu à peu. Keine Sorge. Über die Details zum Bauausschuss unterhalten wir uns in der kommenden Woche. – Gut wäre der Montag.“
Direktor Saalfeld holte aus seinem Rucksack einen Taschenkalender.
„Montagnachmittag, 16 Uhr, ginge. Dann will ich ihnen noch eine ausführlichere Einführung geben. Und dann können wir über ihre Fragen reden, die sich bis dahin ergeben haben.“
„Wunderbar. Der Termin ist notiert. Jetzt bin ich gespannt, was heut noch auf dem Programm steht?“, fragte Julius.
„Eine Menge. Sie wissen ja, der erste Tag ist anstrengend. Jetzt machen wir erst einen Rundgang durch die Büros, damit sie alle Mitarbeiter kennen lernen. Um 13 Uhr ist Pfarrer Schatz im Haus, der sie bei ihm im Büro begrüßen möchte. Um 14 Uhr bitte ich sie, zu Herrn Molitor zu gehen. Herrn Molitor kennen sie ja bereits vom ersten Vorstellungsgespräch. Und um 15 Uhr habe ich alle Mitarbeiter der Bauabteilung in den Konferenzraum 9.02 eingeladen. Dann können sie sich dort einander vorstellen.“
Julius und Direktor Saalfeld liefen ins achte Stockwerk, das unterste der Verbandsverwaltung. Von dort gingen sie von Büro zu Büro, um am Ende wieder die oberste Etage zu erreichen. Die achte Ebene beherbergte die Angestellten der drei Sektionen Kinder- und Jugendhilfe, Familienhilfe sowie Alten- und Behindertenhilfe. Deren Leiter Frau Larson, Herr Karstrop und Herr Dankmeier besuchten gemeinsam eine Tagung, so dass sich Julius allein den vorwiegend weiblichen Angestellten vorstellte.
Im neunten Stockwerk waren die restlichen drei Sektionen Wirtschaft, Personal und Fortbildung untergebracht. Die zu ihnen gehörenden Stellen wurden ungefähr zu gleichen Teilen von Männern und Frauen besetzt. Auch sie vermittelten den Eindruck, dass jede Sektion sein Eigenleben pflegte und seinen speziellen Charakter gegenüber dem der anderen abzugrenzen suchte.
Herrn Sonnenzweig umgab eine Aura, die Julius – ohne esoterisches Pathos – als engelhaft vorkam. Er erhob sich beschwingt von seinem Schreibtischstuhl und kam federnden Schrittes auf die beiden zu. Mit kindlicher Begeisterung begrüßte er sie und bot ihnen einen Platz, Kaffee und Kekse an. Direktor Saalfeld wehrte die Gastfreundschaft von Herrn Sonnenzweig abrupt ab. Mit seinen Armen, die er mehrmals vor seinem Oberkörper von oben nach unten drückte, als ob er Herrn Sonnenzweigs Eifer zu Boden pressen wollte, sagte er ihm, er wolle ihm nur kurz Dr. Zey vorstellen. In den kommenden Tagen könne er sich mit ihm in Ruhe zusammensetzen und die Übergabe der Geschäftsführung des Bauausschusses vornehmen.
Nachgiebig akzeptierte Herr Sonnenzweig Direktor Saalfelds Anweisung und hielt Julius die Schale mit den Keksen hin:
„Wenigstens eine kleine Wegzehrung für den restlichen Rundgang. Ich schreib ihnen eine E-Mail, wann wir uns treffen können.“
Bei Herrn Molitor erfolgte Julius Vorstellung in der Knappheit, in der es sich Direktor Saalfeld erhofft hatte. Nach drei Minuten, guten Wünschen für den Arbeitsbeginn und der Bitte, um 14 Uhr zu ihm zu kommen, verließen sie ihn wieder.
Viele kräftige Männer- und zarte Frauenhände begrüßten Julius, bis sie schließlich vor Frau Eichhorn standen. Julius erkannte sie als die Pendlerin, die er morgens am Bahnhof getroffen hatte, die Frau mit dem Frühlingsmantel, die einen kräftigen Schluck Wasser aus einer Plastikflasche getrunken hatte. Sie kam hinter ihrem Schreibtisch hervor und schaute Julius unsicher an. Nachdem sie Direktor Saalfeld die Hand gab, wandte sie sich an Julius:
„Grüß Gott, Dr. Zey. Herzlich willkommen.“
„Grüß Gott, Frau Eichhorn“, antwortete Julius. Er überlegte kurz, ob er sie auf das morgendliche Zusammentreffen ansprechen solle.
„Kann es sein, dass wir uns am Bahnhof begegnet sind?“
Ehe Frau Eichhorn zur Antwort ansetzte, sagte Direktor Saalfeld:
„Stimmt. Sie wohnen in derselben Stadt. Und sie fahren auch noch beide mit dem Zug. Dann nutzen sie die Zeit am besten und reden dort über Geschäftliches.“
Direktor Saalfeld war klar, dass nicht jeder, wie er, jede Minute, die er im Auto oder Zug verbrachte, damit ausfüllte, per Telefon dienstliche Fragen zu klären. Frau Eichhorns Gesichtsausdruck verriet, dass sie, wie Julius, morgens im Zug lieber etwas anderes tat, als sich schon mit der Arbeit zu beschäftigen oder sich mit Kollegen darüber zu unterhalten. Da Frau Eichhorn nicht wusste, was sie auf Herrn Direktor Saalfelds Bemerkung antworten solle, sagte Julius:
„Das find ich prima, dass wir in derselben Stadt wohnen. Wir begegnen uns sicher öfters mal im Zug.“
Über Frau Eichhorns Mund huschte ein abgerungenes Lächeln. Sie schien froh zu sein, dass Julius Direktor Saalfelds Vorschlag ins Feld der Möglichkeit abgelenkt hatte. Um weitere persönliche Fragen zu verhindern und sich bald wieder hinter ihren Schreibtisch zurückziehen zu können, sagte sie:
„Ich glaub, ich hab sie am Bahngleis heute Morgen auch gesehen. In unserer Richtung fahren am Morgen ja nicht viele Leute zur Arbeit. Wir sehen uns da bestimmt mal wieder. Ich komme in den nächsten Tagen bei ihnen im Büro vorbei. Ich werde ihnen etwas über meinen Arbeitsbereich erzählen. Aber wir müssen nichts überstürzen.“
„Ich denke, sie sollten nicht zu lange mit der Einführung in ihren Arbeitsbereich warten, Frau Eichhorn“, sagte Direktor Saalfeld und fügte hinzu: „Ende dieser Woche sollte es spätestens erledigt sein.“
„Das kriegen wir hin“, sagte Frau Eichhorn, wonach sie erst Direktor Saalfeld, anschließend Julius, ihre Hand zur Verabschiedung gab. Sie kratzte sich an ihrem Hals und brachte die beiden zur Tür.
Direktor Saalfeld eilte mit Julius die Treppen in den zehnten Stock hinauf. Er hatte nicht mehr viel Zeit, Julius den Angestellten der Direktion vorzustellen. Sein nächster Termin stand kurz bevor.
Über die Sekretärinnen sagte Direktor Saalfeld, sie seien die Gruppe der Mitarbeiter, die sich über die drei Stockwerke am einheitlichsten zeige und die die Binnenidentität der Sektionen teilweise öffne. Ihre gegenseitige Treue verbinde sie. Viele von ihnen kämen aus dem nahe gelegenen, vom Katholizismus geprägten Landstrich. Und viele entsprächen dem sympathischen Typus einer katholischen, deutschen Frau mittleren Alters. Sie wären fleißig und legten Wert auf ein gepflegtes Äußeres. Zudem – und das sei ihre feinste Eigenschaft – trügen sie mit ihrer mütterlich menschlichen Art den entscheidenden Anteil daran, dass ein Mindestmaß an emotionaler Wärme in der Verbandsverwaltung nicht unterschritten werde.
Herr Liebig, der zweite Architekt, aß gerade ein belegtes Brötchen, als Direktor Saalfeld in dessen Büro trat, von Julius gefolgt. Herr Liebig war überrascht. In seinen Gedanken versunken hatte er die beiden nicht gesehen, wie sie durch die anderen Büros gelaufen waren. Wegen der Schallschutzglaswände, hier im zehnten Stock, konnte er sie auch nicht hören. Standen bei den anderen Mitarbeitern die Glastüren allesamt offen, bemerkte Julius erst, als Direktor Saalfeld die Glastür von Herrn Liebigs Büro hinter sich schloss, welche Wirkung die Schallschutzglaswände erzeugten. Es war mucksmäuschenstill. Wie einem Taubstummen erschien Julius die außerhalb liegende Büroszenerie.
Herr Liebig legte das Brötchen in eine Schreibtischschublade und beeilte sich, während sich Julius vorstellte, seinen letzten Bissen schnell zu zerkauen, dass er ihn hinunterschlucken konnte. Er sagte, er freue sich, zukünftig mit Julius zusammenzuarbeiten. Julius bedankte sich. Sie schwiegen. Direktor Saalfeld, der immer ungeduldiger wurde, erinnerte Herrn Liebig an die beiden Gespräche am Nachmittag, worauf sich alle voneinander wieder verabschiedeten.
Auf dem Weg ins Büro der Pressesprecherin erzählte Direktor Saalfeld, dass der Leiter der Abteilung für Sozialpolitische Grundsatzfragen, Dr. Himmelstingel, noch die nächsten zwei Wochen seinen Urlaub in der Toskana verbringe, sie also vor dem Ende des Rundgangs nur noch der Pressesprecherin Hallo sagen müssten, weil der Bauzeichner von Julius Abteilung – Herr Schuhmacher – an diesem Vormittag frei habe.
Die Pressesprecherin Frau Eisler war eine zarte Person, dessen Haupthaar hinter den beiden großformatigen Bildschirmen auf ihrem Schreibtisch, auf dem sich Zeitungen, Broschüren, Plakate und verschiedene Werbematerialien stapelten, hervorschaute.
Interessiert schaute Frau Eisler Julius an, während Direktor Saalfeld freundliche Worte über ihn sagte. Seine Frage, ob sie Julius neben dem Verbandspressespiegel auch den der Bischöflichen Verwaltung weiterleiten könne, setzte sie einem Dilemma aus. Sie äußerte zunächst ihre Bedenken wegen des Datenschutzes. Es sei bereits eine Ausnahme, dass sie als Externe den Pressespiegel der Bischöflichen Verwaltung erhalte. Letztlich sagte sie aber doch zu, Julius täglich beide Pressespiegel per E-Mail zuzusenden.
Julius war froh, als er das Büro von Frau Eisler verließ. Eine weitere Hürde seines ersten Arbeitstags, das Kennenlernen der Kollegen, hatte er übersprungen. Direktor Saalfeld sagte ihm noch, dass er in drei Monaten beim ‚Plenum‘ die Möglichkeit habe, sich vor allen Mitarbeitern vorzustellen. Das ‚Plenum‘ sei eine halbjährliche Veranstaltung, bei der sich alle Kollegen der Verbandsverwaltung träfen und über gemeinsame Fragen berieten. Sie vereinbarten, dass sie sich am Mittwochmorgen in Direktor Saalfelds Büro wiedersehen würden, um über die wichtigsten aktuellen Aufgaben zu sprechen. Den Dienstag solle Julius nutzen, sich in die Ordner einzuarbeiten und sich mit dem status quo vertraut zu machen.
Julius schloss die Tür seines Arbeitszimmers. Wie bei Frau Eisler und Dr. Himmelstingel, die beiden anderen Abteilungsleiter der Direktion, waren die Jalousien blickdicht verschlossen.
Er ließ sich auf den Schreibtischstuhl sinken, das Fenster im Rücken, vor dem sich das Stadtpanorama ausbreitete. Die ohrenbetäubende Stille, die er in Herrn Liebigs Büro das erste Mal bewusst erlebt hatte, schützte nun seine Innen- vor der Außenwelt.
Julius musste an eine Fischart denken, die er bei seinem letzten Zoobesuch entdeckt hatte. Es handelte sich um den ‚Indischen Glasbarsch‘ (Parambassis ranga). Zum Zwecke der Tarnung entwickelten sich seine Vorfahren zu ‚unsichtbaren‘ Fischen. Seine Haut war durchsichtig. Die Fressfeinde konnten durch den gläsernen Körper hindurchsehen und bemerkten ihn (im Idealfall) nicht. Da Julius vom Indischen Glasbarsch zuvor nie gehört hatte, blieb er lange vor dem Aquarium stehen und beobachtete fasziniert ein Exemplar dieser Gattung. Als hätte es ihm seinen Wunsch von den Augen abgelesen, kam es mehrere Male an die Glasscheibe geschwommen und wandte sich ihm seitlich zu, so dass er das Rückenmark, die Gräten, die Kiemen, sowie kurz hinter den Augen sein pulsierendes Herz erkennen konnte. Der Indische Glasbarsch hörte nichts, genauso wie Julius. Der Indische Glasbarsch tarnte sich, um nicht gefressen zu werden, genauso wie Julius. Der Indische Glasbarsch wählte die Unsichtbarkeit als Tarnung, statt sich wie andere Fische durch Farben oder Muster ihrer Umwelt anzupassen. Vielleicht solle er sich nicht durch das Herunterlassen der Jalousien verbergen, dachte er, sondern wie der Indische Glasbarsch durch die Sichtbarkeit unsichtbar werden.
Im Anschluss an die Mittagspause hieß ihn Frau Niekisch willkommen. Sie leitete das Büro von Pfarrer Schatz. Augenscheinlich liebte sie das Solarium oder reiste häufig in Länder, wo die Sonne häufiger schien als in Deutschland und ihre Haut auf natürliche Weise bräunte.
Frau Niekisch öffnete sich im Lauf des Gesprächs und vertraute Julius die wichtigsten Stationen ihrer Biographie an. Julius wunderte sich, dass sie, ohne auf die Zeit zu achten, lebhaft von sich erzählte. Die Uhrzeit, zu der der Termin mit Pfarrer Schatz hätte beginnen sollen, war überschritten. Vielleicht sei er noch nicht in seinem Büro und komme später, überlegte Julius. Und so hörte er Frau Niekischs Geschichte weiter zu.
Als diese in der Gegenwart angekommen war, sagte sie, Pfarrer Schatz lasse sich entschuldigen. Er werde bei einem Termin festgehalten, wolle aber am Mittwoch zu dem Gespräch mit Direktor Saalfeld hinzukommen.
„Jetzt haben sie ja noch etwas Zeit, bis zu ihrem nächsten Termin“, stellte Frau Niekisch fest, „erzählen sie doch etwas über sich. Sie wirken auf den ersten Blick ganz sympathisch!“
Frau Niekisch hatte also Zugriff auf Julius Kalender. Bereits bei seinem alten Arbeitgeber mochte er diese technische Einrichtung nicht.
„Bevor ich’s vergesse“, sagte Frau Niekisch, „nach dem Treffen mit den Mitarbeitern ihrer Abteilung kommt um 16 Uhr noch Herr Wardorf zu ihnen. Herr Wardorf ist der Leiter der EDV-Abteilung. Er wird ihnen eine Einführung in den Computer geben.“
Julius hoffte, dass dies der letzte Termin an seinem ersten Arbeitstag sein würde. Dann erzählte er Frau Niekisch von sich, wobei sie ihn milde anschaute.
Unsicher, ob er Frau Niekisch zu viel von sich preisgegeben hatte, ging er zu Herrn Liebig, der ihn bereits erwartete. Zusammen liefen sie in die neunte Etage zu Herrn Molitors Büro, sprachen auf dem Weg dorthin über dies und jenes, doch Julius Versuch, herauszufinden, weshalb sie sich in dieser Konstellation trafen, blieb erfolglos.
Herr Molitor besaß eine athletische Statur. Sein kurz geschnittenes schwarzes Haar saß so perfekt wie sein Anzug, sein weißes Oberhemd und die rote Krawatte. Der dichte Vollbart, in dem sich sichtbar die grauen Barthaare mehrten, wie seine kräftige Stimme bildeten äußere Zeichen seiner Männlichkeit. Stand er bei einer Unterhaltung nicht im Mittelpunkt, wie bei Julius erstem Vorstellungsgespräch, starrte er, den Kopf ein wenig nach rechts gelegt, auf einen unsichtbaren Punkt.
Dieses Treffen führte Herr Molitor dagegen unbestritten. Nachdem seine Sekretärin Tee und Kaffee gebracht und das Büro wieder verlassen hatte, weihte er Julius in den Grund für die Besprechung ein:
„Sie werden sich gefragt haben, warum wir uns mit ihnen gleich am ersten Arbeitstag treffen möchten. Es handelt sich um eine schwierige Personalie. Der Bauzeichner ihrer Abteilung, Herr Schuhmacher, ist wegen einer ominösen Erkrankung öfters krankgeschrieben als er uns zur Verfügung steht. In 2010 hat er bis auf wenige Wochen das ganze Jahr gefehlt. Darum mussten Herr Liebig und ihre Sekretärin Frau Maus alle anfallenden Arbeiten alleine erledigen. Das Problem ist nicht, dass jemand krank ist. Unser Verdacht hat sich aber erhärtet, dass Herr Schuhmacher ein vages Krankheitsbild vorschiebt.
Als Ursache vermuten wir schlicht Unzufriedenheit. Er macht seine Arbeit ungern, will sich aber auch nicht woanders einen Arbeitsplatz suchen. Folglich: Auch wenn er nicht krankgeschrieben ist, sind seine Arbeitsergebnisse ungenügend. Zudem ist er, lassen sie es mich salopp formulieren, bockig, uneinsichtig. In mehreren Gesprächen mit ihm konnten wir wenigstens erreichen, dass er in drei Jahren in Altersteilzeit geht. Aber bis dahin müssen wir mit Herrn Schuhmacher leben. Den einzigen Weg, diese Phase zu überstehen, ist eine ‚enge‘ Führung.“
Auch von Schulz & Adler kannte Julius Kollegen, die ihren Beruf ungern ausübten. Sie schleppten sich von Tag zu Tag zur Arbeit. Julius fand es gut, dass ihm Herr Molitor von den Schwierigkeiten mit Herrn Schuhmacher berichtete. Ob das aber gleich am ersten Arbeitstag hätte sein müssen, wusste er nicht.
„Stellen sie ihre Sicht der Dinge doch bitte auch mal dar, Herr Liebig! Dann kann sich Dr. Zey einen besseren Überblick über die Situation verschaffen.“
Herr Liebig hatte während Herrn Molitors Ausführungen still durch seine kreisrunden Brillengläser geschaut. Dabei war er allmählich auf der Sitzfläche seines Stuhles mit dem Gesäß nach vorn gerutscht, während sich sein Rücken an der Lehne nach unten schob. Direkt von Herrn Molitor angesprochen richtete sich Herr Liebig auf und schilderte die Problematik:
„Ich kann dem, was sie gesagt haben, nur beipflichten. Die Unzuverlässigkeit von Herrn Schuhmacher hat mich schlaflose Nächte gekostet. Die Arbeitsergebnisse, die er ablieferte, waren unbefriedigend. Seitdem wir die Zügel angezogen haben, läuft es eigentlich ganz gut. Mir ist freilich daran gelegen, dass das so bleibt. Sobald ihnen im Umgang mit Herrn Schuhmacher etwas negativ auffällt, bitte ich sie, es mir mitzuteilen. Ich möchte ihnen das in diesem Rahmen sagen, weil bei unserer Abteilungsbesprechung auch Herr Schuhmacher anwesend sein wird. Er hat sich heute Vormittag frei genommen.“
Julius merkte, dass Herr Molitor und Herr Liebig versichert werden wollten, dass er mit der von ihnen angewandten Strategie gegenüber Herrn Schuhmacher einverstanden sei und sich bereit erkläre, seinen Part dabei zu erfüllen. Er entschied sich, seinen Kollegen eine salomonische Antwort zu geben:
„Heut bin ich ja den ersten Tag hier und bin Herrn Schuhmacher noch nicht begegnet. Ich denke, ich muss zunächst mal sehen, wie er auf mich reagiert. Danke aber, dass sie mir vorab von dem Problem erzählt haben. So kann ich die Lage besser einschätzen. Danke auch für das Angebot, dass ich mich mit ihnen absprechen kann“, er blickte zu Herrn Liebig, „wenn ich wegen Herrn Schuhmacher Redebedarf hab.“
Herr Liebig und Herr Molitor waren mit der Antwort zufrieden.
Herr Molitor machte keine Anstalten, das Gespräch fortzusetzen. Stattdessen schwieg er. Da auch Herr Liebig nichts mehr sagte, führte Julius die Unterhaltung zu Ende:
„Ich schlag vor, dass wir uns in einem Monat noch mal zusammensetzen. Dann kann ich von meinen Erfahrungen mit Herrn Schuhmacher erzählen und wir sehen weiter.“
Julius setzte an aufzustehen, beobachtete, ob ihm Herr Molitor und Herr Liebig folgten, was sie taten, worauf die drei langsam über Belanglosigkeiten redend zur Bürotür gingen. Herr Liebig und Julius verabschiedeten sich von Herrn Molitor und gingen zusammen zu Konferenzraum 9.02.
Die Tür des Konferenzraums stand offen. Frau Maus war gerade dabei, das Treffen vorzubereiten. Eine Kaffee- und Teekanne, eine Dose mit Zucker, ein Kännchen mit Milch, kleine Flaschen mit Wasser und Organgensaft, Obst, Gebäck und Teilchen arrangierte sie zwischen vier Gedecken. Eines lag vor dem Platz am Kopf des Konferenztisches. Zwei befanden sich zu dessen rechter, das letzte zur linken Seite. Frau Maus hatte ihren Notizblock wie Schlüsselanhänger neben das Gedeck linkerseits gelegt. Somit war die Sitzordnung fast vollständig vorgegeben. Julius platzierte sich an den Kopf des Konferenztisches. Herr Liebig setzte sich an Julius rechte Seite und griff zum Telefon, um Herrn Schuhmacher wegen der Vorverlegung des Termins zu informieren.
Nach den Klagen über Herrn Schuhmachers Unzuverlässigkeit war Julius überrascht, dass es nur drei Minuten dauerte, bis er erschien, die Tür des Konferenzraums schloss, den Anwesenden zunickte und sich auf den Platz rechts neben Herrn Liebig setzte. Julius wartete noch einen Moment, dass Herr Schuhmacher seine Unterlagen vorbereiten konnte und eröffnete das Treffen: