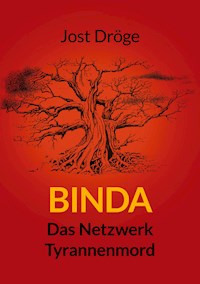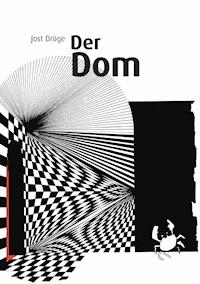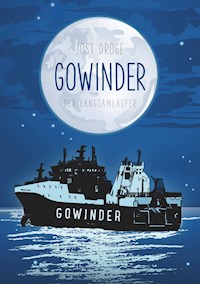
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Stille Wasser sind tief Ein Schiff, undefinierbaren Geschlechts und mit geheimnisträchtiger Vergangenheit, schwer beladen mit Hunderttausenden Fahrrädern für Kim Jong-un, stampft so behäbig wie unermüdlich von Norwegen über das Kap der Guten Hoffnung bis ins Chinesische Meer. Die Besatzung: ein Reigen ebenso skurriler wie tiefgründiger Gestalten - russische Offizierinnen, jugendliche Delinquenten, ein Bremerhavener Chinese und der griesgrämige Bordhund James T. Kirk. Über sie alle wacht Jan, der Fährmann, einst norddeutscher Provinz-Sozialarbeiter und nun unverhofft Herr der (oder doch des?) "Gowinder". Während die Wellen an den eisernen Bug gischten, kommen nach und nach die Geheimnisse einer altehrwürdigen Reederfamilie an die Oberfläche. Und als bei den jungen Punks John-Heiko und Joy-Charity die übersinnlichen Wahrnehmungen einsetzen, nimmt die Sache langsam Fahrt auf ... Hier lässt Jost Dröge den "Langsamläufer", dessen Dieselmotor mit geringer Drehzahl arbeitet, das Tempo vorgeben für seine Erzählung: Gleichermaßen langsam, gelassen, wohldurchdacht und mit feinem Sprachsinn skizziert, entfaltet sich eine phantastische Geschichte auf den Weltmeeren.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 474
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Über das Buch
Über den Autor
Prolog
Das Schiff
Kapitel 1
April 2016:
Kapitel 2
Oktober 2014 bis April 2016:
Kapitel 3
Dezember 2014 bis April 2016:
Kapitel 4
Im April 2016 bei Sturm bis Kirkenes:
Kapitel 5
Im Frühjahr 2016 nach Kirkenes:
Kapitel 6
Interlog 1:
Kapitel 7
Im Frühjahr 2016 auf dem Weg in die Welt:
Kapitel 8
Kurz vor dem Kap, Südafrika, Juni bis August 2016 (Winter auf der südlichen Halbkugel!):
Kapitel 9
Interlog 2:
Kapitel 10
Strandung:
Kapitel 11
Im Meer, Oktober/November 2016:
Kapitel 12
Interlog 3:
Kapitel 13
Surinam, Kokos- und Weihnachtsinseln, November 2016:
Kapitel 14
Jakarta bis Spratly Islands im November/Dezember 2016:
Kapitel 15
Joy-Charity, im Winter 2016:
Kapitel 16
Interlog 4:
Kapitel 17
Joy-Stick im tropischen Winter 2016/2017:
Kapitel 18
Interlog 5:
Kapitel 19
John-Heiko geht ins Jahr 2017:
Kapitel 20
Interlog 6:
Kapitel 21
Chester in der Jahreswende:
Kapitel 22
Interlog 7:
Kapitel 23
Epilog:
Über das Buch
Ein Schiff, undefinierbaren Geschlechts und mit geheimnisträchtiger Vergangenheit, schwer beladen mit Hunderttausenden Fahrrädern für Kim Jong-un, stampft so behäbig wie unermüdlich von Norwegen über das Kap der Guten Hoffnung bis ins Chinesische Meer.
Die Besatzung: ein Reigen ebenso skurriler wie tiefgründiger Gestalten – russische Offizierinnen, jugendliche Delinquenten, ein Bremerhavener Chinese und der griesgrämige Bordhund James T. Kirk.
Über sie alle wacht Jan, der Fährmann, einst norddeutscher Provinz-Sozialarbeiter und nun unverhofft Herr der (oder doch des?) „Gowinder“.
Während die Wellen an den eisernen Bug gischten, kommen nach und nach die Geheimnisse einer altehrwürdigen Reederfamilie an die Oberfläche. Und als bei den jungen Punks John-Heiko und Joy-Charity die übersinnlichen Wahrnehmungen einsetzen, nimmt die Sache langsam Fahrt auf …
Über den Autor
Autor Jost Dröge ist Diplom-Sozialpädagoge, hat Religionspädagogik, Philosophie und neuere deutsche Literatur studiert und schreibt seit seiner Kindheit. Bei BoD – Books on Demand veröffentlichte er die Romane „Tod in der Lune“ und „Eisbrandung“ (beide 2010), „Willbrock“ (2014) und „Der Dom“ (2017).
Hier lässt er den „Langsamläufer“, dessen Dieselmotor mit geringer Drehzahl arbeitet, das Tempo vorgeben für seine Erzählung: Gleichermaßen langsam, gelassen, wohldurchdacht und mit feinem Sprachsinn skizziert entfaltet sich eine phantastische Geschichte auf den Weltmeeren.
Prolog
Das Schiff
Februar 2015: Ich erwarb das Schiff als Langsamläufer. Später werde ich erklären, warum ich es mir überhaupt leisten konnte, also, rein finanziell! Denn ein richtiges, seetaugliches Arbeitsschiff zu kaufen, ist ja nun nicht einfach ein Shopping bei Aldi oder Ikea.
Ein Langsamläufer ist objektiv betrachtet keineswegs wirklich langsam, wie eine Schnecke oder ein Barsch (der langsamste Fisch der Weltmeere), er schafft immerhin acht oder neun Knoten, aber keine fünfzehn wie mittlere Läufer, zwanzig wie Passagierschiffe oder gar dreißig und mehr wie Schnellboote in der Marine oder im Sport. Zu motorlosen Seglerzeiten wurden Leinen ins Meer gehängt, wobei der Abstand der Knoten einer Leine die Fahrtgeschwindigkeit bestimmt. Merkwürdig, wie so etwas zu verbinden ist, aber es hat sich bis heute gehalten. Ein Knoten sind 1,852 Stundenkilometer – also fast siebzehn Stundenkilometer sind nicht wirklich langsam, z. B. für einen Fußgänger.
Aber egal. Ich benötigte ein Schiff, kein Boot, damit ihr das bitte nicht verwechselt. Ein Schiff eben, das durch die Weltmeere schiffen kann, nicht schnell, aber zielgenau, kein Hausboot, Tretboot oder U-Boot.
Ich fand einen Schlepper, um genau zu sein, einen Bulker-Carrier. Er lag am Kai seiner Heimat. In Brake. Gebaut wurde er Ende der sechziger Jahre auf der Lloyd-Werft in Bremerhaven, aber dann an den Lühringkai nach Brake geschleppt, wo er seither lag, ohne auch nur die Weser verlassen zu haben.
Familie Lühring ist eine große Reederfamilie der traditionellen Art, deren Enkel, mehrheitlich nun Urenkel noch immer eine Kaianlage als Immobilie ihr Eigen nannte.
Die Marianne, der Name der Tochter des Werftgründers Hinrich Lühring, war eines von den vier Schiffen, die dort lagen, kostenlos, eben weil die Kaianlage den Lührings gehörte, die nun endlich zur Versteigerung beim Amtsgericht Brake angemeldet werden konnten. Sie verursachten die vielen Jahre seit 1969 kaum Kosten, denn niemand kümmerte sich um sie, aber Gewinne warfen sie ebenso wenig ab.
Über vierzig Jahre vergingen. Die bisher anvisierten Versteigerungen, um dem Verfall ein Ende zu bereiten, verliefen ins Leere, weil die Erbengemeinschaft von Hinrich und Hedwig Lühring immer wieder vor dem Problem stand, dass die Haupterbin, ebenjene Marianne Lühring, nicht auffindbar war.
In den sechziger und bis Anfang der siebziger Jahre wurden Rohstoffe wie Erz, Holz oder Kies von A nach B verschifft, und dafür wurden Bulker und ein Carrier benötigt, der ebenjene Bulker zog. Dieses Schiff musste nicht unbedingt schnell, aber vor allem kraftvoll in seiner Zugleistung sein. Pferdestärken, auch wenn Pferde auf der Weser und keinem anderen Fluss, außer dem Nil natürlich, zweckdienlich waren.
Mittlerweile waren Bulker nicht mehr erforderlich, weil sie z. B. von KüMoS (KüstenMotorSchiffen), Ro-Ro-Schiffen (Roll-on, Roll-off) oder anderen (Ent-)Ladungssystemen abgelöst wurden. Die Reederei Lühring hatte sich von da an auf Spezialfrachtschiffe konzentriert und die Container taten ihr Übriges, den Bulkern den Todesstoß zu versetzen.
Das Vormundschaftsgericht der Gemeinde »Stadland« hatte nun, nach fast fünfzig Jahren, Marianne Lührings Tod testiert, so dass erst dadurch eine letztgültige Zwangsversteigerung der vier Schrottschiffe, drei davon motorlose Bulker, die Massengüter transportiert hatten, ermöglicht wurde. Die Jahre zuvor hatte die Erbengemeinschaft der Lührings immer wieder erfolglos versucht, Marianne Lühring zu finden. Bis 1999 hatte die Erbengemeinschaft überhaupt keine Chance, die Schiffe zu verkaufen, denn auch das Gründerehepaar Lühring galt bis dahin ebenfalls als vermisst.
1999 wurden die Unterböden der vier schwimmenden Altlasten erstmals wieder TÜV-geprüft. Man befürchtete, dass sie gar nicht mehr schwimmfähig waren und vielleicht zu sinken drohten. Das war bei den drei motorlosen Bulkern durchaus der Fall und sie wurden vom Amtsgericht zur Verschrottung freigegeben. Der Bulker-Carrier war jedoch erstaunlich intakt, was aber kaum noch eine Rolle spielte, als man bei diesen Arbeiten zwei Leichen fand, gemeinsam festgebunden am Anker des Schiffes, der offenbar schon vor vielen Jahren mit der Ankerkette in die Tiefe gelassen worden war, ohne dass es irgendjemandem aufgefallen war, denn am Kai liegend benötigt kein Schiff der Welt einen Anker.
Man war nach langwierigen Ermittlungen und ätiologischer Pathologie von Selbstmord des Reederehepaares Hinrich und Hedwig Lühring ausgegangen, denn die Skelette der beiden, die schließlich dreißig Jahre im Salzwasser verbracht hatten, gaben keine andere Erklärung preis. Die Tochter Marianne war jedoch nicht dabei und blieb verschwunden. Die Möglichkeit, dass diese den Tod ihrer Eltern verursacht hatte, veranlasste die Behörden lange Zeit, die Ermittlungen und damit die Suche nach Marianne Lühring aufrechtzuerhalten. Erst im Jahr 2015 entschied das Amtsgericht Stadland, sie für tot zu erklären, was die Erbengemeinschaft (60 bis 70 Menschen unterschiedlichen Alters, deren Zahl natürlich nach Geburten und Sterbefällen in den Jahren bis heute variierte) berechtigte, über die Mobilien zu verfügen.
Es war, wie gesagt, ein Langsamläufer mit acht bis maximal elf Knoten Spitzengeschwindigkeit. Das gefiel mir nicht wirklich, zwölf, dreizehn Knoten wären mir lieber gewesen, aber die Marianne war ein schönes Schiff.
Ein Arbeitsschiff, sicher, keine Teerkutsche wie die drei Bulker, die allmählich standortverschrottet wurden, weil man sie nirgendwo mehr hin transportieren konnte.
Sieben Personen waren anwesend bei der Versteigerung. Fünf vertraten Schrottfirmen – und tatsächlich wurde ich einmal überboten.
Sechstausendsiebenhundertfünfzig Euro musste ich bezahlen. Bei sechstausend hatte dieser Schrottmensch zweihundert drauflegen wollen. Keine Ahnung, warum.
Eine Vertreterin der Familie Lühring, die sich mit Dora Lühring vorstellte, aber keinen weiteren Mucks von sich gab, und natürlich der Auktionator.
Jedenfalls gehörte die Marianne nun mir, für 6 437,- € netto, plus Steuern, Auktions- und Gerichtsgebühren.
Ein Schiff, das ich aber nicht einfach nach Hause fahren konnte. Ich war kein Kapitän, kein Offizier, habe keine nautische Vorbildung, nix. Kein Patent der Seefahrt, als ich das Boot, sorry natürlich, das Schiff, übernahm.
Außerdem war der Langsamläufer äußerlich nicht wirklich gut gepflegt.
Der alte Dieselmotor war kräftig, aber unterölt, verteert und die zwölf Zylinder waren festgefahren. Ich brauchte neben einem Kapitän dringend einen, der sich mit Motoren auskannte, im Fachjargon einen Chief, der was mit dieser Maschine anfangen konnte. Ich wollte keine neue Maschine, nicht nur, weil ich sie mir nicht leisten konnte, sondern einfach deshalb, weil der Antrieb eines Schiffes auch seine, nein, ich glaube, ihre Seele ist.
Und eine Seele lässt sich nicht einfach austauschen, sie muss therapiert werden, mit Händchen und Schmierstoff.
Ich wusste damals nur, dass es sich um einen Zweitakter handelte, der eben bis maximal elf Knoten leisten konnte, aber mit 220 Umdrehungen bei einer Bohrung von 256 mm 320 Hubraumkubik vorlegte. Dafür hatte der Gegenkolbenmotor satte 654 PS vorzuweisen, das benötigte er auch als alter Bulker-Carrier – er musste in seinen jungen Jahren drei Bulker hintereinander ziehen können, was heute gar nicht mehr erlaubt ist.
Ich hatte als Kind »Das Totenschiff« von B. Traven gelesen und war seither begeisterter Seefahrer. Leider war unsere Familie ein »Seefahrergrab«, so dass ich hauptberuflich nicht Seefahrer werden durfte.
Das verhielt sich nämlich so: Unser Vater (ich habe zwei Geschwister) hatte zwölf Geschwister, acht Buben, vier Mädels. Alle Jungs waren damals irgendwie Seefahrer. Zwischen den Kriegen in der Fischfangflotte Bremerhavens, während der Kriege bei der Marine, auf U- und Schnellbooten, auf Fregatten und Versorgern. Fast alle Jungs waren irgendwie auf dem Meer geblieben, außer dem Jüngsten. Meine Großmutter hatte nämlich beschlossen, dass wenigstens der jüngste Sohn, also mein Vater, irgendetwas, vielleicht Hafenarbeiter, werden, aber auf keinen Fall zur See fahren sollte. Und mein Vater, der dann Kupferschmied auf der Lloyd-Werft geworden war (Kupferschmiede haben Grünspan am Arsch), hatte das Nichtzurseefahren als Grundgesetz der Nachkriegs-Familienhistorie eingeläutet, und zwar nicht wegen der Entscheidung meiner Großmutter, sondern weil meine Mutter Seefahrer, vor allem in Fisch, für ständig betrunkene Raufbolde hielt (ein impliziertes Vorurteil), dem ihre Söhne nicht verfallen durften.
So blieb meine Seefahrerei auf die Nächte und Tagträume am Meer beschränkt – bis ich mich in jenen Bulker-Carrier, Langsamläufer, verliebte, viele, viele Erkenntnisse und einige Jahrzehnte später, wie ihr euch denken könnt.
Ich kaufte ihn also und machte mich auf die Suche nach nautischem und schiffsbetriebstechnischem Personal.
Ich fand Nadja und Romika, aber davon später, resp. gleich sofort, im ersten Kapitel dieser narrativen Dokumentation werdet ihr sie kennenlernen.
Erst einmal hatte ich das Problem, ein Schiff zu haben, aber keine Parkgarage dafür. Die Erben der Familie Lühring in Brake fanden eine Lösung, die mir sehr zugutekam, jedenfalls musste ich das zu diesem Zeitpunkt annehmen. Sie einigten sich auf ein Raumordnungsprogramm mit der Gemeinde Stadland, dass eine neue Schwerlastkaje auf dem Gelände der ehemaligen Lühringwerft vorsah. Für meinen Langsamläufer konnte ich mit der Familie Lühring einen Liegeplatz aushandeln. Die Familie entschied dies allein aus dem Grunde, dass die Marianne, zwar nicht unter ihrem ursprünglichen Namen, denn ich hatte andere Vorstellungen, aber dennoch durch mich, wieder die Meere der Welt langsam durchpflügen würde – man wollte ihr Heimathafen bleiben. Für die Kaje in Brake hatte ich zwar einen jährlichen Obolus zu leisten, der aber im Vergleich zu Bremerhaven, Bremen oder Hamburg minimal war.
Ich unterschrieb bedenkenlos, ohne die vierundvierzig Seiten differenziert zu lesen, da ich nicht wirklich vorhatte, ein aktiennotiertes Wirtschaftsunternehmen zu werden.
Ich mietete mir eine kleine Wohnung in Brake, um nahe an der Marianne deren Innen- und Außenleben zu gestalten bzw. gestalten zu lassen. Als Erstes bekam es aber (innen und außen) einen neuen Namen: Gowinder!
Ich konstruierte mir aus diversen Materialien, die ich an Bord fand, eine Hängematte, mit der ich mich an die Bordwand zur Marianne hinunterlassen konnte. Das war mit Hilfe einer Flanschwinde einfacher, als ich gedacht hatte, und ich bin kein einziges Mal ins Hafenbecken gefallen. Ich nahm eine Rolle mit weißem Lack und tünchte Marianne über. Am nächsten Morgen vollzog ich einen Schwung schwarzer Buchstaben auf die frisch gezogene eiserne Leinwand:
Gowinder!
Kapitel 1
April 2016:
216 784 Fahrräder passen auf einen Langsamläufer! Das hätten wir nicht gedacht. Nadja, Romika und ich. Wir hatten einen Job von Nordnorwegen nach Nordkorea akquiriert.
Keine Ahnung, wie viele Container man benötigte, um 216 784 Fahrräder zu transportieren, viel mehr jedenfalls, als für die öffentliche Hand Norwegens zumutbar war.
Sorry, aber ich muss das erklären. Kein einziger Norweger und keine einzige Norwegerin durfte eins dieser Fahrräder in Norwegen auf die Straße bringen. Nicht nur, weil wegen Schnee und Eisglätte Norweger und Norwegerinnen sich eher auf snowboardähnliche Fortbewegungstechniken ausrichten, sondern weil sie auf Norwegens Straßen einfach nicht zugelassen waren und sind!
Nun, woher kommen sie – und warum durften wir ein solches Geschäft machen, denn wir erhielten einen ganzen Euro pro Fahrrad, unabhängig vom technischen Zustand, allein dadurch, dass wir sie an Bord nahmen! Und noch einmal je einen Euro, wenn wir sie relativ heil im Delta von Taedong-gang, genauer gesagt in Nampo, Nordkorea, ablieferten.
Sie zu vernichten wäre vielleicht billiger gewesen, aber das duldete das Grunnloven, also das norwegische Grundgesetz, nicht – Fahrräder sind zwar keine schützenswerten Kulturgüter, gerade bei Nationen, die in neun von zwölf Monaten Schlitten bevorzugen würden, aber sie bestehen aus Rohstoffen, die entweder recycelt oder ihrem ursprünglichen Zweck wieder zugeführt werden mussten.
Diese Fahrräder kamen jedoch von Neubürgern! Ja, wirklich, von Flüchtlingen aus dem nahen, na ja, für Norwegen doch wohl eher aus dem fernen Osten, aus Syrien, Afghanistan, dem Irak.
Ausschließlich aus diesen Ländern! Keineswegs aus dem Südsudan, Eritrea, Mali oder vom Horn von Afrika.
Denn diese Menschen aus Afrika hätten in der Regel nicht das Kapital, folgende Fluchtroute zu bewältigen:
Vom Fluchtort (Aleppo z. B., Bagdad oder Kabul) meist mit einem PKW zum
nächstmöglichen Flughafen, meist in Istanbul oder Kairo, von dort über die
Drehkreuze Frankfurt, Paris oder Amsterdam nach
Moskau oder Petersburg, von dort im »Regionalflieger«
nach Murmansk.
Kosten ca. 36 000,- €, einschließlich aller notwendigen Visa und anderer Dokumente, wohlgemerkt pro Person. Also keine Reiseroute für Hartz-IV-EmpfängerInnen oder deren Äquivalente in den Herkunftsländern, die es aber meines Wissens gar nicht gibt.
Von Murmansk sind es dann vierunddreißig Kilometer bis zur norwegischen Grenze – in die (bis dahin schon teuer erkaufte) Freiheit für die ehemaligen Eliten aus ehemals nicht nur ölreichen Ländern arabischer Staaten.
Aber, in diese Freiheit gibt es keinen Weg. Es gibt keine Busverbindung von Murmansk zur Grenze, keiner privaten Taxe war es erlaubt, dorthin zu fahren, schon gar nicht darüber hinaus, z. B. nach Kirkenes im Norden Norwegens. Absolutes, nämlich militärisches Sperrgebiet – an Norwegens Grenze beginnt nämlich die NATO, Russlands existenzielle Bedrohung!
Es gibt aber einen »kleinen« legalen Grenzweg. Russen und Norweger sind ja nicht nur Russen oder Norweger, sie sind Nordkäppler, Nordmänner (und -frauen): Fischer, Jäger, Hirten und Sammler(-innen)!
Sie kennen die Grenze nur theoretisch, denn praktisch gibt es nicht nur Verwandte, hüben und drüben, einen gemeinsamen Dialekt und einen fairen Handel – russischen Fisch, Kaviar und Schalentiere gegen norwegische und europäische Technologie, aber auch norwegischen Fisch, Schalentiere und dänische Textilien gegen russische Waffen, Drogen oder Prostituierte aus dem Kaukasus.
Aber sie kennen die Grenze auch durch die Grenzschützer, die einen Untätigkeitsobolus erhalten, je nach Art des Grenzverkehrs. Nicht sie, sondern die Administration in Moskau hatte festgelegt, dass man nur mit einem Fahrzeug bis zur Grenze fahren durfte, z. B. mit einem Krabbenkorb im Anhänger, mit Fischkisten mit blau- oder gelbflossigem Tunfisch auf Eis (Waffen und Prostituierte kamen im Rahmenbefehl selbstredend nicht vor und wurden selten auf Eis transportiert).
Außer den Fahrzeugen der Fischer im kleinen Grenzverkehr waren Militärfahrzeuge, Panzerspähwagen oder Raupenfahrzeuge, vor allem im Winter, die einzig geduldeten Fahrzeuge zwischen den Ortschaften rund ums militärische Sperrgebiet bis zur Grenze. Und erst dort durfte man die Grenze passieren, mit einem Fahrzeug, Moped, Fahrrad, aber keinesfalls individuell zu Fuß – und auch nur dann, wenn man entsprechende Papiere hatte oder in Norwegen Asyl beantragen würde. Man wollte sie keineswegs in Russland behalten, egal wie dollarschwer sie auch waren. Sie gehörten einfach nicht ins Mütterchen Russland!
Dieser »kleine Grenzverkehr« wurde nicht nur von den (gut betuchten) Flüchtlingen genutzt, sondern von (spätestens heute ebenso gut betuchten) russischen Geschäftemachern.
Diese nämlich gaben der russischen Wirtschaft einen profitablen Beitrag – und nur deshalb hat die putinsche Bürokratie diese Eskapaden toleriert – nämlich die Herstellung von Fahrrädern, die keinerlei verkehrstechnische Ausstattung hatten, außer einem Rahmen, zwei (Vollgummi-) Rädern, einem Lenker und einem Sitz. Es wurde keine Beleuchtung benötigt, dafür hatten die Benutzer selbst zu sorgen, zwar wurde eine simple Bremse produziert, aber keine Gangschaltung, oder was noch zu einem ordentlichen Hollandfahrrad gehören würde. Dafür aber überdimensionierte Gepäckträger vorne, hinten und an den Seiten aus Kaninchendraht.
Die Herstellung in Murmansk hatte wenige Rubel gekostet, den Flüchtlingen wurden aber pro Fahrrad pauschal 1 000 amerikanische Dollars abgezockt. Devisen für das wirtschaftlich absackende Russland, nicht nur für die Schleuser, die im Dienste des FSB (also des russischen Geheimdiensts nach dem KGB) standen. Russland hat also allein an den 216 784 minderwertigen Fahrrädern mindestens 200 000 000, in Worten zweihundert Millionen Dollar, also wichtige Devisen, innerhalb eines Zeitraumes von rund zwölf Jahren, nämlich zwischen 2003 (Beginn des Irakkrieges) und in den Folgejahren bis nach 2011 (Beginn des Syrienkonflikts) eingenommen. Im Vergleich: Amerika hat Russland zu Zarenzeiten 7 200 000, in Worten sieben Komma zwei Millionen Dollar bezahlt, um Alaska zu erwerben! Für die Krim hingegen hatte Russland keinen Cent an die Ukraine bezahlt, außer Ansehen in der Welt.
Für die Flüchtlinge war es fast egal – noch ein Tausender drauf – und keiner der Geflüchteten, vor allem die Frauen nicht, die aus islamischen Wüstenstaaten das Fahrradfahren nicht gewohnt waren, fuhr tatsächlich. Die Flüchtlinge packten ihr Hab und Gut auf die Fahrräder und machten sich (jedenfalls in den Sommermonaten) »zu Fuß« von Murmansk aus in Richtung Grenze auf nach Norwegen. Am Sperrgebiet warteten die militärischen Fahrzeuge auf ihren monetären Gewinn. Die ausschließlich gut betuchten Flüchtlinge, die diesen Transitweg im Winter nutzten, wurden mit Militärfahrzeugen bis zum Schlagbaum gefahren, einschließlich Fahrrad.
Hier taten alle, irgendwie wie bei Brechts Mutter Courage, als würden sie stolz ihr Fahrrad besteigen, aber es war nicht nötig, die norwegischen Grenzschützer waren im Bilde.
Anders als im Balkan, in Österreich oder Deutschland waren diese Flüchtlinge in Norwegen durchaus willkommen! Denn manche dieser Flüchtlinge hatten die Kosten für diese Flucht »aus der Portokasse« bezahlt. Hieß für die demographisch gebeutelten Norweger: Wir bekommen die Eliten und zeigen der Europäischen Union den Stinkefinger, die die Verlorenen dieser Länder zu Gast hat. Diese musste den Unterhalt der neuen Mitbürger aus den Sozialsystemen zahlen. Norwegen hingegen ließ sich bezahlen und nahm die Ingenieure, Ärzte, Banker, die diversen Naturwissenschaftler und Ökonomen, vor allem auch mit deren Kindern, mit offenen Armen in ihren Kita-, Job-, aber ganz und gar nicht den Sozialsystemen auf.
Nur mit den Fahrrädern gab es allmählich ein Problem. In Norwegen waren sie nicht zugelassen. Außer in Bergen, Trondheim und Oslo fuhr in Norwegen sowieso niemand mit einem Fahrrad. Die Aufrüstung würde so viel kosten wie drei neue Fahrräder aus den hochqualifizierten deutschen Produktionsstätten, die in Norwegen Standard waren.
An der Grenze standen LKWs der Kommune Kirkenes, die die Fahrräder in die Lagerhäuser transportierten, denn die Flüchtlinge wollten sie selbstredend nicht behalten. Die Lager platzten aber langsam aus allen Nähten. Eine Lösung musste her, die dem Grunnloven nicht widersprach.
Und so kamen Nadja, Romika und ich ins Spiel, denn 216 784 Fahrräder in Container zu verpacken hätte eine Reihe von Logistikkosten verursacht, die wir mit unserem Langsamläufer vermeiden konnten.
Ich konnte damit natürlich auch den Lohn für die letzten vier Monate an Nadja und Romika endlich bezahlen. Ich hatte zwar eins meiner drei Häuser von Tante Lieschen in Berlin verkauft, nämlich ihre alte Villa in Charlottenburg, aber die Arbeiten an Gowinder hatten peu à peu das Zwanzigfache dessen an Kosten gefressen, was ich in meiner grenzenlosen Naivität kalkuliert hatte.
Natürlich passierte das mir, dass die beiden anderen Häuser weder Miete einbrachten, noch konnte ich sie verkaufen. Nicht nur, weil Nadja und Romika, und die drei Punker, die seit vierzehn Tagen unsere Matrosen waren, mir das nie verziehen und auf der Stelle ihre nautischen Fachlichkeiten und auch ihre Freundschaft zu mir gekündigt hätten (was beides allerdings nur sehr bedingt vorhanden war), sondern auch, weil ich die Alternative selbst nicht moralisch-ethisch hätte vertreten können.
Ich hätte die Häuser, die in Berlin-Kreuzberg nicht grad nebeneinander, aber zwei Straßenzüge voneinander entfernt von Hausbesetzern übernommen worden waren, mit Profit an die Haie der Branche verkaufen können und hätte damit ein postsozialistisches (und postTanteLieschens) Verbrechen begangen. Immerhin war ich mit den Hausbesetzern in Kontakt und man versuchte, wenigstens die Bausubstanz in freiwilliger Arbeit zu erhalten und zu verbessern. Zwar waren die Mädels und Jungs der autonomen Szene nun nicht gerade die Handwerker der Stunde, aber man bemühte sich. Ich hatte mich selbst davon überzeugt – und schließlich kamen Nadja und Romika genau aus diesem Milieu.
Davon später.
216 784 Fahrräder sind 216 784 €, weitere 216 784 €, die wir dann aus Nordkorea erhoffen (die Verlässlichkeit der Kim-Family ist Legende), denn der Job war ja nicht damit getan, die Fahrräder einfach nur huckepack zu nehmen. Es bedeutete auch, eine der längsten Seefahrtsrouten zu bewältigen, vom Nordmeer bis in den chinesischen Graben – und dabei die Fahrräder nicht verrosten zu lassen, auch wenn ich da noch überhaupt keine Idee hatte, außer dass ich einige Tonnen Schmieröl mehr an Bord genommen hatte, als der Diesel benötigte.
Sogar mit einem Flieger wäre man von Nordnorwegen bis Pjöngjang in Nordkorea netto zwei Tage und vier Stunden unterwegs, netto, wie gesagt, denn klar gibt es keinen Direktflug von Kirkenes in die Hauptstadt Nordkoreas. Vielleicht gibt es allein deshalb keinerlei diplomatische Verbindungen zwischen Norwegen und der Kim-Dynastie Nordkoreas. Wahrscheinlich sind aber die Werteunterschiede der Hauptgrund.
Jedenfalls hatten wir drei Optionen: noch weiter gen Norden, in die Barentssee hinein, um Sibirien herum bis in die Beringstraße zwischen Alaska und Russland, das wäre die kürzeste Strecke. Allerdings im April mehr als eine risikoreiche Fahrt, trotz Klimakatastrophe – und die Mär der Eisfreiheit der Handelsrouten.
Nadja und Romika verweigerten diese Tour außerdem, weil sie dann nicht ihre gewohnten Schill-Orgien an Deck (auf die sie nun auch schon zwei Wochen hier in Nordnorwegen verzichten mussten) praktizieren konnten. Übrigens nur dann zu zweit, wenn die Wellentäler der Weltmeere oder Flussmündungen es zuließen, dass Kapitänin und Chief mir das Ruder überließen. Vor allem Romika traute mir nautisch nicht viel zu, obwohl sie ja eigentlich der Chief war und Nadja das Patent vorwies, ein Schiff dieser Größenordnung zu manövrieren.
Und die »Matrosen«, die ja eigentlich gar keine waren, sondern irgendwelche Looser, die mal grad für eine Zeit von der legalen Bildfläche verschwinden mussten (das war der Kontrakt mit der Hausbesetzerszene gewesen – auch dazu später mehr!).
Aber ich lernte schnell, weil es ja, wie gesagt, schon immer mein Traum war, und sobald wir in Küsten- oder Hafennähe kamen, gab ich das Ruder selbstverständlich an Nadja ab.
Also gab es den langen Weg. Im Atlantik rund ums Kap von Afrika, durch den Indik bis ins Gelbe Meer. Unser Langsamläufer war zwar hochseetauglich, würde durch jeden Sturm und jede Dünung stampfen, aber eben eher gemütlich.
Wir entschieden uns für den nicht einmal wesentlich längeren Weg, der uns meist Küstennähe bescherte: von Norwegen durch die Nordsee, an Spanien (das billigere Schweröl bunkern in Portugal, durch die Nordsee mussten wir mit dem teuren Leichtöl fahren), am Horn von Westafrika vorbei, nach Südafrika (Bunkern von Schweröl in Kapstadt), dann die weiteste Strecke übers offene Meer, dem Indik bis nach Jakarta, um dort wieder Leichtöl zu bunkern. Die Straße von Lampung und die Küstenregionen von Malaysia durften wir nur abgasreduziert passieren. Von dort an Vietnam und über die chinesische Urlaubsinsel Hainan am großen China vorbei ins Ostchinesische Meer, ins Gelbe Meer und dann ins Delta von Taedong-gang, dem Fluss, der zur Hauptstadt von Nordkorea, Pjöngjang, führt.
Den Fluss würden wir wahrscheinlich nicht befahren dürfen, als Europäer galten wir als Spione. In Nampo, im Delta des Taedong-gang, würden wir die Fahrräder abladen, in der Hoffnung, dann noch einmal Devisen i. H. v. 216 784,- € zu erhalten. Wir würden jedenfalls keine Won, also die Währung Nordkoreas, akzeptieren – kein Fahrrad würde dann unser Deck verlassen.
Romika hatte sich bewaffnet, für den Fall der Fälle, Nadja hatte sie für verrückt erklärt und ich, ja, ich hatte mir tatsächlich auch eine Pistole besorgt, selbstredend ohne, dass meine Crew das wusste. Ich hatte übrigens noch nie geschossen, nicht einmal auf einer Kirmes. Und irgendwie Schießübungen abzuhalten hatte ich keine Lust. Aber so eine Pistole unter dem Kopfkissen beruhigte schon, fand ich, auch wenn sie natürlich nicht unterm Kopfkissen lag!
James T. Kirk war es egal! Unser Hund. Also eigentlich Romikas Hund, ein Golden Retriever, nur mit dem Unterschied, dass er überhaupt nicht golden, geschweige denn goldig war, sondern eher ocker, gelbgrau. James T. Kirk mochte mich nicht. Wahrscheinlich war er eifersüchtig. Jedenfalls pinkelte er regelmäßig an meine Kajütentür, bis ich beschloss, meinen Türrahmen mit Tigerbalsam einzuschmieren. Das half, machte unsere Beziehung aber nicht leichter, auch wenn Romika sich bemühte, James T. Kirk klarzumachen, dass ich ein Freund sei. Aber wir knurrten uns nur an, fast bis Hainan (danach nicht mehr – später mehr dazu).
Gut! Die Geschichte soll beginnen. Aber zuvor müsst ihr natürlich mehr über Nadja und Romika wissen und deren Beziehung zu mir, untereinander und zu James T. Kirk.
Und vielleicht auch von mir: Jan Fergemann.
Eine Bemerkung vorweg: Ich bewohne eine Einzelkajüte auf Deck 7, also neben dem Kartenraum und direkt hinter der Brücke, ursprünglich natürlich für den Kapitän reserviert, fast fünfzig Quadratmeter groß, einschließlich Bad und WC. Romika, Nadja und James T. Kirk bewohnen die Eigner-Suite, fast eine kleine Wohnung mit Bad und WC, aber ohne Küche, auf Deck 6, siebzig Quadratmeter direkt unter der Brücke mit entsprechendem Panorama auf die See bugwärts. Daneben gibt es auf Deck 6 noch zwei recht große Kabinen, beide ca. fünfzig Quadratmeter, jeweils back- und steuerbord, die zwar vollständig eingerichtet, aber versiegelt und unbenutzt sind – außer uns dreien gibt es schließlich weder Eigner noch Offiziere.
Die »Matrosen« sind unter dem Brückenaufbau neben dem Laderaum, also auf dem Deck 3 beheimatet. Hier gibt es die Mannschaftskajüte, die für neun bis zehn Matrosen ausreicht. Aber die drei aktuellen »Matrosen« sind eh kaum zu gebrauchen, nicht nur, weil sie ständig seekrank, sondern weil sie auch sonst zu allem fähig, aber zu nichts zu gebrauchen sind.
Darunter sind dann nur noch: die Maschine auf Deck 2, ebenfalls unter dem Brückenhaus, die aber den Laderaum durch die Pleuelstange bis zur Schraube und dem Ruder in zwei Teile teilt. Die Unterböden und die Bilge mit ihren Lenzpumpen, um das Kondenswasser, das sich dort bildet, auch Bilgewasser oder Kieljauche genannt, über Bord zu transportieren. Deck 1, wenn man so will, bildet dann den gesamten Schiffsboden, der das Schiff auf dem Meer hält (jedenfalls solange die Bilgepumpen funktionieren).
Allerdings sind nun alle Wohnstätten wesentlich mit Fahrrädern zugestellt, denn der Bulker-Carrier hat zwei nicht wirklich große Laderäume, und Bulker, die das geschultert hätten, zieht er halt nicht mehr.
Meine Hauptaufgabe an Bord ist übrigens die Kombüse. Kochen macht mir Spaß und »die Hand, die füttert, wird nicht gebissen« – das gilt für Nadja und Romika, manchmal auch für die Loser auf Deck 3 (nämlich dann, wenn es ihnen schmeckt), aber nicht für James T. Kirk – auch wenn ich seine Bisswütigkeit nur seinen Augen ablese. Aber seelisch fühle ich mich schon längst gebissen und hätte ihn am Liebsten den Haien zum Fraß vorgeworfen.
Aber das mit den Haien, in Berlin oder im Indik, hatten wir schon. Als vernunftbegabter Mensch überlegt man die Folgen seines Handelns. Obwohl mir das beim Gowinder nicht so wirklich gelungen war. Ihr werdet sehen, lesen, jedenfalls wenn ihr noch Bock habt, um die Sprache der Jugendlichen an Bord zu imitieren.
Kapitel 2
Oktober 2014 bis April 2016:
Tante Lieschen war neunundneunzig Jahre alt geworden. Sie war Eigentümerin von drei Häusern in Berlin. Eins, in dem sie selbst in Charlottenburg wohnte, zwei in Kreuzberg, die schon seit vielen Jahren von der autonomen Szene besetzt waren. Tante Lieschen hatte zu ihren Lebzeiten eher mit den Besetzern kollaboriert, als mit den Behörden zusammenzuarbeiten. Ich jedenfalls hatte zu ihrer posthumen Zeit gar keine Lust, mich politisch in der Berliner Autonomenszene einzubinden, eher vielleicht, um die Häuser zu Geld zu machen.
Dennoch wurde ich fast vier Monate nach ihrem Tod von der Berliner Bürokratie aufgefordert, mich nun endlich, nach dem Ableben der alten Dame, die man zu ihren Lebzeiten nicht unter Druck setzen wollte, um die Häuser zu kümmern, die ich beerben durfte.
Naiv, wie ich war, setzte ich mich in meinen alten Renault R 4 und fuhr nach Berlin, nachdem ich siebzehn Wochen zuvor, eher am Rande, erleben durfte, wie meine alte Tante unter die Erde gebracht wurde.
Sie hatte ein gewisses Geldpolster auf zwei Girokonten hinterlassen, die offenbar dem Erhalt dieser Häuser dienten, nicht unbedingt meinem Wohlsein als Erbe.
Ich bin keineswegs ein direkter Abkömmling der Familie von Tante Lieschen, das war mir bewusst, eher ein entfernter Verwandter. Ich glaube, meine Mutter war die Enkelin der Schwägerin von Tante Lieschen, also der Frau ihres Bruders – oder so.
Die Beerdigung auf dem Charlottenburger Friedhof fand in eher leisen Tönen, aber durchaus angemessen und gediegen statt, die Trauernden kannte ich ausnahmslos nicht.
Zu diesem Zeitpunkt hatte ich keine Ahnung, dass ich irgendetwas von ihr erben würde. Ich war nur gekommen, weil ich sie als Kind, als Jugendlicher wirklich geliebt hatte, als Hesse-Opfer (darauf werde ich zurückkommen müssen).
Ein Mann namens Max Behrends hatte mir eine Todes- und Trauernachricht zukommen lassen, mit der Bitte, Tante Lieschen die letzte Ehre zu geben.
Einen Max Behrends kannte ich nicht, war ihm aber irgendwie dankbar, dass er mich informiert hatte. Tante Lieschens Tod wäre mir wahrscheinlich ansonsten nicht »zu Ohren gekommen«.
Ihre altersentsprechenden Freunde waren offensichtlich ihrem Weg ins postexistenzielle Dasein vorausgegangen, denn es gab kaum Trauernde, die Tante Lieschens zu vermutender Alters-Peergroup entsprachen.
Aber es gab dennoch drei unterschiedlich große Gruppen, die die Beerdigung in stiller Trauer verfolgten:
Etwa dreißig Menschen, Paare, Einzelwesen, scheinbar aus gutbürgerlichem Ambiente, mit üblicher Trauerbekleidung, also schwarzgrau. Mir schien es, dass diese Gruppe sozusagen die Nachfolgegeneration ihrer altersgleichen (im Jenseits befindlichen) Freunde und (mir unbekannten) Verwandten darstellte. Mit Kindern, Kindeskindern und Urenkeln. Einer von diesen musste Max Behrends sein, ich wusste aber nicht, wer – und erfuhr es auch nicht, weil es nach der Zeremonie keinerlei weitere Zusammenkunft gab – man verließ den Friedhof, teilweise in Gruppen, aber offensichtlich auf eigenen Wegen.
Die zweite Gruppe hatte keine Kinder dabei und auch keine richtige Trauerbekleidung. Siebzehn Männer und Frauen in Jeans, T-Shirt, Westen, manche auch in Ostleinen – später erfuhr ich, dass es eine Gruppe aus der Partei »Die Linke« in Berlin war.
Beide Gruppen beachteten mich nicht, hörten der Grabrede aber konzentriert zu. Als ich auch hinhörte, wurden mir (dann später) einige Zusammenhänge klar: »Eine moderne Rosa Luxemburg«, »Menschlichkeit vor Kapital« usw. Entweder war der Grabredner aus ihren eigenen Reihen der Linken oder von der Fraktion finanziert.
Die kleinste Gruppe bestand aus zwölf Punkern, die sich zu Tante Lieschens Beerdigung eingefunden hatten. Ich hatte erst geglaubt, sie seien vielleicht Grufties und hier auf dem Friedhof zu Haus, obwohl sie nicht ganz so eindeutig als solche zu identifizieren waren. Aber vielleicht hofften sie nur auf einen ausgiebigen Leichenschmaus, dachte ich.
Als norddeutscher Provinz-Sozialarbeiter waren mir die Berliner Großstadtgebräuche allerdings nicht wirklich transparent – und einen Leichenschmaus hatten Tante Lieschen und ihre (wirklichen) Erben nicht vorgesehen.
Außerdem waren sie dann kurz nach der Zeremonie, die sich völlig säkular einfand, testamentarisch von Tante Lieschen festgelegt, wie ich später erfuhr, fast wortlos und mit den (natürlich ziemlich sakralen) Brandenburgischen Konzerten von Johann Sebastian Bach unterlegt, wieder verschwunden.
Siebzehn Wochen später sah ich zwei dieser Punks wieder – um genau zu sein, zwei Punkerinnen, jedenfalls, an die ich mich erinnern konnte: Nadja und Romika, um hier schon einmal äquifinal alle Spannung aus diesem Kapitel herauszunehmen. Aber natürlich wusste ich damals weder ihre Namen noch ihre Vita, wie es so schön neudeutsch heißt.
Die Beerdigung war dann Geschichte und zu der Zeit wusste ich noch nicht von einer Erbschaft. Dann hatte ich plötzlich drei Häuser geerbt und musste nun irgendwie den Nachlass, also den materiellen im Haus in Charlottenburg, hinkriegen – und natürlich auch trauern!! Eine Testamentseröffnung, wie man es so schön im Fernsehen sieht, wenn alle Erbschleicher zusammenkommen und ein devoter Notar die letzten Worte verlas, gab es allerdings nicht.
Einen Notar gab es schon, aber ich glaube, es war eher ein Notariatsgehilfe, der mir mitteilte, dass ich diese fünf Habitate geerbt hatte: drei Häuser und zwei Girokonten in Berlin, über die alle relevanten Transaktionen für die drei Häuser abliefen. Ich dachte an Miete, monatliche Eingänge, die zu einem Teil die Kosten abdeckten, aber einen gewissen Gewinn für mich abwerfen würden. Ich irrte mich, aber auch das erfuhr ich erst, nachdem ich durch meine Unterschrift das Erbe angenommen hatte.
Ihr findet wahrscheinlich, dass meine Beziehung zu Tante Lieschen zu kurz kommt, jetzt hier beim Erzählen. Aber natürlich mochte, nein, liebte ich Tante Lieschen, jedenfalls als Kind, vor allem als Jugendlicher, und das muss ich natürlich auch erklären.
Meine Eltern, heute schon viele Jahre unter der Erde, hatten davon gesprochen, sie sei eine britische Spionin gewesen. Sie hieß im echten Leben Alice McGraw und war mit dem britischen Piloten Alexander McGraw verheiratet gewesen, der in den letzten Kriegsjahren des Zweiten Weltkrieges ums Leben gekommen war.
Jedenfalls hielten meine Eltern den Kontakt zu Tante Lieschen zur Zeit meiner Kindheit und frühen Jugend. Tante Lieschen hatte offenbar selbst keine Kinder und schien unsere fünfköpfige Kleinfamilie als ihr Refugium zu betreiben: Wir gingen plötzlich in den Zoo, fuhren auf Ausflugsdampfern, gingen sogar ins Theater. Wenn Tante Lieschen bei uns war, war immer etwas los. Und immer bezahlte Tante Lieschen. Wir gingen z. B. in Restaurants, was sich mein Vater als Werftarbeiter für Frau und drei Kinder seinerzeit niemals hätte leisten können. Aber Tante Lieschen war immer großzügig. Aber sie war ein-, zwei-, vielleicht dreimal im Jahr für ein paar Tage in Bremerhaven, wohnte in einem Hotel – und las uns Kindern vor, wenn wir sie in ihrer Suite (wir wussten natürlich nicht, was eine Suite war, bzw. bedeutete – für uns war es nur ein ziemlich großes Hotelzimmer) besuchen durften.
In den für mich unendlich langen Zeiten zwischen ihren Besuchen fand bei uns der ziemlich magere Alltag statt. Das an sich war gar nicht so schlimm, wir lebten ja dennoch nicht schlecht im Nachkriegswirtschaftswunder, aber meine Eltern wurden von Tante Lieschen vergoldet.
Mein Vater war in den sechziger Jahren meiner/unserer Kindheit ein kräftiger Werftarbeiter, der physisch gesund aus dem Krieg heimgekehrt war, weil er sich in britischer Gefangenschaft befunden hatte, seit er 17 Jahre alt war.
Die kleine Macke, dass er als Matrose eines Hitlerschnellbootes zwei Tage lang im Ärmelkanal mehr Salzwasser als Lebensperspektive geschluckt hatte, hatte ihn natürlich nicht davon abgehalten, seine große, pubertäre Liebe von vor dem Krieg nach dem Krieg dreimal zu schwängern. Dass diese sich darauf einließ (es gab in den vierziger, fünfziger Jahren kaum wirksame Verhütungsmittel), war der Tatsache geschuldet, dass es nach dem Krieg wenige männliche Existenzbewahrer gab.
Meine Mutter war ein aktives »BDM«-Mädel (Bund Deutscher Mädels), und zwar auch noch nach dem Krieg, eigentlich bis zu ihrem Tod. Sie lebte nicht nur in einer Vergangenheit, sondern war von ihr dermaßen traumatisiert, dass sie die Realität anfangs nur durch bestimmte Boulevard-Heftchen ertragen konnte, die die Vergangenheit als Gegenwart vorgaukelten, später dann durch eine exquisite Mischung von Tabletten und Alkohol.
Tante Lieschen wusste offenbar, was ihr wirklich zugestoßen war, als Siebzehnjährige in den letzten Kriegswochen: Ihre Mutter, also meine Großmutter, eine Zeugin Jehovas, die nur deshalb nicht im KZ saß, weil ihr Mann ein hoher SS-Mann war, hatte sich die Kehle durchgeschnitten. Und unsere Mutter war als Jugendliche dabei. Das hat mir Tante Lieschen erst sehr viel später berichtet, als ich sie als Jugendlicher in Berlin besuchte. Ich habe damals Tante Lieschen über die zwei Gesichter meiner Mutter berichtet und sie wollte wohl bei mir Verständnis und Mitleid für deren psychische Erkrankung hervorrufen.
Durch ihre zeitweise Anwesenheit hatte sie uns als Kinder und auch unseren Vater gerettet, denn wenn Tante Lieschen da war, war unsere Mutter nicht nur tatsächlich eine liebevolle Mutter, sondern ließ sich etwas sagen. Tante Lieschen war ihre Autorität, jedenfalls »face to face«.
War Tante Lieschen allerdings nicht anwesend, war unsere Mutter nicht nur nicht berechenbar, sondern sprach über Tante Lieschen nur unter den Gesichtspunkten einer möglichen Erbschaft, durch die sie sehr reich werden würde, neben einem mysteriös von ihr nicht genannten zweiten Verwandten. Sie meinte beim Erben übrigens nur sich selbst, nicht ihre Familie, um das noch einmal zu betonen. Sie starb dann ungeerbt vor der Erblasserin.
Wer der zweite Erbe war, hatte sie uns nie erzählt. Aber auch wenn sie es getan hätte, wussten wir nicht, ob es wahr oder aus ihrem kranken Hirn entsprungen war. Daher hatte es mich dann auch nicht mehr wirklich interessiert.
Ich mag Berlin nicht, nicht weil Berlin Berlin ist, sondern weil ich auch Frankfurt nicht mag, nicht Köln, München, Bremen, nicht einmal Bremerhaven. Ich bin einfach nicht anders als provinziell. Vielleicht gibt es auch so etwas wie Städteangst, so wie Agoraphobie, Klaustrophobie, Arachnophobie oder Homophobie: Cityphobie. Wenn nicht, habe ich es hiermit erfunden, oder besser, wie bei Christoph Columbus, ich habe es entdeckt. So wie Amerika (obwohl es ja die Wikinger waren).
Jedenfalls hatten wir Tante Lieschen in Berlin besucht, als ich Kind war, und 1966 und 1967 hatte ich sie viermal während der gesamten Sommer- und Herbstferien in Berlin allein besuchen dürfen. Da war ich zwölf, dreizehn Jahre alt – meine Eltern waren offenbar froh, dass sie mich während der Ferien nicht zu bespaßen brauchten (oder teure Ferienmaßnahmen bezahlen), was sie im Übrigen niemals getan hatten, meist hatten sie mich (und damit auch sich) entspaßt.
Nach diesen Jahren hatte ich Tante Lieschen nur gesehen, wenn sie mal ins norddeutsche Tiefland verreiste. Das war selten der Fall, vor allem zu DDR-Zeiten, weil sie (wie meine Eltern behaupteten) als englische Spionin nicht durch die DDR fahren konnte, weder mit dem PKW noch mit der Bahn. Sie musste also fliegen. Und Fliegen mochte sie nicht, vor allem wohl, weil ihr Alexander dabei ja ums Leben und um ihre Liebe gekommen war.
Also hab’ ich sie nach 1967 nur drei-, viermal gesehen, aber, wie gesagt, ich liebte sie. Sie lebte ihr eigenes Leben und kümmerte sich einen Scheiß um Konventionen oder um eine mir unbekannte Familie, zu der meine Eltern sich intim zählten, aus naheliegenden monetären Gründen, denn Tante Lieschen galt bei meinen Eltern als reich, was sich später als Verniedlichung herausstellte und ganz und gar nicht zu ihrem Lebensbild passte, das ich von ihr hatte.
Tante Lieschen war mehr als reich – auch wieder davon später, sorry, aber so müsst ihr natürlich weiterlesen!!!
Sie hatte in den Jahren vor ihrem Tod ihre Freunde bei den Linken und in der autonomen Szene (in meiner Jugend beim KBW – Kommunistischer Bund Westdeutschlands –, wie ich recherchiert hatte), war später als Großmutter der PDS- und dann Linken-Abgeordneten im Berliner Senat bekannt, obwohl sie niemals in der DDR gelebt hatte, und war deshalb wahrscheinlich auch unangreifbar für die Berliner Behörden in Sachen Hausbesetzung. Die DDR-Funktionäre mochten sie nicht, vor allem aus zwei Gründen: Sie galt als englische Spionin und als Maoistin, was sich mit dem real existierenden Sozialismus der DDR nicht vertrug.
Genau damit musste ich mich, nun siebzehn Wochen nach ihrem Tod, auseinandersetzen. Denn, und da hatten mich die Hausbesetzer total überrumpelt, es gab überhaupt keine Hausbesetzung!
Die Häuser waren alt, stammten aus der Vorkriegszeit, dreißiger Jahre des letzten Jahrhunderts, mit roten Ziegeln, damals üblich für Mehrfamilienhäuser. Eins in der Gitschiner, eins in der Oranienburger Straße, beide aber wenige Meter vom Kottbusser Tor entfernt.
Ich hatte mich angekündigt. Das war mir lieber, als irgendwie abgeschossen zu werden, von wildgewordenen Autonomen oder deren polizeilichem Gegenüber.
Tante Lieschen hatte mir ihr erstaunlich modernes, aber passwortloses Notebook vermacht und ich fand, neben ein paar von Tante Lieschen politisch geprägten Informationen über die Szene, eine E-Mail-Adresse, mit der ich, bis dahin rein einseitig, kommunizieren konnte.
Zu Haus hatte ich ein Sabbatical erhalten, mein Arbeitgeber war so freundlich, weil ich ihm meine Erbschaftsprobleme nahebringen konnte. Ich hatte sechs Monate Zeit, mich um das Vermächtnis meiner Tante zu kümmern. Die waren zwar bald rum, aber ich gedachte nicht, meinen Job tatsächlich wiederaufzunehmen. Ich konnte das Haus in Charlottenburg für runde 600 000,- € verkaufen – und das sollte doch erst einmal genügen, dachte ich.
Ich habe keine Kinder, meine Produktionsfähigkeit in Sachen Mensch war also gleich null. Meine Generativität hatte versuchsweise ejakulativ mehr als einmal in jungen Jahren stattgefunden und war damit erledigt. Meine erste feste Beziehung, im Alter von siebzehn bis einundzwanzig Jahren während meiner ersten Ausbildung als Beamter im gehobenen Dienst, war zweimal schwanger geworden. Die beste aller denkbaren Schwiegermütter hatte dann zweimal einen Trip nach Holland organisiert. Ich musste dabei sein!! Nicht beim Abort, aber beim Warten in der in Holland legalen Klinik für Abtreibungen, was damals in Deutschland unter Strafe stand.
Die Mutter meiner Freundin wollte mir die Verantwortung klarmachen und den Schmerz, den meine Freundin erleiden musste.
Ich war bestimmt ein Idiot, klar, ich, wir hatten nicht aufgepasst.
Aber einen Samenerguss gab es danach nie wieder in irgendein Schmuckkästchen einer Frau – das hatte ich mir bewusst abgeschminkt, dann war es in mein ES übergegangen – und meine Samenleiter hatten dem nichts entgegenzusetzen!
Viele Absichten sind gut! Die Absichten meiner zukünftig nun verhinderten Schwiegermutter waren sehr gut! Sie, also die Mutter meiner Freundin, hatte vollkommen recht!
Aber die Folgen manches Gutgemeinten sind nicht immer … okay, lassen wir das.
Es wird uns auch weiterhin bewegen, nämlich ob das, was wir tun, auch immer die beabsichtigte Wirkung hat.
Ich spreche von Gowinder und was er (oder sie) mit uns bewegen wird!
In Berlin 2014 und 2015 hatte ich nichts anderes als ein Schiff im Kopf. Der Traum meiner Kindheit und Jugend schien zum Greifen nahe, weil Tante Lieschen mir die Moneten dafür zur Verfügung stellte, dachte ich jedenfalls. Ohne zu wissen, ob ich mit nun gerade über sechzig Jahren die Folgen einer solchen Anschaffung auch in der Lage war zu verantworten.
Siebzehn Wochen nach der Beerdigung Tante Lieschens war ich also auf dem zweiten, und ich hoffte letzten, Weg nach Berlin und besaß ein Schiff (kein Boot), das an der Lühring-Kaje (resp. deren kümmerlichen Überresten von knapp einhundert Kaimetern) mit knapp siebzig Metern Länge, knapp sieben Metern Breite, knapp fünf Metern Tiefgang (unbeladen) und knapp zweitausend Bruttoregistertonnen mit einer Ladekapazität von knapp neuntausend Tonnen auf mich wartete, ohne dass ich nun genau wusste, was ich damit anfangen konnte, ohne es selbst bewegen zu dürfen und derzeit auch nicht zu können, weil der alte Diesel (noch) nicht mitspielte.
Ich war auf dem Weg in die Oranienburger Straße, schon von dem Berlin an sich, ich hab’ noch keinen Namen für diese Phobie gefunden, gestresst.
Das Taxi, gefahren von einem Marokkaner, wie ich annahm, setzte mich aber sanft in Kreuzberg ab. Aber nicht direkt vor dem Haus an der Oranienburger Straße, sondern am Kottbusser Kreisel. Vielleicht wollte er nicht mit den Punks in Verbindung gebracht werden – aber wahrscheinlich hatte er einfach nur Schiss, dass sein Taxi demoliert würde. Ich musste dringend pinkeln, als ich dort ankam.
Irgendwie sah mir Romika das an, denn sie nahm meine Hand (später war mir klar, dass sie mich von der Beerdigung kannte) und führte mich ins Haus.
»Dort ist das Klo, Tante Lieschen hat es renovieren lassen!«
Es kam kaum etwas mehr als dunkelgelber Stressfluss, der nicht wirklich vorhandene Blasendruck ließ aber dennoch ein wenig nach.
»Ja!«, sagte ich. Das Klo war sauber, ein Gästeklo wie bei Mustermanns, »hat Tante Lieschen auch die ganzen anderen Bäder renovieren lassen?«
Im Haus gab es zehn Wohnungen, das wusste ich. Drei im Erdgeschoss, zwei in der ersten Etage, eine einzige in der zweiten und gleich vier in der oberen Dachetage.
1932 wohnte hier eine einzige Familie, schätzungsweise mit vier bis sechs Kindern. Auf der ersten und zweiten Etage. Im Erdgeschoss Butler, Hausmädchen und Hauswarte, im Dachgeschoss Kindermädchen und Praktikantinnen – so stand es in irgendwelchen Papieren, die ich zu den Häusern erhalten hatte.
Heute wohnten allein in der Oranienburger Straße offenbar mehr als achtundachtzig junge Menschen, wie ich später erfuhr. Sechsundvierzig lebten ständig hier, der Rest sporadisch. Und die Zahlen variierten von Woche zu Woche, eigentlich von Tag zu Tag.
Romika war aber ständig hier. Seit sieben Jahren ohne Aufenthaltsgenehmigung, wie ich ebenfalls erst später erfuhr. Es gibt überhaupt keinen Grund dafür, dass man, wenn man aus Moldawien stammte, Asyl in Deutschland erhielt, meinten die Behörden. Der Fall schien aber zu unwichtig, um Personal- und Flugkosten für eine Abschiebung der jungen Frau zu veranlassen. Daher war sie irgendwie toleriert, erhielt aber keine Stütze, also Hartz IV, weil sie sich damit illegal in Berlin aufhielt. Diese Tatsache und dass Romika in Odessa, also in der ukrainischen Hafenstadt am Schwarzen Meer ein Studium zur Schiffsbetriebstechnikerin, Bachelor of Science (so jedenfalls würde man in Deutschland sagen), absolviert hatte, erfuhr ich ebenfalls erst später.
Die Basisversammlung, wie gesagt wurde, fand in der Wohnung Etage 2 statt, einfach deshalb, weil hier der größte Raum des Hauses zu finden und ursprünglich das Musikzimmer der irgendwie aristokratischen Herrschaftsfamilie gewesen war. Woher Tante Lieschen übrigens die drei Häuser hatte, wusste ich nicht und wollte es auch gar nicht wissen, auch wenn ich das ebenfalls später erfuhr. Nun hatte ich diese Häuser am Hals, jedenfalls noch zwei davon, auch wenn das Wohnhaus von Tante Lieschen, das ich verkauft hatte, einer anderen Kategorie angehörte.
Eine Gruppe von rund achtzig gar nicht mal so jungen Menschen, wie ich eigentlich erwartet hatte, war anwesend, einschließlich einer »Abordnung« aus der Gitschiner Straße. Die Ältesten waren zwar noch nicht in meinem reifen Alter angekommen, aber die wenigsten der grün- und rosahaarigen Basispunks waren unter achtzehn Jahre alt, aber diese gab es natürlich auch. Die Mehrheit schätzte ich zwischen achtzehn und fünfundzwanzig Jahren. Romika mit ihren zweiunddreißig gehörte zwar zu den Seniorpunks, aber sie war keineswegs die Älteste.
Die Älteste – und so stellte sie sich auch vor – war Nadja.
»Ich bin die Älteste!«, sagte sie. »Und damit du weißt, wie wir ticken: Wir sind Anarchisten, aber keine Chaoten! Wenn alle Anwesenden durcheinanderreden würden, kämen wir zu keinen Erkenntnissen und damit auch zu keinen Ergebnissen. Daher macht immer der oder die Älteste, die grad anwesend ist, die Moderation. Aber jeder darf und muss mich natürlich jederzeit unterbrechen, wenn es der Sache dient oder seinem Outing hilft. Also Wut und Liebe sind hier jederzeit erlaubt. Und das gilt auch für dich!«
Ich war gemeint und nickte.
Nadja sprach wie ein Kapitän, fand ich. Später stellte sich heraus, dass sie tatsächlich eine Kapitänin war, eine russische, wie man allerdings an ihrem Akzent vermuten durfte, nicht jedoch, dass sie auch eine militärische Offizierin gewesen war. Sie war aus der russischen Armee desertiert und war auf der Flucht erst vorm KGB und nun vor dem FSB, also dem gleichen Geheimdienst mit anderem Namen. Nadja war zweiundfünfzig Jahre alt und von ihrer Existenz wusste keine offizielle deutsche Behörde, nur die Geheimdienste. In der Tat war sie die Älteste der Autonomen und wurde als Kapitänin akzeptiert, auch wenn man anfangs »die Kapitänin« eher als Spitzname einführte. Alle Autonomen, die hier gestrandet waren, wussten davon, dass sich Nadja in Berlin nicht auf den öffentlichen Straßen aufhalten konnte. Sie hatte siebzehn Anschläge hinter sich, immer war sie entkommen, weil sie einen Schritt schneller war als die Killer der sowjetischen und später russischen Geheimdienste. Aber sie vermutete, dass auch deutsche Geheimdienste hier am Werke waren. Die z. B., die die Mörder der NSU-Bande und andere Faschisten beschützten oder ungeschoren davonkommen ließen.
Zwölf der Anwesenden kannten mich. Das waren die, die bei Tante Lieschens Beerdigung dabei waren. Vielleicht mochten sie die Musik nicht. Bach ist ja nun gerade nicht die wahre Punkmusik. Ich hatte bei der Beerdigung keinen Ton gesagt, also konnte man mir nicht irgendeine verbale Entgleisung nachsagen.
»Wann sind wir dran?«, kam dann irgendwann »des Pudels Kern« auf den Tisch. Romika hatte das Wort ausgesprochen. Die anderen hätten mich am liebsten gelyncht. Vor allem ein Hund hatte es auf mich abgesehen. Ihr werdet es erraten: James T. Kirk. Er hatte mich schon seinerzeit so angestarrt, als ob ich in sein Beuteschema passen würde – aber natürlich kannte ich seinen Namen damals noch nicht.
Mir kam allmählich die Erkenntnis, worum es hier ging: Tante Lieschen hatte die autonome Punkergemeinde immer beschützt. Daher galten sie eben nicht als Hausbesetzer, jedenfalls rechtlich. Wenn die Eigentümerin eine Hausbesetzung duldet, ist es halt keine Hausbesetzung mehr. Es ist ein Mietverhältnis – allerdings ohne Mietzinszahlung und schriftliche Verträge, aber mündliche galten nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch eben auch. Tante Lieschen bezahlte, und das nicht gerade wenig. Sie bezahlte Material für Renovierungsarbeiten, Hygieneartikel und Matratzen. Offenbar hatte sie in den letzten Jahrzehnten mehr Geld zur Verfügung, als mir so richtig bewusst geworden war. Mit den Barschaften auf den Girokonten hätte sie das jedenfalls nicht lange aufrechterhalten können. Hätte ich die Villa in Charlottenburg nicht verkauft, wäre mir wenig übriggeblieben.
Die Immobilienhaie und der Regierende Bürgermeister Müller standen also Pate dabei. Sie meinten mit der Ansprache »Bitte kümmern Sie sich um das Vermächtnis Ihrer Tante« nichts anderes als: »Verkaufen Sie endlich, Sie werden der Gewinner sein! Monetär jedenfalls.«
Man hatte mir bereits ungefragt mehrere Angebote unterbreitet, die ich allesamt in den Papierkorb geworfen hatte. Zum Schluss sogar ungeöffnet. Ich bin kein Lakai der Immobilienhaie und schon gar kein Prostituierter, der mit jedem ins Bett steigt, nur weil der bezahlt!
Aber das wusste weder der Regierende Bürgermeister noch die Basisgemeinschaft mehr oder weniger junger Anarchisten.
»Keine Ahnung, wann ihr dran seid!«, antwortete ich daher und musste schon wieder pinkeln, auch wenn ich wusste, es würde nix rauskommen. »Und außerdem habe ich Durst und Hunger!«
Nadja schaute mich irgendwie nachdenklich an und Romika sagte: »Okay, Leute, der kommt heute hier an. Ihr wisst, der Weg ist das Ziel. Wir sollten ihm erst einmal was zu futtern geben – und machen dann morgen weiter. Einverstanden?«
»Gebt ihm einen Joint«, sagte jemand und ich hätte durchaus Lust gehabt, wusste aber nicht, wohin das führen würde.
Ich hatte mir selbstredend ein Hotelzimmer reservieren lassen, in der Charlottenburger Villa waren die Lichter für mich schon längst ausgegangen. Vielleicht würde der marokkanische Taxifahrer mich ja dahin bringen. Aber wahrscheinlich müsste ich dann wieder zum Kottbusser Platz marschieren.
Egal, Nadja und Romika jedenfalls sagten, sie würden in der oberen Etage leben, selbstredend nicht alleine, aber als ich eine Etage höher kam, wurde mir die Beziehung schon klar: Nadja und Romika hatten ein zwar kleines, aber eigenes, gemeinsames Schlafzimmer, auch wenn alle anderen Räume von diversen Punks bewohnt wurden, die ich grad noch eine Etage tiefer erleben durfte. Nadja hatte offenbar ein paar Privilegien, als Punkikone – und Romika war ihre Wärmflasche, denn die Senatsverwaltung Berlin hatte in den beiden Häusern selbstverständlich Strom und Fernwärme gekappt. Wasser durften sie nicht kappen, das wäre eine Menschenrechtsverletzung.
Die Küche in der dritten, also ja eigentlich vierten Etage war Antihungerareal und Kommunikationszentrum des vierten Basislagers. Die beiden unteren Etagen waren offenbar autonomer als autonom. Von rechts nach links ging es hier offenbar von oben nach unten. Aber die Jungs und Mädels waren eine Gemeinschaft – vielleicht, weil sie ständig diskutierten um das Hier und Jetzt, wobei die Zukunft bereits Vergangenheit ist, wenn das Hier und Jetzt beginnt.
»Was willst du?«, fragten sie mich, während Romika versuchte, Nudeln ins kalte Wasser eines Topfes zu drapieren.
»Oh Gott«, entfuhr es mir und ich nahm Romika die Nudeln aus der Hand, »keinen Matsch produzieren, das kann man nicht essen! Lass es mich machen, wie wäre es mit Nudeln in Tomatensauce! Was habt ihr?«
Peu à peu tauchten dann, dem Geruch geschuldet, etwa sieben weitere Punks auf. Ich hatte gefunden, was ich suchte, neben den Nudeln Tomaten, Paprika, Oregano, Chili, Honig und vor allem Kapern, wer immer das auch hier vergraben hatte. Gekocht auf einem Campingkocher mit zwei Flammen, auf deren Erhalt ich ständig hoffte und deren Anschlüsse zur Gasflasche ich argwöhnisch im Visier behielt.
Aber es klappte und jeder wurde satt, nachdem den unteren Etagen der Zutritt verwehrt worden war.
»Was willst du?«, stand im Raum.
Gesättigt begann ich zu erzählen, von Gowinder, den ich grad gekauft hatte, vom Totenschiff bei B. Traven und davon, dass ich meinen Job als Sozialpädagoge in der Jugendhilfe gekündigt hatte. Mir war klar, dass ich damit alle Sympathien verscherzt hatte. Aber meine Berlinphobie und das Meer in meiner Seele schienen meinen Job irgendwie zu kompensieren.
Also das ist die Kurzfassung. Die Langfassung unter Hinzufügung von drei Tetrapacks italienischen Rotweins müsst ihr euch einfach selber ausmalen.
Am Ende stand: »Und wann verkaufst du uns, um deinen Bootstraum zu verwirklichen?«
»Gowinder ist ein Schiff, kein Boot! Darauf bestehe ich. Und ich brauch kein Geld, ich brauch einen Nautiker und einen Chief – und den einen oder anderen Matrosen.«
Es dauerte fünf Basisversammlungen innerhalb einer Woche.
Da wurde rauf und runter diskutiert, im Hier und Jetzt, obwohl sie eine Zukunft entscheiden sollten. Viele waren übrigens dauerbekifft und mir war nicht klar, inwieweit sie eine realistische Vereinbarung treffen und vor allem einhalten würden.
Ich hatte mich in mein Hotel zurückgezogen und es allein nur bei Dunkelheit verlassen. Da konnte ich meiner Berlinphobie entkommen und mich an diversen Kneipen und ehrlich, köstlichen Menüs in Esssalons mit merkwürdigen Namen wie Wartesaal, Bleiberg, La Fauborg, Marooush, Maredo usw. erfreuen. Da war ich immer (noch) nüchtern, denn nichts verdirbt einen kulinarischen Genuss mehr als Bier und Schnaps (aber kein Weiß-, Grau- oder Spätburgunder).
Tagsüber schlief ich und hackte nach dem Aufwachen gen Mittag auf meinem Notebook herum – ihr erinnert euch, ich schreibe sehr erfolgreich, aber ohne zählbare Einnahmen, unausgezeichnete Prosa. Klar, ihr seid ja grad an meinen Ergüssen beteiligt und saugt sie ein, nicht wahr?!
Das Hotelpersonal hatte sich daran gewöhnt, dass ich gegen Mittag ein ausgewogenes (Kater-)Frühstück zu mir nahm. Fast jeden Tag besuchte mich eine Punkerbasisabordnung, um mir die neuesten, meist unsinnigen Forderungen oder Kompromisse zu meinem »Vorschlag« abzuverlangen. Ich lehnte fast alles ab, weil das meiste den dauerbekifften Gehirnen zu entstammen schien.
Als sie zum ersten Mal erschienen, war das Anlass für den Hotelmanager, die Daten meiner Visa-Karte einzufordern. Nachvollziehbar, denn ein Sozialarbeiter aus der Provinz sah ja nun nicht gerade aus wie Udo Lindenberg, obwohl dessen Tagesablauf kaum anders verlief, nur, dass der auf einer Gitarre rumhackte statt auf einem Notebook. Im Übrigen sehe ich bei Weitem seriöser aus als Udo Lindenberg, um das mal klarzustellen, vor allem gewichtiger!
Zur letzten Basisversammlung wurde ich gerufen. Es wurde Zeit, denn ich hatte langsam keine Lust mehr, immer nur gut essen zu müssen, auch wenn ich es mir zu der Zeit noch leisten konnte.
Ich sehnte mich nach meiner phobiefreien, norddeutschen Heimat, in der ich mich auch tagsüber draußen aufhalten konnte.
Die Basisversammlung dauerte vier Stunden. In diesen Stunden war mir schwindelig vom THC, ohne dass ich einen einzigen Zug genommen hatte. Es wurden vor allem spontane Outings ausgetauscht, auch knatschig-wollüstige Liebe, weniger, eigentlich gar nicht mir gegenüber, aber die Wut hatte definitiv abgenommen.
Irgendwie wurde ich als Bruder aufgenommen, wenn auch von einer anderen (substanzunabhängigen) Fakultät, ähnlich wie bei »Easy Rider«. Haut dem Establishment was auf die Fresse, meinte ich zu erkennen – und irgendwie nahmen sie an, auch ich wäre dazu bereit. James T. Kirk jedenfalls zählte mich ganz bestimmt zum Establishment! Auch wenn ich im Boxen bestimmt besser wäre als er, hatten meine sechzig Jahre alten Zahnreihen schon einige Lücken. Eine Beißerei hätte ich verloren!
Eins wurde deutlich:
Nadja und Romika opferten sich für das Gemeinwohl der Punkerbasisgemeinschaft!
Schon nach dem ersten Rotwein-Tetrapack erfuhr ich, was die beiden getrieben hatte, sich hier einzunisten: Es gab keine bessere Wahl! Hier waren sie geschützt und in einem sozialen Kontext. Hier hatten sie eine durchaus menschliche Aufgabe und gleichzeitig ihre zwar eingeschränkte, aber lebbare und nicht nur sexuelle Freiheit.
Ich brauchte eine Schiffsbetriebstechnikerin und eine Nautikerin, schwul hin oder her. Dafür würden ich meine beiden Tante-Lieschen-Häuser in der Oranienburger und Gitschiner Straße zur Verfügung stellen müssen, nicht mehr, nicht weniger. Ich schwelgte noch in 600 000,- €, Erlös der kleinen Villa meiner geliebten Tante (abzüglich der aktuellen Genusskosten), ohne wirklich realistisch darüber nachzudenken, dass auch diese Summe irgendwann endlich sein würde.
Die Punks hatten bei den Basisversammlungen eine Reihe von weiteren Forderungen diskutiert, wenn sie Nadja und Romika freigeben würden. Aber Nadja und Romika verstanden sich nicht als Tauschware.
Wie gesagt, ich lehnte irgendwelche Zugeständnisse ab. Zwar versprach ich, der Berliner Senatsverwaltung mitzuteilen, dass der Aufenthalt der Punkergemeinschaft in »meinen« Häusern legal wäre, mehr aber nicht. Im Gegenteil forderte ich von ihnen, dass sie alle dafür erforderlichen Arbeiten zu tätigen hatten, nicht nur die Bausubstanz zu erhalten, sondern vor allem Frieden und Freude mit den Nachbarn zu praktizieren, und, wenn nötig, auch mit der Ordnungsmacht.