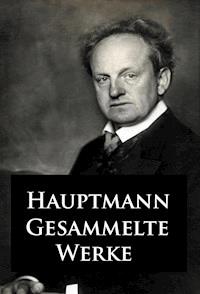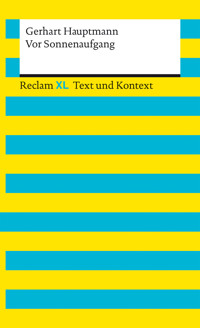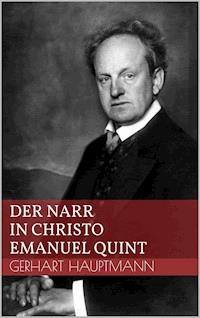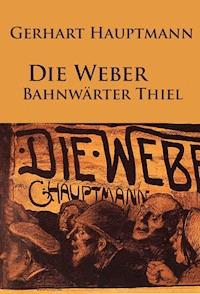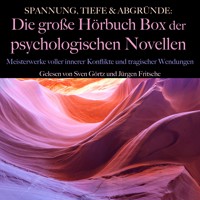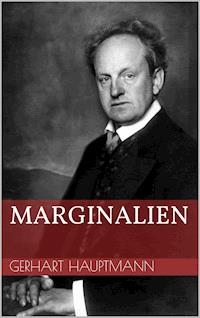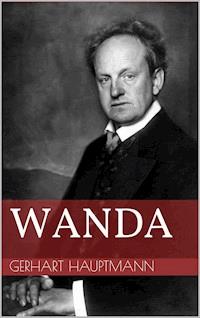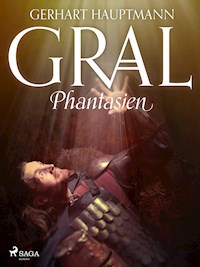
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Hauptmann interpretiert den ursprünglichen Gral-Stoff neu und schafft mit "Lohengrin" und "Parsival" zwei Werke voller Abenteuer, die man nicht mehr aus der Hand legen möchte. Die "Gral-Phantasien" bestehen aus zwei Teilen. In der umgekehrten Reihenfolge erzählt Hauptmann die Geschichte um den legendären Ritter Parsival. Der erste Teil handelt von Parsivals Sohn Lohengrin, der auch der Schwanen-Ritter genannt wird und auf seiner Reise fesselnde Aventüren erlebt. Anders als man es vielleicht erwarten würde, bildet der zweite Teil keine Fortsetzung, sondern erzählt rückblickend das Leben Parsivals. Er begibt sich ebenfalls auf eine mitreißende Wanderschaft und macht sich dabei auf die Suche nach dem sagenumwobenen Gral.-
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 178
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Gerhart Hauptmann
Gral-Phantasien
Saga
Gral-Phantasien
Coverbild/Illustration: Shutterstock
Copyright © 0, 2021 SAGA Egmont
Alle Rechte vorbehalten
ISBN: 9788726956511
1. E-Book-Ausgabe
Format: EPUB 3.0
Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt. Kopieren für gewerbliche und öffentliche Zwecke ist nur mit der Zustimmung vom Verlag gestattet.
Dieses Werk ist als historisches Dokument neu veröffentlicht worden. Die Sprache des Werkes entspricht der Zeit seiner Entstehung.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - ein Teil von Egmont, www.egmont.com
1. Kapitel
Unter Glockengeläut und Volksjubel geschah die Hochzeit Parsivals und Blancheflours. Als ein besiegter, irrender Ritter, sein schwarzes Ross am Zügel führend, war Parsival in der Hauptstadt Blancheflours eingezogen, und nun war er ihr Gatte und König geworden. Welche Irrfahrten er bis dahin durchgemacht hatte, ist in der besonderen Geschichte Parsivals aufgezeichnet, auch dass er und warum er seine Gattin schon am Morgen nach der feierlichen Hochzeit heimlich verliess.
Dreiviertel Jahre nach dem Verschwinden Parsivals gebar Blancheflour ihren einzigen Sohn Lohengrin.
Der witwenhafte Ernst, der ihr eigen war, hinderte nicht, dass der junge Prinz und Nachkomme Parsivals mit allem Glück der Jugend gesättigt seine Kinderjahre verleben durfte. So war Lohengrin bald zu einem schlanken glücklichen Knaben geworden, dessen gläubige Heiterkeit unbesieglich schien. Der blonde Knabe, der Stadt und Reich mit Bürgern und Untertanen seiner Mutter zu seinen Füssen sah, ward gleichsam von allen auf Händen getragen. Das erhöhte natürlich den Zustand seiner Glückseligkeit, der auch immer wieder in den trüben Dämmer, der das Herz seiner Mutter erfüllte, hineinstrahlte. Güte und Kraft waren vermählt in dem Knaben und noch mehr in dem Jüngling Lohengrin, dessen Schönheit so blendend war, dass man nach dem geheimnisvollen Verschwinden seines Vaters geradezu von göttlicher Herkunft munkelte.
Blancheflour, die nach Parsivals Verschwinden in ihrem Sohne das Einzige sah, was sie im Leben festhalten konnte, hatte ihn mit den vorzüglichsten Lehrern umgeben und zu seinem Umgang nicht nur die edelsten Sprossen seiner Altersstufe aus dem Adel des Landes ausgewählt, sondern auch junge Priester und Philosophen, so dass der Jüngling im Bereiche der sieben freien Künste ebenso meisterlich ausgebildet, als im Reiten und Fechten war.
Überdies ward Lohengrin aus dem unerschöpflichen Reichtum seiner Mutter jeder nur halb geäusserte Wunsch erfüllt, trotzdem er an Wünschen fast noch reicher, als seine Mutter an irdischen Gütern war.
Er liebte die Jagd, er liebte den Glanz, er baute sich hie und da im Lande romantische Burgen und Lustschlösser, die er mit köstlichen Gärten umgab und abwechselnd mit seinem grossen Gefolge besuchte. Er feierte Feste, hielt weltberühmte Tourniere ab, während seine Mutter in der Stille der Bibliothek mit einem Araber über den Gralsbüchern grübelte.
Blancheflour vertiefte sich unter Leitung eines Arabers in das Studium vom heiligen Gral, hauptsächlich um den Weg dorthin zu ergründen und ihren verlorenen Gatten wiederzusehen. Aber weil es der Gral gewesen war, der, stärker als sie, ihren Gatten und früher Gornemant an sich gezogen hatte, betrachtete sie seine Segnungen mit Sehnsucht sowohl als mit Bitterkeit und mit einer Ehrfurcht, die, wenn sie an Lohengrin dachte, der nackten kahlen Furcht zum verwechseln ähnlich sah.
So hatte sie einen geheimen, strengen Befehl an jedermann ausgehen lassen, der mit Lohengrin in Berührung kam, dass er bei Strafe des Köpfens oder Hängens niemals vom heiligen Grale sprechen, ja auch nur seinen Namen erwähnen dürfte. Ebenso blieb der Teil der Bibliothek, wo die Gralsbücher aufgestapelt lagen, imme rvor dem Prinzen verschlossen, auch dann, wenn die Königin mit dem Araber in diesem Raume ihre Studien trieb.
Blancheflour war für Lohengrin nicht nur die Mutter, sondern er sah in ihr eine Heilige. Der sanfte, doch tiefe Schmerz, der ihr Wesen durchtränkte, auch wenn sie lächelte, galt dem Knaben, dem Jüngling, dem jungen Manne als Zeichen tiefster Weisheit und des tiefsten Wissens, das in der Welt zu erlangen ist.
Der Prinz, der weisse arabische Pferde zu reiten liebte, zog nie auf die Jagd, ohne dass er durch seine silbernen Jagdhörner die Mutter beim Auszug begrüssen liess. Bei jeder Tafel erhob er sich feiersich, wenn er das erste Glas Wein an die Lippen setzte und trank es auf seiner erhabenen Frau Mutter Wohl. Es war bezaubernd, wie er, an lich der gewinnendste Mann, seiner Königin Mutter begegnete, wie er mit edelstem Anstand und kindlicher Devotion behutsam die lange weisse Hand Blancheflours an die Lippen nahm, jene Hand, die einst der Vater Parsival in glühendster Liebe geküsst hatte. Nie trug Lohengrin andere Farben, als die seiner Mutter, grün und weiss, beim Tournier, und niemals, auch dann nicht, wenn fremde Königinnen zugegen waren, verneigte er sich auf dem Tornierplatz eher vor jemand anderem, als vor ihr. Er sagte laut, seiner Mutter ein einziges Lächeln abzugewinnen, bedeute ihm mehr als der Besitz von aller Könige Land und die Gunst aller Königstöchter der Erde.
Was Wunder, wenn er nur lachend den Kopf schüttelte, als seine Mutter ihm die Notwendigkeit, ein Weib zu nehmen, vorstellte. Nein, er wollte, nicht heiraten. Und er heiratete nicht.
Lohengrin hatte die Anmut und sanfte Selbstherrlichkeit solcher Prinzen, die ohne einen Vater, der sie in Schatten stellt, aufgewachsen sind. Erst als er im zwölften Jahre war, fing er an, sich über seinen Vater, den er nicht einmal dem Namen nach kannte, heimlich Gedanken zu machen. Er würde den Namen Parsival ohne Zweifel längst erfahren haben, wenn nicht der Wille der allgeliebten Königin Blancheflour es verhindert hätte. Sie wollte den Sohn auf keine Weise in das dunkle Schicksal des verschollenen Gatten verwickelt sehen.
Nach Art eines guten Sohnes trat Lohengrin eines Tages mit der gewohnten, ehrerbietigen Herzlichkeit in die Frauengemächer der Mutter ein. Er wollte die Fragen, die ihn beschäftigten, von niemand als ihr beantwortet wissen.
Die Mutter sagte: Du hast ein Recht nach deinem Vater und seinem Schicksal zu fragen, Lohengrin, und so muss es wohl scheinen, als habe ich, als Mutter, nicht das Recht dir eine Auskunft zu verweigern. Gerade aber, weil ich deine Mutter bin, tu ich das.
Aber Blancheflour verbesserte sich. Du weisst es, fing sie von neuem an, dass ich dir gegen deinen klaren und ausgesprochenen Wunsch nichts zu verweigern imstande bin. Deshalb bitte ich dich, nimm deine Fragen aus freiem Willen zurück, verzichte, um meiner besseren Einsicht Willen, auf ihre Beantwortung.
Lohengrin, der die Hand seiner Mutter während sie sprach, zärtlich gehalten hatte, kniete nieder und legte sie an die Stirn, womit er seinen herzlich freien Gehorsam ausdrückte. Was du mir zu verschweigen wünschest, hohe Frau Mutter, sagte er, danach will ich nicht fragen. Dein Schweigen soll mir so wert und werter als aller anderen Menschen Antwort sein.
Nun aber sagte die in heimlicher Angst um das Glück ihres Sohnes erbebende Königin Blancheflour: willst du mir ein Versprechen geben? Jedes, gab er zur Antwort, was du von mir verlangst, Mutter Königin! So gelobe mir, sagte sie wiederum, niemals und niemand nach deinem Vater und niemals und niemand nach dem geheimnisvollen Gegenstand zu fragen, in dessen Studium ich hinter den Mauern unserer Bibliothek versunken bin. Ich gelobe es! sagte, sich tief verneigend, der Knabe.
Unzweifelhaft war dem Prinzen durch diese Vorsicht der Mutter und durch den ritterlichen Gehorsam, der es ihm ganz unmöglich machte, je sein Gelübde zu verletzen, der schöne, freie und sorglose Wuchs seiner Knaben- und Jünglingsjahre erhalten geblieben.
2. Kapitel
Eines Tages befand sich Prinz Lohengrin auf der Falkenjagd. Tagelang war er zu Pferde mit vielen Falken in grosser Gesellschaft durchs Land geritten. Man hatte so einen entlegenen See erreicht, bei dessen Anblick Lohengrin äusserte, er komme ihm vor, wie der Styx, das ist jener Strom der Unterwelt, über den der Totenfährmann abgeschiedene Seelen ins Reich der Schatten hinüberrudert.
Kaum dass der junge Prinz diesen Gedanken ausgedrückt hatte, so schien ihn ein Nachen mitten im See zu bestätigen, in dem sich die hohe, unbewegte Gestalt eines Anglers abzeichnete.
„Der dort könnte wahrhaftig Charon sein,“ sagte Lohengrin, „und der See sieht nicht anders aus, als hätten ihn Tränen statt Himmelsregen gebildet.“
Als er diese Betrachtung anstellte, hatte der schöne Mann und Jagdherr — er war damals fünfundzwanzig Jahre alt — den weissen Lieblingsfalken auf der Faust und sein weisses arabisches Pferd unter sich: zugleich aber kam eine Wildtaube aus der Gegend, wo eben die Sonne blutig unterging, über den See herangeflogen. „Lieber Täubrich,“ sagte da in einer Anwandlung frevlen Übermutes Lohengrin, „für dich soll dieser See nun wahrhaft und wirklich den Styx bedeuten.“ Damit nahm er dem Falken die Kappe ab, warf ihn hoch, und in kurzer Zeit, als der Kampf in der Luft entschieden war, fiel die ermordete Taube aus grosser Höhe und zwar, wie man deutlich sah, in den Nachen des angelnden Fischers hinein.
Über den sonderbaren Zufall suchten die Herren des Gefolges mit lautem Lachen hinwegzukommen. Man erwartete lärmend den langsam herwärts treibenden Kahn, der, wie es schien, sich ohne das Ruder des Anglers den Ufern näherte. Sowie der Nachen zwischen dem Schilf zum Stillstand kam, war es, als habe ein eisiger Hauch die Flamme der Freude unter den Wartenden ausgeblasen.
Der Fischer sagte: Hier hast du dein blutendes Opfer, Prinz Lohengrin! Du tötest den Schwachen, Parsival pflegte den Starken zu töten. Er schoss den Sperber, du hast die Taube ums Leben gebracht.
Da war nun zum grossen Entsetzen des Gefolges der Name Parsival vor den Ohren des Prinzen genannt worden.
Ein Jeder erschrak, denn die gute Königin Blancheflour hatte auch diese Verfehlung mit Todesstrafe belegt. Aber man liess den Fischer unbehelligt davonrudern. Schien es doch, als habe der Prinz die Worte des Mannes überhört, und man würde zudem nicht recht gewusst haben, wie man die Gefangennahme des Fremden begründen sollte, ohne Lohengrin das Geheimnis ganz zu enthüllen, dessen bergender Vorhang ja erst kaum merklich gelüftet war.
Allein die Rätselworte des Fischers hatten sich in die Seele des Prinzen eingebrannt und alle eigentümlichen Umstände, die den Tod der Taube begleitet hatten. Von da ab kam es zuweilen vor, dass den Prinzen das schmerzverzehrte Antlitz des Anglers nach frohen Gelagen im Traume ängstete. Gern hätte er nun mit seinen Gedanken und Zweifeln, die ihm das wunderliche Erlebnis erregt hatten, bei der Mutter Belehrung gesucht. Aber er fühlte zu wohl, wie nahe ihm die Gefahr gekommen war, das Blancheflour gegebene Versprechen zu verletzen, das ihm die Frage nach seiner Herkunft, das heisst nach seinem Vater, verbot.
So starb eines Tages Blancheflour, ohne ihr irdisches Schweigen gebrochen zu haben, und ging in das grössere Schweigen des Todes ein.
Bald nach ihrem Hingang hatte der neue König ein Gespräch mit dem alten Araber, der seiner Mutter bei ihren geheimnisvollen Studien nicht von der Seite gewichen war.
Die erhabene Frau Königin, deren sterbliche Hülle heut im Dom auf dem Katafalk meinem Volke gezeigt wird, war viel zu jung für den Tod, sagte Lohengrin.
Dagegen der Araber:
Sie ist an einer alten verheimlichten Wunde gestorben.
Wer hat ihr die Wunde geschlagen?, fragte Lohengrin.
Einer, sagte der Araber, der, wie mir die Planeten verraten haben, heut noch irrend die Welt durchschweift.
Den will ich suchen und strafen, sagte Lohengrin, der meiner Mutter die unheilbare Wunde geschlagen hat.
Davor muss ich dich warnen, sagte der Araber.
Aber Lohengrin fügte hinzu: ich will es halten wie Parsival.
Woher weisst du den Namen deines Vaters? fragte der Araber.
Ich weiss nur, sagte der junge König, dass sein Wahlspruch gewesen ist: dem Starken ein Trutz, dem Schwachen ein Schutz.
Die Glocken des Doms und alle übrigen Kirchen läuteten, als man Blancheflour zur Erde bestattete. Lohengrin, in silberner Rüstung, auf dem Haupt einen Helm in Form eines silbernen Schwanes tragend, ritt hinter dem Sarge her, der, nach der Zeit-Sitte, offen war. Er hatte die Farben der Verstorbenen, grün und weiss, angelegt, die er so oft, der Mutter zu Ehren, beim ritterlichen Spiele getragen hatte. Da geschah es, dass er, das Auge durch Tränenströme verschleiert, dennoch, als der Leichenzug durch das Stadttor hindurch ins Freie gelangte, zur Seite der Strasse ein angebundenes schwarzes Ross und einen daneben stehenden Ritter gewahrte, den er in seinem Schmerze nicht weiter beachtete. Hätte er Sinne für etwas anderes als den Schmerz um die Tote gehabt, so hätte ihm der Mann, das Ross und die Rüstung auffallen müssen.
Die Gestalt des Mannes war sehnig, sein Auge voll Glut, sein Haar ergraut, er trug auf dem Schilde eine Taube, sein Helm war als Falke gebildet, und beim näheren Hinsehen hätte man auf dem Schildrande das Wort Herzeleide entziffern können. Auf dem Brustharnisch war ein Schiffer mit einer Angel angebracht. Waffen und Rüstungsstücke, sowie der Ritter selbst, waren merkbar durch Wetter und Wind mitgenommen.
Dieser Ritter war niemand anderes als der noch immer irrende, nach dem Grale suchende Parsival, den sein dunkles Geschick gerade in einem Augenblick hergeführt hatte, wo man seine von ihm verlassene Gattin begrub. Noch trug er die Rüstung Gornemants, die er übernommen hatte und deren genaue Beschreibung in der Chronik des Hauses zu finden war. Aber auch diese Chronik war sorgfältig im Auftrage der Königin Blancheflour ihrem Sohne verborgen worden.
Trotzdem würde vielleicht der schmerzliche Augenblick zu einer Erkennung zwischen Vater und Sohn geführt haben, da der fremde Ritter nahe daran war, sich durch einen Ausbruch ungeheurer Qual zu verraten. Allein der Schmerz war zu gross, er lähmte ihn. Und was nun noch geschah, entzog sich den Blicken Lohengrins, der, versunken in Trauer, dem wächsernen Bilde im Sarge nachfolgte.
Im Zuge der Trauernden ging auch der Araber. Ihm hatte sich plötzlich der unerkannte Parsival zugesellt. Beide hatten nun ein Gespräch, worin der gelehrte Araber, der in der Kenntnis der Gralsbibliothek und in der Wissenschaft der Sterne nicht seinesgleichen besass, bewies, dass er den fremden Ritter sogleich erkannt hatte.
Ich sehe dir an, sagte er zu Parsival, du hast den Weg zum Gral nicht gefunden. Was mich betrifft, ich bin heute hundertunddreissig Jahre alt, älter als mir die Sterndeuter voraussagten, und wenn Blancheflour noch ein Jahr gelebt hätte, so hätte ich sie mit verbundenen Augen den Weg zum Gral zu führen gewusst. Denn, musst du wissen, sie grübelte seit du fort bist nur immer über den Weg zum Gral, leider nicht aus dem reinen Grunde, das heilige Wunder des Herrn zu finden, sondern, armer Parsival, um dich wiederzusehen. Ich wusste es aus den Planeten, aber ich habe es Blancheflour nie gesagt, du würdest am dritten Tage nach ihrem Tode, ohne den Gral gefunden zu haben, zurückkehren.
Parsival fragte: Wer ist der Ritter im silbernen Harnisch, mit dem silbernen Schwan auf dem Helm, der ähnlich dem Sonnengott auf schneeweissem Pferd hinter dem Sarge herreitet?
Das ist Lohengrin, sagte der Araber, ist dein Sohn! Aber ich rate dir ab dich vor ihm erkennen zu geben. Er hat das gütigste Herz in der Brust und alle Welt liebt ihn und trägt ihn auf Händen. Nur einen hasst er und sucht er als ärgsten Feind: den, der seiner Mutter die unheilbare Wunde geschlagen hat.
,,Das bin ich,“ Parsival, trat aus dem Kondukt und liess das weinende Volk in endlosem Zuge, hinter dem Sarge der guten Königin her, zu Grabe schreiten. Da alles weinte, fiel es nicht auf, dass Parsival ebenfalls in Tränen gebadet war.
Parsival hatte einst seine Mutter verlassen, um die Welt zu bekämpfen. Als er zurückkam, fand er die Mutter nicht mehr. Er verliess den Gral, den er nicht erkannte, als er an ihm vorübergetragen wurde, und als er erkannt hatte oder wenigstens ahnte, was er war, vermochte er ihn nicht wiederzufinden. Um ihn zu finden, verliess er sein junges Weib Blancheflour und verscherzte ein irdisches Königreich; denn als er zurückkam, fand er auch sein Weib nicht mehr, und seinen eigenen, ihm fremden Sohn, musste er meiden, wie seinen Feind. So trat er denn wiederum aus dem Zuge heraus, stieg auf sein. Ross und ritt von dannen.
Als die Königin Blancheflour zur Erde bestattet war, glaubte man allgemein, der neue König werde nun auf eine noch glänzendere Weise als vordem Hof halten. Allein, siehe da, man täuschte sich. Die Thronbesteigung hatte noch in der vorgeschriebenen, pomphaften Form stattgefunden, bald danach entliess man den grössten Teil der Hofbeamten und der Dienerschaft. Auch die Jägerei wurde eingeschränkt, so dass man selbst in den Kreisen der Eingeweihten durchaus nicht mehr wusste, was man von dem jungen Herrscher erwarten, glauben und hoffen sollte. Staunen und Betrübnis war daher allgemein, als man eines Tages erfuhr, Lohengrin habe eine Regentschaft eingesetzt und treibe irrende Ritterschaft oder habe die Reise ins heilige Land, zum Grabe des Herrn Jesus angetreten. Es war gerade das, was man zuallerletzt von diesem lebensfrohen Manne und Prinzen erwartet hatte.
Bald danach wurde ein fahrender Held unter dem Namen Ritter Hilfreich berühmt, der einen Schwan als Helmzier führte und dessen Schild die Inschrift:
„Dem Starken ein Trutz
Dem Schwachen ein Schutz“
trug. Und wo er erschien, schön, stark und gewappnet wie ein Erzengel, jauchzte das niedere, bedrückte, in Arbeit und Not fast erstickende Volk ihm zu, während die Starken, Harten und Ungerechten ihn heimlich verhöhnten und bitter hassten. Dieser Ritter war Lohengrin.
Die Worte des Fischers hatten auf eine fast zauberhafte Weise in seinem Herzen Wurzel geschlagen. Alle Mühseligen und Beladenen liefen ihm zu, als ob er der neue Heiland wäre, und manchen Tyrannen hatte der Ritter mit dem Schwan aus dem Sattel geworfen. Nicht selten zog er, das Ross am Zügel führend, zu Fusse durch irgend ein Stadttor ein, während ein kranker Bettler im Sattel hockte. Zuweilen war es ein Weib, zuweilen ein ländlicher Arbeitsmann, zuweilen ein Kind, dessen Bedürftigkeit ihn angezogen, dessen Klagen er vernommen oder dessen Wunden er verbunden hatte. Zu vielen Malen hatte er nicht verschmäht, in die allerniedrigsten Hütten der Armut mit seiner silbernen Rüstung hineinzukriechen. Soweit seine mitgebrachte Barschaft reichte, hatte er Gold mit vollen Händen ausgeteilt und bitterste Not auf jede mögliche Weise gelindert, ja er war in Gefängnisse eingedrungen und hatte viele unter denen von Entehrung, Kerker und Todesstrafe befreit, die eine blinde Gerechtigkeit zu Unrecht verurteilt hatte.
Er hatte, der Stimme seines Herzens und noch mehr der Stimme des Blutes folgend, eine ähnliche Wallfahrt wie sein Vater angetreten.
3. Kapitel
Eines Abends kam Ritter Hilfreich unter dem Jubel des armen Volkes in eine Stadt geritten. Man schrie Hosianna, warf Blumen und grüne Zweige auf seinen Weg, und einige abergläubische Weiber gingen so weit, sich vor sein Ross zu werfen, damit es über sie hinwegschreite. Sie glaubten dadurch von ihren unheilbaren Übeln geheilt zu werden.
In der Nähe des Hafens redete Lohengrin einen armen Lastträger an, damit er ihm durch das Gewirr der Gassen einen gewissen Weg weise. Kein Wunder, wenn der Alte, der irgendein schweres Gewicht auf dem Rücken trug, wie geblendet die Hand über beiden Augen zu dem strahlenden Schwanenritter aufblickte. Dieser sagte: Ermanne dich, lieber Alter, vergiss nicht zu antworten, bedenke, dass ich ein fremder, irrender Ritter bin.
Der Alte zitterte sehr, als er dem Fragenden antwortete: Wenn du ein irrender Ritter bist, sagte der Lastträger, und du fragst keinen anderen nach dem Wege, den du gehen solltest als mich, so helfe mir Gott, dass ich dich zurecht weise: suche nie nach dem, der deiner Mutter die heimliche Wunde geschlagen hat.
Ich danke für deinen Rat, alter Vater, sagte mit herzlicher Güte Lohengrin, ohne zu wissen, dass er in Wahrheit mit Parsival, seinem Vater, redete. Dieser fuhr fort: Zum Zeichen der Versöhnung und des Friedens, steige vom Ross, brich das Brot mit mir und lass dir etwas erzählen vom heiligen Gral und vom Parsival.
Lohengrin glaubte anfangs, irgendein Unglück habe den alten Lastträger um den Verstand gebracht; als er ihn aber den Namen Parsival und den des heiligen Gral erwähnen hörte, beschloss er, dem alten, gebrechlichen Manne zu willfahren. Er hob ihn aufs Ross und leitete dieses am Zügel bis an die Tür der elenden Bretterhütte, wo dieser arme Lazarus mit ihm das Abendmahl zu nehmen gedachte.
So sass nun Parsival auf dem milchweissen Streitross seines geliebten Sohnes Lohengrin, ohne dass jener es ahnte, wer er war. Was Wunder, dass er unaufhaltsam salzige Tränen heimlicher Freude weinte.
Während des Essens war der glänzende, gottgeliebte Paladin, mit seinem unerkannten Vater in einem Bretterschuppen untergekommen. Als sie das Brot miteinander brachen und den ersten Schluck aus einem gemeinsamen Kelche tranken, hörten sie beide Glockenlaut und wussten sofort, wie dieser Klang von keinem der städtischen Dome herstammte. Da wusste der alte Lastträger Parsival, wie nun die Gnade, die Liebe und die Versöhnung gekommen war. Und er begann seine eigenen Irrfahrten, als wären es die eines anderen, zu erzählen.
Er sprach von Herzeleiden, der Mutter Parsivals. Er nannte sie, gleichsam vom Geist erleuchtet, die Allmutter. Auch Blancheflour wäre, ebenso wie Parsival, von Herzeleidens Geschlecht gewesen. Er schloss: Auch du und ich, wir sind von Herzeleidens Geschlecht, lieber Sohn.
Nun erfuhr der Ritter auch die näheren Schicksale Parsivals. Wie er auszog, die Mutter an seinem Vater zu rächen. Er erfuhr vom Gral, den Parsival fand und wieder verlor, von Gornemant und dem Gralskönig, dem kranken Amfortas, der Parsivals Vater und also Lohengrins Grossvater war. Ihm wurde eröffnet, was Parsival mit einem Fischer und mit einem schwarzen Ritter erlebt hatte, Vermummungen seines Vaters, durch die er versucht hatte, ihn auf den rechten Weg zu leiten.