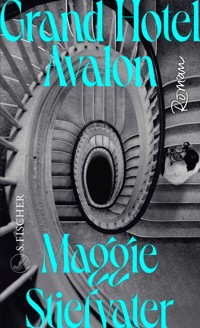
19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Januar 1942. Für June Porter Hudson ist die Führung des Avalon und seines ihm treuen Personals kein Beruf, sondern Berufung. Umgeben von der magischen Einsamkeit der Appalachen, steht das legendäre Grand Hotel für Luxus, Raffinesse und für sein besonderes Heilwasser. Doch als die Wirrungen des Krieges in seine Welt einbrechen, muss June sich einer harten Prüfung stellen, denn nur sie kennt die Kräfte, die aus den Quellen hinter den Fassaden wirken. Sind das Hotel und die ihm verschriebenen Menschen zu retten und eine Katastrophe aufzuhalten? »Grand Hotel Avalon« ist eine bezwingend-soghafte Geschichte über Liebe, Geheimnisse, Verrat und eine unwiderstehliche Heldin, deren Hingabe mitten ins Herz trifft.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 514
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Maggie Stiefvater
Grand Hotel Avalon
Roman
Über dieses Buch
Januar 1942. Für June Porter Hudson ist die Führung des Avalon und seines ihm treuen Personals kein Beruf, sondern Berufung. Umgeben von der magischen Einsamkeit der Appalachen, steht das legendäre Hotel für Luxus und Raffinesse. Und sein besonderes Heilwasser. Doch als die Wirrungen des Krieges in seine Welt einbrechen, muss June sich einer harten Prüfung stellen, denn nur sie kennt die Kräfte, die aus den Quellen hinter den Fassaden wirken. Ein bezwingend-soghafter Roman über Liebe und Verrat und eine Heldin, deren Hingabe mitten ins Herz trifft.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Maggie Stiefvater, geboren 1981, liest schon immer für ihr Leben gern und hat bereits als Jugendliche angefangen, Geschichten zu erzählen und zu schreiben. Mit ihren Jugendbüchern stand sie auf der New-York-Times- und SPIEGEL-Bestsellerliste. Sie lebt mit ihrer Familie in den Bergen Virginias.
Impressum
Erschienen bei FISCHER E-Books
Die Originalausgabe erschien 2025 unter dem Titel »The Listeners« bei Viking, an imprint of Penguin Random House LLC, New York.
Copyright © 2025 by Maggie Stiefvater
Für die deutschsprachige Ausgabe:
© 2025 S. Fischer Verlag GmbH,
Hedderichstr. 114, 60596 Frankfurt am Main
Covergestaltung: Studio Godewind nach einer Idee von Penguin Random House
Coverabbildung: ullstein bild/Michael Herrmann und Getty Images
ISBN 978-3-10-491880-8
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
[Widmung]
[Motto]
[Brief]
Oben
[Bestellung]
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Unten
[Bestellung]
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Drinnen
[Bestellung]
[Brief]
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Draußen
[Bestellung]
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Epilog
[Bestellung]
[Brief]
Anmerkungen der Autorin
Dank
Leseempfehlungen
Für Richard,
der vom Avalon träumte
Eines wird es in einem guten Hotel niemals geben – Streit.
The Hotel Monthly, Januar 1940
Jillian Pennybacker
Lodge 3
William & Mary Campus
7. Dezember 1961
Liebe Miss Pennybacker,
dies ist die Geschichte des Hotels, das ich auf der Party erwähnte, jenes prächtigen Gebäudes, unter dem das magische Wasser fließt. Ich dachte, Sie würden an der Rolle, die Ihr Vater darin gespielt hat, vielleicht Gefallen finden.
Deshalb, Kopf hoch! Es geschehen wirklich manchmal Wunder.
Herzlich,
Eric Parnell
U. S. State Department Washington, D. C.
Teil 1
Oben
New York Times
Vogue
Britannia and Eve
Modes & Travaux
2 Zitronen
2 Croissants
2 Meter senfgelbe Wolle (Muster anbei)
1 Meter bedruckter Baumwollstoff (Muster anbei)
Die Bucht des Franzosen, Daphne du Maurier
Die schwarze Sonne, Marguerite Steen
Windswept: Roman dreier Generationen, Mary Ellen Chase
Fettstift
Kapitel 1
Der Tag, der das Hotel für immer verändern sollte, begann wie jeder andere auch.
June Porter Hudson erwachte vor dem Morgengrauen in der Souterrainwohnung des kleinen Personal-Cottage, das den heißen Quellen am nächsten lag. Sie stand auf und verscheuchte die drei Hunde (zwei Langhaar- und einen Rauhaardackel), die vom Bett rutschten und ihr in höflichem Abstand folgten. Sie duckte sich unter der quer durch den Raum gespannten Wäscheleine hindurch, nahm Hemd und Unterwäsche ab und hängte die Steppdecke darüber, damit sie auslüften konnte.
Im Licht der Nachttischlampe warf sie sich in ihre übliche Montur: taillenhohe weite Hosen, ein Hemd mit ordentlich hochgekrempelten Ärmeln, eine zierliche Armbanduhr, ein Hauch Lippenstift. Sie trug einen dunklen Bob, den sie sich jetzt mit etwas Pomade elegant hinters Ohr strich. Ihre Erscheinung passte nicht zu den steifen Locken und Kleidern, denen man sonst im Hotel begegnete, aber schließlich erwarteten die Rockefellers und Roosevelts auch nicht, dass sie aussah wie sie; und vor allem klang sie nicht wie sie, mit ihrem Hinterwäldlerdialekt. Diese Gäste waren es gewohnt, dass ihre Hoteliers, wenn überhaupt, einen französischen Akzent hatten, doch Junes Französischkenntnisse beschränkten sich auf »Vive l’empereur!«, was einer ihrer Kellner jedes Mal leise vor sich hin zischte, wenn er des Küchenchefs ansichtig wurde. Und doch. Die Gäste liebten sie.
Nachdem sie in ihre Mary Janes mit den niedrigen Absätzen geschlüpft war, leerte June am einzigen Fenster der kleinen Küche lautlos zwei volle Gläser Heilwasser. Im Sommer bot das Fensterchen den grauen morgendlichen Blick auf Mulch und Sträucher rund um die Veranda, aber jetzt, im Winter, spiegelte das dunkle Glas nur ihr Gesicht (weit auseinanderliegende Augen, gewölbte Brauen, Lippen so schnörkellos wie ein Bleistift). Zwei Gläser Heilwasser. Süßwasser nannten es die Einheimischen, obwohl es nach einer aufgeplatzten Lippe und einem Mundvoll Staub schmeckte. Süßwasser hieß es nicht wegen seines Geschmacks – sondern wegen seiner Wirkung auf den Körper. Wovon wurde man geplagt? Rheumatismus, Verstopfung, Unfruchtbarkeit, Grippe? Dyspepsie, Malaria, Gallensteine, Krupp? Heimweh, Ekzeme, Gicht? Verdauungsstörungen, Entzündungen, Schlaganfall, Zweifel? Medizinische Fachzeitschriften und medizinisch ausgebildete Gäste diskutierten über die Heilkraft der Quellen, aber June dachte nicht viel darüber nach. Sie begann und beendete jeden Tag auf dieselbe Weise und versäumte es nie, ihre vier Gläser Wasser zu trinken. Jetzt leerte sie, nachdem sie fertig war, ein Glas in den Dackelnapf, fütterte den Hunden ein paar Fleischreste aus dem Kühlschrank und machte sich an die Arbeit.
Arbeit, Arbeit. Sie nahm kein Ende. June beaufsichtigte 450 Angestellte, 420 Zimmer, 418 Hektar Land, 212 Shropshire-Schafe, 110 Golden-Delicious-Apfelbäume. 60 Pferdeboxen, 21 Cottages, sieben Hütten, vier Badehäuser, drei Abfüllräume und zwei Mineralquellen. Jeden Tag musste sie das Personal organisieren, Vorräte inventarisieren, Veranstaltungen auf die Beine stellen, jeder mühsame Atemzug dieses kostenintensiven Monstrums musste auf den Cent genau abgerechnet werden, damit die Gilfoyles, denen das Hotel gehörte, Gewissheit hatten, dass kein Quäntchen ihres Reichtums sich ohne sie amüsierte. Das Geschäft mit dem Luxus: Junes erster Gedanke, wenn sie aufwachte, und ihr letzter, wenn sie zu Bett ging.
An diesem Tag, dem 25. Januar, veranstaltete das Avalon einen Tartan-Ball zu Ehren von Robert Burns, einem längst verstorbenen, aber immer noch hochgepriesenen schottischen Dichter. Ihre Dackel im Schlepptau, hatte June sich zu ihrem Personalchef Griff Clemons auf den Balkon des Ballsaals gestellt, um der Generalprobe der technischen Abläufe beizuwohnen. Der Ballsaal war beeindruckend. In seiner Mitte stand ein mit geschnitzten Rhododendronblüten verzierter Süßwasserbrunnen, der den Raum mit seinem lieblichen Duft nach Erde und Wildblumen erfüllte. Die hohe Decke schmückte ein prächtiges Gemälde von Susie M. Barstow, einer Malerin der Hudson River School, mit Szenen aus West Virginia. An der Nordwand befand sich eine riesige Bühne, auf der einst die glamouröse Geraldine Farrar noch einmal in ihrer Rolle als Madame Butterfly der MET aufgetreten war. Den Kamin an der Südwand hatte man Stein für Stein aus den Ruinen des Battlesden House erbaut, eine freundliche Gabe des Duke of Bedford. Während eines Aufenthalts des Präsidenten Coolidge hatte dessen Ehefrau Grace bei der Auswahl des Parkettbodens mitgewirkt. Erbinnen. Präsidenten. Mitglieder von Königshäusern. Das waren die Gäste des Avalon: Leute, so weit oben auf der sozialen Leiter, dass sie sich ducken mussten, wenn die Sonne über sie hinwegwandern wollte.
»Wie geht’s Ihren Mädchen, Griff?«, fragte June.
»Ganz gut«, antwortete er.
»Klingt aber nicht so.«
Die Hoteldirektorin und der Personalchef des Avalon waren für ein Hotel diesen Ranges ein ungewöhnliches Duo – eine lächelnde Weiße aus den Bergen und ein sehbehinderter Schwarzer –, aber sie hatten sich beide auf ehrliche Weise von ganz unten hochgearbeitet. Weiter konnten sie beide nicht kommen, und keiner von ihnen lief Gefahr, auf einer künftigen Gästeliste jemanden wie sich selbst zu entdecken.
»Eins der Mädchen hat beschlossen, dass sie sich verliebt hat«, antwortete Griff. »Die andere sinnt auf Rache.«
Griffs Zwillingsmädchen waren gerade fünf Jahre alt geworden.
»Klingt nach schweren Zeiten für die Familie Clemons.«
»Mädchen sollten doch eigentlich sanft sein«, sagte Griff.
»Bin ich etwa sanft?«, fragte June.
Der Personalchef rieb sich nachdenklich ein Auge, eine gedankenlose Geste, die man im Gespräch oft an ihm beobachten konnte. Seine großen haselnussbraunen Glupschaugen würden ihn vor der Einberufung bewahren. Das linke war funktionstüchtig, aber das rechte nur noch Zierde, seit ihn im Alter von sechs Jahren ein störrisches Kalb ins Gesicht getreten hatte. June empfand Dankbarkeit. Der große, drahtige Personalchef war ihre rechte Hand, verantwortlich für alles, was außerhalb des Gästebereichs passierte. »Kein Kommentar, Hoss«, sagte Griff.
Von unten aus der Grotte war Klirren und Klappern zu hören, die Geräusche der Vorbereitung des Festmahls. Aus dem Orchestergraben ertönten Triller und Gestöhn. Während es sich bei Burns-Partys anderswo meist nur um bescheidene typisch schottische Ceilidhs handelte, wo man zur Musik von Fiedeln und Pfeifen tanzte und traditionelles Haggis schmauste, gab es hier im Avalon eine komplette Dudelsackkapelle aus New York, ein Fünf-Gänge-Menü und ein Meer von Alkohol. Es würde bis vier oder fünf Uhr morgens getanzt.
Normalerweise wäre das, für die Ansprüche des Avalon, ein schlichtes Event außerhalb der Saison gewesen. Aber dieses Jahr war alles anders. Es handelte sich nämlich um das erste Fest, seit Mr. Francis Gilfoyle, der Besitzer des Hotels und Junes Mentor, am 7. November auf der Aufzugsschwelle im vierten Stock zusammengebrochen und verstorben war. Und um das erste Fest, seit die Japaner am 7. Dezember Pearl Harbor angegriffen und Amerika damit in den Krieg gezwungen hatten. Deshalb war der Burns-Night-Ball mehr als nur ein Fest. Er war eine Entscheidung: Konnte es in diesen Zeiten noch Partys geben? The Hotel Monthly, eine Publikation von Hoteliers für Hoteliers hatte kürzlich eine sechsseitige Reportage veröffentlicht (»Amerikanischer Luxus – Versuch einer Definition«), in dem das Avalon als Vorbild präsentiert wurde, dem die anderen Hotels, auch wenn es für die meisten unerreichbar blieb, nacheifern sollten. Die Haltung des Avalon zu Festivitäten in Kriegszeiten würde man allgemein zur Kenntnis nehmen und imitieren.
Und June hatte Folgendes beschlossen: Jahrzehntelang hatten Präsidenten, ausländische Würdenträger, Trendsetter und Entscheidungsträger sich darauf verlassen, dass im Avalon Vergangenheit und Zukunft vergessen und durch eine zeit- und sorglose Gegenwart ersetzt wurden. Jedes Zögern hätte diesen Zauber für immer zerstört. Man würde weiterfeiern.
Jetzt ertönte von unten eine Stimme. »Hoss, sind Sie das da oben?«
»Ja!«, antwortete June. »Und da unten ist wer? Johnny?«
»Ja. Können Sie von dort, wo Sie stehen, die Befestigungspunkte sehen? Alle bündig, auf gleicher Höhe?«
Sie ahmte einen schottischen Akzent nach, Burns zu Ehren. »Aye, Laddie.«
Johnny ging auf das Spiel ein. »Aye, Lassie! Wir sind gleich fertig.«
In der Nacht zuvor, um drei Uhr morgens, als sie sich endlich in ihr bescheidenes Büro hinter der Rezeption davongestohlen hatte, um einen Happen zu essen (kaltes Hühnchen, glasierte Zitronenkartoffeln, Pilaw-Reste), hatte sie dreißigtausend Dollar für Betttücher, Nylonstrümpfe, Laken und Gummibänder genehmigt, alles Dinge, die wohl bald knapp werden würden, selbst wenn der Krieg im Sommer zu Ende ging, wie manche glaubten. Als June die Bestellungen abschloss, hatte sie das Gefühl, den Krieg mit ihrer Unterschrift offiziell heraufbeschworen zu haben. Sie hatte den Gedanken bis jetzt verdrängt: Sie konnte sich Sandy, den Jüngsten der Familie Gilfoyle nicht in Uniform vorstellen. Edgar David Gilfoyle, Mr. Francis’ charmanter ältester Sohn und Erbe des Avalon, hatte June gesagt, er glaube nicht, dass das Hotel wirklich betroffen sein würde. Das war nur ein paar Tage nach Pearl Harbor und nur etwa einen Monat nach der Beerdigung seines Vaters gewesen. Er und June hatten zusammen im Bett gelegen – das war schon einmal passiert und hätte eigentlich kein zweites Mal geschehen sollen –, und Gilfoyle nahm gerade eine pink blühende Rose aus der Nachttischvase mit auf eine Reise, die an einem schweißnassen Punkt zwischen Junes Brüsten begann und an einem schweißnassen Punkt unterhalb ihres Bauchnabels endete. Der Krieg wird das Avalon nicht erreichen, hatte er zu ihr gesagt. Wie sollte er uns denn finden?
Und bis jetzt hatte er recht behalten. Der Krieg hatte die Berggegend nur leicht touchiert. Die 150. Infanterie der West Virginia National Guard war in die Panamakanalzone verlegt worden, und an einigen kohleverdreckten Hauptstraßen hatte man Einberufungsbüros eröffnet. Diese Tatsache veranlasste June dazu, ihr Personal nach neuen Kriterien zu bewerten. Zuvor unwichtige Eigenschaften verwandelten sich in Vorzüge. Ihr bester Schreiner hinkte, ihrem Schlosser fehlten ein paar Finger, ihr warmherziger Registrar litt glücklicherweise an einer alten Militärtuberkulose. Griff sah nur auf einem Auge. Lauter Glücksfälle.
»Los geht’s«, rief Johnny (über vierzig, zu alt, um eingezogen zu werden). »Hoss, rufen Sie, falls sich irgendwo was lockert!«
»Aye.«
»Aye!«
June stützte sich mit den Ellbogen erwartungsvoll auf dem Balkon ab. Griff, der sich nie lässig gab, stellte sich neben sie, aufrecht, als hätte er ein Lineal verschluckt. Über ihnen erwachte die Decke zuckend zum Leben. Die Dackel zogen ängstlich den Kopf ein, als sich ein dumpfes Dröhnen erhob – es erinnerte eher an einen aufkommenden Sturm als an eine Maschine.
»Soll das so sein?«, fragte Griff.
»Die Dudelsäcke werden es übertönen«, erwiderte June.
Was war Luxus? Er war veränderlich, relativ. Bei Dürre war es ein Glas Wasser, bei Flut ein trockener Platz zum Stehen. Was auch immer den Luxus des Avalon im Vorjahr ausgemacht hatte, jetzt galt es nicht mehr. Für die Burns-Night hatte eine berühmte Designerin, zufällig auch der treueste Gast des Avalon, an der Entwicklung einer Überraschung mitgewirkt, die die Gäste daran erinnern sollte, dass es selbst in Kriegszeiten noch Luxus gab.
June war sehr dogmatisch, wenn es um Luxus ging, und zu einem früheren Zeitpunkt ihrer Karriere hatte Mr. Francis, der stolz auf seine der Arbeiterschicht entstammende Novizin war und sie stets in Schutz nahm, ihr immer wieder Gäste geschickt, die sie auf die Probe stellten. Zuletzt war ein Vertreter der Familie Delafield, die sich in der Immobilienbranche New Englands einen Namen gemacht hatte, in ihrem Büro erschienen, um sie in die Enge zu treiben.
Die Schlacht war schnell geschlagen:
Delafield: »Frank sagt, Sie hätten da so eine Art religiöse Theorie, dass Luxus und Reichtum nichts miteinander zu tun hätten.«
June: »Auch ich freue mich, Sie zu sehen, Mr. Delafield. Es ist doch ganz einfach, nicht wahr? Reichtum bedeutet nur Sicherheit. Luxus hingegen ein Leben ohne Sorgen.«
Delafield: »Ich habe keine Sorgen.«
June: »Natürlich nicht. Was wollen Sie von mir hören, Mr. Delafield? Eine Predigt? In Ordnung, dann predige ich eben: Der Reichtum kümmert sich nicht darum, wer Sie sind, tief in Ihrem Inneren, nachts, wenn Sie nicht schlafen können. Der Luxus hingegen kümmert sich um nichts anderes. Deshalb erraten wir, was Sie alle brauchen, bevor es Ihnen selbst bewusst ist. Ist Ihnen nicht aufgefallen, dass Sie diesmal ein anderes Zimmer bewohnen? Die Verwaltung hat dafür gesorgt, dass Sie den Aufzug nicht mit Miss Q teilen müssen; nichts zu danken, gern geschehen. Das Zimmermädchen hat Ihren Nachttisch umgestellt, damit Ihnen Ihre Brille nicht immer hinten runterfällt. Und die Stallburschen wissen, dass Commander Ihr Lieblingspferd ist – da er aber während Ihrer letzten Besuche ein bisschen frech war, haben sie ihn longiert, damit er sich diese Woche lammfromm benimmt. Können Sie sich erinnern, irgendetwas davon verlangt zu haben? Wohl kaum. Dem Avalon ist es eine Freude, all Ihre Wünsche vorauszusehen. Einerseits würde ich gern Ihre Meinung dazu hören, da ich für Verbesserungsvorschläge immer offen bin, andererseits weiß ich schon jetzt, dass Sie mir zustimmen werden. Denn Sie befinden sich hier bei uns an einem Ort des Luxus, statt in Connecticut, dem Ort Ihres Reichtums. Dafür, dass Reichtum und Luxus angeblich das Gleiche sind, haben Sie einen ziemlich weiten Weg auf sich genommen.«
Delafield: »…«
Delafield: »Schlafen Sie mit mir.«
June: »Dazu fehlt mir höchstwahrscheinlich die Zeit, Mr. Delafield, aber ich kann Ihnen ein paar gute Bücher empfehlen.«
Ihr war klar, dass er sich nicht etwa zu ihr hingezogen fühlte. Sie hatte ihn einfach nur überrascht. Einflussreiche Menschen vergessen, dass sie überrascht werden können. Das wusste June aus eigener Erfahrung, denn, oh Wunder, sie war selbst zu einer einflussreichen Person geworden. June Hudson, aus dem Bergtal, eine Frau, Direktorin des Grand Hotel Avalon. Es war ein Wunder, dass diese Worte nebeneinander existierten. Während ihrer ersten Hotelkonferenz, auf dem Cocktailempfang, als sie das erste Mal öffentlich gesprochen hatte, hatten die Männer neben ihr gelacht. Nicht aus Gemeinheit, sondern vor Schreck. Diese schmächtige Frau, dieser unmögliche Dialekt!
»Ach«, hatte einer gesagt. »Sie sind die Direktorin des Avalon!«
O Gott, sie hatte sich gefreut wie ein Schneekönig. Dreihundert Meilen entfernt, und sie hatten von ihr gehört! »Wie entwickeln Sie denn Ihre Strategien?«, wurde sie gefragt.
»Ach, wissen Sie, das Süßwasser steckt voller Ideen«, hatte sie geantwortet, denn schon damals hatte sie das eine oder andere über Legendenbildung gehört.
Jetzt, im Ballsaal des Avalon, ließen Junes Angestellte mit mehreren Handkurbeln ruckartig eine extra für diesen Anlass konstruierte Vorrichtung herab, die unterhalb des Deckengemäldes fixiert gewesen war. An den langen hölzernen Armen hingen Hunderte von Blättern, dickes Bristol-Papier, und auf jedem stand ein Gedicht von Robert Burns.
Den Hagelschlag, den Wintertag
All’ ohne Sonnenschein …
»Sieht ja aus wie ein Hund, der im Regen bibbert!«, rief Johnny.
»Sachte!«
Die Vorrichtung wurde vorsichtiger abgesenkt. Jetzt sackten die Blätter nicht mehr abwärts, sondern flatterten und schwebten nach unten. Sie schienen lebendig, organisch, wirbelten und tanzten.
Der Mechanismus verstummte. Die Gedichte bewegten sich jetzt direkt auf Augenhöhe mit June und erinnerten sie an ein Mobile in einem Kinderzimmer.
So sah Luxus jetzt aus, in diesem Moment, bevor er sich erneut verwandeln würde. Relativ.
June und Griff murmelten wortlos vor sich hin. June hatte ihre Zweifel gehabt, aber jetzt hörte sie die überraschten Ausrufe der Ballgäste beim Anblick des sich herabsenkenden Mobiles förmlich, sah, wie sie nach einem der flatternden Gedichte griffen, um es ihrer Begleitung vorzulesen, wie sie dann weitertanzten, durch papierne Wolken langsam verträumte Runden drehten. June wusste, wie es sich anfühlte, wenn sich das eigene Blut in prickelnden Champagner verwandelte, sie wusste, wie Erdbeeren schmeckten, wenn jemand sie einem auf diesen hellen Ledersofas in den Mund schob. Es gab Zeiten, da hätte man sie selbst für eine Ballbesucherin halten können. Sie drückte die Finger leicht zusammen, als wolle sie nach einem der Gedichte greifen. Sie konnte die Worte geradezu schmecken:
Einen Kuss noch, eh wir scheiden …
Oh! Sie hätte nach der Beerdigung nie wieder in Gilfoyles Zimmer gehen dürfen. Diese dumme Hoffnung. Sie wusste es besser. Sie hatte es schon seit Jahren besser gewusst. Die Seele erinnerte sich, der Körper vergaß.
»Achtung!«
Schrei und Aufprall in derselben Sekunde.
Von irgendwoher über Junes und Griffs Kopf war ein Gegenstand herabgefallen und hatte einen der Arbeiter nur knapp verfehlt. Das Ding schlitterte über den Parkettboden und blieb vor Johnnys Füßen liegen.
»Um Himmels willen!«, rief June. Sie inspizierte das Kunstwerk in der Luft, schaute, ob irgendein Teil fehlte. »Was war das denn?«
Doch als Johnny das Corpus Delicti schwenkte, sah sie, dass es sich um eine hölzerne Sprosse aus dem Balkongeländer handelte.
»Hat der Apparat das abgerissen?«, fragte June.
Jemand, den man nicht sah, erwiderte: »Es wurde geworfen!«
»Was ist das da am unteren Ende?«, fragte June.
»Das Holz ist verfault, Hoss«, meinte Johnny.
Die Angestellten murmelten; niemand war zu sehen, der als Täter in Frage kam; jeder kannte die Gerüchte über den vierten Stock; hier war übernatürliche Bosheit am Werk.
»Wir sollten uns in nichts verrennen«, meinte June. So ein Nässeschaden war zwar rätselhaft, aber er erklärte immerhin, warum der Stab durch die Belastung so leicht hatte herausbrechen können. »Vorsicht, Griff, fallen Sie nicht auch noch runter!« Er lehnte sich über das Geländer und spähte zum oberen Stockwerk hinauf. Die vierte Etage war Langzeitgästen vorbehalten, die Lust hatten, das ganze Jahr im Avalon zu verbringen – und über das nötige Geld verfügten. June kannte sie gut – was größtenteils der Grund war, warum sie blieben –, aber keinem dieser Gäste war so eine Bosheit oder Tollpatschigkeit zuzutrauen.
Als June Griffs Miene bemerkte, seufzte sie: »Fangen Sie bitte nicht auch noch damit an!«
Griff rieb sich das blinde Auge. »Jetzt, wo Mr. Francis von uns gegangen ist, wäre es doch möglich …«
Sie unterbrach ihn: »Das Wasser hat damit nichts zu tun.«
Selbst wenn man die Schwimm- und Badebecken nie benutzte, kam man mit dem Süßwasser des Avalon unweigerlich in Berührung. Das unstete Wasser floss durch Rohre in den Wänden, füllte die Waschbecken und sprudelte in jedem Stockwerk aus den Springbrunnen. Aber es warf nicht mit Gegenständen aus dem vierten Stock.
Zumindest bisher nicht.
»Hoss?« Das war Griffs neuer Laufbursche, Theophilus Morse, ungefähr so alt wie June damals, als sie ins Avalon gekommen war. Elf, zwölf. Er hatte eine tragische Vorgeschichte, aber das war nun mal West Virginia, Tragödien gab es hier im Überfluss. Er bemühte sich nach Kräften, Griff nachzueifern, der stets Haltung bewahrte, aber jetzt keuchte der Junge angestrengt. Er war offenbar gerannt.
»Wo brennt’s denn, Theo?«, erkundigte sich June.
»Mr. …« Er schnappte nach Luft. »Mr. Gilfoyle hat angerufen …« Schon wenn sie seinen Namen hörte, wurde ihr warm. Sie hatte ihn seit jener Nacht nicht wiedergesehen. Ein Monat. Eine Ewigkeit, ein kurzer Moment. Sie spürte immer noch die Blütenblätter auf ihrer Haut.
»Reiß dich zusammen, Junge«, sagte Griff. Er stand kerzengerade. Theo stand kerzengerade. Gemeinsam atmeten sie ein und aus, wie Spiegelbilder.
Jetzt hatte Theo wieder genug Luft, um den Rest der Nachricht zu überbringen. »Mr. Gilfoyle hat angerufen!« Einatmen. »Er fliegt gerade aus New York ab, zu einer Besprechung hier!« Einatmen. »Er hat uns die Liste der Teilnehmer besorgt.« Einatmen. »Er will, dass Sie bei der Besprechung dabei sind.«
Gilfoyle kam hierher, ins Avalon, zu ihr.
»Wer steht denn hinter dieser Besprechung?«, fragte sie.
»Das FBI, Hoss. Das State Department.« Griff verzog den Mund.
»Was will denn das FBI von uns?«, fragte June. Theo zögerte.
June wusste schon seit langem, dass die meisten Menschen schlechte Zuhörer sind; sie denken, zuhören sei das Gleiche wie hören. Aber das gesprochene Wort machte nur die Hälfte eines Gesprächs aus. Die wahren Bedürfnisse, Wünsche, Ängste und Hoffnungen verbargen sich in dem, was ungesagt blieb, und all dies bildete den Kern des Luxus. June war eine gute Zuhörerin geworden.
Und so hörte sie zwischen den Zeilen ein einziges unausgesprochenes Wort, das die Wahrheit mit Pulverdampf verschleierte und in ihre Herzen Schützengräben zog.
»Sie beschlagnahmen das Hotel«, sagte Theo.
Der Krieg.
Der sich ihr Hotel holte.
Der Krieg wird das Avalon nicht erreichen, hatte Gilfoyle ihr versprochen. Wie sollte er uns denn finden?
Offenbar musste er einfach nur den Berg herauffahren und die Eingangstür öffnen.
Kapitel 2
Special Agent Tucker Rye Minnick durfte das Hotel nicht durch die Eingangstür betreten.
Keiner der Agenten durfte das. Als sie am Avalon eintrafen, konnten sie gerade mal einen Blick auf die winterliche Fassade des Hotels werfen, perfekt wie ein Postkartenmotiv, bevor livrierte, behandschuhte Bedienstete ihren Wagen vom Eingang weglotsten. Diese Fahrt schien kein Ende zu nehmen. Sie waren von Washington aus mit vierzig Meilen pro Stunde hierhergeschlichen, dem Tempo, das Roosevelt wohl in Bälde allen empfehlen würde, um Kautschuk und Benzin zu sparen, und jetzt schien es, als wolle man sie noch tiefer in die grauen Berge schicken. Um ihre Fahrzeuge wirbelte Schnee, monoton, meditativ. Nebel stieg aus den Schluchten. Der Januar in West Virginia war rau, karg, objektiv betrachtet schön.
Tucker überlegte, warum sich Menschen so sehr von der Schönheit der Natur angezogen fühlten. Die existierte ja nicht für sie, hier war sie sogar eindeutig gegen den Menschen gerichtet. Alles, was die Schönheit dieser Berglandschaft ausmachte – ihre Abgelegenheit, die steilen Hänge, die rauschenden Stromschnellen –, war gefährlich. Und doch, wie die Maus vor der Schlange, wie das Wild vor dem Jäger, wie ein bestimmter sanfter Frauentyp vor bestimmten brutalen Männern, sehnte sich der Mensch schmerzlich nach diesem Anblick. Selbst ihn, Tucker, ergriff der Liebreiz dieser Gegend, seiner Ausbildung und aller Lebenserfahrung zum Trotz. Alle Vernunft blieb auf der Strecke, der Rest: pures Entzücken.
Auch bei seinem letzten Posten war das so gewesen, wenngleich es sich um eine vollkommen andere Ästhetik gehandelt hatte. Albino Ridge, Texas, eine kleine Grenzstadt, die das Pech hatte, »Singing Joey« Puglisi, der Opium quer durch Mexiko bis nach New York schmuggelte, als Operationsbasis zu dienen. Die karge Landschaft außerhalb der Stadt war abweisend gewesen, dornig und giftig und konnte einen Menschen in ein bis zwei Tagen das Leben kosten … und doch hatte er in den ersten Monaten jeden Abend auf der Veranda gestanden, um den Sonnenuntergang zu bestaunen, der die Chisos Mountains erst in tiefes Rot, dann in Schwärze tauchte. Immer wieder hatte er sich in Erinnerung gerufen, wie lebensfeindlich dieser grausame Ort war, hatte sich dagegen gewehrt, dass seine Schönheit ihn so berührte. Aber stand er in Gedanken nicht auch jetzt noch allabendlich auf jener Veranda?
Der Weg um das Hotel herum führte endlich zu einem Personaleingang, wo ihn ein behandschuhter Portier in der grau-goldenen Avalon-Uniform erwartete.
»Hallo, hallo, hallo. Hallo, junger Mann, wir sind da.«
Mit diesen Worten betrat Mr. Benjamin Pennybacker, Vertreter des State Department, der die Mission leitete, das Hotel. Das State Department stand zwar nicht in Konkurrenz zu Tuckers FBI, aber es waren auch nicht gerade Lieblingskollegen. Eigentlich hätten die FBI-Männer von Agent Pennybacker sprechen sollen, oder, noch passender, von Special Agent Pennybacker, aber untereinander nannten ihn die drei in stillschweigender Übereinkunft Mr. Pennyback, wobei die erste Hälfte seines Namens schnell und in höherer Tonlage gesprochen, die zweite Hälfte energisch in den Dreck gepfeffert wurde. PennyBAAACK. Give me my PennyBAAACK. Jetzt also begrüßte Pennybacker den Portier und balancierte dabei auf einem Fuß, um ein paar Kieselsteinchen vom anderen Schuh zu schnipsen, während er übers Wetter, über Golf, über die hiesige Tierwelt, über das Problem klemmender Schreibmaschinentasten und über walisische Aufstände im fünfzehnten Jahrhundert plauderte; wobei er sich mit seinen Worten der Situation, in der sie alle sich gerade befanden, nicht annäherte, sondern die Beteiligten mit jedem dieser Themen immer weiter von dem wegführte, was eigentlich anstand.
Das State Department! Das waren doch keine Agenten. Sie waren Schuljungen, die nicht merkten, dass ihnen hinten das Hemd aus der Hose gerutscht war; sie wuchsen in einem Aktenschrank auf, während die FBI-Leute im praktischen Einsatz ausgebildet wurden. Tucker unterbrach ihn. »Mir wurde gesagt, dass die Besprechung im Hauptgebäude stattfindet.«
»Wir wurden gebeten«, sagte der Portier, »Ihre Wagen hier hinten zu parken, um die Gäste nicht zu beunruhigen.«
»Die Gäste sind noch hier?«
»Sir?«
Pennybacker warf erst dem Portier, dann Tucker einen flehenden Blick zu. Er schien sprachlos vor Enttäuschung; wie ein kleiner Junge, den ein anderes Kind verhauen hat, um ihm die Süßigkeiten zu klauen.
»Ist Mr. Gilfoyle noch da, um uns zu treffen?«, fragte Tucker den Portier.
»O ja, Sir.«
Na, dann klappt wenigstens das, dachte Tucker. Er drehte sich nach den beiden anderen FBI-Agenten um. »Macht eure Schuhe sauber, Jungs.«
Die Berge im Rücken betraten sie das Hotel und streiften sich den Januarmatsch von den Sohlen. Benjamin Pennybacker, der fest entschlossen war und optimistisch das Kinn vorreckte; Special Agent Hugh Calloway, graziös wie Astaire; Special Agent Pony Harris, grinsend wie ein Krokodil. Special Agent Tucker Minnick, stramm wie ein Kolben. Köpfe gesenkt, Hüte in der Hand. Scharr, scharr, scharr.
»Möchten Sie Ihre Mäntel ablegen?«, fragte der Portier. Pennybacker zog seinen sofort aus, darunter kam sein zerknittertes Hemd zum Vorschein. Die FBI-Männer aber blickten Tucker an. Sie alle trugen 38er-Colts unter ihren Jacketts.
»Wir legen nicht ab«, entschied Tucker.
Das Innere des Hotels glich einem vergoldeten Kaninchenbau mit einem Labyrinth aus Fluren. Treppen führten tunnelartig ins Dunkel, manche hatten nur sechs oder acht Stufen und sahen aus, als müssten sie noch wachsen. Überall Türen, deren Anordnung willkürlich schien. An den Wänden steinerne Bären und Pumas, Adler und Hirsche, die aus ihren dunkel gefärbten Mäulern Mineralwasser in Becken spien. Und immer noch plauderte Pennybacker munter weiter. Über Kreuzfahrtschiffe, Harfenwettbewerbe, das Färben von Wolle, Heilige in Amerika.
Tucker unterbrach ihn: »Haben Sie den Grundriss angefordert?«
»Gute Idee«, meinte Pennybacker. »Ausgezeichnete Idee. Geheimgänge. Männer, die aus Wandöffnungen springen. Frauen, die in der Nacht verschwinden. Dieser Ort regt die Phantasie an.«
Tucker winkte in Richtung eines FBI-Assistenten, der hinter ihm stand. »Kümmern Sie sich drum.«
»Ich werde mein Möglichstes tun, Sir«, antwortete der Assistent.
»Das reicht nicht«, sagte Tucker. »Kümmern Sie sich drum.«
»Jawohl, Sir.« Schon besser.
Im Gegensatz zu Tucker würde der Assistent nach dieser Besprechung frei wie ein Vogel nach Washington zurückkehren. Der Mann war noch jung, so jung, dass er vermutlich noch die Muskelzerrungen von seiner Ausbildung an der FBI-Academy spüren konnte. Ihn erwartete jetzt jahrelange Routinearbeit, bevor er irgendeinen Status erreicht haben würde, Arbeit, die Tucker damals nur allzu gern hinter sich gelassen hatte. Doch jetzt war er neidisch auf jene Tage der Sicherheit, der ehrgeizigen Träume, auf das Gefühl, dass es nur aufwärts gehen konnte. Hoover hatte Tucker als leitenden Special Agent mit zwei Untergebenen hierhergeschickt – auf dem Papier ein seitlicher Schritt auf der Karriereleiter, wenn nicht einer nach oben –, aber er und Hoover wussten, dass es Exil bedeutete, und das hatte er sich verdient.
Die Agenten sahen die Bediensteten kommen und gehen, Türen öffnen und schließen; sie wirkten weniger wie Angestellte als vielmehr wie eine Erweiterung des Hotels, Helfer, jederzeit bereit, Zaudernden beizuspringen. Verwirrend war das alles, ja, auch für Tucker, aber nicht so verwirrend wie die komplexen Gerüche des Hotels: Parfüm, Blut, Früchte, Schmutz, Höhlen, Blüten. Der Duft der Mineralquellen.
Er erinnerte sich gut an diesen Geruch.
Du wirst hier nicht lange bleiben, dachte Tucker. Bring’s einfach hinter dich.
Das Hotelpersonal beobachtete Hugh diskret. Er war nicht der einzige Schwarze hier, aber der einzige, den man sah; denn alle Angestellten im Gästebereich waren weiß. Vielleicht waren die Bediensteten einfach nur neugierig; schon ein FBI-Mann war ungewöhnlich hier, noch dazu ein Schwarzer. Vielleicht gab es aber auch dunklere Gründe für ihre Aufmerksamkeit, in hübschen Uniformen konnte sich bekanntlich allerlei Hässliches verbergen.
»Hat Ihnen Ihr Dad nicht beigebracht, wie man blinzelt?«, fragte Pony einen starrenden Bediensteten, der schnell den Kopf einzog.
»Du bist ja nur neidisch auf meinen Verehrer«, meinte Hugh zu Pony.
Pony salutierte knapp vor einem weiteren Gaffer und bleckte die Zähne.
»Hey«, mahnte Tucker. »Reißt euch zusammen.«
Derart verwarnt schlichen die beiden Untergebenen in die Bibliothek und ließen Tucker mit einem noch unbehaglicheren Gefühl zurück. Dass er gegenüber dem so viel jüngeren Assistenten autoritär auftrat, ging für ihn völlig in Ordnung, aber er war unsicher, wie er mit seinen Kollegen Hugh und Pony umgehen sollte. Hugh hätte diese Mission ja selbst leiten können, aber Hoover hätte einem Schwarzen niemals so viel Verantwortung übertragen. Und Pony … als sie sich kennenlernten, hatte ihm der junge Pete erzählt, er verdanke seinen Spitznamen einem Gläschen Whiskey, a pony of whiskey; als ob Tucker diese autobiographische Notiz beeindruckt hätte. Pony war ein heißblütiger junger Mann, was Tucker nie gewesen war, und die einzige Rolle, die Tucker ihm gegenüber spielen konnte, war die des enttäuschten Vaters. Keiner von ihnen war für das FBI wie geschaffen, vielmehr lag es nahe, dass die beiden anderen Agenten Tucker ins Exil folgen sollten – oder er ihnen.
Tucker griff nach Pennybackers Arm, um ihn in der Tür aufzuhalten, und sagte: »Wir werden uns nicht noch einmal so hemdsärmlig benehmen. Wir vom FBI, meine ich.«
Pennybacker richtete nervös seine Fliege, als hätte der Tadel ihm gegolten. »Ach, schon in Ordnung, ist doch bloß ein ganz normales Hotel.«
»Wenn es das wäre«, erwiderte Tucker, »wären wir nicht hier.«
In der Smith Library – nach Meinung des Personals die gemütlichste der drei Bibliotheken des Avalon, trotz Tausender Bände mit steifen Schutzumschlägen – begann die Besprechung. Neben dem FBI und dem State Department waren auch Vertreter der örtlichen Polizei, ein Bürgermeister, zwei Einwanderungsbeamte und Edgar David Gilfoyle anwesend, ein Society-Playboy, der am Kopfende des großen Tischs thronte. Er sah professioneller aus, als es sein Ruf vermuten ließ. Sein gelbbraunes Haar war gepflegt frisiert, die lange Nase zeugte von seiner vornehmen Herkunft. Das harte Winterlicht warf einen scharfkantigen Schatten hinter ihn – hinter eigentlich alles hier. Die dicht um den Tisch gedrängten grünen Ledersessel, die Stehlampen mit den Messingschirmen, die Windhundstatuetten aus Messing, die Agenten, die sich jetzt auf ihre Stühle niederließen: Alles hatte seine dunkle gespiegelte Schattenversion.
Während Gilfoyle und Pennybacker die Art elliptischen Smalltalks führten, mit dem sich mächtige Männer gegenseitig diskret umkreisen, wurde Tucker ein makelloses Törtchen mit Erdbeerglasur serviert, ein Feengeschenk. Er runzelte misstrauisch die Stirn.
Neben seinem Ellbogen erschien wie aus dem Nichts ein Kellner.
»Agent Minnick, was möchten Sie trinken?«
Was für ein Zaubertrick! Agent Minnick. Absurd, dass das Hotel offenbar Tuckers Namen kannte und doch die wichtigste Voraussetzung für diese Besprechung nicht erfüllt hatte: die Gäste wegzuschicken.
»Was haben Sie denn außer Wasser?«, fragte er.
»Kaffee, Tee, Limonade, Saft, Coca-Cola.«
Kaffee, aufgebrüht mit Wasser, Tee, der mit Wasser übergossen wurde, Limonade, zubereitet mit Wasser – er konnte dem Süßwasser nicht für immer ausweichen.
»Eine Cola wäre okay«, sagte Tucker.
Aber für den Moment noch.
»Sehr wohl«, erwiderte der Kellner, und Tucker fand das interessant – nicht dass dieser Mann wie auf Augenhöhe wirkte, immerhin nahm er ja seine Bestellung auf, sondern welche Würde er dabei ausstrahlte. Die Kellner wirkten alle gut gelaunt, als hätte nur eine zufällige Wendung der Ereignisse dazu geführt, dass diese eleganten Männer das Essen servierten, statt ihrerseits bedient zu werden, und als haderten sie keineswegs mit ihrem Schicksal. In diesem Leben bedienten sie, im nächsten Leben war es vielleicht umgekehrt. Es herrschte keine unterwürfige Atmosphäre, alle waren eingeladen, dieses unschuldige Spiel des Luxus gemeinsam zu genießen.
Gilfoyle erhob die Stimme. »Ah, da ist sie ja!«
Die Nachzüglerin war die erste Frau, die die Männer seit ihrer Ankunft hier im Hotel zu Gesicht bekamen. Sie wirkte recht unkonventionell – Hose, Wolljacke, kurzes dunkles Haar, glatt nach hinten gekämmt –, und sie hatte drei Dackel im Schlepptau, die sich, als sie den Finger hob, an die Wand setzten, ebenso gehorsam wie das Personal. Sie wirkte nicht überheblich, aber selbstbewusst – in diesem Raum schienen beide Begriffe identisch. Man starrte sie unwillkürlich an.
Oder vielleicht tat das nur Tucker.
»Wie schmecken Ihnen die Törtchen, meine Herren? Die Drinks? Haben Sie alles, was Sie brauchen?«
Ihr Hinterwäldlerdialekt fiel hier ebenso aus dem Rahmen wie ihre ganze Erscheinung, ihre Weiblichkeit. Sie sprach mit hoher Stimme, kurze Vokale, verknappte Verben. Keine Hauskatze wie Edgar Gilfoyle, sondern eine Berglöwin.
»Das ist June Hudson«, erklärte Gilfoyle. »Unsere Hoteldirektorin.«
Im Raum entstand Unruhe.
Man sah June Hudsons Miene an, dass sie es gewohnt war, Aufsehen zu erregen.
»Schmeckt alles sehr … äh … sehr gut!« Mr. Pennybacker brach das Schweigen als Erster. Er stupste sein Törtchen mit der Gabel an.
»Wirklich prima. Ich werde solche Leckereien vermissen, wenn die Rationierung kommt!«
»Möchten Sie wissen, wie diese süßen kleinen Törtchen zubereitet werden?«, fragte June Hudson. »Ich habe eine ganze Schar junger Frauen, die schwärmen durchs Hotel und durch die Stadt und sammeln Marmeladengläser ein, von denen die Leute glauben, sie seien schon leer. Dann werden sie hier in der Küche ausgekocht. Nicht die Frauen, die Gläser. In einem großen Bottich geben all diese Gläser den winzigen Rest Marmelade ab, der noch am Boden klebt. Dann holt eine Gruppe junger Männer die Gläser aus dem Bottich, und dann wird das Wasser eingekocht, bis auf diese Glasur. Kein Gramm extra Zucker ist in diesen Törtchen, nur Süße, die andere übrig gelassen haben. Wir mögen ein Luxushotel sein, haben aber in den letzten zehn Jahren auch das eine oder andere dazugelernt.«
Sie lächelte. Es war das Lächeln eines Cowboys, Lachfältchen um die Augen, ein Zucken der Lippen. Tucker kam sich wieder vor, als stünde er auf der Veranda einer texanischen Hütte und betrachte die Sonne, die die tödliche Landschaft golden auflodern ließ. Aber er konnte es sich nicht leisten, fasziniert zu sein. Den Job erledigen. Und dann weg hier.
»Das ist einfach toll, Miss Hudson!«, rief Pennybacker begeistert.
»Genau die Art von Innovation, die mir so gefällt, und deshalb ist das Avalon die perfekte Wahl, um unserem großartigen Land zu dienen!«
In Junes Stimme schlich sich Januarkälte. »Mr. Gilfoyle hat uns erst gestern Abend davon in Kenntnis gesetzt, dass sich unser großartiges Land für das Avalon interessiert.«
Gilfoyle starrte in den Kamin.
Eine alte Spannung erfüllte den Raum, intensiv wie der Geruch des Mineralwassers.
Plötzlich wurde Tucker klar, warum das Personal nichts von der Mission gewusst hatte.
Gilfoyle wollte, dass das FBI diese Nachricht überbrachte. So, wie man einen Informanten auf einem öffentlichen Platz trifft. In aller Öffentlichkeit wird man selten erschossen.
»Ach so, ja. Da muss es hinsichtlich der Sicherheitsvorkehrungen wohl ein Missverständnis gegeben haben!« Pennybacker glich einem Kind, das sich zwischen seine streitenden Eltern drängt. »So haben wir zwar ein bisschen Zeit verloren, aber wir wissen seine Diskretion zu schätzen!«
Benjamin Pennybacker, State Department, schob eine Akte über den Tisch.
June Hudson, Hoteldirektorin, rührte sie nicht an. Sie betrachtete die Schlipsträger ringsum.
»Nein«, sagte sie.
Es war ein Nein, das es in sich hatte, ein handfestes Nein. Die Anwesenden verstummten, um die Bedeutung dieses entschiedenen Neins zu würdigen.
»Nein?«, wiederholte Pennybacker. »Sie haben ja noch nicht mal reingeschaut.«
»Nein«, bekräftigte sie. »Das Avalon ist im Moment nicht dafür ausgestattet, Sonderwünsche zu erfüllen, aber es gibt zwischen hier und Washington mehrere Hotels, die Ihnen sicher gerne behilflich sein werden. Mir ist so mancher einen Gefallen schuldig; ich kann ein paar Anrufe tätigen.«
Es knackte im Kamin. Eine Rohrleitung ächzte in der Wand. Draußen auf dem Flur vor der geschlossenen Tür klackerten die Absätze einer Hotelangestellten. Pennybacker räusperte sich dreimal, beinahe ein viertes Mal. Ihm saß immer noch ein Frosch im Hals. Tucker hatte nichts getrunken, nicht einmal die Cola, und doch spürte er den eklig brackigen Geschmack des Süßwassers hinten auf der Zunge.
»So verhält es sich nicht, Miss Hudson«, sagte Gilfoyle.
Gott bewahre uns vor solchen Männern!, dachte Tucker. Es gab immer jemanden wie ihn, der bereit war, West Virginia seinen staubfreien Schuh in den Nacken zu drücken. Gut informierte Männer mit weichen, gepflegten Händen und makellosen Knöcheln, Männer, die mit verständnisvoller Stimme herumstotterten und einer erbitterten, fähigen Frau wie dieser hier sagen wollten, wo’s langging. So war Tuckers Job nicht gedacht gewesen.
Dieser Staat, dieses Hotel, ihr Dialekt, seine Vergangenheit, diese Leute …
»Wie verhält es sich nicht?«, fragte June.
Nur noch dieser eine Einsatz, dachte Tucker. Hol dir dein Leben zurück. Aber …
Pennybacker reckte den Hals. »Agent Minnick, Sie sind aufgestanden? Wollten Sie etwas sagen?«
Tucker sah sich selbst wie von außen, die Arme verschränkt, die Finger in die Riemen seines Achselholsters gehakt. Er merkte, dass June ihn anstarrte – oder genauer gesagt, seinen Hals. Ihr Blick hatte einen Fleck entdeckt, ein fast vom Hemdkragen verborgenes Mal, das die meisten Leute gar nicht bemerkten, und wenn sie es bemerkten, nicht einordnen konnten: eine Kohletätowierung. Kinder, die in Häusern voller Kohlenstaub spielten, Bergleute, die Tunneleinstürze überlebten, bekamen so ein Mal, wenn sich Kohlenstaub dauerhaft in ihren Wunden festsetzte. Schon jetzt bezweifelte er, dass es richtig war, zu sprechen, während er hier stand; er fand das unausgesprochene Wort weitaus wertvoller als das gesprochene. Aber ihr Blick auf seine Kohletätowierung hielt ihn auf den Beinen, stramm wie eine Marionette.
June sah, dass der FBI-Mann tatsächlich etwas sagen wollte. Es war der dunkelhaarige Agent, der June bei ihrer Ankunft gleich aufgefallen war. Wäre sie gefragt worden, hätte sie vielleicht gesagt, dass ihr das Kohletattoo aufgefallen sei, aber das stimmte nicht; sie hatte es erst gesehen, als er da stand. Es war sein Gesicht gewesen, das sie in Bann gezogen hatte. Es gab eine Stelle auf dem Grundstück, an der die heißen und die kalten Quellen so nah beieinanderlagen, dass man, wenn man auf dem Moos dazwischenlag, beide berühren konnte, erstaunt über den Kontrast. Genau so sah das Gesicht dieses Agenten aus: harte Brauen, weiche Augen, harte Züge, weicher Mund. Federal Agent. Kohletätowierung. Er sagte: »Ich bin Agent Tucker Rye Minnick vom Federal Bureau of Investigation. Miss Hudson, ich denke, es steht fest, dass Ihnen und Ihren Angestellten niemand offen gesagt hat, worum es geht. Sie sind mit der aktuellen Situation nicht glücklich; lassen Sie mich Ihnen versichern, dass das FBI ebenfalls nicht glücklich damit ist. Sie wünschen sich, dass bei dieser Besprechung Entscheidungen diskutiert werden, aber das wird nicht passieren. Der einzige Zweck dieser Zusammenkunft ist der, Ihnen mitzuteilen, was zu tun ist, und alles, was daraus folgt, dann ganz allein Ihnen zu überlassen.«
»Na, das ist doch ein wenig übertrieben. Ich glaube nicht, dass dies der einzige Zweck ist …«, begann Pennybacker.
Doch Agent Minnick fuhr fort, als hätte der Mann vom State Department nichts gesagt, und zählte die Punkte an seinen Fingern ab.
»Erstens. Die derzeitigen Gäste werden das Hotel verlassen müssen, umgehend. Hier dürfen sich nur Hotelangestellte, FBI-Leute und die in der Akte gelisteten Personen aufhalten.
Zweitens. Vierzig Grenzschutzbeamte werden zwecks Außensicherung provisorische Wachtürme errichten.
Drittens. Ein Schweizer Verbindungsmann wird als neutraler Vermittler zwischen den Regierungen agieren.
Viertens. Agent Pennybacker und ich brauchen aktualisierte Listen sämtlicher derzeitiger Angestellter. Wir werden sie alle befragen und strenge Hintergrundchecks durchführen. Das Personal muss darauf hingewiesen werden, dass mangelnde Kooperation die Beendigung des Arbeitsverhältnisses zur Folge hat.
Fünftens. Am Mittwoch werden dreihundert ausländische Staatsangehörige am Bahnhof eintreffen und so lange bleiben, bis das State Department die Rückkehr in ihre Heimatländer ausgehandelt hat, das geschieht voraussichtlich am einundzwanzigsten April.
Sechstens. Agent Calloway zu meiner Rechten, Agent Harris zu meiner Linken und ich werden aus dem Gästebereich sämtliche Telefone, Radios und Zeitungen entfernen und im Auftrag des FBI die gesamte Kommunikation über die Telefonvermittlung und die Poststelle überwachen.«
Gilfoyle wirkte etwas verärgert; Pennybacker geradezu verzweifelt. »Agent Minnick«, zischte er, »ich glaube wirklich, Sie vermitteln Miss Hudson das Gefühl –«
Agent Minnick hob die Hand. »Die betreffenden Personen sind auf dem Weg hierher; die Uhr tickt; sie hat schon zu ticken begonnen, bevor wir hier eingetroffen sind. Sie können nicht ablehnen, Miss Hudson, weil niemand Sie nach Ihrer Meinung gefragt hat. Es wurde bereits von höherer Stelle entschieden.«
Er lehnte sich über den Tisch und schlug das erste Dokument auf. Schweigend wartete er ab, bis June es überflogen hatte, die ganze Seite bis zur Unterschrift des Präsidenten.
Einige Jahre zuvor hatte June Mr. Francis einmal zu einem Treffen mit den Honoratioren von Constancy, der nächstgelegenen Kleinstadt, begleitet, um eine Vereinbarung zu besprechen, die das Avalon und die Bahn zur Verbesserung der lokalen Infrastruktur getroffen hatten. June war damals noch jung und unerfahren gewesen und hatte die Rahmenbedingungen dieses Projekts ähnlich umrissen wie Agent Minnick jetzt. Punkt für Punkt. Alle Erfordernisse. Am Ende hatte damals unbehagliche Stille im Raum geherrscht. Mr. Francis hatte sie souverän gerettet. Er hatte das Ganze so gedreht, als sei die Liste im Wesentlichen die Idee der Honoratioren gewesen und damit gekränkte Egos beruhigt. Inzwischen wusste June es besser, und im Gegensatz zu den anderen erkannte sie deshalb, dass Agent Minnick nicht grausam war. Er kochte nur ein Marmeladenglas bis auf den Bodensatz ein.
»Blättern Sie um«, mahnte er jetzt.
Sie blätterte um. Das nächste Dokument verriet alles, was Agent Minnick nicht gesagt hatte. Er hatte von ausländischen Staatsangehörigen gesprochen, aber das waren keine gewöhnlichen Ausländer. Es waren Diplomaten.
Nazis.
Na ja, nicht alle.
Die nächste Seite offenbarte eine Liste mit japanischen Namen. Dann kamen Italiener, Ungarn, Bulgaren. Viele Sprachen und ein unausgesprochenes Wort: der Feind. Und diese Akte enthielt noch viele unausgesprochene Worte mehr. Eines zum Beispiel wurde nie benutzt: Internierung. Stattdessen sollte das Hotel ein »Sammelplatz« für Diplomaten der Achsenmächte und ihrer Familien sein. Die ausländischen Staatsangehörigen wurden in Gewahrsam genommen, unter Kontrolle gehalten und geschützt. Man würde Grenzschutzbeamte zur Verfügung stellen, ungefähr so, wie man Handtücher und Bademäntel zur Verfügung stellte. Die Kommunikation würde zivilisiert ablaufen, wie bei einer Cocktailparty. Diplomatie beruhend auf Gegenseitigkeit: Ihr serviert ihnen auf der einen Seite des Ozeans Kaviar, wir auf der anderen.
June hörte förmlich Sandy Gilfoyles freundlich-spöttische Stimme: O Mann, willkommen in der dünnen, exklusiven Luft des hohen internationalen Rechts …
Sie hätte am liebsten protestiert. Der Sohn der Ersten Hausdame war kürzlich in Pearl Harbor getötet worden. Ihr fielen spontan mindestens drei polnische Jüdinnen und Juden ein, die zum Servicepersonal gehörten. Die Einberufung würde Brüder, Ehemänner, Söhne das Leben kosten. Wie grotesk, so etwas von ihnen zu verlangen!
Der junge Sandy trug jetzt Uniform, und June hatte seit Wochen nichts mehr von ihm gehört. Wie grotesk, so etwas von ihr zu verlangen.
Aber Agent Minnick hatte gesagt, dies sei keine Besprechung, bei der Entscheidungen diskutiert würden.
June las den Namen Takeo Nishimura. Er war der japanische Gesandte, häufig in Begleitung von Saburo Kurusu und Botschafter Nomura zu sehen, der bis Pearl Harbor friedliche Lösungen versprochen hatte. Dann Friedrich Wolf, Kulturattaché Nazi-Deutschlands.
Schließlich Erich von Limburg-Stirum, ein so berühmter Kunstflieger, dass sogar sie seinen Namen kannte. Also nicht nur Diplomaten. Auch Journalisten. Geschäftsleute. Kunstflugpiloten.
»Diese Burschen werden also alle aus Washington verjagt?«
»Verjagt«, wiederholte Pennybacker und lachte leise, um die Wirkung des Worts zu entschärfen. »Es geht um den Schutz vor einer überreizten amerikanischen Öffentlichkeit. Jedes negative Ereignis würde, wie Sie sich denken können, internationales Aufsehen erregen. Wichtig ist die – wie soll ich sagen – moralische Überlegenheit. Wir sprechen hier von diplomatischer Reziprozität. Präzedenzfall. Exzellenz. Das Avalon ist eines der bekanntesten Luxusresorts in Reichweite von Washington. Hören Sie, Miss Hudson, das Greenbrier hat bereits kurz vor Weihnachten eine erste Gruppe aufgenommen, und wenn die mitmachen, dann …«
Das Greenbrier! Hatte sie deshalb nichts mehr von Loren, dem Direktor des Greenbrier, gehört? Seltsame Vorstellung, dass offenbar auch ihr einziger ernsthafter Konkurrent mit diesen ethischen Fragen gerungen hatte. »Wie viele haben sie denn aufgenommen?«, fragte June.
Pennybacker schüttelte bedauernd den Kopf, als hätte er sie dabei ertappt, ihn austricksen zu wollen.
»Wir geben keine Details aus den anderen Hotels preis.«
Hotels, Plural. Gilfoyle musste es schon seit Tagen, vielleicht sogar Wochen gewusst haben. Er hatte ihr ihren wertvollsten Vorteil geraubt, einen Zeitvorsprung, obwohl ihm vielleicht gar nicht bewusst gewesen war, welch unerhörten Diebstahl er da begangen hatte. Jahrelang hatte er in den Häusern anderer Leute gewohnt, war von Freund zu Freund, von Party zu Party gezogen und hatte strahlend die Klatschspalten dreier Länder belebt. Smoking und Champagner, Frauen und Nachtleben; für Gilfoyle waren es noch immer die goldenen Zwanziger Jahre. Was war das Avalon für ihn? Nur ein Gebäude.
»Mr. Pennybacker, ich bekomme es so oder so heraus. Um welche weiteren Hotels handelt es sich?«
»Das Homestead«, erwiderte er.
Das Greenbrier und das Homestead waren große Häuser, die Hunderte von Gästen beherbergen konnten. Nun betrachtete June die Liste mit anderen Augen. Sie war ihr endlos lang vorgekommen, aber jetzt begriff sie, dass es sich nur um eine unvollständige, gekürzte Fassung handelte. Diese Aufzählung war exakt auf das Avalon zugeschnitten, um es fast bis aufs letzte Zimmer zu belegen, und war Teil einer viel längeren, in hotelgroße Teile gestückelten Liste. Zum allerersten Mal glaubte June wirklich, dass das Land einen Monat zuvor in den Krieg eingetreten war.
Sie erhob sich. Die Dackel erhoben sich. Agent Minnick nickte, irgendwie zufrieden.
Edgar Gilfoyle wirkte sehr angespannt und riss erschrocken die Augen auf. »Miss Hudson«, sagte er, »Sie wollen doch nicht schon gehen?«
Natürlich ging sie. Er hatte sie in eine Aufzugskabine gesperrt und die Kabel zerschnitten. Mr. Francis hatte June vergessen lassen, dass es eigentlich gar nicht ihr Hotel war. Jede Entscheidung war ihre Entscheidung gewesen. Jetzt aber gehörte das Hotel Gilfoyle, und das hieß, dass er Ja sagen konnte, wo sie Nein gesagt hätte, ohne vorher mit ihr zu sprechen. Falls sie auf ein Zeichen gewartet hatte, ob ihm ihre gemeinsame Zeit etwas bedeutete, hier war es. Der Aufzug stürzte ab.
»Wie Sie soeben hörten, Mr. Gilfoyle«, sagte June, »gibt es jede Menge zu tun.«
Kapitel 3
Wenigstens kam die Dekoration für die Burns-Night doch noch zu ihren Ehren.
Weil so viele Gäste gleichzeitig abreisten, fand der Checkout im Ballsaal statt. Die Gedichtblätter wurden aufgewirbelt, als June die Schlange entlang hin- und hereilte und sich bei allen Gästen persönlich entschuldigte. Die Kellner, immer noch mit Schottenkaroschärpen, versorgten die Gäste mit Reiseproviant, der aus Häppchen des geplanten Festmahls bestand. Hier und da streckten Gäste die Hand nach den schwebenden Blättern aus, um ein Gedicht zu lesen, so wie June es sich ein paar Stunden früher vorgestellt hatte. Es war eine denkwürdige Szene. Eine verstörende Szene. Diese Leute Schlange stehen zu sehen, um an ihre Mäntel und Autos zu gelangen! Diese Leute standen nicht an. Diese Leute hatten andere Leute, um für sie anzustehen.
Mit manchem Schwur und manchem Kuß/Sind zärtlich wir geschieden/Mit manchem Schwur, zu sehen uns/Recht häufig noch hienieden. Mr. Astor (der Mr. Astor, an den die meisten Leute dachten, wenn von »Mr. Astor« die Rede war, dem engen Freund Roosevelts (des Roosevelts, an den die meisten Leute dachten, wenn es um Roosevelt ging)) war einer der letzten Gäste in der Reihe. Er war heute ausnahmsweise einmal nicht gereizt, sondern in freundlicher Stimmung.
»Mr. Astor, es tut mir so leid, dass Sie uns verlassen müssen«, sagte June. »Haben Sie vielleicht noch einen Rat für mich?«
Er ließ das Gedicht los und blickte June unter seinen buschigen Augenbrauen hervor an. »Meiden Sie Schiffe.«
»Meine Liebe!«, platzte der letzte Gast in der Reihe dazwischen. »Was für ein Abenteuer!«
Beim letzten Gast handelte es sich eigentlich um vier Gäste: die Familie Morgan. Seit June das Hotel leitete, hatten sie jede letzte Januarwoche im Avalon verbracht. Das Avalon hatte die Ehe einer Morgan-Generation gerettet, ein Zerwürfnis zwischen Brüdern gekittet, eine Großmutter beerdigt und die jüngste Generation glücklich verheiratet erlebt. Ein Jahrzehnt im Leben einer ganzen Familie.
Die beiden Söhne der Morgans (die June auf bewegende Weise an Sandy erinnerten) streichelten die Dackel und umarmten June schüchtern, eine höchst ungewöhnliche Geste der Zuneigung, die nur möglich war, weil June die beiden schon von Kindesbeinen an kannte. Die sonst übliche Zurückhaltung war das Zeichen der Oberschicht; das hatte Mr. Francis ihr zu vermitteln versucht. Bedenken Sie, was es heißt, die eigene Schicht hinter sich zu lassen. Direktheit, Besitz, Lust, Hunger, das Naheliegende – das ist die Sprache der Unterschicht. Und das ist die Sprache der herrschenden Klasse: Tradition, Humor, Geschick, Großzügigkeit, Finesse. Wenn Sie wollen, dass man Sie behandelt, als gehörten Sie dazu, muss das meiste unausgesprochen bleiben. Wer es ausspricht, beweist seine Primitivität. Eine June Hudson ist nicht primitiv. Ich bin nicht primitiv, Mr. Francis. Eine June Hudson ist zu Großem bestimmt. Das können Sie sagen, nicht ich; sind halt die Regeln, wie? Ha. Das sind die Regeln, June.
»Liebste Miss Hudson«, sagte Mutter Morgan (Weckruf 9.50 Uhr, beim Einchecken einen Roman-Punch-Cocktail auf dem Balkon bereitstellen, drei Spa-Anwendungen pro Woche). Es hieß, außerhalb des Hotels sei sie völlig skrupellos, aber hier war sie eine Seele von Mensch. »An der Rezeption liegt ein Geschenk für Sie.« Die Gäste schenkten June oft Keramik, Schmuck, Bücher und Kunst. Eigentlich Geschenke für eine Dame der Gesellschaft, nicht für die hart arbeitende Direktorin eines Hotels. Unvergessen, als ihr einmal eine frisch geschiedene Erbin edelste italienische Bienen von Sears and Roebuck’s geschenkt hatte. In der einen Schachtel kamen die Arbeiterinnen, in der anderen saß die Königin, die als Nahrung nur einen Klecks Gelée royale bei sich hatte.
»John«, meinte Mutter Morgan in ihrer nüchternen Art, »erklär mal Miss Hudson, was sie wissen muss.«
»Wie -? Ah, ja. Miss Hudson, sagen Sie jetzt nichts und hören Sie mir einfach zu«, begann Vater Morgan (Linkshänder, begeisterter Winnet-Spieler mit gelegentlicher Neigung zum Glücksspiel, mag keine Sardellen), der außerhalb dieses Hotels über das Schicksal tausender Menschen entschied. Hier im Avalon zeigte er sich lammfromm dankbar, wenn das Personal an seinen geliebten Toddy vor dem Schlafengehen dachte. Leise sprach er über demnächst drohende Rationierungen, die aktuelle Debatte über das Kriegsrecht, Haftbefehle auf den Schreibtischen des FBI, Industriezweige und Städte, denen die Kriegswirtschaft einen Aufschwung bescheren würde, seine Einschätzung der gegenwärtigen Macht des State Department und weitere Einberufungspläne, soweit er oder sein Umfeld dies beurteilen konnten. Es war das wertvollste Geschenk, das ihr die Morgans je gemacht hatten.
Und dann, einfach so, waren sie verschwunden. Der Ballsaal stand leer, bis auf das samtverkleidete Gestänge, die schwebenden Burns-Night-Gedichte und ein paar Angestellte, die überlegten, was als nächstes zu tun sei.
June hatte noch nie das ganze Hotel geräumt. Nicht einmal während der Weltwirtschaftskrise, als Flüsse und Feierlaune versiegt und Männer reihenweise aus dem Fenster gesprungen waren, ein egalitärer Zeitvertreib, der Wirtschaftsmagnaten und Oberkellner im Kummer vereinte. Andere Luxushotels hatten sich in Tagungsorte oder Apartment-Hotels verwandelt, um ihr Überleben zu sichern. Doch June hatte stattdessen tief in die Schatulle der Gilfoyles gegriffen, um Zimmer zu renovieren und Speisekarten umzugestalten.
June hatte die schreckliche Vergangenheit ebenso beiseitegeschoben wie die hoffnungslose Zukunft und das Avalon in den Stand versetzt, seinen Gästen eine herrliche Gegenwart zu bieten. Wertloses Geld floss schneller von den Bankkonten der Gilfoyles als das Süßwasser aus den Felsen. Bist du wirklich ganz sicher, June?, hatte Mr. Francis gefragt, nachdem ihn in New York die Nachricht von einer besonders halsbrecherischen Ausgabe erreicht hatte – sie musste halsbrecherisch gewesen sein, wenn Mr. Francis nervös wurde. Wir müssen furchtlos wirken, hatte June entgegnet. Die Rechnungen zahlen und für Regen beten. Eine gewagte Strategie für eine unerfahrene junge Direktorin. Aber erfolgreich. War das Hotel zu Beginn der Depression eine Institution gewesen, ging es als Legende aus ihr hervor. Und jetzt waren die kultivierten Stammgäste dieser Hotellegende, ihr Lebenselixier, einfach an die Luft gesetzt worden.
Alle, bis auf einen verbliebenen Gast.
»Hoss, 411 …«, sagte Griff und rieb sich sein Auge.
»Ich weiß, ich weiß.«
June fuhr in den vierten Stock hinauf; sie hatte den Aufzug ganz für sich allein. Alle anderen Gästeaufzüge waren mit einer gut ausgebildeten Fahrstuhlführerin besetzt, nur dieser eine nicht. Mr. Francis war bei weitem nicht der Erste gewesen, der in diesem Haus gestorben war. Wie viele ältere, gut betuchte Gäste hatte June, in Bettzeug gewickelt, auf dem untersten Bord zweier zusammengebundener Servierwagen aus dem Hotel schmuggeln müssen? – aber Mr. Francis war eine Institution in der Institution gewesen. Die Gilfoyles besaßen riesige Liegenschaften, die meisten davon in New York State und Massachusetts, und die meisten Leute in ihrer Position hätten sich für einen anderen Geschäftsführer entschieden, um ihren Reichtum nach eigenem Gutdünken genießen zu können. Doch Mr. Francis hielt zu seinen Angestellten, zog seine Kinder auf dem Hotelgelände groß und verließ es niemals für längere Zeit, bis June seine Nachfolgerin wurde. Obwohl inzwischen zehn Jahre seit seinem Tod vergangen waren, war er immer noch eine Legende. Aber June fürchtete sich nicht vor Geistern. Ach, hätte Mr. Francis doch in diesem Aufzug gespukt!
Oben im vierten Stock kroch der Teppich im Halbdunkel den Korridor entlang, vorbei an dem dämmrigen Blattwerk der Tapeten, den mitternachtsblauen Ranken unter den mit Tierköpfen dekorierten Süßwasserbrunnen. Die dunkle Holzvertäfelung absorbierte das Licht der verschnörkelten Wandleuchten. Die endlose Zahl gleichaussehender Türen wirkte einschüchternd. Früher hatten die Dienstmädchen Angst gehabt, die Türen könnten auffliegen und dahinter wartende Geister freigeben. June hingegen stellte sich vor, die Türen flögen auf, und in den Zimmern warteten die Lebenden, alle mit dringenden, unerwarteten Anliegen. Das alltägliche Grauen.
June pochte an die Tür von Zimmer 411. Leise, aber hörbar, so wie man es ihr in der Ausbildung beigebracht hatte.
Trotziges Gepolter.
Von drinnen ertönte eine Stimme: »Das war ein Beistelltisch. Mit geschnitzten Lilienfüßen. Na, zufrieden? Los, klopfen Sie noch mal, es gibt noch viel zu …«
June unterbrach: »411!«
Die Tür ging auf. Gerade weit genug, dass man ein leuchtend grünes Auge herausspähen sah.
»Direktorin Hudson«, sagte 411. »Ich hatte Sie früher erwartet.«
Die meisten Gäste mochten es, wenn man sie mit Namen ansprach, doch dies galt nicht für 411. Sie war hier schon so lange Gast, wie June im Avalon arbeitete, und hatte ihre Suite in dieser Zeit, soweit bekannt, niemals verlassen. Mahlzeiten, Bücher und andere Annehmlichkeiten des täglichen Lebens wurden ihr nach oben gebracht. Einmal wöchentlich schloss sie sich im Bad ein und erlaubte einer einzigen Angestellten, ihre Räume zu putzen, einem ehemaligen Zimmermädchen, das längst zur Ersten Hausdame befördert worden war und eigentlich über solchen Aufgaben stand. Man erzählte sich seit Jahren, 411 sei während des präsidialen Besuchs von Franklin D. Roosevelt auf ihrem Balkon gesehen worden, aber welcher Angestellte sie damals gesehen hatte, war nicht bekannt.
Was June über 411 wusste: Sie war eine bekannte Designerin gewesen, geschieden, verfügte über einen hinterhältigen Humor und hatte sich die wunderbare Vorrichtung mit den Gedichten für die Burns-Night ausgedacht.
»Ziemlich laut hier oben, 411.«
»Ich werde Ihnen sagen, wer laut war: Mr Beekhof gestern Abend«, erwiderte 411. »Es klang, als hätte er in seinem Zimmer ein Schwein freigelassen.«
»Mr Beekhof hat ausgecheckt.«
»So ein Feigling! Wir hatten unseren Streit doch noch gar nicht beendet. Ihre nächsten Worte wählen Sie besser mit Bedacht! Ich möchte hier ungern noch größeres Chaos anrichten.«
In ihrer theatralischen Art hatte 411 dem Personal angedroht, jedes Mal, wenn jemand sie zum Auschecken überreden wollte, Teile des Mobiliars aus dem Fenster zu werfen. Wie viele kleine Nationalstaaten, die stark von Importen abhängig sind, neigte sie bei Machtdemonstrationen zu Gerissenheit und Manipulation. Guerilla. Schattenbataillone. Und so weiter. Was würde aus ihr werden, wenn man sie rauswarf? Hier hatte sie alles, was sie brauchte, und blieb von allem übrigen verschont. Fraglich, ob sie überhaupt noch imstande war, woanders zu leben.
»Ich bin kein bibberndes Zimmermädchen, 411!«, erklärte June. »Es braucht schon mehr als ein paar Poltergeistpossen, um mich von Ihrer Tür zu vertreiben.«
»Sie wissen doch, wessen Telefonnummer immer noch auf meiner Karteikarte steht, oder? Ich kann nirgends hin.«
»Hier hat jetzt das State Department das Sagen, nicht ich. Und was kümmert diese Leute Francis Gilfoyles Nummer auf Ihrer Karteikarte?«
411 lachte. Ein Lachen wie Buttercreme: süß, üppig und in größeren Mengen unbekömmlich. »June Hudson, Sie Opossumzüchterin! Sie verstehen Status nur so, wie er in diesem Hotel funktioniert, nicht wahr? Frank war nicht einfach nur der Besitzer des Avalon. Haben Sie nicht seine Freunde in der Lobby gesehen? Stellen Sie mich ein. Der letzte fliegende Affe, der vor Ihnen hier oben war, hat mir verraten, dass nur Bundesagenten und Angestellte bleiben dürfen. Also denken Sie sich eine schlaue Stellenbeschreibung für mich aus.« June überlegte, ob sie sie rausschmeißen sollte, unsanft, per Gerichtsbeschluss, nur um ihr, was längst überfällig war, ein bisschen Demut beizubringen. Dann aber dachte sie an jene Nacht, über die sie nie sprachen, die Nacht, in der June aus New York zurückgekehrt war. June wusste, dass 411, so grässlich sie auch sein mochte, hier im Hotel ihre beste Freundin war. Nein, sie würde sie nicht rausschmeißen.
»Sie entwickeln sich zu einem der größten Probleme in meinem Leben«, sagte June zu ihr.
»Wenn das stimmt, Schätzchen«, meinte 411, »dann ist Ihr Leben doch gar nicht so schlecht.«
Die Tür ging zu; 411 nahm an, dass sie gewonnen hatte. Und war es nicht auch so? Denn schon gab June dem Personal ein Zeichen, und einer der Angestellten galoppierte davon, um Junes Pläne festzuhalten.
»›Beraterin!«, rief June noch, kurz bevor sich der Dienstboteneingang schloss. »Den Einstellungstag um einen Monat zurückdatieren! Und bringt die Reste ihres Beistelltischs wieder herauf!«
»Klar, Hoss.«
Kapitel 4
An diesem Abend wurden die Vorbereitungen für den Burns-Night-Ball fortgesetzt. Nutznießer waren vierzig Grenzschutzbeamte, die in den Magnolia Dining Room drängten und sich auf das Festmahl stürzten, das eigentlich für die vorherigen Gäste gedacht gewesen war. Danach würde man sie ins Personalgebäude verbannen, aber jetzt, an diesem ersten Abend nach der langen Reise, wurden sie verwöhnt. Der größte und festlichste Speisesaal des Hotels war kostbar ausgestattet: üppige Stuckleisten, getäfelte Decke, Brokattapete, Schachbrettboden aus italienischem Carrara-Marmor. June bewahrte immer noch die Briefe auf, die sie damals von Kollegen (Kollegen!) bekommen hatte – Männern mit einem Abschlussdiplom der Cornell School of Hospitality! –, die ihr zu ihrer Entscheidung gratulierten, das Hotel trotz der Wirtschaftskrise zu renovieren.





























