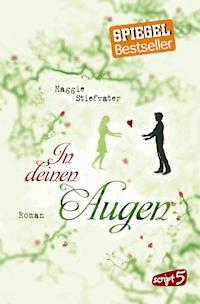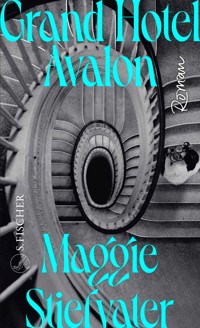14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Dreamer-Trilogie
- Sprache: Deutsch
Im Krieg zwischen Traum und Wirklichkeit steht jedes Schicksal auf dem Spiel: In »Wie die Nacht entrinnt«, dem 3. Urban-Fantasy-Roman von Maggie Stiefvaters Dreamer-Trilogie, stehen nicht nur die Brüder der Familie Lynch an ihrem ganz persönlichen Abgrund – in ihren Händen liegt auch das Schicksal aller Welten. Declan, der sich als Sohn und als Bruder stets für alles verantwortlich gefühlt hat, muss nun feststellen, dass er seine Familie nicht schützen kann. Ronan hat als Träumer an der Grenze zwischen Traum und Wachen gelebt – doch diese Grenze existiert nicht mehr, und Ronan fällt. Und Matthew, der immer der Sonnenschein der Familie war, rebelliert gegen alles, denn nichts scheint mehr real zu sein. Unsere Welt ist nicht für die Familie Lynch, die Welten erschaffen und zerstören kann, gemacht. Und wenn es den Brüdern nicht gelingt, einander zu retten, sind wir alle dem Untergang geweiht … Die Dreamer-Trilogie ist ein Spinn-off des Fantasy-Bestsellers »Raven Boys«, kann aber auch unabhängig gelesen werden. Maggie Stiefvaters geheimnisvoll-abenteuerliche Urban-Fantasy-Reihe um Träume, Sehnsüchte, Schicksal und Tod umfasst die folgenden Romane: - »Wie der Falke fliegt« - »Wie Träume bluten« - »Wie die Nacht entrinnt«
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 439
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Maggie Stiefvater
Wie die Nacht entrinnt
Aus dem amerikanischen Englisch von Jessika Komina und Sandra Knuffinke
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Declan, der sich als Sohn und als Bruder stets für alles verantwortlich gefühlt hat, muss nun feststellen, dass er seine Familie nicht schützen kann.
Ronan hat als Träumer an der Grenze zwischen Traum und Wachen gelebt – doch diese Grenze existiert nicht mehr, und Ronan fällt.
Und Matthew, der immer der Sonnenschein der Familie war, rebelliert gegen alles, denn nichts scheint mehr real zu sein.
Unsere Welt ist nicht für die Familie Lynch, die Welten erschaffen und zerstören kann, gemacht. Und wenn es den Brüdern nicht gelingt, einander zu retten, sind wir alle dem Untergang geweiht …
Weitere Informationen finden Sie unter: www.droemer-knaur.de
Inhaltsübersicht
Widmung
Zitat
Prolog
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
39. Kapitel
40. Kapitel
41. Kapitel
42. Kapitel
43. Kapitel
44. Kapitel
45. Kapitel
46. Kapitel
47. Kapitel
48. Kapitel
49. Kapitel
50. Kapitel
51. Kapitel
52. Kapitel
53. Kapitel
Epilog
Danksagung
An alle, die jemals mit Blumen oder Federn erwacht sind
Nimmt man sich jedoch die Zeit, den Gegenstand genau zu studieren, Formen und Schattenwurf zu analysieren und in Farbwerte zu übertragen, entsteht dabei ein überzeugendes Abbild.
William L. Maughan, The Artist’s Guide to Drawing the Head
Es dauert lange, bis ein Mann aussieht wie sein Porträt.
James McNeill Whistler
Wenn der Traum eine Übersetzung des Wachseins ist, dann ist das Wachsein gleichsam eine Übersetzung des Traums.
René Magritte
Prolog
Am Anfang dieser Geschichte, vor vielen, vielen Jahren, fanden zwei Träumer das Paradies.
Niall Lynch und Mór Ó Corra erwarben ein idyllisches, verstecktes Stück Land im tiefsten Virginia. Hügelige Wiesen, dichter Eichenwald und in der Ferne die geisterhaften, über alles wachenden Silhouetten der Blue Ridge Mountains. Niall und Mór erschien es wie Hexerei, dass sie dieses grüne Refugium nun tatsächlich in Besitz nehmen durften. Gut, das Haupthaus war bis unter den First mit dem Gerümpel des Vorbesitzers vollgestopft, eines krankhaften Hamsterers, der kurz vor ihrer Ankunft gestorben war. Und auch die zahlreichen Nebengebäude, denen das Ganze seinen Namen verdankte – die Schober –, waren in erbärmlichem Zustand mit ihren durchhängenden Dächern und der abblätternden Farbe.
Aber für Niall und Mór war es von Anfang an ein kleines Königreich.
»Das findet sich schon alles«, verkündete Niall gewohnt optimistisch.
Niall war ein charmanter junger Kerl, gut aussehend, einnehmend und eloquent. Wenn jemand diese Massen von Plunder dazu bewegen konnte, sich selbst zu beseitigen, dann er.
Mór (die damals noch nicht Mór hieß) erwiderte: »Wir müssen aufpassen, dass der Kleine sich nicht im Gestrüpp verirrt.«
Mór war eine unerschrockene junge Heldin, nüchtern und zupackend. Vor einem Jahr hatte sie ihr goldenes Haar auf Kinnlänge gekappt, damit es sie nicht mehr störte, und vor einem Monat hatte sie dasselbe mit ihrer Vergangenheit getan.
Niall grinste sein breites, jähes Grinsen und strich sich das lange Haar hinter die Ohren, um sich für sie schön zu machen. »Gefällt’s dir?«
Mór verlagerte das Gesicht des kleinen Declan auf ihrem Arm und ließ ihren kühlen Blick schweifen. Alles war genau, wie Niall es ihr beschrieben hatte. Märchenhaft schön. Riesig. Meilenweit entfernt von den nächsten Nachbarn und einen Ozean entfernt von ihren Familien.
Doch das war nicht das Wichtigste.
»Das weiß ich erst, wenn ich geschlafen habe«, antwortete sie.
Niall und Mór waren Träumer – im wahrsten Sinne des Wortes. Manchmal gingen sie schlafen, und wenn sie wieder erwachten, waren ihre Träume Wirklichkeit geworden. Die reinste Magie! Und zwar eine ziemlich seltene Form. Noch nie waren sie jemand anderem mit dieser Fähigkeit begegnet … oder zumindest hatte keiner je zugegeben, sie zu besitzen, was wohl auch kein Wunder war. Es lag schließlich auf der Hand, auf welche Weise Menschen mit unlauteren Absichten versuchen könnten, daraus Profit zu schlagen.
Dabei war das leichter gesagt als getan. Träumen war eine komplizierte Angelegenheit, und Niall und Mór gerieten leicht auf Abwege bei ihren Expeditionen in ihr eigenes Unterbewusstsein. Nahmen sie sich etwa vor, Geld zu träumen, erwachten sie stattdessen mit haufenweise Haftnotizzetteln, auf die das Wort Pfund oder Dollar gedruckt war.
Die brauchbarsten Träume waren die klarsten.
Die klarsten Träume waren die vom Wald.
Ihrem Wald.
Dieser mochte auf den ersten Blick wie ein ganz normaler Laubwald wirken, doch sobald Mór ihn betrat, spürte sie, dass seine Wurzeln tiefer reichten. Tiefer als die Erde. Tiefer als der Fels. Tiefer, als ein Mensch je gelangen konnte. Sie waren auf der Suche nach etwas anderem als Wasser. Wenn Mór in ihren Träumen dort war, spürte sie, dass sich in dem Wald etwas verbarg, doch sehen konnte sie es nie. Nur hören. Und fühlen.
Was immer es war, es schien fasziniert von ihr.
Und Mór war fasziniert von ihm.
»Mach dir keine Sorgen«, erwiderte Niall und ergriff ihre Hand. »Hier wirst du den Wald sicher finden.«
Denn auch er träumte vom Wald. Und das Ding im Wald war auch von ihm fasziniert.
(Niall war ebenfalls fasziniert von ihm, wenn auch nicht ganz so sehr wie von Mór.)
Er hatte sich große Mühe gegeben, ihnen einen Ort zu suchen, an dem sie klar und gezielt träumen konnten, an dem sie sich Nacht für Nacht bewusst für den Wald entscheiden konnten. Insgeheim hatte er gehofft, dass Mór sich genauso in diesen Ort verlieben würde wie er, in die Aussicht auf ihr gemeinsames Leben hier, dabei wusste er, was sie sich in Wahrheit wünschte.
Und so träumte Mór in jener ersten Nacht. Als schließlich die Sonne aufging, trat sie zu Niall auf die baufällige Veranda. Niall nahm ihr Declan ab, barg ihn an seiner Brust, und sie blickten gemeinsam auf die nebligen Wiesen hinaus.
Er fragte Mór nicht, ob sie vom Wald geträumt hatte. Er wusste es auch so. Sie träumten vom Wald; der Wald träumte von ihnen.
»Ich habe heute Nacht im Wald ein Wort gehört, Liebes«, eröffnete er ihr. »Aber es war kein Englisch und auch kein Irisch.«
»Ich habe ein Wort gesehen«, entgegnete Mór. »Es stand auf einem Felsen.«
Sie schrieb das Wort in den Blütenstaub vor sich auf dem Geländer, während Niall es aussprach:
Greywaren.
1
Früher war Kunstkriminalität mal witzig.
Oder vielleicht eher aberwitzig. Die meisten Verbrechenszweige sind eine Zeit lang in und bald wieder out, Kunstkriminalität dagegen kommt nie aus der Mode. Man sollte meinen, Kunstliebhaber seien die Letzten, die Diebstahl oder Fälschungen tolerieren, in Wirklichkeit aber üben diese Themen gerade auf sie einen ganz besonderen Reiz aus. Es ist wie Kunstgenuss mit eingelegtem Turbo. Kunstgenuss als Gesellschaftsspiel, als Teamsport. Die meisten Leute würden niemals selbst ein Gemälde stehlen oder fälschen, finden es jedoch äußerst interessant, darüber zu hören. Anders als bei einem Handtaschendiebstahl oder einer Kindesentführung drücken erstaunlich viele heimlich dem Täter die Daumen.
Das Risiko schien nicht allzu hoch. Kunst mochte wertvoll sein, allerdings ging es dabei selten um Leben und Tod.
Aber die Welt hatte sich verändert.
Heute hieß ein Kunstwerk zu besitzen, dass jemand anders es nicht besaß.
Und mit einem Schlag ging es doch um Leben und Tod.
Niemand schenkte Bryde Beachtung, als er das Museum of Fine Arts betrat. Ein ganz normaler rötlich blonder Mann in einer grauen, für den Bostoner Winter viel zu dünnen Jacke. Leichtfüßig joggte er die Eingangsstufen hoch, geradezu winzig vor dem imposanten Säulenportal, die Hände in den Taschen vergraben, die Schultern gegen die Kälte hochgezogen. Er sah weder wie jemand aus, der in der näheren Vergangenheit etwas Wertvolles zerstört hatte, noch wie jemand, der in der näheren Zukunft vorhatte, etwas Wertvolles zu stehlen. Und doch traf beides zu.
Not machte eben erfinderisch.
Gerade mal sechsunddreißig Stunden war es her, dass rund um den Globus plötzlich Zehntausende Menschen und Tiere eingeschlafen waren. Alle gleichzeitig, wie auf Kommando. Egal, ob sie gerade die Straße runterspazierten, ihr Kind in die Luft warfen oder Rolltreppe fuhren: Sie schliefen einfach ein. Flugzeuge fielen vom Himmel. Lastwagen rasten von Brücken. Seevögel regneten ins Meer. Egal, ob die Leute in einem Cockpit oder hinter dem Steuer eines Linienbusses saßen, egal, wie laut die Passagiere schrien. Die Schlafenden schliefen weiter. Warum? Das wusste niemand.
Oder, na ja, fast niemand.
Bryde marschierte auf seine gewohnt zielstrebige Art zum Ticketschalter und hauchte sich dabei fröstelnd in die kalten Hände. Sein heller Blick huschte mal hierhin, mal dorthin, und wieder zurück, gerade lange genug, um den Wachmann vor den Toiletten und eine Museumsführerin zu registrieren, die eine Gruppe Besucher von einem Saal in den nächsten führte.
Die junge Frau hinter dem Schalter sah nicht mal von ihrem Monitor hoch. »Tagesticket?«, fragte sie.
Die Experten in den Nachrichten hatten zunächst je nach Forschungsschwerpunkt von ungeklärten Stoffwechselstörungen, Zoonosen oder Giftgasunfällen gesprochen, waren jedoch zusehends ins Schwimmen geraten, als sie versuchten, ihre Erklärungen von den komatösen Menschen und Tieren auf die Hunderte von Windrädern, Autos und sonstigen technischen Geräte auszuweiten, die ebenfalls den Dienst quittiert hatten. Bestand womöglich, so die These des einen, ein Zusammenhang mit den milliardenschweren Fällen von Industriesabotage, die in letzter Zeit die gesamte Ostküste in Atem hielten? Hatte man es etwa mit einem groß angelegten Angriff auf die Wirtschaft zu tun? Vielleicht würde die Regierung am nächsten Morgen ja mehr enthüllen.
Doch auch der nächste Morgen hatte keine neuen Erkenntnisse gebracht.
Niemand bekannte sich zu den Vorfällen. Und die Schlafenden schliefen weiter.
»Einmal die Wien-Ausstellung«, sagte Bryde.
»Die ist ausgebucht bis März«, entgegnete die junge Frau, als hätte sie diesen Satz schon sehr, sehr oft wiederholt. »Aber wenn Sie Ihre E-Mail-Adresse hinterlassen, setze ich Sie gern auf die Warteliste.«
Die einzigartige Wanderausstellung über die Künstler der Wiener Sezession war sofort ausverkauft gewesen. Kein Wunder. Herzstück des Ganzen war schließlich kein geringeres Gemälde als Gustav Klimts Der Kuss, das kaum je sein Heimatland verließ. Der Kuss ist ein atemberaubendes Werk, und fast jeder kennt es, ohne es vielleicht zu wissen. Es zeigt ein Liebespaar, das gleichermaßen in eine vergoldete Decke wie ineinander verschlungen scheint. Der Mann küsst die Frau auf die Wange. Er trägt Efeuranken im Haar und umfasst geradezu andächtig den Kopf der Frau. Die Frau wiederum kniet gleichmütig auf einem Bett aus Blumen; aus ihrem Gesicht spricht die Gewissheit, begehrt zu werden. Wie begehrt? Schwer zu sagen. Andere, weniger berühmte Klimt-Gemälde hatten in der Vergangenheit Preise über hundertfünfzig Millionen Dollar erzielt.
»Ich muss aber heute rein«, sagte Bryde.
»Sir –« Endlich sah die Museumsangestellte zu ihm hoch. Zögerte. Musterte ihn eine Winzigkeit zu lange. Seine Augen. Sein Gesicht.
»Bryde«, flüsterte sie.
Nicht nur das Leben der Schlafenden hatte sich seit dem Tag der vom Himmel fallenden Flugzeuge verändert. Auch die Träumer – von denen es bedeutend weniger gab – konnten plötzlich nichts mehr in die Wirklichkeit holen. Viele hatten es bloß noch nicht gemerkt, weil sie dafür zu selten träumten. Und andere waren schon vor langer Zeit gescheitert (am Träumen, am Leben).
Einige von ihnen hatte Bryde im Schlaf besucht.
»Die Wien-Ausstellung«, wiederholte er ruhig.
Diesmal zögerte die junge Frau nicht. Sie zog sich ihren eigenen Museumspass über den Kopf und reichte ihn Bryde. »Halt das, äh, Foto verdeckt.«
Als er sich im Gehen den Pass umhängte, presste sie sich die Hand vor den Mund und unterdrückte einen leisen Schluchzer.
Manchmal bedeutet es unendlich viel, wenn man erfährt, dass man nicht allein ist.
Ein paar Minuten später pflückte Bryde in aller Seelenruhe den Kuss von der Wand des belebten Ausstellungsraums, mit einer Entschlossenheit und Selbstverständlichkeit, als wäre er von offizieller Stelle damit beauftragt worden. Was wohl auch der Grund war, warum sich zunächst keiner der anderen Museumsbesucher daran störte.
Dann schlug der Gewichtssensor Alarm.
Dieb, Dieb, Dieb, kreischte der durchdringende Elektronikton.
Das blieb nun doch nicht unbemerkt.
Bryde strauchelte unter dem Gewicht des Gemäldes, das immerhin genauso groß war wie er selbst. Schon die Szene an sich war die reinste Kunst: dieser Mann mit den hellen Haaren, der Adlernase und seinen irgendwie stimmigen, gefälligen Proportionen und dieses wunderschöne Gemälde mit seiner ähnlich eleganten Ausgewogenheit.
Eine Ecke des Rahmens krachte zu Boden. Bryde zerrte das Gemälde kurzerhand über das Parkett Richtung Ausgang.
Spätestens jetzt war allen klar, dass Der Kuss gerade gestohlen wurde. So transportierte man doch kein unbezahlbares Meisterwerk!
Trotzdem hielten die Umstehenden Bryde nicht auf; sie sahen einfach zu, wie es eine solch künstlerische Darbietung nun mal erforderte – oder etwa nicht? Sie sahen zu, wie Bryde stehen blieb, etwas aus der Jackentasche holte, das wie ein Papierflieger aussah, und es einem herbeirennenden Museumsführer entgegenschleuderte. Als das Wurfgeschoss den Mann vor die Brust traf, zerschmolz es zu einer schleimigen Substanz, rann zu Boden und klebte ihn dort fest. Eine Kollegin bekam eine Handvoll Glitzerpulver ins Gesicht, das quietschte und Funken sprühte, als es ihre Haut berührte.
Eine dritte Museumsführerin kam schlitternd zum Stehen, nachdem Bryde ihr einen völlig normal aussehenden Tennisball vor die Füße gerollt hatte, der ein Gewirr aus Gras und Brombeerranken aus dem Boden emporschießen ließ.
Bryde kämpfte sich weiter.
Immer mehr Museumsangestellte eilten herbei, und für jeden von ihnen hatte Bryde eine neue Kuriosität aus seinen Jackentaschen parat. Es war, als würde er Stücke aus einer Sammlung unterschiedlichster Kunstwerke auswählen. Die Objekte waren schön, fremdartig, Furcht einflößend, verblüffend, laut, zaghaft, verlegen, fröhlich – alles Geschenke, die Bryde in den letzten sechsunddreißig Stunden von Menschen bekommen hatte, die bis zu seinem Auftauchen geglaubt hatten, sie seien allein. Früher hätte er sich selbst die nötigen Waffen träumen können, um die Leute vom Museum in Schach zu halten, aber die Zeiten waren vorbei. Heute musste er sich mit geschenkten Träumen von vorher begnügen.
Doch damit würde er es nicht bis zum Ausgang schaffen.
Immer mehr krächzende Funkgeräte machten sich bemerkbar, immer mehr Alarmanlagen jaulten, und er hatte noch so viele Treppen vor sich.
Keine Chance.
Man spazierte wohl einfach nicht mal eben in eins der berühmtesten Museen der Welt, schnappte sich einen Klimt von der Wand und trug ihn nach draußen.
Der Plan war von Anfang an zum Scheitern verurteilt gewesen.
»Wollt ihr etwa nicht, dass sie wieder aufwachen?«, fauchte Bryde die anderen Besucher an.
Seine Worte zeigten größere Wirkung als jede der Traumwaffen zuvor. Denn sie riefen den Leuten all jene in Erinnerung, die heute nicht hier waren, all die Schlafenden, die schliefen und schliefen und schliefen. In Gästezimmern. In Kinderzimmern mit hoffnungsvoll offen stehenden Türen, während den Babyfonen langsam, aber sicher der Saft ausging. Auf den Geriatriestationen der Krankenhäuser, wo die vielen Schlafenden lagen, auf die niemand Anspruch erhob.
Ein paar der Umstehenden rannten zu Bryde und halfen ihm beim Tragen.
Spätestens jetzt war das Meisterwerk vollkommen, als Bryde und ein Grüppchen Helfer den Kuss schulterten und an den Infotafeln vorbeischleppten, auf denen Klimts künstlerischer Werdegang geschildert wurde, der beschwerliche Weg seines berühmtesten Gemäldes und die Skandale, die ihn zeitlebens zu einer umstrittenen Figur gemacht hatten.
Und dann waren sie draußen, fünf, sechs, sieben Leute und ein Bild, während ein paar andere Besucher sich dem Sicherheitspersonal in den Weg stellten.
Auf der Eingangstreppe wartete die Polizei, zahlreiche Pistolen im Anschlag.
Ohne seine geschenkten Träume war Bryde bloß noch ein Mann, der sich an ein berühmtes Gemälde klammerte. Daher bedurfte es lediglich einer Handvoll Polizisten, um es ihm abzunehmen. Im Grunde war es kaum verwunderlich, dass der Diebstahl gescheitert war. Eher, dass Bryde es überhaupt so weit geschafft hatte. Aber so war das nun mal mit der Kunst: Es ließ sich schwer voraussagen, was einschlug und was nicht.
Als Bryde in Handschellen abgeführt wurde, geriet er ins Straucheln.
»Na, na«, sagte einer der Polizisten, nicht unfreundlich.
»Nicht, dass noch jemand zu Schaden kommt«, fügte sein Kollege hinzu.
Hinter ihnen wurde Der Kuss eilig zurück ins Museum geschafft. Je weiter das Gemälde sich von Bryde entfernte, desto träger wurden dessen Schritte.
»Mensch, was haben Sie sich denn dabei gedacht?«, fragte der erste Polizist. »Sie können doch nicht einfach da reinlatschen und ein Bild einsacken.«
»Was Besseres ist mir nun mal nicht eingefallen«, entgegnete Bryde.
Er sah kein bisschen mehr aus wie der Mann, der kurz zuvor das Museum betreten hatte. Jegliches Leben war aus seinem Blick gewichen. Er sackte zu Boden, bloß ein Häufchen Elend in grauer Jacke, dem die Träume ausgegangen waren.
»Irgendwann«, flüsterte er den Polizisten noch zu, »schlaft ihr auch.«
Und dann schlief er.
2
Alle Menschen gieren nach Macht … Die Werbung versichert dem Konsumenten: Du bist wichtig und verdienst Aufmerksamkeit … Der Lehrer versichert dem Schüler: Ich glaube an dich … Schöpfe dein Potenzial aus … Sei die bestmögliche Version deiner selbst … Du kannst alles schaffen … Nichts als Lügen … Macht ist wie Benzin und Salz … Man könnte meinen, es gäbe unendlich viel davon, aber in Wirklichkeit sind die Vorkommen begrenzt … Scharfe Klingen gieren nach Macht, um zu schneiden … Stumpfe Klingen gieren nach Macht, um sich vor den scharfen zu schützen … Scharfe Klingen gieren nach Macht, um zu tun wofür sie geschaffen wurden … Stumpfe Klingen gieren nach Macht, um ihren Platz in der Schublade verteidigen zu können … Wir leben in einer widerwärtigen Welt … Die Schublade ist voller hässlicher Klingen, die zu nichts zu gebrauchen sind …
NATHAN FAROOQ-LANE,
Die offene Schneide, Seite 8
3
An die Arbeit, fertig, los …
Declan war früh aufgewacht. Er frühstückte nicht, weil er fürchtete, dass das Frühstück ihm auf den Magen schlagen würde. Kaffee trank er trotzdem, obwohl er wusste, dass der ihm auf den Magen schlagen würde, aber er wusste eben auch, dass er ohne die Aussicht auf das energische Geblubber der Kaffeemaschine gar nicht erst aus dem Bett käme. Außerdem hatte Matthew mal angemerkt, dass ein Morgen nach Kaffee duftete, also musste es eben so sein.
Nachdem die Maschine in Gang gesetzt war, rief Declan Jordan Hennessy an – im Gegensatz zu seinem Arbeitstag ging ihrer gerade zu Ende. Während er dem Tuten in seinem Ohr lauschte, wischte er sorgfältig Kaffeereste von der Arbeitsplatte und Fingerabdrücke vom Lichtschalter. Er mochte seine Bostoner Wohnung, hauptsächlich weil sie im Stadtteil Fenway lag und Jordan nur eine knappe Meile entfernt wohnte, allerdings würde er das alte Gebäude niemals so penibel sauber halten können wie sein vorheriges seelenloses Domizil in D. C. Declan liebte geordnete Verhältnisse. Und in deren Genuss kam er selten genug.
»Pozzi«, begrüßte Jordan ihn warmherzig.
»Bist du noch wach?«
Die Frage war von wesentlich größerer Tragweite als noch vor ein paar Tagen.
»Schockierender- und faszinierenderweise ja«, antwortete sie. »Das Publikum hält gespannt den Atem an; selbst die Trainer haben keine Ahnung, wie dieses Match endet.«
Wach, wach – warum war Jordan wach, während so viele andere schliefen? Und was sollte Declan tun, wenn sich das morgen änderte?
»Ich will dich heute Abend sehen«, sagte er.
»Ich weiß.« Sie legte auf.
An die Arbeit, fertig, los … Declans Hemd hatte Knitterfältchen, also hängte er es ins Badezimmer und drehte die Dusche auf. Aus dem Spiegel beäugte ihn ein jüngerer Declan Lynch, ein anderer als noch vor wenigen Monaten. Der Declan von damals war eine nichtssagende Anordnung massenproduzierter Fertigteile gewesen: perfektes weißes Lächeln, gepflegte dunkle Locken, manierlicher Drei-Millimeter-Bart, die Körperhaltung selbstbewusst, aber nicht bedrohlich. Der Declan von heute dagegen grub sich einem rasiermesserscharf ins Gedächtnis. Hinter seinen blauen Augen lag etwas Lauerndes, kaum zu Bändigendes.
Declan hatte nie gefunden, dass er seinem Bruder Ronan sonderlich ähnlich sah, aber jetzt –
(Nicht an Ronan denken)
Angezogen, hinreichend koffeiniert und mit einem kaffeesauren Brennen im Magen machte Declan sich schließlich an die Arbeit. Seit er nach Boston gezogen war, um in Jordans Nähe zu sein, verdingte er sich als eine Art Nobel-Personal-Assistant. Seine Klienten vertrauten ihm ihre Handys an, für ein Wochenende oder einen Monat, während sie außer Reichweite waren, außer Landes oder im Gefängnis. Einige von ihnen überließen es ihm sogar gleich ganz. In diesen Kreisen wurde stets hoch gepokert, und manchen von ihnen fiel es schwer, ihren Geschäftskontakten gegenüber einen kühlen Kopf zu bewahren und keine vorschnellen Zugeständnisse – seien sie nun emotionaler oder materieller Natur – zu machen. Also übernahm Declan das Reden für sie.
Darin hatte er schließlich lebenslange Übung: die interessantesten Dinge so langweilig wie möglich erscheinen zu lassen.
Seine Klienten wünschten sich einen diskreten Vermittler, der die seltene Sprache der Süßmetalle beherrschte, jener begehrten Kunstwerke, die einen Schlafenden wach zu halten vermochten. Dafür war Declan genau der Richtige. Declan wusste, dass Menschen, die Gefahr liefen, zu Schlafenden zu werden, als Bedürftige zu bezeichnen waren. Er wusste, dass er behutsam vorgehen musste, wenn er sich nach der Herkunft eines Bedürftigen erkundigte, und dabei niemals Träume oder Magie erwähnen durfte. Die meisten seiner Klienten waren durch eine Heirat an ihre Bedürftigen gelangt, andere hatten welche geerbt, während wieder andere ihr bedürftiges Kind oder ihren bedürftigen Ehepartner auf dem Schwarzmarkt erstanden hatten. Diese Klienten wussten für gewöhnlich nichts über die Gründe für die gefährliche Neigung ihrer Lieben zu immerwährendem Schlaf. Weil sie nichts darüber wissen wollten. Sie wollten lediglich wissen, wie sie sie wach halten konnten.
Was Declan nur zu gut verstehen konnte.
Er warf einen Blick auf die Uhr und rief Adam Parrish an. »Hat sich irgendwas getan?«
Adams Stimme klang abgehackt. Als würde er laufen. »Die Ley-Linie ist immer noch weg. Keine Spur. Nirgends.«
»Gibt’s was Neues von …«
Adam antwortete nicht. Also nein. Kein gutes Zeichen. Adam Parrish war Ronan wichtiger als jeder andere Mensch auf der Welt. Wenn Ronan sich nicht bei ihm meldete, dann bei niemandem.
»Okay, du weißt ja, wie du mich erreichst.« Declan legte auf.
(War Ronan tot?)
An die Arbeit, fertig, los … Das frühmorgendliche Boston erwachte grummelnd zum Leben, als Declan nach draußen trat: rumpelnde Müllautos, zischende Bustüren, zeternde Vögel. Sein Atem bildete Wölkchen, während er sein Auto für einen kurzen Moment entriegelte, um nach dem Lufterfrischer am Rückspiegel zu angeln.
Er gab sich lässig.
Es ist nur ein Lufterfrischer. Nicht mein mühsam Erspartes. Hier gibt’s nichts zu sehen.
»Guten Morgen!«, rief eine seiner Nachbarinnen, eine Ärztin. Declan hatte Nachforschungen über sie angestellt, wie über alle Leute in dieser Straße. Gute Zäune sorgen für gute Nachbarschaft. »Geht es … Ihrem Bruder wieder besser? Marcelo meinte, er wäre neulich ohnmächtig geworden oder so.«
Vielleicht war auch sie ein Traum. Oder eine Träumerin. Manches brachten selbst die gründlichsten Nachforschungen nicht an den Tag. Sehr wahrscheinlich war es nicht, aber auch nicht unmöglich. Anfangs hatte Declan schließlich auch noch geglaubt, er wäre der einzige Mensch, der mit Träumen zusammenlebte. Inzwischen wusste er aus den Nachrichten, dass das nicht stimmte. Es gab noch mehr. Nicht viele. Aber mehr, als er je für möglich gehalten hätte.
Und auf jeden Fall mehr, als es Süßmetalle gab.
»Niedriger Blutdruck«, log Declan geschmeidig. »Liegt bei uns in der Familie. Mütterlicherseits. Haben Sie bei der Arbeit mit so was zu tun?«
»Oh! Nein, haha. Nein. Bei mir geht’s ans Eingemachte. Alles, was sich hier drin abspielt«, erwiderte sie mit einer Geste auf ihre Körpermitte. »Freut mich jedenfalls, dass es nichts Ernsteres war.«
»Nett, dass Sie gefragt haben«, log er wieder.
Zurück im Apartment, schraubte er in sicherer Entfernung zu den Fenstern das Fläschchen auf und fischte die darin versteckte Halskette heraus. Der Anhänger war ein filigran gearbeiteter silberner Schwan, dessen Hals sich um die Ziffer Sieben schlang. Declan hatte keine Ahnung, was das Symbol ursprünglich für eine Bedeutung gehabt hatte, aber für irgendjemanden musste es wichtig gewesen sein, dachte er bei sich, sonst wäre der Anhänger heute wohl nicht so wertvoll für ihn selbst. Er erinnerte sich vage an eine Geschichte über sieben Schwäne, die Aurora ihnen früher gern erzählt hatte, aber worum es darin ging, wusste er nicht mehr. Im engmaschigen Netz seines Gedächtnisses schienen sich nur die Geschichten seines Vaters verfangen zu haben.
Der Süßmetall-Anhänger hatte ihn einiges gekostet.
Die Kunstwerke, die er dafür hatte verkaufen müssen, fehlten ihm schon jetzt.
»Schule fängt gleich an!«, rief er auf dem Weg die Treppe hoch zu Matthews Zimmer. In der Tür stolperte er über ein riesiges, extrem hässliches Paar Sneakers. Er versuchte noch, sich wieder zu fangen, doch so leicht ließ das knallbunt gesteppte Schuhwerk ihn nicht davonkommen. Declan segelte in hohem Bogen ins Zimmer und konnte seinen Sturz gerade noch am Rand der Matratze abfangen; Matthews goldene Locken auf dem Kissen bewegten sich keinen Millimeter.
»Matthew«, ächzte Declan. Sein nervöser Magen brannte.
Der Junge im Bett sah aus wie siebzehn und sieben zugleich. Das war die Magie von Matthews engelsgleichen Zügen. Er schlief weiter. Declan presste ihm den Schwanenanhänger an den Hals. Die Haut seines Bruders fühlte sich warm und lebendig an.
»Mmmf.« Matthew tatzte verschlafen nach dem Anhänger und umfasste die Kette. Fest. Wie eine Rettungsleine – und war sie nicht genau das? »Steh gleich auf«, nuschelte er.
Declan atmete auf.
Noch war die Kraft des Süßmetalls nicht erschöpft.
»Beeil dich«, sagte er. »In zwanzig Minuten müssen wir los.«
»Hättest mich ja wohl früher wecken können«, beschwerte sich Matthew.
Nein, hätte Declan nicht. Unpraktischerweise neigten die kraftvollsten Süßmetalle nämlich dazu, sehr berühmte Gemälde zu sein: John Singer Sargents Madame X, Klimts Der Kuss, Georgia O’Keeffes Schwarze Iris III. Diese und andere Mona Lisas lächelten allesamt in Museen von den Wänden, nach Freigabe und als Leihgabe von irgendwelchen Großkonzernen und sonstigen Superreichen dieser Welt. Die mittelmäßig kraftvollen Süßmetalle befanden sich im Besitz geträumter Firmenchefs und Erbinnen oder ungeträumter Firmenchefs und Erbinnen, die geträumte Kinder oder Ehepartner hatten. Die am wenigsten begehrten Exemplare wiederum zirkulierten auf dem Schwarzmarkt. Diese Süßmetalle waren wirkungsschwächer, vergänglicher, unästhetischer, amateurhafter … und trotzdem noch sehr teuer. Seit neuerdings jeder Traum ein Süßmetall brauchte, um wach zu bleiben, waren die Preise selbst für die minderwertigsten in exorbitante Höhen geschossen.
Im Moment bekam Matthew den Schwanenanhänger kurz vor dem Frühstück und musste ihn direkt nach der Schule wieder abgeben. Er hatte seit Tagen keinen Sonnenuntergang mehr gesehen und würde innerhalb der nächsten Monate auch kein Wochenende erleben. Denn der Anhänger musste noch bis zum Ende des Schuljahrs halten. Declan konnte sich kein weiteres Süßmetall leisten. Er hatte sich schon für dieses völlig krummlegen müssen.
(Schuldgefühle stürzten auf ihn ein, umhüllten ihn, zogen ihn in die Tiefe.)
»Ich hab mal ’ne hypothermische Frage«, sagte Matthew ein paar Minuten später. »’ne hypothetische, meine ich.«
Mehr oder weniger bereit für die Schule, stand er in der Küchentür. Sogar das Gesicht hatte er sich gewaschen und hielt seine geradezu grausam hässlichen Sneakers in der Hand, damit Declans Fußboden sauber blieb.
Er wollte sich einschleimen.
»Nein«, sagte Declan und griff nach seinem Autoschlüssel. »Die Antwort ist Nein.«
»Kann ich heute nach der Schule noch zum D&D-Klub?«
Declan versuchte, sich zu erinnern, was noch gleich D&D war. Zuerst schwirrten ihm Bilder von Peitschen und Leder durch den Kopf, aber das passte nun doch nicht zu Matthew, nicht mal in dieser neuen aufmüpfigen Phase. »Zauberer?«, fragte er.
»Genau, da kloppt man sich im Spiel mit Trollen und so.«
Declan kloppte sich nicht im Spiel mit Trollen und so. Für ihn war das leider Realität. Weniger D&D und mehr B&B wäre schön. »Fragst du, weil sich das auch über Abende und Wochenenden erstrecken würde?«
Wenn Matthew doch ohne Süßmetall wach bleiben könnte, so wie Jordan, aber wer wusste schon, wieso das funktionierte –
»Nur Mittwoche. Zählen Mittwoche überhaupt als Tage?«
»Ich denk drüber nach.«
(Am liebsten wollte er über gar nichts nachdenken.) (War Ronan tot?)
An die Arbeit, fertig, los … Declan fuhr Matthew zu seiner neuen Schule; er musste zu jedem Zeitpunkt wissen, wo sein Bruder sich befand. Nachdem die Träume eingeschlafen waren, hatte er Stunden gebraucht, um ihn aufzuspüren. Das würde er nicht noch einmal ertragen. Die Ungewissheit.
»Hast du schon über D&D nachgedacht?«, quengelte Matthew.
»Du hast vor gerade mal zwölf Minuten gefragt.« Declan reihte sich in die Schlange vor dem Schultor ein. In so gut wie jedem der anderen Autos saß jemand um die vierzig oder fünfzig, ein Elternteil, der nicht in der eigenen Auffahrt mit einem Wagenheber erschlagen worden war, bevor seine Kinder volljährig waren.
Declan fühlte sich, als wäre er um die vierzig oder fünfzig.
(WarRonanTotWarRonanTotWarRonanTotWar–)
»Und, hast du?«
»Steig aus, Matthew«, kommandierte Declan. Sein Handy hatte zu klingeln begonnen. Sein Handy, sein eigenes, nicht das eines Klienten. »Keine Cola zum Mittagessen. Und häng dich nicht so an die Autotür, das ist kein Fitnessgerät.« Das Handy klingelte, klingelte. Er ging dran. »Declan Lynch.«
»Hier ist Carmen Farooq-Lane.«
Sein Mund war plötzlich trocken. Als er vor ein paar Tagen zum letzten Mal mit ihr gesprochen hatte, hatte er ihr Ronans Aufenthaltsort verraten, damit sie Bryde überwältigen und Ronan von seinem Einfluss befreien konnte. Mann, war das in die Hose gegangen.
Die Schuldgefühle nagten an seinen Eingeweiden.
(Ronan, Ronan, Ronan)
Matthew hing noch immer an der Beifahrertür. Declan versuchte, ihn reinzuscheuchen, aber Matthew blieb und lauschte.
»Die Sache wird zwar ziemlich unter Verschluss gehalten«, redete Farooq-Lane weiter, »aber vielleicht haben Sie trotzdem gehört, dass Bryde vor ein paar Tagen im Museum of Fine Arts festgenommen wurde.«
Das Brennen in Declans Magen wurde schlimmer. Sofort servierte sein Gehirn ihm Bilder eines ausgedehnten Schusswechsels, infolgedessen Ronan reglos in seinem eigenen Blut lag, in der Hand irgendeinen Traum, der unzweifelhaft seine Schuld bewies.
Bitte nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein.
»Ronan –?«
»Wir sollten uns treffen«, sagte Farooq-Lane.
Declan wurde schwindelig vor Erleichterung. Sie hatte nicht gesagt, Ihr Bruder ist tot. »Wo?«
Sie nannte ihm einen Ort.
Declan starrte auf das staubige Lenkrad, dessen Lederummantelung nur an den Stellen sauber war, an denen seine Hände gelegen hatten. Dieser Staub machte ihn fertig. Diese Geschwindigkeit, mit der sich Schmutz und Unordnung breitmachten, wenn Declan nur mal kurz nicht hinsah. Was er brauchte, dachte er, waren bloß ein, zwei Tage, an denen ohne ihn nicht alles vor die Hunde ging. Bloß ein, zwei Stunden. Minuten.
(Ronan, Ronan, Ronan)
»Declo«, nölte Matthew, »was ist denn?«
An die Arbeit, fertig, los …
»Steig wieder ein«, sagte Declan. »Schule fällt heute aus.«
4
Fürs Erste war keine Apokalypse mehr zu befürchten, doch es fühlte sich an, als würde noch immer die Welt untergehen.
Wer bist du jetzt?
Eine Frau, die die Apokalypse abgewendet hat.
Das versuchte Carmen Farooq-Lane sich zumindest einzureden, und doch drängte sich ihr eine ganz andere Antwort auf.
Farooq-Lane und Liliana saßen auf dem Parkplatz des Medford-Pflegezentrums im Auto und warteten auf Declan Lynch. Die weißhaarige Liliana auf dem Beifahrersitz strickte irgendwas aus türkiser Wolle, passend zu ihrem Haarband, und summte dabei vor sich hin. Sie war Expertin im Zeittotschlagen. Die dunkelhaarige Farooq-Lane auf dem Fahrersitz bohrte derweil mit den Fingernägeln zehn Kerben ins Lenkrad und knetete es so fest, dass ihre Knöchel weiß hervortraten. Sie war eine Niete im Zeittotschlagen.
Wer bist du jetzt?
Eine Frau, die ihren Bruder getötet hat.
Declan Lynch hatte sich nach Kräften bemüht, seinen Bruder, einen gemeingefährlichen Zed, zu beschützen, sie dagegen hatte alles getan, um ihren auszuschalten.
Farooq-Lane war klar, dass sich das nicht direkt vergleichen ließ. Nathan hatte mithilfe geträumter Waffen eine Reihe unschuldiger Menschen getötet und die Tatorte mit geöffneten Scheren markiert. Ronan dagegen wurden Verbrechen zur Last gelegt, die er in Zukunft möglicherweise begehen würde, Weltuntergänge, die er möglicherweise herbeiführen könnte. Eines allerdings vereinte die beiden: viel zu viel Macht für einen einzelnen Menschen. Da war es nur folgerichtig, sie aus der apokalyptischen Gleichung zu tilgen. Zusammen mit allen anderen viel zu mächtigen Zeds dieser Welt.
Also waren Farooq-Lane und die Regulatoren ausgezogen, um zu töten und zu töten und zu töten und –
Weißt du, wer sich am leichtesten manipulieren lässt?, hatte Nathan sie einmal gefragt. Leute, die auf der Flucht vor der letzten Person sind, von der sie manipuliert wurden.
Farooq-Lane sah sich um. Nach einem sehr kalten Start war der Tag noch unerwartet warm geworden, zu warm für Massachusetts um diese Jahreszeit. Der diesig blaue Himmel wirkte unpassend hinter den laublosen Baumkronen, als wäre er seiner Zeit voraus. In einiger Entfernung marschierte ein Passant zügig dahin und erinnerte sie an Nathan. So hatte auch er beim Gehen ausgesehen: schnelle, zielgerichtete Bewegungen und den Kopf voran, wie eine Galionsfigur an einem Schiffsbug.
Hör auf, über die Vergangenheit nachzugrübeln, ermahnte sie sich im Stillen. Grübel lieber über die Gegenwart nach.
Es war vorbei. Stecker: gezogen. Träumer: gestoppt. Feuergefahr: gebannt. Welt: gerettet.
Sicher?
Sicher.
Diese ganze verdammte Geschichte hatte sie ihre Familie gekostet. Ihre Karriere. Ihre Seele. Und was hatte dem Morden schließlich ein Ende gesetzt? Ein paar Minuten Träumen bei einer Tasse Kakao, und schon waren die Zeds ihrer Energiequelle beraubt gewesen. Auftritt mit Wumms, Abtritt mit Wimmern.
»Mir kommt das alles irgendwie zu leicht vor«, gestand Farooq-Lane. »So antiklimaktisch.«
»Nichts an dem, was wir gemacht haben, war leicht«, widersprach Liliana mit ihrem ungewöhnlichen Akzent. Das rhythmische Klappern ihrer Nadeln – eine Masche rechts, eine Masche links – war wie das Ticken eines Sekundenzeigers. »Ich persönlich bin jedenfalls froh, dass das alles hinter uns liegt und wir einfach in Frieden weiterleben können.«
Liliana: früher Farooq-Lanes Visionärin/ Freundin, heute möglicherweise nur noch Freundin. Bevor die Ley-Linie stillgelegt worden war, hatte sie immer wieder gefährliche Visionen von der drohenden Apokalypse gehabt, die sie wild zwischen drei verschiedenen Lebensaltern hatte wechseln lassen. Seit dem Versiegen der Ley-Energie jedoch war sie vollkommen davon verschont geblieben. Ihre Vorahnungen hatten sich offenbar, ebenso wie Träume, aus der Ley-Linie gespeist.
Natürlich fand Farooq-Lane es schön, nicht mehr ständig fürchten zu müssen, von einer der tödlichen Schallexplosionen in Fetzen gerissen zu werden, die mit den Visionen einhergingen. Allerdings war es doch sehr merkwürdig, eine Beziehung mit einer Liliana mittleren Alters angefangen zu haben und sie nun mit einer wesentlich älteren Version von ihr fortzusetzen. Zuvor hatte Farooq-Lane kaum darüber nachgedacht, dass Liliana zwischendurch uralt war, denn schließlich hatte sie genauso oft zurückgewechselt. Jetzt jedoch, nachdem die Ley-Linie verschwunden war und mit ihr die Visionen, schien es, als würde Liliana in diesem Alter verharren. Sie war so elegant und erhaben wie eh und je, aber eben auch unübersehbar Jahrzehnte älter als Farooq-Lane.
Und außerdem waren sie nun blind für alles, was da kommen würde.
»Ich weiß gar nicht mehr, wie das geht, in Frieden weiterleben«, entgegnete Farooq-Lane. »Kannst du dir vorstellen, dass ich mal mein Geld damit verdient habe, anderer Leute finanzielle Zukunft zu planen?«
»Ich glaube, keine Zukunft, ob finanziell oder sonst wie, lässt sich planen.«
Liliana legte ihr Strickzeug hin und nahm Farooq-Lanes Hände fest zwischen ihre. Wie immer hatte ihre Berührung sofort eine beruhigende Wirkung. Die Farooq-Lane nach wie vor ein Rätsel war. Sie wusste, dass Liliana eine spezielle Magie anhaftete, die einem das Gefühl gab, ein besserer Mensch zu sein. Beim ersten Kennenlernen hatte die Visionärin ihr gestanden, wie sehr es sie betrübe, dass Menschen so fragil seien. Wer so etwas sagte, meinte es entweder scherzhaft oder betrachtete sich selbst nicht als Menschen.
Und Liliana neigte nicht zum Scherzen.
»Weißt du noch, was als Nächstes kommt?« Lilianas Alterssprünge waren verwirrend, aber mittlerweile meinte Farooq-Lane, verstanden zu haben, dass es eine echte Version von Liliana gab, eine, die ins Hier und Jetzt gehörte. Die anderen blickten auf Ereignisse zurück, die bereits passiert waren, oder voraus auf solche, die noch bevorstanden.
Zuvor hatte ihr die älteste Liliana hin und wieder mit kleinen Erinnerungshäppchen aufgewartet. Jetzt jedoch sagte sie bloß: »Erst mal kommt das Abendessen. Hennessy hat vorhin etwas von Falafel gesagt, und ich finde, das klingt fabelhaft.«
»Ich hoffe, es war kein Fehler, sie allein zu lassen«, murmelte Farooq-Lane. »Dass sie noch ein bisschen schlafen wollte, hab ich ihr jedenfalls nicht abgekauft. Sie tut doch kaum was anderes als schlafen.«
»Die Arme hat ja auch einiges nachzuholen.«
In Lilianas Stimme lag Mitleid, und natürlich hatte sie recht. Hennessy war in der Tat zu bemitleiden; all die Jahre, in denen sie immer wieder denselben Albtraum gehabt hatte; all die Jahre, in denen sie hatte fürchten müssen, den Albtraum wahr werden zu lassen. Hab Mitleid mit ihr, befahl Farooq-Lane sich. Hab Mitleid mit ihr! Doch sie hatte nur wenige Tage gebraucht, um zu dem Schluss zu gelangen, dass Hennessy der unausstehlichste Mensch aller Zeiten war.
Erstens: Hennessy war laut. Ihre ewigen Monologe schien sie für so interessant zu erachten, dass sie sie stets in voller Lautstärke vortrug, und zwar vorzugsweise von erhöhten Plätzen wie Möbelstücken, Autos oder Hausdächern aus. Ein endloser, pulsierender Strom aus Worten.
Zweitens: Hennessy war unberechenbar. Gleich in der ersten Nacht, nachdem sie die Ley-Linie lahmgelegt hatte, war sie für mehrere Stunden verschwunden. Ohne Bescheid zu sagen. Ohne Erklärung. Erst als Farooq-Lane und Liliana schon drauf und dran waren, sich auf die Suche nach ihr zu machen, kam sie zurück. In einem Auto ohne Nummernschild, dafür aber mit röhrendem, schepperndem Auspuff, dessen Gebrüll und Gebrabbel – ähnlich wie das von Hennessy selbst – Farooq-Lane derart auf die Nerven ging, dass sie den Wagen schließlich in die Garage sperrte. Sie hätte unmöglich sagen können, ob er sehr billig oder sehr teuer war. Und schon gar nicht traute sie sich zu fragen, wo er herkam.
Drittens: Hennessy litt unter chronischem Zerstörungsdrang. Man musste sie permanent im Auge behalten, sonst zerlegte sie alles um sich herum, wie ein eingesperrter Fuchs. In den wenigen Tagen, die sie jetzt bei ihnen war, hatte sie Badewannen zum Überlaufen und Öfen zum Funkensprühen gebracht, Fensterscheiben zum Splittern und Nachbarn zum Starren, indem sie zu wummernder Musik aus dem (vermutlich gestohlenen) Auto eine gigantische Version von Munchs Schrei ans Garagentor gesprayt hatte. Von der Kaution konnte Farooq-Lane sich verabschieden.
Viertens: Hennessy war komplett lebensmüde. Oder zumindest gab sie sich keine sonderlich große Mühe, nicht zu sterben. Sie wagte Sprünge aus nicht zwangsläufig überlebbaren Höhen. Tauchte, ohne vorher ausreichend Luft geholt zu haben. Trank Sachen, die in hoher Konzentration nicht gerade gesundheitsfördernd waren. Sie aß, erbrach sich, aß weiter. Sie spielte mit dem Feuer, und wenn sie sich daran verbrannte, inspizierte sie die Blase voller Neugier statt Entsetzen. Manchmal bekam sie so qualvolle Lachanfälle, dass Liliana aus reiner Anteilnahme in Tränen ausbrach.
Die letzten paar Tage hatten sich hingezogen wie Jahre.
Trotzdem konnte Farooq-Lane die ungebärdige Zed-Frau nicht einfach vor die Tür setzen. Denn Liliana und sie hatten dem Einhorn sein Horn genommen, ohne ihm etwas im Austausch dafür anzubieten.
Wer war Hennessy, wenn sie nicht mehr träumen konnte?
Wer war Farooq-Lane?
Eine Frau, die die Apokalypse abgewendet hat.
»Da ist er«, bemerkte Liliana zufrieden.
Ein grauer Volvo war um die Ecke gebogen und blieb ein Stück vom Haus entfernt stehen. Am Steuer saß Declan Lynch, auf dem Beifahrersitz der goldgelockte Matthew. Zwei Drittel der Lynch-Brüder.
»Lass die Vergangenheit ruhen«, riet Liliana ihr. »Das hier ist ein Neuanfang.«
Du hast die Apokalypse abgewendet.
Farooq-Lane nahm zwei Grußkarten aus dem Türfach und ging damit auf Declan zu. Zu beiden Seiten einer weißen Parkplatzmarkierung blieben sie stehen. Die Situation schien ein Händeschütteln nahezulegen, doch keiner von ihnen machte Anstalten dazu, und nach kurzer Zeit war die Anspannung zwischen ihnen so greifbar, dass Farooq-Lane schließlich beflissen seufzte, als wollte sie eine Konferenz eröffnen.
»Ist er tot?«, fragte Declan unumwunden.
Statt zu antworten, reichte sie ihm die erste der beiden Grußkarten.
Er klappte sie auf. Darin stand in Schnörkelschrift gedruckt: Alles Gute zum Valentinstag an den besten Sohn und die beste Schwiegertochter der Welt!
Darunter hatte sie hinzugefügt:
Seit dem Vorkommnis im Rosengarten habe ich nichts von den anderen Regulatoren gehört. Ich unterstehe zwar nicht mehr ihrer Direktive, aber möglicherweise beobachten sie mich trotzdem weiter. Für den Fall, dass sie mich, mein Handy oder sonst irgendetwas aus meinem Besitz verwanzt haben sollten, habe ich aufgeschrieben, was Sie wissen müssen.
Das Schweigen der Regulatoren war alles andere als beruhigend. Und die seltsame Funkstille betraf nicht nur Farooq-Lane. Als die Polizei sie über Brydes Festnahme informiert hatte, hatte sich herausgestellt, dass man es zuvor bereits bei einigen der anderen Regulatoren versucht hatte. Was war da los? Diese Leute waren doch eigentlich wie nervige Verwandte oder eine Pilzinfektion: Sie gingen nicht von selbst wieder weg.
Sie reichte Declan die zweite Karte.
Auch diese enthielt eine vorgedruckte Grußbotschaft (Ich mag dich ein kleines bisschen mehr als ursprünglich geplant … Alles Gute zum Hochzeitstag, Schatz!), die jedoch kaum mehr zu entziffern war, weil Farooq-Lane die freie Fläche bis in den letzten Winkel mit allem vollgeschrieben hatte, was sie über die Situation wusste.
Declan fing an zu lesen. Seine Miene gab nichts preis.
Kurz warf er einen Blick über die Schulter zum Pflegezentrum und dann zu seinem Bruder, der so eindringlich zurückstarrte wie ein ins Auto gesperrter Hund.
Farooq-Lane bekam Mitleid mit ihm. Dieses Gefühl für Declan Lynch aufzubringen, der sich derart bemühte, sich sein Leid nicht anmerken zu lassen, fiel ihr sehr viel leichter als für Hennessy, die jeden Raum, den sie betrat, mit ihrem Unglück füllte. Hennessys Beweggründe konnte sie nicht nachvollziehen, aber wie es war, das vernünftigste Geschwisterkind zu sein, wusste sie nur zu gut.
»Sie hätten mich nicht kontaktieren müssen«, murmelte Declan schließlich ausdruckslos.
»Ich hatte Ihnen ein Versprechen gegeben. Dass ich Bryde dingfest mache und Sie Ihren Bruder zurückbekommen. Und ich habe es nicht gehalten. Da ist das ja wohl das Mindeste.«
Einen Moment lang sah er sie bloß an, dann schnalzte er mit der Zunge. Das Geräusch war so unerwartet wie unmissverständlich. Ein Entscheidungsfindungsgeräusch. Er zog eine Visitenkarte aus der Jackentasche und kritzelte zwei Ziffern und eine Adresse darauf. »Ich möchte nicht das Gefühl haben, Ihnen was schuldig zu sein.«
Sie nahm die Karte. »Sollte ich mich dafür bedanken?«
»Möglicherweise finden Sie dort ein paar Antworten.«
Farooq-Lane war nicht sicher, was für Antworten ihm da vorschwebten. »Tja, dann: danke«, sagte sie dennoch.
Er schüttelte leicht den Kopf. »Das ist nur fair. So sind wir wieder quitt.«
»Wir sind die Agenten auf der Brücke«, kommentierte Farooq-Lane.
»Oder die einzigen Erwachsenen im Raum«, entgegnete Declan. Er wirkte noch immer kühl und professionell, aber auch zunehmend rastlos; er schien über den Text in der Grußkarte nachzudenken. Die Unruhe ließ kurz die Illusion eines wesentlich älteren Mannes verschwinden, und für einen Sekundenbruchteil sah er seinem Bruder Ronan sehr ähnlich.
Dem Ronan, den Farooq-Lane von ihrer letzten Begegnung in Erinnerung hatte. Nicht dem jetzigen.
Nun schüttelte sie Declan doch die Hand, um ihre Besprechung offiziell zu beenden. »Viel Glück, Mr Lynch.«
»Kann ich gebrauchen«, erwiderte Declan bitter, »je mehr, desto besser.«
5
Ronan Lynch träumte vom Gespinst.
Er bewegte sich darin. Durch es hindurch.
Über ihm ein Geflecht aus Ästen.
Unter ihm ein Gewirr aus Schatten.
Verworrene Muster. Lichtreflexe auf einem Ozean, eine geäderte Fläche, alles verknäuelt und verknotet.
Ronan dachte: Ach, dich kenne ich.
Das Gespinst antwortete: Ich kenne dich auch.
Dann brach der Traum ab, und Ronan fand sich in einem Meer aus Leere wieder. Einer Welt ohne Inhalt, oder zumindest keinem, den seine Sinne wahrzunehmen imstande waren.
Nach einer Weile durchbrach ein heller Fleck das Schwarz. Schwer zu sagen, ob Ronan sich auf den Fleck zubewegte oder der Fleck sich auf Ronan, aber von Näherem erkannte er schließlich, dass es ein Gestrüpp aus Stromschnellen war, verschlungen wie Wasserpflanzen.
Es war wunderschön.
Ronan wollte näher heran, und plötzlich war er es, trieb mitten hinein in das strahlende Dickicht. In dem Moment, als er damit in Berührung kam, erfasste ihn ein regelrechter Bilderwirbel, und Ronan fand sich nacheinander an ganz unterschiedlichen Orten wieder. Er sah imposante Villen mit hohen Decken, lauschig grüne Friedhöfe, ein Schiffswrack auf dem Meeresgrund, schummrige Hütten mit Stockbetten an den Wänden, dunkle, enge Keller, helle, offene Seen, Museen bei Nacht, Schlafzimmer bei Tag.
Er versuchte jedes Mal, so lange wie möglich zu bleiben, um sich alles einzuprägen, nach einer Weile jedoch wurde er stets zurück hinaus auf das leere Meer gezogen.
Allmählich wurde ihm klar: Diese Orte waren real.
Nicht für ihn. Aber für alle, die dort lebten. Die Leute. Die Menschen.
Auch sie waren wunderschön.
Die Leute schienen sich ebenfalls zu ihm hingezogen zu fühlen. Sie musterten ihn neugierig. Kamen so dicht an ihn heran, dass er die Tränen in ihren Wimpern sehen und ihren Atem hören konnte. Diese Hand hielt ihn fest. Jene Lippen gaben ihm einen zarten Kuss. Diese Wange schmiegte sich dankbar an ihn. Jenes Herz klopfte direkt an seinem. Er wurde betrachtet, er wurde umklammert, er wurde getragen, er wurde getauscht, er wurde um Hälse und Handgelenke gewunden, er wurde anprobiert, er wurde in Schubladen verstaut, er wurde in Kisten versteckt, er wurde in noch warme Blutlachen fallen gelassen, er wurde verschenkt, er wurde gestohlen, er wurde gebraucht, er wurde gebraucht, er wurde gebraucht.
Es dauerte eine Weile, bis er begriff, dass all diese Menschen gar nicht ihn sahen. Sondern die Objekte, aus denen er ihnen entgegenblickte. Süßmetalle.
Für sie war er das Gemälde im marmorgefliesten Flur, das Amulett um den Hals, die von Generationen von Kindern gestreichelte Hundestatue, die stehen gebliebene Uhr auf dem Kaminsims. Er war der Ring am Finger, das Taschentuch in der Westentasche, er war die Schnitzerei und das Werkzeug, das sie geschaffen hatte, aber vor allem war er das, was in diesen Süßmetallen steckte: Er war die Liebe, er war der Hass, er war das Leben, er war der Tod, er war all das, was ein Süßmetall zu einem Süßmetall machte.
Süßmetall, Süßmetall, dieses Wort: Süßmetall. Hatte er überhaupt geahnt, dass es so etwas gab, bevor er an diesem Ort gelandet war? Irgendein Teil von ihm musste es gewusst haben. Die Süßmetalle waren der geheime Pulsschlag der Welt, untrennbar verwoben mit der Menschheit, mit allem, woran die Leute glaubten und was ihnen lieb und teuer war.
Genau wie die Menschen auf der anderen Seite bekam auch Ronan nicht genug von den Süßmetallen. Sooft er nur konnte, hielt er sich in ihnen auf. Doch es waren nicht bloß der Anblick und die Geräusche der Menschenwelt, die ihn faszinierten, sondern vor allem die Emotionen. Jeder, der ein Süßmetall zu Gesicht bekam, brachte einen ganzen Berg an Gefühlen mit. Wut, Liebe, Hass, Freude, Enttäuschung, Trauer, Aufregung, Hoffnung, Angst.
Auch sie waren wunderschön.
In dem leeren Meer gab es nichts dergleichen. Wie herrlich und wie schrecklich diese Gefühle doch waren! Wie überwältigend und undurchschaubar. Er fragte sich, wie es wohl sein mochte, so etwas zu empfinden. Er erinnerte sich, dass einiges davon angenehmer war als der Rest.
Das verwirrte ihn. Er erinnerte sich?
Doch er hatte keine Zeit, sich darüber den Kopf zu zerbrechen, denn als er in das nächste Süßmetall wechselte, blickte er plötzlich in ein bekanntes Gesicht. Hennessy. Er hatte vergessen, dass er Menschen kennen konnte! Und wie er Hennessy kannte! Er kannte ihr Gesicht, ihren Namen, ihre Tränen, die seine Schulter benetzten.
Sie war in einem Atelier voller fertiger und unfertiger Porträts, deren geballte Süßmetall-Ausstrahlung ihn überhaupt erst angelockt hatte. Und Hennessy selbst schien von einer ähnlichen Energie umgeben. Als sie eine Schicht Firnis auf die Leinwand vor ihr auftrug, schien die Luft regelrecht zu knistern. Vielleicht war ja das Erschaffen eines Süßmetalls selbst eine Art von Süßmetall – was war zuerst da, Schöpferin oder Schöpfung?
Langsam dämmerte ihm, dass er gar nicht Hennessy vor sich hatte, sondern Jordan. Diese junge Frau war nicht hektisch genug für Hennessy. Außerdem wurde ihm klar, dass er die Person auf dem Porträt, an dem sie arbeitete, kannte. Das Gemälde zeigte einen sitzenden jungen Mann, sein Jackett über dem Knie, die Hände locker verschränkt, das lächelnde Gesicht fast vollständig abgewandt. Es war –
Declan.
Ein Name, auf den direkt ein weiterer folgte: Matthew. Gehörten die beiden zusammen? Declan. Matthew. Brüder. Ja, sie waren Brüder.
Sie waren –
Sie waren seine Brüder. Jetzt erinnerte er sich. Er erinnerte sich –
Mit einem Schlag erinnerte Ronan sich an sich selbst.
Er war noch nicht immer hier in dieser Leere gewesen. Er war ein Mensch gewesen. Er hatte einen Körper gehabt. Einen Namen.
Ronan Lynch. Ronan Lynch. Ronan Lynch.
Jordans Atelier löste sich vor seinen Augen auf. Die plötzliche Wucht an Emotionen riss ihn zurück in das leere Meer. Verzweifelt suchte er nach Halt.
Jordan!, schrie er.
Doch seine Stimme hatte keinen Klang, und die Süßmetalle waren kein Fenster, das sich öffnen ließ.
Ronan Lynch. Ronan Lynch.
Was, wenn er sich wieder vergaß? Oder war er vielleicht längst dabei? War das alles hier schon einmal passiert? O Gott, wie lange mochte er schon hier sein und immer wieder dasselbe erleben, gefangen in einem ewigen Kreislauf aus Vergessen und Erinnern, Vergessen und Erinnern?
Kurz darauf war er zurück in dem leeren Meer.
Er wurde immer unruhiger. Bilder stürzten auf ihn ein, ein Tal mit Schobern und Scheunen und Weiden voller schlafender Rinder. Dort hatte er nach Süßmetallen gesucht. Nein. Er hatte versucht, welche zu erschaffen. Wenn er doch nur eins für Matthew gehabt hätte. Für seine Mutter. Das hätte alles geändert. Seine zerbrochene Familie, die Familie Lynch.
Wie hatte er das bloß vergessen können? Und an was alles konnte er sich noch nicht erinnern?
Ronan Lynch war ein Flur, den er Schritt für Schritt mit Licht erfüllte.
Wieder richtete er seine Aufmerksamkeit auf das leuchtende Gewirr aus Süßmetallen, das sich durch die Dunkelheit schlängelte. Bis eben noch war er bloß neugierig gewesen. Ziellos.
Jetzt dagegen wusste er, wonach er suchte.
Declan, Matthew, Ronan. Die Brüder Lynch.
Ein Parkplatz, bedeckt von einer schmutzigen Eisschicht. Salzverkrustete Autos. Laublose Bäume. Ein flaches Gebäude, umwuchert von dürrem Gestrüpp. Spätwinter oder Frühlingsanfang.
Ronan hätte nicht sagen können, wie lange er die Welt bereits durch Süßmetalle betrachtete; hier in diesem endlosen Meer folgte die Zeit anderen Regeln. Anfangs war er nur quälend langsam vorangekommen, allmählich aber wurde es besser. Und jetzt zahlte seine Beharrlichkeit sich aus. Während sein Bewusstsein über dem Parkplatz niederging, erhaschte er einen Blick auf zwei vertraute Gestalten vor der elektrischen Schiebetür am Gebäudeeingang.
Eine der beiden trug ein Süßmetall um den Hals, einen Kettenanhänger in Form eines Schwans. Nicht das mächtigste Süßmetall, in dem Ronan je gewesen war, aber trotzdem stark. So stark, dass es ihn fest genug in diesem sonnigen Tag in Neuengland verankerte, um ihm zu gestatten, wie ein Geist umherzuschweben. Er wusste nicht, wie warm oder kalt es war, nahm dafür aber jede Menge anderer Informationen auf, die er in seinem aktuellen Zustand besser wahrnehmen konnte. Er fühlte das Summen der Hochspannungsleitungen dort drüben. Das Rauschen eines nahen Ozeans. Und er verzeichnete eine seltsame Taubheit in der Atmosphäre; nichts direkt Greifbares, mehr wie eine Lücke, wo normalerweise etwas sein müsste – die fehlende Energie der Ley-Linie.
Er folgte Declan und Matthew ins Gebäude. Ihr Anblick schockierte ihn. Matthew wirkte älter als in seiner Erinnerung, viel älter, groß wie ein Zwölftklässler, und nur seine goldenen, beim Gehen auf und ab wippenden Locken nahmen seiner mürrischen Miene ein wenig die Schärfe. Declan dagegen kam ihm jünger vor, ein Typ Anfang zwanzig, den nur seine teuren Klamotten und kontrollierte Art reifer erscheinen ließen.
Declan hatte Ronan irgendwas Schlimmes angetan. Oder?
Er hat mich verraten, schoss es Ronan durch den Kopf, aber keine Details.
War Ronan sauer auf ihn? Das alles schien so weit weg. Vielleicht würde die Wut ja noch kommen.
Drinnen liefen Declan und Matthew an verwaisten Rollstühlen, dann an verwaisten Sesseln vorbei, wechselten ein paar Worte mit einer Frau hinter einem Plexiglasfenster und passierten anschließend eine schwere Zwischentür. Der Flur dahinter stand voller Krankenbetten und irgendwelchem medizinischen Zubehör. Ronan spürte das unangenehme Flimmern der Neonröhren. In dem Gebäude sah es aus wie beim Tierarzt oder im Krankenhaus, irgendwo jedenfalls, wo häufig feucht durchgewischt wurde, und dennoch schien keins von beidem zuzutreffen. Er hatte keine Ahnung, was seine Brüder hier wollten.
Zumindest Matthew schien es ähnlich zu gehen. »Wo sind wir hier eigentlich? Müffelt, als wäre hier irgendwo mal ein Trinkpäckchen ausgelaufen.«
Declan marschierte unbeeindruckt weiter zum Aufzug am Ende des Flurs.
»Jordan würdest du’s bestimmt erzählen«, nörgelte Matthew.
»Nicht jetzt, Matthew, bitte«, erwiderte Declan.
Der Aufzug beförderte sie in einen ebenso verlassenen zweiten Stock. Vor einem Zimmer mit der Nummer 204 konsultierte Declan unerklärlicherweise eine Grußkarte und tippte #4314 in das Zahlenfeld neben der Tür.
Sie entriegelte sich mit einem satten Klack.
Erst jetzt, als Declan, der die ganze Zeit komplett entspannt gewirkt hatte, Matthew ein ungeduldiges »Mach schnell« zuzischte, begriff Ronan, dass die beiden Brüder in irgendeiner geheimen Angelegenheit hier sein mussten.
Mit einem weiteren Klack verriegelte die Tür sich wieder hinter ihnen.
Es war schummrig in Zimmer 204. Nur eine Lichtleiste unterhalb ein paar funktional anmutender Oberschränke spendete Helligkeit. Ein Vorhang teilte den Raum in zwei Hälften. Auf dieser Seite stand ein säuberlich gemachtes Krankenbett. Ronan sah nicht, was sich auf der anderen Seite befand, aber dafür konnte er es spüren. Etwas in diesem Zimmer sog mit unstillbarer Gier an Matthews Süßmetall.
Matthew blickte sich nervös um.
Declan drückte auf den Lichtschalter. Die Neonröhren erwachten summend zum Leben, während Declan den Vorhang zurückzog. Und dahinter –
»Ist das …«, flüsterte Matthew, »Bryde?«
Erinnerungen prasselten auf Ronan ein wie Faustschläge. Es war, als wüchse mit jeder einzelnen die Anziehungskraft seines alten Lebens.