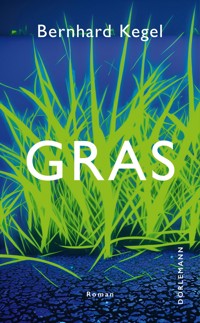
19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Dörlemann eBook
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
Die Katastrophe beginnt auf dem Bundesplatz in Berlin-Wilmersdorf. Die angehende Biologin Natalie entdeckt auf ihrem Weg zur U-Bahn zwischen den Pflastersteinritzen zarte Halme in einem hellen, intensiven Grün.Das Gras vermehrt sich rasant, bald drückt es den Asphalt der Straßen, die Steine auf den Gehwegen hoch, erobert angrenzende Stadtteile, zerstört Fahrbahnen, Bürgersteige und Hausfundamente. Das Schlimmste: Gegen bekannte Herbizide erweist sich das Gras als resistent. Für Natalie, die Behörden und die Wissenschaft beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit.Unfall oder Verbrechen, Manipulation oder Mutation? Bernhard Kegel erzählt in diesem Berlin-Roman eine Geschichte von Katastrophe und Hoffnung.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 436
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Bernhard Kegel
Gras
Roman
DÖRLEMANN
Alle Rechte vorbehalten © 2024 Dörlemann Verlag AG, Zürich Umschlaggestaltung: Mike Bierwolf Satz und eBook-Umsetzung: Dörlemann Satz, Lemförde ISBN 978-3-03820-897-6www.doerlemann.ch
Inhalt
Zitate
»Über etwas wächst Gras …«
Umgangssprachlich: eine unangenehme Sache wird mit der Zeit vergessen.
duden.de
»Er hört auch das Gras in der Erde
und die Wolle auf den Schafen wachsen …»
Georg Büchmann: Geflügelte Worte, 19. Auflage, 1898
Gemeint ist der Gott Heimdall aus dem Geschlecht der Asen, Sohn von neun Riesenschwestern, Wächter der Regenbogenbrücke Bifröst, die von Midgard nach Asgard führt.
»Jeden Morgen hat er das Gefühl, sich hinzusetzen und der Welt beim Vergammeln zuzusehen.«
Virginie Despentes: Das Leben des Vernon Subutex
1
Heute hätte es uns fast erwischt. Es war knapp. Und das Schlimmste ist: Es war meine Schuld. Ich habe die Gefahr zu spät erkannt. Habe geschlafen, völlig arglos. Plötzlich war die Wolke da – schwarz, haushoch und voluminöser als alles, was ich bisher gesehen habe – und schon zu nah, um ihr noch entkommen zu können. Mir zittern jetzt noch die Knie.
Ich habe mal einen Hund in so einer Wolke ersticken sehen. Sie war nur so groß wie ein Lkw und nicht ganz so dicht wie die von heute, so dass ich alles erkennen konnte. Wie eine Amöbe schwappte sie unberechenbar mal hier-, mal dorthin. Der Hund – jung und unerfahren, nehme ich an – kam der Wolke zu nah und im nächsten Moment war er mittendrin. Erst jaulte er, dann schnappte er um sich, rieb mit den Pfoten über Augen und Nase und schüttelte sich. Statt einfach wegzurennen, begann er sich um sich selbst zu drehen, offenbar war er desorientiert. Irgendwann brach er zusammen, wand sich von Krämpfen geschüttelt auf dem Boden, ruderte wild mit den Beinen. Eine Weile zitterte er noch. Dann war es vorbei und er rührte sich nicht mehr. Das hätte uns auch so gehen können.
Marie schläft jetzt. Sie hatte große Angst, weinte und ich hatte Mühe, sie zu beruhigen. Später war sie vollkommen fertig, und mir geht es auch nicht besser. Aber ich kann noch nicht schlafen, ich muss das erst loswerden. Es war grauenhaft. ICH MUSS BESSER AUFPASSEN.
Alles hatte nach einem schönen Tag ausgesehen. Die Sonne schien und wir sind rausgegangen, um Zwiebeln zu ernten, draußen im Garten. Na ja, es sind nur ein paar Quadratmeter, aber es war mühsam, sie freizulegen und so herzurichten, dass ich etwas aussäen konnte. An einer Wand im Supermarkt gibt es einen unbeachtet stehengebliebenen Ständer mit Pflanzensamen. Meistens meide ich den verwüsteten Verkaufsraum, aber einmal ging ich doch an dem Ständer mit den bunten Tütchen vorbei. Warum es nicht versuchen? Leider enthält er vor allem bunte Blumen und nur wenige Gemüsesorten, aber es gibt Zwiebeln, Lauchzwiebeln und normale. Der Ertrag ist nicht gerade rekordverdächtig, aber ich freue mich, dass ich etwas ernten kann. Zwiebeln sind wichtig, finde ich. Frisch und scharf werten sie jedes Essen auf. Jetzt werde ich es auch mit anderen Gemüsesorten versuchen, Mohrrüben zum Beispiel. Hier zum Selbstversorger zu werden ist aber ziemlich aussichtslos. Das Wasser ist ein Problem und ich müsste den Garten vollständig umzäunen. Dazu fehlt mir das Werkzeug.
Es war windig gewesen, wahrscheinlich war das der Grund, warum alles so schnell ging. Wir knieten neben meinem Beet, rupften Unkraut und gruben ein paar Lauchzwiebeln aus dem Boden. So kümmerlich sie waren, allein von ihrem Geruch lief mir schon das Wasser im Mund zusammen. Wir alberten herum, lachten, waren abgelenkt. Als sich plötzlich die Sonne verdunkelte, war es fast zu spät. Ich spürte sie bereits in der Nase. Marie hustete.
Wir haben uns auf den Boden geworfen. Wenn man erstmal eine größere Menge eingeatmet hat, ist es schwer, sich zu schützen, weil man so heftig husten muss. Ich habe Marie an mich gedrückt und geschrien, sie solle sich ihr Halstuch vors Gesicht halten, ich selbst habe mir das T-Shirt über den Kopf gezogen. Gott sei Dank beißen die Biester nicht, aber sie waren überall zu spüren, ein widerwärtiges Kribbeln auf der Haut. Von irgendwoher war hysterisches Hundegebell zu hören und die Luft war von einem seltsamen Geruch und einem hohen feinen Sirren erfüllt, einem Knistern, Rascheln. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, ich werde dieses Geräusch nie mehr vergessen.
Wir pressten uns eng aneinander und warteten. Ich redete beruhigend auf Marie ein, die hinter ihrem Halstuch leise wimmerte. Keine Ahnung, wie lange wir so gelegen haben. Zwanzig Minuten, eine halbe Stunde vielleicht, dann wurde das ekelhafte Geräusch schwächer. Irgendwann ließ das Kribbeln nach und ich spürte wieder die Sonne auf meinem Rücken. Wir warteten noch eine Weile, zur Sicherheit. Dann schielte ich vorsichtig über meinen T-Shirt-Kragen und sah gerade noch, wie Ausläufer der Wolke zwischen zwei vierstöckigen Häusern verschwanden. Sie reichte bis zum Dach. Neben mir tauchte Maries rundes Gesicht auf. Ein paar der Winzlinge klebten auf ihrer schweißnassen Haut. Ich wischte sie weg und wir lächelten uns an.
Ich nenne sie Wolken, weil sie aus der Ferne so aussehen, aber ich weiß natürlich, dass es in Wirklichkeit riesige Schwärme sind. Diese Wolken leben. Ich glaube, es sind Zweiflügler, winzige, nur zwei, drei Millimeter große Insekten mit rauchglasfarbenen Flügeln, Milliarden von ihnen, Billionen. Ich glaube sogar zu wissen, wo sie herkommen und wie sie sich entwickeln. In einer anderen Zeit hätten sie vielleicht Verbündete sein können, jetzt sind sie eine heimtückische Gefahr.
»Du willst wirklich nicht mitkommen?«
»Nein.« Marie ist bockig. Sie sitzt im Zwielicht meines Verstecks auf der Matratze, hat die Arme um ihre Knie geschlungen und rührt sich nicht von der Stelle. Dabei will ich nur noch einmal in den Garten. In der Aufregung habe ich gestern die geernteten Zwiebeln liegen lassen. Sie sind kostbar, es gibt nicht viele und ich will nicht, dass sie nach all der Mühe, die es gekostet hat, sie heranzuziehen, ohne jeden Nutzen in der Sonne vertrocknen. Es ist nicht weit.
»Warum denn nicht, Marie? Hast du Angst? Ich weiß, das war schlimm gestern, aber so eine Wolke kommt so schnell nicht wieder. Ganz sicher. Du kannst dich doch jetzt nicht immer in diesem Loch verkriechen. Wir müssen in Zukunft einfach besser aufpassen.« Sie rührt sich nicht. »Nun, mach schon. Zieh dir die Schuhe an und komm mit.«
»Nein.«
So geht das schon eine Weile. Unwillkürlich verdrehe ich die Augen und stemme die rechte Faust in die Hüfte. Falsch, denke ich, ganz falsch. Beherrsch dich, sonst hast du keine Chance. Ich werde zu schnell ungeduldig, das war schon immer so. Glücklicherweise hat sie es nicht gesehen, ihr Kopf liegt auf den Knien.
Was soll ich tun? Ich kann sie hier nicht allein lassen. Die Umgebung ist zu gefährlich, ein chaotisches jahrelang verwahrlostes und von Gras überwuchertes Baustellengelände. Schutt, verrostete Stahlstreben, Steinhaufen, verrottetes Holz – da draußen liegt alles Mögliche herum und oft sieht man es nicht, weil es von Pflanzen verdeckt wird. Unvermittelt steht man vor tiefen Gruben. Das ist kein Kinderspielplatz. Marie und ich kennen uns keine zwei Wochen und die jetzige Situation zeigt mir, dass ich noch nicht einschätzen kann, wie sie sich verhalten wird, ob ich mich auf sie verlassen kann. Ich weiß nur, dass ich meines Lebens nicht mehr froh werde, wenn ihr etwas zustößt. Mir ist dieses kleine Mädchen zugelaufen. Ich kann sie nicht einfach wegschicken, wenn es mir zu viel wird. Ich seufze tief.
Ein letzter Versuch: »Marieee, komm doch mit«, sage ich in eindringlich bittendem Ton. Sie schüttelt entschieden den Kopf.
Okay, es reicht. Dann soll es so sein.
»Also gut, dann versprich mir, dass du hier auf mich wartest, dass du nicht rausgehst. Klar?«
Keine Reaktion.
»Marie, hast du gehört, was ich gesagt habe? Versprich mir, dass du hier wartest. Draußen ist es gefährlich. Ich gehe nur schnell zum Garten, hole die Zwiebeln und bin gleich wieder zurück.«
»Ja.«
»Was ja?«
»Ich verspreche es.« Sie nuschelt, ohne aufzublicken.
»Okay, dann … dann verlass ich mich auf dich.«
Ich zögere. Meine innere Stimme sagt mir, dass ich nicht gehen darf. Andererseits, wenn nicht jetzt, wann dann? Bin ich in Zukunft bei allem, was ich tun will, auf ihre Zustimmung angewiesen, darauf, dass sie mich begleitet, weil ich es nicht schaffe, sie allein zu lassen? Das würde nicht lange gut gehen.
Ich greife nach meinem Knüppel, der neben dem Bett an der Wand lehnt, und öffne die Tür. Helles Sonnenlicht fällt in den Raum. »Ich beeile mich«, sage ich, gehe nach draußen, fülle in einem der Eimer eine Literflasche mit Wasser und hoffe dabei, dass Marie es sich doch anders überlegt. Aber sie sitzt in unveränderter Haltung auf dem Bett, ein bockiges kleines Mädchen. Widerstrebend laufe ich los. Eigentlich habe ich immer Kinder gewollt, aber vielleicht sollte ich mir das noch einmal überlegen.
Wenn man wiederholt durch das alles überwuchernde dichte, an vielen Stellen mannshohe Gras geht, hinterlässt man nach einer Weile unübersehbare Spuren. Um meine Anwesenheit nicht zu verraten und unliebsame Besucher von meinem Versteck fernzuhalten, habe ich deshalb nach und nach ein Wegenetz mit Schlaufen und etlichen Sackgassen angelegt, eine Art Irrgarten. Eine Machete besitze ich nicht, einer der ersten Einträge in meiner unendlichen Liste schmerzlich vermisster Gegenstände. Hätte ich so etwas überhaupt frei kaufen können? Ich habe nur ein großes Küchenmesser, das ich gewissenhaft schleife, trotzdem ist es unendlich mühsam, sich damit durch die zähen Halme voranzukämpfen. Also benutze ich lieber meine Füße. Bisher hat der Irrgarten seinen Zweck erfüllt, es kostet aber viel Zeit, ihn zu erhalten, denn dazu muss ich die Wege immer wieder ablaufen, sonst schließt sich der Grasteppich. Mit Marie habe ich aus der Not eine Tugend gemacht, indem wir dort Verstecken spielen. Mittlerweile ist die Orientierung so kompliziert geworden, dass ich mich manchmal, vor allem wenn ich aus der Gegenrichtung komme, selbst verlaufe und plötzlich am Ende einer Sackgasse vor einer undurchdringlich scheinenden Gräserwand stehe.
Trotz des Aufruhrs, der in meinem Inneren herrscht, weil ich Marie allein zurückgelassen habe, passiert mir das heute nicht. Ich laufe in Bögen und im Zickzack um den Flachbau des Supermarktes herum und lande schließlich an der Straße, die als solche kaum mehr zu erahnen ist. Ich spüre es nur an dem veränderten Untergrund. Hier, neben einer Schulturnhalle, mündet mein schmaler Pfad in einen etwas breiteren, der dem alten Straßenverlauf folgt, wahrscheinlich das Ergebnis der kollektiven Anstrengungen etlicher Tierarten und von mir.
Normalerweise ist es sehr still hier. Es gibt nur den Wind, der mit den Halmen und Blättern der Bäume spielt, es gibt Vogelgesang, ab und an Hundegebell und andere Tierstimmen, sonst nichts. Deshalb ist es in gewissem Maße normal, dass jedes ungewohnte Geräusch mich sofort innehalten lässt, egal, was ich tue. Geräusche sind in einer Welt, in der man meistens nur wenige Meter weit sehen kann, weil dann ein mannshohes dichtes Halmgewirr beginnt, ungeheuer wichtig. Wenn ich mich draußen bewege, bin ich immer auf Empfang, sperre die Ohren weit auf und bleibe nach ein paar Schritten stehen und lausche. Manchmal, wenn ich glaube, ein wenig Überblick zu brauchen, gehe ich in irgendein Haus, laufe den Treppenaufgang hoch und schaue in den oberen Stockwerken aus dem Fenster.
Das alles habe ich bisher aufmerksam und ohne Angst getan. Man darf in dieser Umgebung nicht schreckhaft sein. Heute zucke ich jedoch bei jedem Geräusch zusammen. Der Warnruf eines Vogels lässt mich herumfahren. Einmal raschelt es heftig im trockenen Gras und ich bleibe wie angewurzelt stehen und halte die Luft an. Mein Herz pocht.
Mist, fluche ich innerlich, was ist los mit dir? Steckt dir das gestrige Erlebnis noch in den Knochen? Wovor hast du Angst? Reiß dich zusammen. Das ist mein Reich, mein Revier, niemand, weder Mensch noch Tier, ist mir hier in der ganzen Zeit ernsthaft in die Quere gekommen, nie gab es ein Problem, das ich nicht durch Schreien oder durch Schwenken meines Knüppels hätte lösen können – bis gestern. So froh ich über Maries Anwesenheit bin, ich muss der Tatsache ins Auge sehen, dass sie mich ablenkt, dass sie mich ängstlicher, schwächer und verwundbarer macht, und das darf ich auf keinen Fall zulassen. Ich bezweifle, dass mich unser gestriges Erlebnis so beeindruckt hätte, wenn ich allein gewesen wäre. Natürlich hätten Geschrei und Drohgebärden die Wolke nicht vertrieben, aber ich wäre aufmerksamer gewesen, konzentrierter. Ich wäre gar nicht erst in diese Situation geraten.
Hinter dem großen alten Schulgebäude, dessen reich geschmückte Fassade aus dem hohen Gras aufragt wie ein verwunschenes Schloss, zweigt links ein Pfad ab, der in einen ehemaligen kleinen Park führt. Er ist so schmal, dass ich mit beiden Armen rechts und links an den Gräsern entlangstreife. Zwischen den Kronen der Bäume sehe ich schon die Häuser, zwischen denen gestern die Wolke verschwunden ist. Auch hier habe ich ein paar Finten gelegt. Um zu meinem Garten zu gelangen, muss ich den zweiten Abzweig nach rechts und dann gleich den nächsten nach links nehmen.
Nun sind es nur noch wenige Meter. Ich verlangsame meine Schritte, bleibe stehen und lausche angestrengt. Bilde ich es mir nur ein oder ist da etwas, ein undefinierbares Schnaufen und Scharren? Mir bricht der Schweiß aus. Meine Hand schließt sich fester um den Knüppel. Ich atme ein paar Mal tief durch, dann gehe ich entschlossenen Schrittes weiter, bis ich auf eine etwa vierzig Quadratmeter große relativ freie Fläche trete. In der Mitte liegt mein Garten, mein Zwiebelbeet. Kleine braune kläffende Wesen stieben nach allen Seiten auseinander. Sie stoßen auf den Zaun, ihr Gekläffe steigert sich in hysterische Höhen und dann schießen sie in heller Panik rechts und links an mir vorbei ins dichte Gras, das sich sofort hinter ihnen schließt. Einen Moment höre ich noch, wie sie durch die Vegetation davonhetzen, dann herrscht wieder Stille. Ich bin allein. Offenbar steht der Wind günstig, sonst hätten sie mich gerochen und ich hätte sie nicht so überrumpelt. Ich seufze erleichtert und bin zufrieden. So muss es sein. Es geht um entschiedenes Auftreten. Es darf kein Zweifel darüber aufkommen, wer hier das Sagen hat.
Ich blicke mich um. Alles sieht intakt aus. Die Hunde haben keinen Schaden angerichtet, vielleicht haben sie bloß in der Sonne gelegen oder gespielt. Freiflächen, die sich dafür anbieten, haben Seltenheitswert. Diese ist nur von einer Seite zugänglich, die anderen drei sind von einem Maschendrahtzaun umgeben, den man allerdings im hohen Gras kaum sieht, dahinter liegt das ehemalige Schulgelände. Deswegen habe ich diese Stelle ausgewählt. Ich weiß nicht, ob der Zaun in Bodennähe Schlupflöcher hat, aber die schlimmsten Gartenplünderer wie Rehe oder Hirsche dürfte er fernhalten.
Die gestern geernteten Lauchzwiebeln liegen verteilt auf dem Boden herum. Sie sind schlaff geworden, trotzdem sammle ich sie ein und halte schließlich einen Bund in der Hand von der Dicke, wie man ihn früher im Supermarkt kaufen konnte, nur nicht so knackig frisch. Gar nicht schlecht. Eine lange entbehrte Delikatesse. Ich überlege, ob ich sie gleich an Ort und Stelle roh verschlinge oder wie ich sie zubereiten könnte, gieße dabei die Pflanzen mit dem mitgebrachten Wasser und lasse den Blick über das kleine mühsam von Gräsern befreite Gemüsebeet schweifen. Noch zwei, drei Bünde wie der, den ich in der Hand halte, dann ist es schon abgeerntet. Es war ja nur ein Versuch. Ich denke darüber nach, ob diese Ausbeute den ganzen Aufwand wert ist und ob ich vielleicht ein paar Pflanzen blühen lassen sollte, um Samen zu erhalten, aber eigentlich ist es nicht nötig, ein paar Tütchen habe ich noch. Vielleicht beim nächsten Mal. Dann werde ich auf jeden Fall mehr aussäen.
Ich drehe mich gedankenversunken um und will die Stelle in der Graswand ansteuern, wo der Pfad beginnt, aber als ich den Blick hebe, erstarre ich und lasse vor Schreck die kostbaren Lauchzwiebeln fallen. Der Zugang ist versperrt, und weil das so unerwartet kommt, brauche ich einen Moment, um es zu begreifen. Wie kann es sein, dass ich nichts gemerkt, nichts gehört habe?
Ein großer schwarzer Hund hat sich am Beginn des Weges postiert und starrt mich mit blutunterlaufenen Augen an. Den mächtigen Schädel hält er aufrecht, der Schwanz steht steif in die Höhe, die Rückenhaare sind gesträubt. Er zieht die Lefzen hoch, entblößt ein beängstigend kräftiges Gebiss und knurrt. Es klingt wie ein tiefes Grollen und fährt mir in Mark und Bein. Einen solchen Hund habe ich hier noch nie gesehen, muskelbepackt, durchtrainiert wie ein Athlet, ein Kraftpaket. Irgendwo habe ich mal gelesen, dass verwilderte Hunde überall in der Welt dieselbe mittelgroße Promenadenmischung hervorbringen, aber diese Bestie hier ist etwas anderes. Ist das überhaupt ein Hund?
Mir fällt der Knüppel ein, ohne den ich normalerweise keinen Schritt aus dem Haus mache. Ich habe ihn doch mitgenommen. Wo ist mein Knüppel?
Da, er liegt etwa drei Meter entfernt neben dem Beet, zu weit weg. Ich darf mich nicht bewegen. Sobald ich mich rühre, schwillt das Knurren bedrohlich an und der Schwarze stemmt seine Vorderbeine in den Boden. Wie konnte ich nur meinen Knüppel aus der Hand legen?
»Braver Hund. Ich tu dir nichts«, sage ich so ruhig, wie ich es in dieser Lage fertigbringe. Er fletscht die Zähne und bellt, gefolgt von einem furchtbaren Knurren. Mein Gott! Ich bin sicher, er riecht meine Angst.
Rechts und links von dem Schwarzen bewegt sich plötzlich das Gras, das eben noch ausgesehen hat wie Spalier aus langen schmalen Schwertern. Weitere Hunde kommen zum Vorschein. Es sind wahrscheinlich die, die ich gerade verjagt habe, braun gefleckt und deutlich kleiner. Zähne haben sie alle.
»Na, ihr Schisser, habt ihr euren großen Bruder geholt?« Es soll cool klingen und mich selbst beruhigen, aber mir steht der Angstschweiß auf der Stirn und meine Stimme zittert. Ihr Klang bewirkt nur, dass alle Hunde unisono zu kläffen beginnen. Das Gras hinter ihnen bewegt sich weiter, da sind noch mehr.
Ich überlege fieberhaft, welche Möglichkeiten mir bleiben. Keine Chance. Ich sitze in der Falle, hinter mir der hohe Zaun, vor mir die Hunde, und irgendwie ist der Meute meine ausweglose Lage klar. Ich habe im Laufe der Monate zwei ausgeweidete Leichen gefunden, ein grauenhafter Anblick. Ich meine, das ist Berlin, nicht der Jurassic Park. Darauf war ich nicht vorbereitet. Ich weiß nicht, ob diese Menschen schon tot waren, bevor sie an- und aufgefressen wurden, aber klar ist auch, dass diese Hunde nicht von Dosenfutter leben. Sie müssen Beute machen, um zu überleben. Warum nicht auch Menschen, warum nicht mich? Wenn sie mich kriegen könnten, wären sie bestimmt nicht wählerisch. Die meisten, wenn nicht alle Hunde, die hier leben, haben Menschen nie als liebevolle fürsorgliche Herrchen oder Frauchen kennengelernt. Trotzdem, sie tragen die Hundegene in sich. Es gibt da eine Saite in ihnen, die ich vielleicht zum Klingen bringen könnte, aber dazu müssten sie sich beruhigen.
Mein Blick fällt wieder auf den großen Schwarzen und sofort verfliegt jeder Gedanke, ihn und die anderen irgendwie besänftigen zu wollen. Wenn der mich mit seinem ganzen Gewicht anspringt, wird es kritisch. Ich brauche eine Waffe, ich muss ihnen wehtun können, wenn sie mich angreifen, aber der Knüppel scheint unerreichbar. Ich nehme allen Mut zusammen, greife rasch in meine Hosentasche, hole mein Messer heraus und lasse die Klinge rausspringen. Das Bellen explodiert zu ohrenbetäubender Lautstärke. Der Große bleibt noch vergleichsweise ruhig, die kleinen jedoch geraten völlig außer sich, bellen sich die Seele aus dem Leib und starten Scheinangriffe. Ich bin jetzt in Kampfposition, die Arme ausgebreitet, der Körper angespannt, in der rechten Hand blitzt die glänzende Stahlklinge auf.
Mit dem Messer in der Hand werde ich mutiger. Ich weiche zentimeterweise zurück, auf den Knüppel zu. Er wäre die bessere Waffe. Mit ihm kann ich die Köter auf Abstand halten. Sie sollen es nur wagen. Sie wären nicht die Ersten, die mit meinem Knüppel Bekanntschaft machen. Aber es sind viele, wahrscheinlich zu viele. Ich sehe mindestens fünfzehn und dahinter sind noch mehr. Gegen Hunde habe ich nichts, aber ich hasse Hundemeuten.
Wissen sie, dass ich nach hinten nicht weiterkomme? Die meisten sind vor einer Viertelstunde selbst an dem Zaun gescheitert. Aber an der Meute komme ich nicht vorbei, auch wenn das Gekläff jetzt etwas nachlässt. Also bleibt nur ein Weg. Ich muss über den Zaun.
Mein rechter Hacken stößt gegen etwas Hartes. Der Knüppel! Blitzschnell lasse ich das Messer fallen, drehe mich um mich selbst, packe dabei das Holz und lasse es durch die Luft sausen. Vor der Graswand bricht die Hölle los, mehrere Hunde schießen auf mich zu und brechen wieder ab, hin- und hergerissen zwischen Angst und Angriffslust. Sie kommen näher, auch der Große bellt jetzt wütend, irgendetwas hält ihn aber an seinem Platz. Er ist vorsichtig, wartet auf den idealen Moment. Ich weiche weiter zurück, schwenke den Knüppel und schreie dabei, mein Garten gleicht einem Tollhaus. Ein weiß-braun Gescheckter kann nicht mehr an sich halten und schießt auf mich zu. Ich hole aus und treffe ihn mit voller Wucht. Etwas knackt. Er jault auf, fliegt zur Seite und bleibt bewegungslos liegen. Das beeindruckt die anderen. Wieder wird es ohrenbetäubend laut, aber sie ziehen sich einen Meter zurück.
Jetzt! Jetzt oder nie! Es sind nur wenige Schritte zum Zaun und ich will nach Hause, will zu Marie, will leben, aber die Angst hält mich ein, zwei Sekunden zu lange fest, so dass ich meinen kleinen Vorteil fast verliere. Dann endlich finde ich den Mut. Mit einem wilden Schrei hole ich aus und schleudere der Meute den Knüppel entgegen, in Richtung auf den Großen. Ob er trifft, weiß ich nicht, denn ich drehe mich sofort um und renne, so schnell ich kann. Kurz vor dem Zaun springe ich ab und bekomme mit den Händen seinen oberen Rand zu fassen.
Hinter mir herrscht ein hysterischer Lärm und ich höre, wie sie näher kommen. Ich strampele, aber meine Füße finden keinen Halt und rutschen immer wieder ab. Scharfe Drahtenden bohren sich in meine Handflächen. Ich darf nicht loslassen. Wenn ich das tue, bin ich verloren. Ich versuche verzweifelt, meine Fußspitzen in die Maschen zu bohren, aber überall ist das zähe Gras im Weg, ich trage die steifen Wanderstiefel mit der breiten abgerundeten Spitze und es will mir nicht gelingen. Meine Hände brennen unerträglich. NICHT LOSLASSEN!
Endlich spüre ich ziemlich weit oben einen Widerstand an meinem linken Fuß. Besser wird es nicht. Ich stemme mich sofort hoch und schwinge das rechte Bein über die Zaunkante. Im selben Moment schießt ein stechender Schmerz durch meine Ferse. Ich spüre ein Zerren und zusätzliches Gewicht. Irgendeiner der kleinen Köter hat sich in meinen linken Schuh verbissen und lässt nicht los, aber was noch schlimmer ist: Aus dem Augenwinkel sehe ich, wie der große Schwarze auf mich zustürzt. Das ist der Moment, auf den er gewartet hat. Mein rechter Fuß hat sich endlich oben am Zaun festgehakt. Ich ziehe mich mit aller Kraft hoch, schreie dabei wie am Spieß, stoße Laute aus, die ich noch nie zuvor von mir gehört habe. Jetzt löse ich den linken Fuß samt dem dranhängenden Köter und schüttele ihn, so sehr ich kann. Es tut mörderisch weh. Das Gewicht fällt von meinem Schuh ab, ich rolle mich mit letzter Kraft über den Zaun, zerreiße dabei meine Hose und stürze aus zwei Metern Höhe ins dichte Gras. Der Schwarze prallt mit vollem Gewicht gegen den Maschendraht. Er fällt zurück, schüttelt sich benommen und versucht es erneut, springt wieder hoch und prallt nochmal und nochmal gegen den Zaun, während ich nur einen Meter entfernt auf dem Boden liege und Mühe habe, genug Luft in meine Lungen zu pumpen. Ich drehe mich auf den Rücken und betrachte meine vor Anstrengung und Schmerz zitternden Hände, von denen das Blut auf mein T-Shirt tropft. Mühsam rappele ich mich auf, mein ganzer Körper ein einziger Schmerz, die Hände, mein linker Fuß, der Brustkorb, auf den ich gestürzt bin. Aber der Zaun hält, ich richte mich auf und brülle der auf der anderen Seite wie wild gegen den Maschendraht springenden Meute meinen Triumph entgegen, was sie zu meiner Freude nur noch wütender macht.
Nach einer Weile humple ich durch das brusthohe Gras davon. Noch strömt Adrenalin durch meine Adern und ich fühle mich wie nach einem Bungee-Sprung, aber ich weiß, dass dieses Gefühl bald nachlassen wird und die Schmerzen zunehmen werden. Ich bin mir nicht sicher, wie ich von hier nach Hause komme, ob es überhaupt einen Durchgang gibt. Nochmal klettere ich nicht über diesen Zaun, zumal ich hinter mir noch immer das Gebell der Hunde höre. Ich habe nur noch das Taschenmesser. Mein Knüppel liegt auf der anderen Seite des Zauns, genauso wie das Springmesser, die Wasserflasche und die Zwiebeln. Ich werde sie ein andermal holen müssen. Zuerst muss ich meine Verletzungen verarzten. In beiden Handflächen habe ich tiefe Wunden. Es wird eine Weile dauern, bis ich meine Hände wieder normal gebrauchen kann. Aber das ist längst nicht alles. Ich bin heiser und der Hals tut mir weh, weil ich so geschrien habe, die Ferse schmerzt bei jedem Schritt und das Atmen fällt mir schwer. Womöglich habe ich mir noch eine Rippenprellung zugezogen. Wenigstens muss ich keine Angst vor Wundstarrkrampf haben. Ich gratuliere mir selbst, dass ich in einer Zeit, als hier noch schreiende Kinder über den Schulhof rannten, an eine Tetanus-Impfung gedacht habe.
Ich muss mir mühsam einen Weg durch das scharfkantige Gras bahnen, deshalb komme ich nur langsam voran. Der Boden ist kaum begehbar. Kreuz und quer liegen große würfelförmige Steine herum, wahrscheinlich das alte Pflaster des Schulhofs. Ich habe Angst zu stürzen und auf die verletzten Hände zu fallen und muss die ganze Zeit vor Wut, Schmerz und Anspannung heulen. Stellenweise verschwinde ich im Gewirr der Pflanzen, sehe nur noch Halme und Blätter. Immer wieder muss ich mir mit meinen blutigen Händen die Spinnenfäden aus dem Gesicht wischen, so dass ich wahrscheinlich wie eine Gestalt aus einem Horrorfilm aussehe. So kann ich Marie nicht gegenübertreten. Ich muss mich zuerst waschen.
Manchmal wird die Vegetation so dicht, dass ich mich mit dem Rücken voran durch das verfilzte Gestrüpp drücken muss. Immerhin hat das den Vorteil, dass mir nicht dauernd die Halme und Blütenwedel ins Gesicht schlagen. Dabei tut mir aber mein Fuß so weh, dass ich kaum auftreten kann. Mit jedem Schritt durchlebe ich meinen Kampf mit der Meute von neuem. Was für ein Albtraum. Einfach nur Pech, zur falschen Zeit am falschen Ort. Letztlich habe ich mich gut geschlagen.
Während ich mich mal im Rück-, mal im Vorwärtsgang voranarbeite, denke ich an den großen Schwarzen. Diese Bestie wird mich noch im Traum verfolgen. Ich hoffe inständig, dass ich ihm nie wieder über den Weg laufe. Seltsam, dass ich ihn noch nie gesehen habe. Vielleicht ist er neu hier. Die Hundemeuten sind einigermaßen ortstreu, sie haben Reviere, die sie markieren und verteidigen, aber es gibt zwischen ihnen eine beträchtliche Fluktuation, ein dauerndes Kommen und Gehen. Wenn ich also Pech habe und er nicht weiterzieht, begegnen wir uns wieder. Ich kann nur hoffen, dass ich dann im Vollbesitz meiner Kräfte bin.
Ich orientiere mich an dem Schulhaus zu meiner Linken. Dahinter liegt die Turnhalle. Wenn ich irgendwo auf die Straße stoße, dann dort, zwischen den beiden Gebäuden. Ob es so ist, werde ich allerdings erst wissen, wenn ich unmittelbar davorstehe, sonst muss ich den ganzen Weg wieder zurück, ein Gedanke, den ich sofort zu verdrängen versuche.
Jetzt habe ich die Ecke des Schulhauses erreicht. Gegenüber liegt die Turnhalle. Wie ich es in Erinnerung hatte, sind beide nicht miteinander verbunden, es muss hier also einen Zugang zur Straße geben. Wenn ich mich auf die Zehenspitze stelle und über die Halme hinwegschaue, kann ich sogar das Dach meines Supermarktes erkennen. Es ist so nah, ich könnte in fünf Minuten bei Marie sein, allerdings haben die Erbauer dieses Ensembles auch hier, zwischen mir und dem, was einmal die Straße war, einen Zaun platziert, ein massives Ding, für die Ewigkeit gebaut und mindestens zwei Meter fünfzig hoch. Mir kommen die Tränen, als ich davorstehe. Ich kann nicht mehr, alles tut mir weh und die Zunge klebt mir am Gaumen, weil ich das Wasser zurückgelassen und seit Ewigkeiten nichts getrunken habe, aber es hilft nichts. Wenn ich nicht einen riesigen Umweg in Kauf nehmen will, muss ich wieder klettern.
Ich lasse mich mit dem Rücken am Maschendraht hinabgleiten und bleibe an den Zaun gelehnt sitzen, um wieder zu Kräften zu kommen. Soll ich barfuß klettern, damit ich mit den Schuhen nicht wieder abrutsche? Und meine Hände … wie soll ich damit …
Ich könnte mein T-Shirt zerschneiden und um die Hände wickeln. Es ist voller Blut und ohnehin nicht mehr zu gebrauchen. Ja, ich schöpfe neue Hoffnung, es wird wehtun, aber es könnte gehen. Das Problem ist allerdings nicht nur, wie ich hinauf-, sondern vor allem, wie ich auf der anderen Seite unbeschadet wieder hinunterkomme. Noch einen Sturz aus dieser Höhe will ich meinen Rippen nicht zumuten. Man könnte meinen, die Gräser würden den Sturz abfangen, aber das tun sie nicht, jedenfalls nicht genug, wenn man wie ich um die siebzig Kilogramm wiegt. Das ist natürlich nur eine grobe Schätzung, eine Waage besitze ich nicht. Tatsache ist aber, so seltsam es klingen mag, dass ich eher zu- als abgenommen habe, wahrscheinlich eine Folge der einseitigen Ernährung. Ich war nie die Schlankeste, aber bei dieser ewigen Nudelkost habe ich angesetzt. Allerdings gab es da noch mehr, wenn ich ehrlich bin, kistenweise Schokolade, Kekse und andere Süßigkeiten, und ja, auch Alkohol, sogar harter Stoff, Whiskey, Gin, Wodka. Ich bin froh, dass das Zeug schon seit Monaten alle ist, sonst hätte es womöglich noch ein übles Ende mit mir genommen. Aber diese endlosen Tage und Abende, die Einsamkeit, irgendwann konnte ich nicht mehr dagegen an. Die letzten Flaschen habe ich gegen eine Hauswand geschleudert.
Das T-Shirt auszuziehen ist eine einzige Quälerei, weil der Brustkorb wehtut und ich meine Hände kaum gebrauchen kann. Es geht nicht, ohne unablässig zu fluchen, so schockiert und wütend bin ich über meinen desaströsen Zustand. Dass ich unter dem Shirt nackt bin, ist mir egal. Mein einziger Sport-BH ist kaputt, und da die Dessous-Geschäfte momentan geschlossen haben und der Versandhandel nicht liefert, werde ich wohl auch in Zukunft ohne auskommen müssen – ein weiterer Eintrag in meiner Liste der schmerzlich vermissten Dinge.
Als ich es endlich geschafft habe, schneide ich den Stoff mit der Schere meines Taschenmessers ein, reiße ihn in breite Streifen und wickele sie um meine Hände. Dann richte ich mich auf und nehme den Zaun in Augenschein. Vielleicht geht es in Hausnähe besser, denke ich und schiebe mich durch das Gras am Zaun entlang, bis ich auf das Schulhaus treffe. In der Fassade gibt es zahlreiche Vorsprünge und Zierbänder, auf denen ich mit den Füßen Halt finden kann. Eine Welle von Euphorie schießt durch meinen Körper. Ich werde es schaffen. Und tatsächlich, es dauert keine zehn Minuten und ich stehe auf der anderen Seite. Meine Hände sind fast taub vor Schmerz, die T-Shirt-Bänder sind blutgetränkt, meine Ferse pocht wie verrückt, aber nun ist es nur noch ein Katzensprung.
Als ich um die Ecke des Flachbaus humpele und die offene Tür sehe, habe ich ein ungutes Gefühl. Wahrscheinlich ist es die Erschöpfung, die mir das Blut sofort in die Beine sacken lässt. Ich muss mich kurz an der Hauswand abstützen, um nicht umzukippen. Sie hatte doch versprochen, nicht rauszugehen.
Wenige Meter entfernt steht ein Eimer mit Wasser. Ich habe überall Gefäße aufgestellt, um den Regen aufzufangen, und da es vor zwei Tagen kräftig geschüttet hat, sind alle gut gefüllt. Ich wickle die Verbände ab, und bevor ich meine Hände in den Eimer halte, zähle ich innerlich bis drei und versuche mich zu wappnen, trotzdem kann ich einen Schmerzensschrei nicht unterdrücken. Nichts geschieht, Marie reagiert nicht. Ich beiße die Zähne zusammen, bis es erträglich wird. Das Wasser färbt sich rosa, während ich sachte darin herumwedle.
Meine Hände! Fassungslos starre ich auf die tiefen Wunden. Ist das Weiße darin etwa Knochen? Ich muss aufpassen, dass es keine Entzündung gibt.
Ich kann mich mit den Händen nicht waschen, deshalb spritze ich mir Wasser ins Gesicht, kippe mir dann kurzentschlossen den ganzen Eimer über den Kopf und wische mich mit dem Rest des T-Shirts ab, den ich mir in die Hose gesteckt habe. Trinken will ich dieses Wasser lieber nicht, aber ich habe schrecklichen Durst, deshalb gehe ich nun, so leise ich kann, zur offen stehenden Tür und schiele vorsichtig in den Raum. Verlassen. Kein Mensch. Marie ist nicht da. Ich nehme einen Kanister, drehe mit zusammengebissenen Zähnen den Verschluss auf und trinke gierig.
Jetzt geht es mir besser. Ich ziehe mir unter Verrenkungen ein neues T-Shirt über und lege mich auf das Bett. Ich muss mich einen Moment erholen. Nach zehn Minuten kann ich mich einigermaßen erfrischt dem nächsten Problem stellen. Wo ist Marie?
Der Raum ist unverändert. Er ist nicht durchwühlt worden. Und unsere Vorräte im Lagerraum dahinter sind unangetastet. Es sieht so aus, als habe Marie das Versteck verlassen und vergessen, die Tür zu schließen. Das ist noch schlimmer, als nur ein Versprechen nicht zu halten. Ich werde ein ernstes Wort mit ihr reden müssen.
Ich gehe nach draußen und rufe nach ihr, zweimal, dreimal, erhalte aber keine Antwort. Mist! Wo könnte sie sein? Ich beschließe die Umgebung systematisch abzusuchen. In etwa zwei Stunden wird es dunkel.
Dann passiert etwas, das an diesem Tag wirklich überfällig ist: Ich habe Glück. Zwanzig Meter von der Tür entfernt liegt sie zusammengerollt im Schatten eines Bretterstapels auf dem Boden und schläft. Ich blicke in ihr entspanntes wunderschönes Kindergesicht und schlagartig ist jeder Ärger verflogen.
Ich lege mich zu ihr, schmiege mich an ihren Rücken und lege den Arm um sie. Statt ihr eine Strafpredigt zu halten, wie ich es vorhatte, sende ich im Geiste Dankgebete an die Vorsehung. Zu zweit hätten wir es womöglich nicht geschafft. Sich diesen Ausflug zu ersparen war die beste Entscheidung, die sie treffen konnte. Alles ist gut.
… das Ende der Bernhardstraße macht einen verwahrlosten Eindruck. Direkt neben der Böschung der Stadtautobahn liegen eine Kfz-Werkstatt und ein alter ungepflegter Garagenhof. Auf Nachfrage sagten mir Anwohner, dass da früher reger Betrieb herrschte und junge Leute aus und ein gingen. Seitdem es dort vor ein paar Monaten gebrannt hat, ist aber nicht mehr viel los. Die Werkstatt ist ausgezogen.
Großflächige Rußspuren an einigen Garagentoren und der Gebäudeaußenwand. Ein Tor ist mit Brettern notdürftig zugenagelt. Z.T. massive Wurzelaufbrüche im Fahrbahnbelag der Bernhardstraße, auch das Gehwegpflaster ist schadhaft. Das Mosaik ist an mehreren Stellen aufgewölbt, Bernburger sind locker und liegen lose herum, an diesen Stellen und in den Fugen ungewöhnlich starkes Pflanzenwachstum. Hüfthoher Wildwuchs auch in den Ecken, entlang der Mauern und auf der Autobahnböschung …
Aus einem Bericht von H. Schimanek,
Straßenbegeher im Bezirk Tempelhof-Schöneberg
2
Ich frage mich oft, ob ich wirklich die Erste war, die es gesehen hat. Wenn ich das sicher wüsste, wäre die Lage um keinen Deut besser, doch es würde mir etwas bedeuten. Wissenschaftlerinneneitelkeit, nehme ich an – aus heutiger Sicht natürlich idiotisch. Aber es steckt in mir drin. Ich habe Biologie ja gern gemacht, hatte endlich ein Ziel. Ich liebe Pflanzen, immer noch, trotz allem. Diese Wissenschaft sollte mein Leben sein.
Als ich Tage nach meiner Entdeckung einige Exemplare mit ins Institut brachte, zeigten Laura und Henrik kaum Interesse. Doktoranden entwickeln diesen Tunnelblick, der nur auf die eigene Arbeit gerichtet ist, besonders Laborfuzzis wie die beiden. Ich habe mir immer geschworen, dass mir das nicht passieren soll. Sie warfen einen flüchtigen Blick auf meine Pflanzenproben und sagten, ich solle Forsch nicht damit behelligen, sie sei schlechter Laune. Als ob ich das vorgehabt hätte. Ich wusste doch, dass man Angela am Tag vor den Prüfungen besser in Ruhe ließ. Es bestand ja auch keine Eile und ich wollte die Pflanzen erst allein bestimmen. Bei Gräsern ist das schwer, man muss es immer wieder üben, den Blick schulen. Auch das kommt mir heute seltsam vor: dieser Drang, alles benennen und klassifizieren zu wollen. Ich habe jetzt echt andere Probleme. Natürlich ist mir klar, dass wir wissen müssen, über wen oder was wir reden. Aber die Situation in der Natur war katastrophal. Viele Pflanzen verschwanden, Insekten starben, Vögel starben, Wissenschaftler sprachen nicht mehr nur von Aussterben, sondern von Defaunation, von biologischer Auslöschung, um das ganze Ausmaß dieses Horrors zu erfassen. Alle einschlägigen Kurven zeigten nach unten, schlimmer hätte es eigentlich kaum kommen können. Und das war allein unser Werk … ich werde sofort wütend, wenn ich daran denke. Die Bilanz unserer Existenz auf diesem schönen Planeten ist einfach nur niederschmetternd. Hätten wir nicht alles andere liegen lassen und nur noch für den Erhalt der biologischen Vielfalt kämpfen müssen, mit allen Mitteln? Wenigstens wir Biologen. Wer sollte es sonst tun? – Na ja, hier hat sich das ja nun erübrigt. Wie es woanders ist, weiß ich nicht.
Vielleicht war ich tatsächlich die Erste, die es gesehen hat, aber der Ursprung des ganzen Schlamassels liegt für mich im Dunkeln. Da diese Entwicklung sich nicht von heute auf morgen vollzogen haben kann, muss Invicta im Verborgenen herangewachsen sein, irgendwo in einer der zahllosen urbanen Ecken unterhalb unseres Radars, niemand hat es bemerkt. Wer achtete in dieser hektischen Stadt schon auf ein paar Grashalme. Damals war ich die Erste und Einzige, und heute bin ich wahrscheinlich die Letzte, die sich dafür interessiert.
Wenn ich von meinen Rundgängen zurückkomme und meine Aufzeichnungen und Messdaten in die Tabellen übertrage, sitzt Marie immer neben mir und schaut zu. Sie möchte unbedingt, dass ich ihr Lesen und Schreiben beibringe. Wenn ich eins von meinen Büchern in die Hand nehme, schmiegt sie sich an mich und fragt mir Löcher in den Bauch. Was heißt dies, was heißt das, lies vor … Seit sie bei mir ist, hat sich alles verändert. Ich bin nicht mehr allein. Sie braucht mich. Manchmal denke ich, sie ist die Tochter, die ich auf normalem Wege nie mehr bekommen könnte, und ich habe große Angst, dem nicht gewachsen zu sein. Ihr gegenüber versuche ich natürlich, mir nichts anmerken zu lassen.
Immer wieder will sie, dass ich ihr von früher erzähle, vom Tag Eins. So nenne ich ihn, weil von diesem Tag an für mich eine neue Zeitrechnung begann. Ich glaube, Marie fasziniert, dass es ein ganz normaler Tag war. Autos, Fahrradfahrer, Busse, U-Bahnen, Menschenmassen, Geschäfte, Restaurants – offenbar kennt sie das alles nicht, jedenfalls hat sie keine bewusste Erinnerung daran. Wenn es dann um die Wochen und Monate nach diesem Tag geht, erzähle ich ihr allerdings nur eine stark gekürzte und entschärfte Version, denn diese Geschichte ist nichts für kleine Kinder.
3
Es war der Tag nach meinem fünfundzwanzigsten Geburtstag, ein Montag in der ersten Maihälfte. Er begann unterirdisch, denn ich war kaum aus der Wohnung, als ich im Treppenhaus mit Rattke zusammentraf, ausgerechnet.
Normalerweise ist meine Meinung zu anderen Menschen deutlich differenzierter, aber über diesen muskel- und fettbepackten ungehobelten dummen Kerl wüsste ich kein einziges nettes Wort zu sagen. Ich hasste ihn, nannte ihn insgeheim Ratte. Schon ästhetisch war er eine Zumutung mit seiner Wampe, den Jogginghosen oder diesem Tarnanzug, in denen er immer herumlief. Natürlich hatte er wieder etwas zu meckern. Wir seien gestern Abend im Treppenhaus viel zu laut gewesen, schimpfte er, unsere Fahrräder stünden im Hof wie immer im Weg und neulich hätten wir den Sack mit dem Plastikmüll nicht ausgeleert, wie es sich gehöre, sondern einfach in die Tonne gestopft. Lauter Lappalien. Er musste die ganze Zeit am Fenster hocken, damit ihm ja keine Verfehlung seiner Mitmenschen entging, und warum auch immer, auf uns, die einzige Wohngemeinschaft im Haus, hatte er es besonders abgesehen. Opa Armin, sein Nachbar, hatte mir erzählt, Rattke sei arbeitslos. Kein Wunder, wer sollte es mit diesem Ekelpaket aushalten?
Im Haus kursierte das Gerücht, er sei ein Prepper, einer dieser Spinner, die Vorräte und Ausrüstung anhäufen, um für den Tag X vorbereitet zu sein, den Zusammenbruch staatlicher Ordnung. Ich habe keine Ahnung, ob das stimmte. Wenn möglich, ging ich ihm aus dem Weg, doch an diesem Morgen hatte ich nicht aufgepasst und bekam prompt die Quittung. Die Ratte drohte zum wiederholten Mal, er werde sich bei der Hausverwaltung über uns beschweren. Das machte uns Angst, denn Ludwig, der Hauptmieter unserer Wohnung, hatte keine Genehmigung zur Untervermietung. Wenn herauskam, dass wir dort als Wohngemeinschaft lebten, flatterte ihm womöglich eine Abmahnung oder gleich die Kündigung ins Haus. Auch wenn ich nicht glaube, dass Rattke das wusste, an diesem Morgen floh ich regelrecht vor ihm.
Draußen war nach einigen kalten und trüben Regentagen endlich der Frühling zurückgekehrt und ich blieb vor der Haustür kurz stehen, um die frische Luft zu genießen und dieses unerfreuliche Zusammentreffen aus dem Kopf zu bekommen. Es war noch früh, kurz nach sieben. Eigentlich nicht meine Zeit. Ich hatte nur rasch einen Kaffee getrunken und war dann gleich aufgebrochen, in der WG schliefen sie noch. Wir hatten am Vorabend in einer Kreuzberger Bar meinen Geburtstag gefeiert und Cocktails getrunken.
In der Detmolder und der Wexstraße schoben sich die Autos dicht an dicht zu den Auffahrten der Stadtautobahn. Auch auf dem Bundesplatz herrschte schon Betrieb. Menschen schritten eilig in Richtung S-Bahn oder verschwanden in den U-Bahn-Eingängen. Ich musste zum Arboretum nach Treptow, wo um acht Uhr ein botanisches Praktikum für Studienanfänger begann. Es war mein erster Einsatz als Tutorin, da kam ich besser nicht zu spät.
Warum ich trotzdem an der Ecke stehen blieb und mich umsah, weiß ich nicht mehr. Irgendetwas muss mich irritiert haben. Der sonst so öde Platz schien an diesem Morgen verändert. Spukte mir immer noch die Ratte im Kopf herum?
Ich sah mich um und blinzelte in die tief stehende Sonne. Das Licht war merkwürdig. Es kam mir so vor, als wären die Farben intensiver als sonst. Nach einer Weile glaubte ich, einen zarten Grünschleier wahrzunehmen, als läge eine feine durchsichtige Gaze über dem Platz. Was war das? Ein Trugbild? Nachwirkungen des gestrigen Abends?
Ein Blick auf die Uhr hätte mir eigentlich Beine machen müssen. Doch ich zögerte, hatte das Gefühl, dass etwas nicht stimmte. Ich ging in die Hocke, suchte angestrengt … und dann sah ich es: Der Schleier existierte tatsächlich, ein feines Netzwerk, das sich im Zickzack über das Pflastermosaik erstreckte. Bernburger, ging mir durch den Kopf, der für die Stadt typische hellgraue Steinteppich aus Bernburger Kalkstein in der Schlagung 4/6 Zentimeter. Keine Ahnung, aus welcher Untiefe meines Gedächtnisses dieses Wissen aufgetaucht war. Hatte ich es in der Zeitung gelesen? Oder hatte Angela Forsch es in ihrer Vorlesung erwähnt?
Zwischen den Steinen zwängten sich dicht an dicht feine schmal lanzettförmige spitz endende Hälmchen ans Licht, nur wenige Millimeter lang, aber von einem hellen, intensiven Grün. Sie schienen geradezu zu leuchten.
Ich hatte den Kopf schief gelegt und mittlerweile berührte meine Wange fast die kalten Pflastersteine, so weit hatte ich mich nach unten gebeugt. Was die Leute wohl gedacht haben, als sie mich so sahen? An dieser Stelle der Geschichte lacht Marie immer, und weil ich sie so gern lachen höre, schmücke ich meine Erzählung manchmal ein wenig aus. Wenn mir danach ist, übertreibe ich hemmungslos und erzähle, ich sei auf allen vieren wie ein Käfer hin und her gekrabbelt, was ich niemals tun würde, schon gar nicht auf dem Bundesplatz. Sicher hat es auch so merkwürdig ausgesehen, wie ich da in aller Herrgottsfrühe fast auf dem Pflaster lag und mit den Fingern über die Pflanzenstoppeln fuhr. Sie sahen aus wie eine grüne Bürste. Und wie Borsten fühlten die Blattspitzen sich auch an, überraschend hart und spitz. Sie piksten wie der Dreitagebart an Nicks Kinn.
Als ich auf meiner Seite des Platzes umherlief, fand ich diese Pflanzenborsten überall. Hatte es sie hier schon immer gegeben? Eine Frage, die ich nicht beantworten konnte.
Den anderen Passanten muss mein seltsames Verhalten aufgefallen sein, aber sie dachten wahrscheinlich: Was kümmert’s mich, eine Verrückte mehr in dieser an Spinnern nicht gerade armen Stadt. Die unbekannte Pflanze im Pflaster beachteten sie nicht. Niemand nahm Notiz von ihr. Niemand bückte sich oder stutzte oder rieb sich verwundert die Augen. Die meisten hatten es eilig und viele starrten im Laufen auf ihre Handys, einige schlugen einen Bogen, um mir aus dem Wege zu gehen, würdigten dabei aber das Pflaster keines Blickes. Niemand sprach mich an, niemand blieb stehen und bückte sich, um zu sehen, was ich sah. In diesen ersten Tagen existierte Invicta nur für mich.
Als ich am späten Nachmittag zurückkam, war ich nach dem anstrengenden Tag und der viel zu kurzen Nacht so kaputt, dass ich nur noch nach Hause wollte. Die Pflanzen beachtete ich erst am nächsten Morgen wieder. Sie waren in diesen vierundzwanzig Stunden eindeutig gewachsen. Ihre steifen nadelspitzen Triebe überragten das Pflaster nun um fünf, sechs Millimeter. Ich bewunderte ihre Farbe, die noch intensiver geworden war, und staunte darüber, wie viele auf engstem Raum durch die Fugen drängten. Sie waren einer Bürste noch ähnlicher geworden. Die vorbeieilenden Passanten schienen nicht zu bemerken, was da unter ihren Füßen vor sich ging.
Natürlich meldete sich die Botanikerin in mir. Ich wusste, dass es anspruchslose kleinwüchsige Arten gab, die auch in großstädtischen Pflasterfugen zwischen Kalksteinen und Granitplatten gediehen. Ein paar Millimeter Boden, mehr brauchten sie nicht. Eigentlich vertrugen sie gar keine Trittbelastung, deshalb zogen sie sich in die etwas tiefer liegenden Ritzen und Zwischenräume zurück, wo sie von den Schuhsohlen der Menschen weitgehend verschont blieben, eine kleine Gemeinschaft, die von den Pflanzensoziologen sogar einen eigenen Namen bekommen hat. Silbermoos und Niederliegendes Mastkraut gehörten dazu, eine Nelkenart. Aber von denen war hier nichts zu sehen. Auch Rispengras, das Kleine Liebesgras und Vogelmiere, ihre Begleiter, fehlten. Stattdessen machte sich eine andere Art breit. Dass ich sie nicht kannte, hatte nichts zu bedeuten. Meine Artenkenntnis war verbesserungsbedürftig, um es vorsichtig auszudrücken. Ich wunderte mich über diese Pflanze, war aber weit davon entfernt, meine Entdeckung als außergewöhnlich oder gar beunruhigend zu empfinden.
Angela hätte sie sicher sofort benennen können. Sie kannte jede noch so unscheinbare Pflanze und las in der Natur wie in einem offenen Buch. Jedenfalls kam es mir so vor. Doch nicht nur das. Sie sah auch toll aus, groß und schlank, mit fein geschnittenem Gesicht und langen Beinen. Schön, schlau, kompetent, selbstbewusst und erfolgreich – manchmal fragte ich mich, warum sich diese Frau ausgerechnet mit jemandem wie mir abgab. Offenbar sah sie etwas in mir, was mir bislang verborgen geblieben war.
Dann begann es wieder zu regnen. Einen ganzen Tag schüttete es wie aus Kübeln und niemand hielt sich länger draußen auf als unbedingt nötig. Meinen Pflanzen schien die Dusche gutgetan zu haben, denn am nächsten Morgen waren die Triebe stellenweise anderthalb Zentimeter lang. Ich habe sie ausgemessen und fotografiert. Der ganze Bürgersteig hatte sich in ein Mosaik aus kleinen, von grünen Minihecken eingefassten Steinpferchen verwandelt. Eindeutig ein Gras. Und ich fand es nun nicht nur zwischen den Bernburgern, es wuchs auch zwischen den Kunststein- und Granitplatten der Gehbahn in der Mitte des Bürgersteigs. Besonders dicke Büschel sprossen direkt an den Häuserwänden, es gedieh auf Baumscheiben und an Straßenlaternen.
Sein Verbreitungsgebiet, wenn man es so nennen darf, konnte ich noch leicht zu Fuß ablaufen. Es erstreckte sich über etwa 50 bis 100 Meter. In südlicher Richtung endete es unter der Brücke, in nördlicher etwa auf der Hälfte des Platzes, nur nach Osten war es weiter vorgedrungen, über die kurze, ein wenig verwahrloste Sackgasse, die Bernhardstraße, hinaus, wo seine Triebe besonders kräftig entwickelt waren.
Ich machte Fotos und freute mich über diese unerwartete Naturentfaltung inmitten einer Millionenstadt. Mit Lineal und Notizbuch Wachstumsfortschritte zu dokumentieren wurde zu meinem morgendlichen Ritual. Doch je länger ich auf der Spur dieser Pflanze herumlief, desto lauter meldete sich auch die Wissenschaftlerin in mir, denn was hier vor sich ging, war zweifellos ungewöhnlich und es wurde mit jedem Tag ungewöhnlicher. Zwar werden in Städten immer wieder neue wildwachsende Pflanzenarten entdeckt, meist ehemalige Gartengewächse exotischer Herkunft, von denen einige den Sprung in die Freiheit schaffen. Aber das hier war etwas anderes. Wie ein Exot sah dieses Gras nicht aus und es waren wesentlich mehr als nur ein paar kümmerliche Pflänzchen, die in irgendeiner entlegenen urbanen Nische ums Überleben kämpften. Invicta wirkte von Anfang an überaus vital und die Geschwindigkeit, die es an den Tag legte, war atemberaubend. Hier ging es um eine plötzliche, scheinbar aus dem Nichts einsetzende Massenvermehrung. Das, was ich sehen konnte, war ja nur ein Teil der Pflanze. Der Rest lag unsichtbar im Boden. Wahrscheinlich verbreitete sie sich durch Wurzelausläufer, unterirdisch, ungeschlechtlich.
Ich kam ins Grübeln. In Amerika gab es Wälder aus Zehntausenden von Bäumen, die in Wirklichkeit alle zusammen ein einziges stilles Wesen von gewaltigen Dimensionen darstellten, einen Klon, hervorgegangen aus einem quadratkilometergroßen Wurzelgeflecht, das seit Tausenden, wenn nicht Zehntausenden von Jahren immer wieder neue Stämme gen Himmel schickte, um sich mit Lichtenergie zu versorgen. Vor der Küste Australiens bildete eine einzige mehrere tausend Jahre alte Posidonia-Pflanze eine 180 Kilometer lange Seegraswiese, die wahrscheinlich größte Pflanze der Welt. Vielleicht war dieses Gras auch so ein Fall, hervorgegangen aus einem einzigen Samenkorn, und nun wuchs es wie eine Bakterienkolonie in der Petrischale kreisförmig in alle Richtungen.
Das war der Tag, an dem ich die ersten Proben mitnahm. Sie vertrockneten später im Labor, weil Laura und Henrik sich nicht dafür interessierten, weil Angela im Vorprüfungsstress war und ich an der Bestimmung scheiterte.
Die Menschen spürten die Pflanze nun unter den Sohlen ihrer Schuhe, trotzdem liefen sie achtlos darüber hinweg. Das änderte sich erst am folgenden Tag. Zum ersten Mal sah ich, wie jemand auf den Boden zeigte und seinen Begleiter auf die Pflanzen aufmerksam machte. Verblüfft strichen einige mit den Schuhen über das junge Straßengras, andere gingen in die Hocke, um es mit den Händen zu berühren. Hunde schnüffelten und knabberten daran, hinterließen ihre Duftmarken. Sie hatten bestimmt schon seit Tagen Bescheid gewusst.
Eigentlich hätte nun bald Schluss sein müssen. Die über den belebten Bundesplatz hinweg eilenden Passanten, Fahrräder, Skateboards, Roller, Rollstühle, der gesamte großstädtische Bürgersteigverkehr hätte der Existenz des Grases ein Ende setzen oder sie zumindest begrenzen müssen. Aber es wuchs unbeeindruckt weiter – man konnte ihm dabei zusehen. Wo es niedergedrückt wurde, richtete es sich wieder auf. Stellenweise waren die Pflanzen jetzt drei Zentimeter hoch. Wenn man schräg draufschaute, nahm die gepflasterte Platzfläche mit dem U-Bahn-Eingang in der Mitte anstelle des gewohnten Kalksteingraus die satte Farbe einer Almwiese an.
Langsam eroberte das Gras den ganzen Bundesplatz. Ein neuer Geruch nach frischem Grün breitete sich aus. Wir hatten das Gefühl, bessere Luft zu atmen. Für kurze Zeit schienen die Menschen amüsiert. Grüppchen von Anwohnern standen auf diesem ungewohnten Untergrund beisammen, unterhielten sich und lachten. Einige trugen später sogar Klappstühle herbei, machten es sich mit Picknickkörben auf dem Platz gemütlich, prosteten sich zu und beobachteten lächelnd ihre Kinder, die von Steinplatte zu Steinplatte hopsten, ohne dabei das dazwischen neu gewachsene grüne Hindernis zu berühren, eine Herausforderung, die mit jedem Tag größer wurde. Auf der anderen Seite des Platzes, vor dem Kino, schnitt eine Gruppe von Jungs kleine Durchlässe in die Grasbarrieren und schuf so einen labyrinthischen Parcours, in dem sie kleine Monster- und Dinosaurier versteckten und der anschließend von ihren Spielzeugautos und Superheldenfiguren bewältigt werden musste. Tolle Idee, ich stand eine Weile dabei, sah zu und hätte nicht übel Lust gehabt mitzuspielen, wenn das nicht unter meiner Würde gewesen wäre. Nick wäre bestimmt begeistert gewesen. Da auch das Wetter mitspielte, kamen immer mehr Menschen zusammen und das Treiben hielt bis in den späten Abend an. Wir hatten das Ganze von unserem Balkon aus verfolgt, bis jemand vorschlug, eine Flasche Wein und ein paar Gläser einzupacken und unten mit den anderen auf dem ergrünten Pflaster den Frühling zu feiern.
Unter den Ladenbesitzern gab es einige, die der allgemeinen Euphorie gar nichts abgewinnen konnten. Da seitens der Behörden nichts geschah, griffen sie zur Selbsthilfe, schickten ihre Angestellten oder eilten selbst mit Spaten und Schneeschaufeln auf die Straße und versuchten die Pflanzen abzuschaben oder auszustechen, bevor sich die Türen ihrer Geschäfte nicht mehr öffnen ließen. Einfach war das nicht, zumal sie sich heftige Kritik einiger Anwohner anhören mussten, die noch am Vorabend auf dem frischen Grasteppich ein spontanes Frühlingsfest gefeiert hatten. Es kam zu lauten Wortgefechten. Bürger opponierten gegen Bürger. Ein paar Grashalme drohten den sozialen Frieden zu gefährden.
In meiner WG wurde beim Abendessen herzhaft darüber gelacht. Wir malten uns die wütenden Anrufe beider Streitparteien bei den zuständigen Behörden aus und machten uns über die vergeblichen Bemühungen der Grasbekämpfer lustig.





























