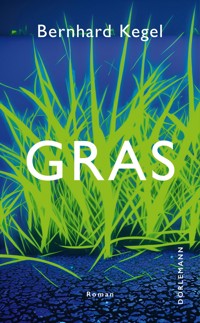9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: DUMONT Buchverlag
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
An Universitäten wie an Stammtischen wird hitzig debattiert, ob Umwelt und Erfahrungen den Menschen prägen oder allein seine Gene. Die noch junge Wissenschaft der Epigenetik zeigt nun, dass beides zutrifft: Nicht nur die Gene werden vererbt, sondern auch die lebenswichtige Information, ob die Zelle diese Gene benutzen soll oder nicht. Die Steuerung erfolgt über biochemische Schalter, die nicht zuletzt durch die Einflüsse der Umwelt programmiert werden. Erfahrungen verändern die Hardware des Genoms. Unser Schicksal – und das unserer Kinder und Enkel – liegt also nicht allein in den Genen. Spannend und kompetent schildert der promovierte Biologe die weitreichenden Konsequenzen der Epigenetik für Medizin, Evolutionsbiologie und unser alltägliches Verhalten. Wir werden Zeugen eines dramatischen Paradigmenwechsels in der Biologie.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 442
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Bernhard Kegel
Epigenetik
Wie unsere Erfahrungen vererbt werden
eBook 2015 © 2009 DuMont Buchverlag, Köln Alle Rechte vorbehalten Umschlaggestaltung: Lübbeke Naumann Thoben, Köln Umschlagabbildung: © plainpicture/Bildhuset
»Es ist heutzutage anerkannt, dass genetische DNA per se nur die Hälfte der Geschichte ist.«
Linda Van Speybroeck, Ghent University, Belgien[1]
»Das ändert alles. Es verändert definitiv meine Vorstellung von Vererbung.«
Robert Pruitt, Purdue University, West Lafayette, Indiana, USA[2]
»Ich glaube, es ist Zeit für die Leute, tief Luft zu holen und einen Schritt zurückzutreten.«
John Mattick, University of Queensland, Brisbane, Australia, ENCODE[3]
1. Die Menschen aus Överkalix
Weit oben im Norden Europas, am Ende des langen Bottnischen Meerbusens, liegt die schwedische Provinz Norrbotten. Vermutlich könnte unsere Auftaktgeschichte überall in der Welt spielen, aber hier, zwischen Lappland und Finnland, nur wenige Kilometer südlich des Polarkreises, inmitten von Wäldern, Feuchtgebieten und Seen ist man ihr durch glückliche Umstände auf die Spur gekommen.
Für mitteleuropäische Verhältnisse ist Norrbotten ein nahezu menschenleeres Gebiet, in dem nur sieben Einwohner pro Quadratkilometer leben. In der kleinen Gemeinde Överkalix sind es noch weniger. Forstwirtschaft und ein wachsender Fremdenverkehr bieten den Menschen Arbeitsplätze, aber der Wohlstand von heute, die hübschen, bunt bemalten Holzhäuser und -kirchen und sogar ein prächtiges Hotel, das Grand Arctic, das in malerischer Lage am Zusammenfluss von Kalix und Ängesån steht, können nicht darüber hinwegtäuschen, dass das Leben in Överkalix über lange Zeit hart und entbehrungsreich gewesen sein muss. Die Jahresmitteltemperatur liegt bei 1,3Grad C, von Ende Oktober bis April herrscht Frost, im Januar und Februar erreicht das Thermometer durchschnittlich –11,5Grad C, von den wenigen Stunden Tageslicht gar nicht zu reden. Das ganze 19.Jahrhundert hindurch war Överkalix eine weit abgelegene, isolierte und verarmte Gemeinde, die häufig mit Missernten zu kämpfen hatte.
Die Geschichte, die aus Överkalix zu erzählen ist, hat mit Nahrung zu tun, genauer gesagt mit einem Zuviel oder Zuwenig an Nahrung. Was wir essen, ist Privatsache und kommt nur uns selbst zugute. Denken wir zumindest. Wer sich ausreichend und gesund ernährt oder ernähren kann, profitiert davon. Wer Hunger leiden muss oder sich überfrisst, wer zu viel Fett oder Süßes zu sich nimmt, wer säuft und raucht, hat die gesundheitlichen Folgen selbst zu tragen. Die einzige Ausnahme sind Schwangere und stillende Mütter. Sie sind nicht nur für sich, sondern auch für ihre Kinder verantwortlich.
Was aber wäre, wenn Ähnliches für alle Menschen gelten würde, ob Mann oder Frau, wenn der Glaube, Qualität und Quantität unserer Nahrung habe nur Konsequenzen für uns selbst, auf Sand gebaut wäre, wenn das, was wir zu uns nehmen, nicht nur Folgen für uns und unsere Kinder, sondern sogar für unsere Enkel hätte? Mit welchem Gefühl würden wir dann die Pommes in die Mayonnaise tunken?
Normalerweise hatten Menschen, die vor 100 oder 150Jahren im äußersten Norden Europas das Licht der Welt erblickten, kaum Chancen, in die Historie einzugehen. Dem Jahrgang 1905 ist dies jedoch in gewisser Weise gelungen, denn die Hälfte der 199Menschen, die in diesem Jahr in der Gemeinde Överkalix geboren wurden, gelangte posthum in eine Zufallsstichprobe der Sozialmediziner Lars Olov Bygren und Gunnar Kaati, die Erstaunliches zutage förderte und weit über Norrbotten hinaus Aufmerksamkeit erregte.[1] Zwei dieser Menschen lebten Ende des 20.Jahrhunderts noch, drei hatten sich schon mit Anfang zwanzig in die weite Welt verabschiedet und blieben unauffindbar. Der Rest der Stichprobe, 94Söhne und Töchter von Överkalix, hatten hier ihr ganzes Leben verbracht, waren hier gestorben und hinterließen im Bevölkerungsregister der an der Universität Umeå archivierten demografischen Datenbank einen Sterbeeintrag samt Todesursache.
Lars Olov Bygren und Gunnar Kaati interessierten sich ursprünglich für den Zusammenhang zwischen der Ernährung von Kindern und Jugendlichen und ihrem Risiko, später an Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu sterben. Mit lebenden Menschen wäre eine solche Untersuchung nahezu unmöglich, zumal wenn man auch die nächste und übernächste Generation im Blick hat. Sie würde Jahrzehnte dauern und wäre zudem ethisch äußerst fragwürdig. Wenn Menschen hungern, sollte man ihnen zu essen geben, anstatt ihrem Leiden tatenlos zuzusehen und abzuwarten, wann und an welchen Krankheiten sie zugrunde gehen.
Die seit 200Jahren geführten Gemeinderegister ermöglichen es aber, diesen Zusammenhang an historischen Datensätzen zu untersuchen. Dabei kam Bygren und Kaati der Umstand zu Hilfe, dass in Schweden seit 1799 auf Anordnung des Königs auch über Ernteerfolg und Lebensmittelpreise genau Buch geführt wird. Da es im 19.Jahrhundert in der Gegend weder Eisenbahnen noch Straßen gab und im Winter durch das Zufrieren der Ostsee auch der Seeweg versperrt war, mussten die Bewohner von Överkalix nahezu ausschließlich mit den vor Ort auf schlechten Böden und mit einfachen Methoden produzierten Nahrungsmitteln auskommen. Die jährlichen Ernteerträge waren also ein recht gutes Maß für den jeweiligen Ernährungszustand der dort lebenden Bevölkerung.
Die Frage war: Hat das, was Mama und Papa und Oma und Opa in jungen Jahren erfahren und erlitten haben, einen Einfluss auf Lebenserwartung und Todesursache ihrer Kinder und Enkel? Mithilfe von Sören Edvinsson, der für die demografische Datenbank der Universität Umeå arbeitete, gelang es Bygren und Kaati, die Geburts- und Todesdaten fast aller Eltern und Großeltern des 1905er-Geburtenjahrgangs ausfindig zu machen. Nun musste deren Leben nur noch mit den jeweils vorhandenen Nahrungsmittelmengen in Beziehung gesetzt werden.
Ein Blick in die Erntestatistik lässt erahnen, was die Vorfahren durchmachen mussten. Natürlich gab es auch gute und sehr gute Jahre, 1822 zum Beispiel, 1825 und 1826, auch 1828, 1841 und 1844. Aber darauf folgten, wie 1821, 1829 und 1851, immer wieder Totalausfälle. In einem Jahr gab es nicht genug Saatgut. In einem anderen zogen während des Schwedisch-Russischen Krieges zwei Armeen durch das Land und beschlagnahmten alles Essbare. Besonders hart müssen die Dreißigerjahre gewesen sein, denn von 1831 bis 1837 konnte in Överkalix praktisch keine Ernte eingebracht werden. Die Not war groß.
Die Forscher unterteilten die Kindheit der Eltern und Großeltern in mehrere Perioden (für Jungen 0–2, 3–8, 9–12, 13–16Jahre, für Mädchen 0–2, 3–7, 8–10, 11–15Jahre) und untersuchten, ob in diese Perioden mindestens ein Jahr mit besonders guter oder schlechter Ernte fiel. Dann setzen sie die Ergebnisse in Bezug zum Lebensalter, das deren Kinder bzw. Kindeskinder erreichten.
In fast allen Fällen führte die Rechnung zu keinem signifikanten Zusammenhang. Gleichgültig, ob die Eltern im Kindesalter viel oder wenig zu essen hatten, ein Einfluss auf die Lebenserwartung ihrer im Jahr 1905 geborenen Nachkommen war nicht nachweisbar.[2] Die Nahrungsmittelversorgung während der Kindheit von Großmutter und Großvater mütterlicherseits hatte ebenfalls keine erkennbaren Konsequenzen für die Enkel. Auch die Oma väterlicherseits hatte keinen Einfluss. Natürlich nicht, ist man versucht zu sagen. War die Fragestellung nicht von vornherein an den Haaren herbeigezogen?
War sie nicht. Denn als die Wissenschaftler als letzte noch zu berücksichtigende Größe die Kindheitserfahrungen der Großväter väterlicherseits in ihre Rechnung mit einbezogen, schalteten plötzlich alle Lämpchen auf Rot. Der Zusammenhang, der sich hier und nur hier auftat, war nicht nur statistisch hoch signifikant, er war genau entgegengesetzt zu dem, was man intuitiv erwarten würde, und noch dazu von einer erstaunlichen Dimension. Nicht das Hungern des Großvaters, sondern im Gegenteil ein von ihm vermutlich mit Freude und ohne jeden Reuegedanken konsumierter Nahrungsüberfluss verkürzte das Leben seiner Enkel um viele kostbare Jahre. Dagegen erhöhte sich deren Lebenserwartung in etwa demselben Maß, wenn Großvater Not leiden musste. Für die Generation der Enkel ging es dabei nicht nur um ein paar Wochen oder Monate. Zwischen den Extremen lagen 32Jahre, nicht weniger als ein halbes Menschenleben.
Nun kamen die Kindheitsperioden ins Spiel. Denn der erstaunliche Zusammenhang, auf den die schwedischen Forscher gestoßen waren, galt nicht für die gesamte Kindheit der Großväter, sondern nur, wenn Nahrungsmangel oder -überfluss im Alter von 9 bis 12Jahren herrschte, der sogenannten slow growth period, einer Art Stagnationsphase im Leben heranwachsender Jugendlicher, bevor sie als präpubertierende Teenager in die Höhe schießen. Davor und danach blieben Hunger oder Völlerei der jungen Großväter ohne Konsequenzen für die Lebenserwartung kommender Generationen. Das Gleiche galt übrigens, wenn die Ernten während der slow growth period des Opas nur durchschnittlich ausgefallen waren. Offenbar machten die Extreme den Unterschied, das Zuviel oder Zuwenig an Nahrung. Wenn man sich seinen Großvater doch nur aussuchen könnte …
Die Ende der 1990er-Jahre gewonnenen Ergebnisse[3] waren statistisch abgesichert, trotzdem blieb vieles an dieser Studie unbefriedigend, vor allem die, wie die Autoren selbst einräumten, »bedauerlich geringe« Zahl an Versuchspersonen. Deren eigene Lebensführung blieb völlig unberücksichtigt. Die getestete Sterblichkeit ist zudem ein sehr unspezifischer Parameter, der von zahllosen Einflussfaktoren bestimmt wird. Detailliertere Aussagen ließ die geringe Stichprobengröße aber nicht zu. Die 94Männer und Frauen des Jahrgangs 1905 aus Överkalix waren einfach zu wenig.
Nur ein Jahr nach ihrer ersten Untersuchung publizierten die schwedischen Forscher jedoch eine zweite Studie.[4] Schon der Titel, in dem es um konkrete Todesursachen ging, machte deutlich, dass Bygren, Kaati und Edvinsson ihrem Ziel näher gekommen waren. Die Datengrundlage hatte sich entscheidend verbessert.
Diesmal waren drei Geburtenjahrgänge aus Överkalix in die Rechnung eingeflossen, die jeweils 15Jahre auseinanderlagen. Zu dem Jahrgang 1905 kamen die etwa gleich starken Jahrgänge 1890 und 1920. Nachdem man wieder alle Personen aus den Stichproben gestrichen hatte, die noch lebten, deren Todesursache unbekannt war, die das Land mit unbekanntem Ziel verlassen hatten oder bei denen die Geburts- und Sterbedaten von Eltern und Großeltern nicht ausfindig gemacht werden konnten, blieben 239Probanden übrig. Da zu jeder Versuchsperson sechs Vorfahren gehörten (die Eltern der Probanden und die Großeltern väterlicher- und mütterlicherseits), flossen die Daten von 1.434Vorfahren mit ein.
Die verblüffende Bedeutung der Großväter väterlicherseits bestätigte sich auch diesmal, allerdings nur für den Jahrgang 1890, nicht für diejenigen, die 30Jahre später im Jahr 1920 geboren wurden. Vermutlich wirkt sich bei diesem späten Geburtstermin bereits aus, dass Missernten gegen Ende des 19.Jahrhunderts nicht mehr die katastrophalen Auswirkungen früherer Zeiten erreichten. Das Krisenmanagement der Gemeinden war effektiver geworden, und langsam verbesserte sich auch die Infrastruktur.
Für 123 der Versuchspersonen gaben die Gemeinderegister zumindest als eine der Todesursachen Erkrankungen des HerzKreislauf-Systems an. Bei 19 spielte Diabetes eine Rolle. Gab es einen Zusammenhang zwischen diesen Todesursachen und der Ernährung der Eltern und Großeltern?
Getestet wurde nur die offenbar besonders sensible slow growth period der Vorfahren. Wieder lieferten die Großväter die signifikantesten Resultate. Boten ihnen gute Ernten in Kindertagen die Gelegenheit zu üppiger Schlemmerei, hatten ihre Enkel ein um das Vierfache vergrößertes Risiko, an Diabetes zu sterben. Bei den Herz-Kreislauf-Erkrankungen waren es die Väter, die ihren Kindern eine ernährungsbedingte Mitgift mit auf den Lebensweg gaben. Hatten sie schlechte Zeiten durchgemacht, waren ihre Kinder vor diesen lebensbedrohlichen Krankheiten relativ sicher.
Die schwedischen Forscher befragten ihren Datensatz noch unter einem weiteren Aspekt. Die Familien in Överkalix hatten erstaunlich viele Kinder, im Durchschnitt waren es sieben. In einem Viertel der Familien lebten mehr als zehn. Stand auch die Zahl der Enkel in einem Zusammenhang mit der Kindheit der Großväter? Wieder ergab sich ein signifikantes Ergebnis. Hatte der väterliche Großpapa reichlich zu essen, fiel die Kinderschar seiner Söhne deutlich kleiner aus (–0,66), musste er hungern, vergrößerte sich die Zahl seiner Enkel.
Was ging hier vor? Wie war die herausragende Bedeutung des Großvaters väterlicherseits zu erklären? Sein Pendant auf mütterlicher Seite konnte essen oder hungern, so viel er wollte, für die Enkelkinder war das ohne Bedeutung. Wie war es möglich, dass Erfahrungen des einen Großvaters auf irgendeine Weise gespeichert wurden, um dann die Generation seiner Kinder zu überspringen und sich erst bei seinen Enkeln auszuwirken, während beim anderen Großvater nichts dergleichen zu beobachten war? Was hier auch geschah, es schien in besonderem Maße die väterliche Abstammungslinie zu betreffen. Die Weitergabe musste über die Spermien erfolgen.
Die zweite Studie von Kaati, Bygren und Edvinsson war im angesehenen European Journal of Human Genetics erschienen, einer Zeitschrift, die offenbar auch von Wissenschaftsredakteuren gelesen wird. Der Spiegel brachte ein kurzes Interview mit Gunnar Kaati, auch die Zeit widmete sich dem Thema. Aber der Ton war ungläubig, fast spöttisch. »Feist, Opa!«, titelte die Zeit[5] und witzelte: »Es ist nicht auszudenken, wie sich unser Verhältnis zu den Ahnen verändern wird, sollte der Schwede Gunnar Kaati recht behalten. Jeden in jungen Jahren verputzten Hamburger würden wir dem Opa posthum verübeln. Und lebte der Alte noch, könnte das einen wahren Generationenkrieg auslösen.« »Das klingt alles sehr gewagt«, kommentierte der Spiegel[6]. Es ging ja nur um Statistiken. Und denen glaubt man bekanntlich nur, wenn man sie selbst gefälscht hat.
Marcus Pembrey vom University College London kannte das. Der Genetiker beschäftigte sich seit Längerem mit solchen generationsübergreifenden Effekten, die der Genetik Hohn zu sprechen schienen. »Sie können die Resultate einfach nicht glauben«, sagte er und meinte die wissenschaftlichen Fachzeitschriften, die derartigen Untersuchungen grundsätzlich skeptisch bis ablehnend gegenüberstünden.[7] Kann nicht sein, was nicht sein darf?
Immer wieder fiel ein Name: Jean-Baptiste de Lamarck. Und wie schon unzählige Male zuvor wurde das umfangreiche Lebenswerk des französischen Zoologen wieder auf das berühmtberüchtigte Giraffen-Beispiel verkürzt. In Lamarcks dreibändiger Philosophie zoologique (1809) nimmt es zwar nur einen kurzen Absatz ein, trotzdem sind diese wenigen Zeilen und der Name ihres Verfassers zu einem Symbol für Wissenschaft geworden, die sich in falsche, ja abwegige Vorstellungen verrennt. Nach Lamarck, berichteten Spiegel und Zeit fast gleichlautend, habe nicht die 50Jahre später von Darwin inthronisierte natürliche Auslese zum langen Hals der afrikanischen Savannenbewohner geführt, sondern deren lebenslanger, fast Mitleid erregender Versuch, sich zu dem verführerisch unberührten Laub der Baumkronen zu strecken, was den Kopf jeder Giraffengeneration eine Winzigkeit in die Höhe beförderte.
In den Ohren von uns Heutigen, die wir mit Darwins Lehre aufgewachsen sind, kann diese Theorie nur lächerlich klingen, ein schon lange überwundener Irrweg. Wer 200Jahre nach Lamarck noch immer eine Vererbung von Eigenschaften für möglich hält, die zu Lebzeiten erworben wurden, und aus dieser Richtung am Thron des großen Engländers zu rütteln wagt, der bekommt den geballten Zorn des wissenschaftlichen Establishments zu spüren. Nach gängiger Lehrmeinung konnte Großvaters in guten Överkalix-Kinderzeiten angefutterte Fettschicht unmöglich für den frühen Diabetes-Tod seiner Enkel verantwortlich sein. Ein Individuum, ob Mensch oder Tier, mag im Laufe seines Lebens viele bemerkenswerte Fähigkeiten erwerben, es mag gute und katastrophal schlechte Zeiten durchleben, der Weg zu den Genen in Spermien und Eizellen und damit zu kommenden Generationen bleibt diesen Einflüssen in jedem Fall versperrt. Basta.
»An Lamarck haben wir überhaupt nicht gedacht«, beteuerte Gunnar Kaati im Spiegel-Interview.[8] »Aber in der Tat müssen wir wohl davon ausgehen, dass bei der Vererbung noch viele unentdeckte Faktoren eine Rolle spielen. Ich frage mich zum Beispiel, was es für zukünftige Generationen bedeutet, wenn zurzeit eine ganze Generation übergewichtiger Kinder heranwächst.«
Marcus Pembrey meldete sich zu Wort und ergriff im European Journal of Human Genetics Partei. Es sei endlich an der Zeit, Ergebnisse, wie sie die schwedischen Forscher erarbeitet hätten, ernst zu nehmen. Die Daten aus Överkalix seien ein Glücksfall für die Wissenschaft. Die Schweden hätten kein statistisches Trugbild, sondern ein reales Phänomen entdeckt: einen »nahrungsinduzierten, durch die Spermien weitergegebenen transgenerationalen Effekt«. Pembrey legte dar, dass im kindlichen Hoden schon im Alter von acht Jahren die ersten primären Spermatozyten auftauchten, Vorläuferzellen der Spermien, deren Zahl in den Folgejahren auf dem Weg in die Pubertät stark zunehme. Die slow growth period, die sich in den schwedischen Untersuchungen als besonders wichtig herausgestellt habe, falle daher mit einer sensiblen Frühphase der Spermienbildung zusammen, mithin »genau der Art von dynamischem Zustand, in dem ein nahrungsmittelempfindlicher Mechanismus operieren könnte. (…) Wir brauchen eine unabhängige Bestätigung, aber diese Beobachtungen sollten zukünftigen Fragen völlig neue Richtungen geben«.[9]
Vier Jahre vergingen ohne neue Nachrichten aus Överkalix, dann meldeten sich Bygren, Kaati und Edvinsson zurück, diesmal in Kooperation mit Marcus Pembrey und einem Autorenteam aus Großbritannien.[10] Die Engländer brachten den riesigen Datensatz ihrer Avon Longitudinal Study of Parents and Children (ALSPAC) ein, einer bis heute andauernden Langzeituntersuchung an über 14.000Kindern, die 1991 und 1992 in der Nähe von Bristol geboren wurden, an deren Müttern und einem Großteil der Väter.[11]
War es möglich, ähnliche transgenerationale Zusammenhänge, wie sie in Schweden gefunden wurden, auch an lebenden Menschen zu entdecken? Würde es gelingen, Einflussfaktoren dingfest zu machen, die während der slow growth period der Eltern einwirkten und zu Effekten bei den Kindern führten?
Da die Nahrungsmittelversorgung in einer Industrienation wie Großbritannien heute keine jährlichen Schwankungen mehr aufweist, waren Pembrey und seine schwedischen Kollegen gezwungen, sich nach anderen Einflüssen umzusehen. Die Lösung steckte in fast 10.000Fragebögen, die den Vätern der englischen ALSPAC-Babys vorgelegt worden waren. Unter anderem wurde darin gefragt, ob die Probanden jemals geraucht hätten. Mehr als die Hälfte der Väter beantwortete die Frage positiv, und fast alle konnten sich auch erinnern, wann sie zu regelmäßigen Rauchern geworden waren. Das am häufigsten genannte Alter war 16, aber 166Väter berichteten, schon mit elf Jahren oder noch früher regelmäßig zur Zigarette gegriffen zu haben. Zu Beginn ihrer Raucherkarriere befanden sie sich damit noch in ihrer slow growth period.
Als die Forscher das Rauchverhalten der Väter mit dem sogenannten Body-Mass-Index[12] der in regelmäßigen Abständen untersuchten Kinder in Beziehung setzten, erhielten sie genau das, wonach sie gesucht hatten. Denn im Alter von neun Jahren waren nur die Söhne der schon als Kinder rauchenden Väter deutlich übergewichtig. Bei den Töchtern war dieser Effekt nicht zu erkennen, und auch die Jungen, deren Väter erst später und damit nach dem Ende ihrer slow growth period mit dem Rauchen begannen, zeigten keine Auffälligkeiten.
Das war ein wohltuender Rückenwind für die Forscher aus Umeå. Wieder war man auf einen geschlechtsspezifischen Effekt gestoßen, der sich erst in einer nachfolgenden Generation zeigte und mit der slow growth period der Väter zu tun hatte, diesmal allerdings in einer Population lebender Menschen und ohne Zuhilfenahme von historischen Daten, die nur indirekt über die während der Kindheit wirksamen Einflüsse Auskunft gaben. Das Netz an Indizien zog sich langsam zusammen, denn es gab auch überaus interessante Neuigkeiten aus Överkalix.
Die statistischen Auswertungsmethoden waren erheblich verfeinert worden, und nun richtete sich das Augenmerk vor allem auf die geschlechtsspezifischen Effekte. Wenn sich das frühe Rauchen der englischen Väter nur auf die Jungen auswirkte, wie verhielt es sich dann mit den schlemmenden oder hungernden Großvätern aus Överkalix?
Bisher hatten die schwedischen Forscher bei den drei Geburtsjahrgängen nicht nach Frauen und Männern unterschieden. Doch gerade durch diese Unterscheidung nach Geschlecht erhielten die Ergebnisse eine verblüffende, bisher verborgen gebliebene Dimension. Denn nun zeigte sich, dass nicht nur die Nahrungsmittelversorgung der Großväter väterlicherseits von erheblichem Einfluss auf die Lebenserwartung ihrer Enkel war, sondern auch die ihrer Frauen. Dieser Einfluss war in beiden Fällen gleichgerichtet, Nahrungsüberfluss zu Kinderzeiten der Großeltern war für die Enkel von Nachteil und umgekehrt. Er beschränkte sich allerdings in erstaunlich strikter Weise ausschließlich auf das eigene Geschlecht. Ob gut oder schlecht – die Versorgungslage der Großväter hatte nur für ihre männlichen Enkel Konsequenzen, und für deren Schwestern war ausschließlich das relevant, was die Großmütter väterlicherseits erlebt und erlitten hatten. Die mütterliche Seite war ohne jede Bedeutung. Die neuen Ergebnisse aus Schweden gewannen zusätzlich an Aussagekraft, als sie in übereinstimmender Weise an zwei unabhängigen Stichproben gewonnen wurden, den Jahrgängen 1890 und 1905.
Da sich schon früh die Bedeutung der slow growth period herausstellte, hatten sich alle folgenden Arbeiten der Schweden auf diese Kindheitsphase von Eltern und Großeltern konzentriert. Jetzt lieferten die Forscher eine viel genauere Analyse, die die Nahrungsmittelversorgung der Großeltern von ihrer Zeit als Fötus bis zum Alter von 20Jahren zum Inhalt hatte. Zu Beginn ihrer Arbeit hatten Bygren und Kaati die Dauer der slow growth period aufgrund von Literaturdaten festgelegt, die an heute lebenden Kindern gewonnen wurden, und sie hatten sie um ein Jahr vorverlegt, um die Verschiebung der Pubertät zu berücksichtigen, die in den letzten 100Jahren stattgefunden hat. Jetzt stellte sich heraus, wie sehr sie damit ins Schwarze getroffen hatten. Hätten sie Beginn und Ende dieser Periode nur um ein oder zwei Jahre anders gesetzt, die in den Daten verborgene Information wäre womöglich bis zur Unkenntlichkeit verwässert worden. Genau in den von den Forschern gesetzten Grenzen der großelterlichen slow growth period zeigten sich nämlich bei den Enkeln die stärksten Effekte.
Nur die ersten drei Lebensjahre der Großmütter erwiesen sich als noch einflussreicher, die Zeit also, die sie als Fötus im Bauch der Urgroßmütter, als Stillbaby in deren Armen und als Brei futterndes Kleinkind auf deren Schoß verbrachten. Für ihre Enkelinnen – und nur für diese – erwies es sich als besonders verhängnisvoll, wenn die Ernteerträge in diesen entscheidenden Jahren gegen Null gingen. Während dieser Zeit wirkte sich eine gute Ernährungslage der Großmutter also sehr positiv für die Enkelinnen aus. Warum sich dieser Zusammenhang dann während der slow growth period umkehrt, bleibt vorerst ein Rätsel.
2007 erschien die bislang letzte Överkalix-Arbeit der schwedischen Forscher, in der sie eine Schwachstelle ihrer Untersuchung ausräumten.[13] Auch wenn sie die individuellen sozialen Lebensumstände ihrer Versuchspersonen aus den Jahrgängen 1890 und 1905 berücksichtigten, änderte sich an den Resultaten nichts. Egal, ob die Probanden früh ihre Eltern verloren, ob sie die Erst- oder Letztgeborenen waren, wie viele Geschwister sie hatten, ob der Vater Landbesitzer oder Analphabet war: Der Zusammenhang zwischen der Ernährungslage der Großeltern väterlicherseits und dem Sterberisiko der Enkel blieb bestehen.
Warum hat eine gute Versorgungslage während der offenbar entscheidenden slow growth period der Großeltern für die Enkel so negative Folgen? Und abgesehen von Zigarettenrauch und Nahrungsmenge, welche Einflüsse wirken noch über die Grenzen der Generationen hinaus? Spielt vielleicht nicht nur eine Rolle, wie viel, sondern auch was wir essen? Wenn Hunger und Völlerei derartige Wirkung entfalten können, was ist mit eindrücklichen und traumatischen Erlebnissen anderer Art, mit schweren Krankheiten, mit Krieg, Vertreibung oder Missbrauch?
Für Lars Olov Bygren, Gunnar Kaati und Marcus Pembrey bestehen kaum noch Zweifel: Sowohl die britischen ALSPAC- als auch die Överkalix-Resultate stützen die Hypothese, dass beim Menschen »ein genereller Mechanismus existiert, der Informationen über die Umwelt der Vorfahren über die männliche Abstammungslinie weitergibt«.[14] Die alte, erbittert geführte Diskussion über das Verhältnis von Umwelteinflüssen und genetischer Veranlagung dürfte damit in eine neue Phase gehen. Die Sünden (und das Leid) der Väter, sie scheinen uns auf eine Weise zu verfolgen, die noch vor Kurzem für unmöglich gehalten wurde.
Nach Meinung der Forscher ist eine Beteiligung der Geschlechtschromosomen die naheliegendste Erklärung. Die Weitergabe vom Großvater über den Vater zum Sohn könnte über das Y-Chromosom erfolgen. Und das von der Großmutter stammende X-Chromosom des Vaters kann von diesem nur an seine Töchter weitergegeben werden, nicht an die Söhne, die ja stattdessen sein Y-Chromosom und ein X-Chromosom der Mutter erhalten, was genau dem beobachteten Zusammenhang entsprechen würde.
2. Das Monster
Für Drehbuchautoren gilt bekanntlich Billy Wilders einfache Grundregel: Beginne mit einem Erdbeben – zur Not tut es auch, wie in unserem Fall, eine sensationelle Enthüllung –, und steigere dich langsam. Deshalb wartet die zweite Geschichte nun mit einem veritablen Monster auf. Es handelt sich zwar nur um eine harmlose Pflanze, besser gesagt ein Pflänzchen, aber immerhin. Sie wird uns helfen zu verstehen, was hinter den Vorgängen in Överkalix stecken könnte. Wenn man so will, hatte die Entdeckung dieses »Pflanzenmonsters« vor über 250Jahren tatsächlich kleinere Beben zur Folge, deren Erschütterungen bis in unsere Tage zu spüren sind. Unterbrochen von langen Phasen der Ruhe, scheint ihre Intensität sogar zuzunehmen.
Die Geschichte spielt einige Hundert Kilometer südlich von Överkalix und beginnt im Jahr 1742, als der Student Magnus Ziöberg seinen Geburtsort auf einer Insel des Roslagen-Archipels nördlich von Stockholm besuchte. Wir bleiben also in Schweden.
Eigentlich war Ziöberg angehender Jurist, der später eine glänzende Karriere als Richter machen sollte, aber er interessierte sich auch für Botanik und nutzte die Gelegenheit, um durch die Inselnatur zu streifen und Pflanzen zu sammeln. Dabei stieß er auf ein unscheinbares Gewächs, das dem Gemeinen Leinkraut ähnelte, aber vollkommen anders gestaltete Blüten besaß. Ziöberg wunderte sich, presste und trocknete die seltsame Pflanze und zeigte sie Professor Olof Celsius in Uppsala. Der Professor fand, das sei in der Tat etwas Bemerkenswertes, und reichte das Herbarblatt sogleich an einen Spezialisten weiter, seinen berühmten Landsmann Carolus Linnaeus. Dieser glaubte zunächst an einen Scherz. Offenbar hatte jemand fremde Blüten an ein ordinäres Leinkraut geklebt, um ihn und seine Kollegen an der Nase herumzuführen.[1]
Aber Pflanze und Blüten gehörten tatsächlich zusammen. Linnaeus griff zum Präparierbesteck und fand im Inneren der Blüten derart ungewöhnliche Strukturen, dass er glaubte, die Pflanze müsse von weit her stammen, vom Kap der Guten Hoffnung, aus Japan oder Peru. Sie konnte unmöglich in Roslagen wachsen, quasi vor der eigenen Haustür, wo Linnaeus, der bald darauf eine Flora Schwedens veröffentlichen sollte, jeden Grashalm kannte.
Carolus Linnaeus, oder Carl von Linné, wie er sich ab 1761, nach der Verleihung des Adelstitels, nennen durfte, war die ordnende Hand, die endlich System in das Durcheinander der Pflanzen- und Tierarten brachte. Ein Jahr bevor Magnus Ziöberg die seltsame Pflanze fand, war Linnaeus an der Universität Uppsala zum Direktor des Botanischen Gartens ernannt worden und trat gleichzeitig eine Professur für Theoretische Medizin an. Seine wichtigsten Arbeiten hatte er allerdings schon Jahre zuvor als kaum Dreißigjähriger in Holland veröffentlicht. Als er nach Uppsala, in die Stadt seiner Studentenjahre, zurückkehrte, war er im Wissenschaftsbetrieb seiner Zeit bereits ein Star, der interessierte Bürger und Studenten aller Fakultäten scharenweise in die Vorlesungen lockte, nicht zuletzt durch seine verfängliche Sprache, mit der er die pflanzliche Sexualität beschrieb. In einem konkreten Fall, der Mohnblüte, hörte sich das so an: »In den Blütenkelchen finden sich die gleiche Zahl von Ehemännern und -frauen in unbeschwerter Freiheit«, schrieb Linné, »aber auch zwanzig Männer oder mehr im selben Bett mit einer Frau.« Oh, là, là … Ganz allgemein gelte: »Die Blütenblätter dienen als Hochzeitsbetten, die der große Schöpfer so herrlich hergerichtet, mit so edlen Vorhängen und Düften versehen, damit das Paar dort seine Hochzeit mit einer erhöhten Feierlichkeit begehen kann.«[2]
Aus heutiger Sicht erscheint diese Seite Linnés erstaunlich modern. Denn mithilfe von Zweideutigkeiten und gezielten Provokationen die öffentliche Aufmerksamkeit auf sich und die eigene Forschung zu lenken ist eine Methode, die sich bei Wissenschaftlern noch heute großer Beliebtheit erfreut, auch wenn, wie wir sehen werden, im 20. und 21.Jahrhundert weniger mit Anzüglichkeiten als mit vollmundigen Ankündigungen, gewagten Versprechungen und provokanten Thesen gearbeitet wird. Man pflegt das eigene Ego, lockt talentierten Nachwuchs an und positioniert sich im Kampf um Forschungsmittel. Auch Linné versuchte Helfer zu gewinnen. Als seine »Apostel« – die Bezeichnung stammt von ihm selbst – schwärmten einige zu gefahrvollen Reisen in die ganze Welt aus, um neue Pflanzen- und Tierarten zu sammeln.[3] Noch heute besitzt Linnés Name eine bemerkenswerte Anziehungskraft. Zu den Feierlichkeiten anlässlich seines 300. Geburtstags reiste 2007 sogar das japanische Kaiserpaar nach Uppsala. Kaiser Akihito, selbst Meeresbiologe und bekennender Verehrer des großen Schweden, traf dort unter anderem auf den ehemaligen UN-Generalsekretär Kofi Annan, den britischen Naturfilmer David Attenborough und die Schimpansenforscherin Jane Goodall.
Seit Linné fassen die Biologen Pflanzen- und Tierarten in immer größeren Gruppen[4] zusammen, beginnend mit den Arten, die zu Gattungen gruppiert werden, diese zu Ordnungen und Ordnungen wiederum zu Klassen: Systema Naturae, das wunderbare Schöpfungswerk Gottes. Seit Linné (genauer gesagt, seit 1753 für Pflanzen und seit 1758 für Tiere) benennen Botaniker und Zoologen ihre Schützlinge mit zwei lateinischen, oft grotesk unaussprechlichen Namen, was ihnen in den Augen vieler Menschen einen unausrottbaren Ruf als elitär verschrobene Blütenblatt- und Fliegenbeinzähler eingetragen hat. Aber die altsprachliche Nomenklatur ist sinnvoll, bis heute.[5] Wie könnten sich ein Schwede und ein Spanier oder Japaner sicher sein, dass sie über dieselbe Pflanzen- oder Tierart reden, wenn jede Sprache eine eigene Bezeichnung bereithielte? Der erste Name benennt die Gattung, Homo, der zweite die Art, sapiens (manchmal kommt noch ein dritter Name für die Unterart hinzu): Homo sapiens sapiens. Oder eben Linaria vulgaris, Gemeines Leinkraut. Linné, mit gesundem Selbstbewusstsein ausgestattet, brachte seine Lebensleistung auf den Punkt: »Gott schuf die Welt, Linnaeus gab ihr eine Ordnung.«[6] Im göttlichen Schöpfungsplan sollte jede Art ihren Platz und ihren Namen haben. Man musste sie nur entdecken.
[1] Die Kleidung, in der Carl von Linné hier posiert, hatte er für seine Reise nach Lappland erworben. Ausschnitt eines Porträts von Hendrik Hollander, 1853.
War diese seltsame Pflanze, die aussah wie ein verunglücktes Leinkraut, eine neue, unbekannte Art? Linné wollte unbedingt frische Exemplare sehen und beauftragte Magnus Ziöberg, am Originalfundort in Roslagen weitere Pflanzen mit Wurzeln und Stielen zu sammeln. Was der Student mitbrachte, versetzte Linné in große Aufregung. Diese Pflanze gehörte zu den bemerkenswertesten, die ihm je unter die Augen gekommen waren. »Nichts kann fantastischer sein als das, was hier geschehen ist«, schrieb er in einer berühmten Abhandlung, die zwei Jahre später erschien, »nämlich, dass ein missgebildeter Nachkomme einer Pflanze, die zuvor immer irreguläre Blüten hervorgebracht hat, nun reguläre Blüten produziert. (…) Das ist ein Beispiel für etwas, das in der Botanik ohne Parallele ist. (…) Es ist sicher nicht weniger bemerkenswert, als wenn eine Kuh ein Kalb mit einem Wolfskopf gebären würde.«[7]
Peloria nannte er die in seinen Augen sensationelle Pflanze – Monster (aus dem Altgriechischen). Um Linnés Aufregung zu verstehen, muss man wissen, dass die von ihm vorgenommene Einteilung der Gefäßpflanzen in 24Klassen auf der Anatomie ihrer Blüten beruhte. Und nun hatte er ein Gewächs vor sich, das in seinen vegetativen Teilen, den Blättern, Trieben und Wurzeln, in allen Einzelheiten dem bekannten Leinkraut entsprach, aber völlig anders gebaute Blüten besaß. Diese abweichende Blütenanatomie würde die Pflanze in Linnés System nicht nur aus der Gattung Linaria hinaus-, sondern in eine völlig andere Klasse hineinkatapultieren, daher das Bild vom Kalb mit dem Wolfskopf. (Obwohl dieses Kalb eher einen Wolfspenis oder -uterus aufweisen müsste, da es sich bei den Blüten um die Sexualorgane der Pflanzen handelt – aber lassen wir das.)
In seiner Peloria-Abhandlung begnügte sich Linné nicht mit einer bloßen Beschreibung der ungewöhnlichen Pflanze, sondern er lieferte auch eine Erklärung für ihre Existenz. Welche Konflikte er dabei mit sich selbst auszutragen hatte, kann man heute nur noch erahnen. Schon in der Namensgebung – Monster – steckt ja eine gehörige Portion Erschrecken. So hässlich oder monströs sah diese Pflanze nun wirklich nicht aus. Das Ungeheuerliche bestand darin, dass es sie überhaupt gab.
Obwohl Carl von Linné ein wissenschaftlicher Pionier war, stand er doch felsenfest auf dem Boden des christlichen Weltbildes und sah seine Lebensaufgabe in der Erhellung des göttlichen Schöpfungsplans. Alles, was auf Erden lebte, war für ihn und seine Zeitgenossen unveränderlich und gottgegeben. »Es gibt so viele Arten, wie das Unendliche Wesen von Anfang an verschiedene Formen geschaffen hat«, schrieb er in einem seiner bedeutendsten Werke. »Diese Formen haben dann gemäß den der Schöpfung innewohnenden Gesetzen immer Nachkommen wie sie selbst erzeugt, sodass wir heute nicht mehr Arten finden, als früher existiert haben.«[8]
In dieses fest gefügte und statische Weltbild schlug Peloria ein wie eine Bombe. Wenn die Zahl der Arten konstant ist und sie immer nur Kopien ihrer selbst hervorbringen können, woher kam dann diese seltsame neue Pflanze, die unzweifelhaft ein Abkömmling des ordinären Leinkrauts war? Linné zog einen gewagten Schluss. Er behauptete, Peloria sei ein Hybrid, also das Resultat der Befruchtung einer normalen Linaria-vulgaris-Pflanze durch eine unbekannte zweite Pflanzenart, die er allerdings nie benennen konnte. Das Besondere dieser neuen Hybridpflanze war, dass sie Samen hervorbrachte und offenbar in der Lage war, sich selbst zu vermehren, anders als etwa Maultiere, Kreuzungen aus Pferd und Esel, die stets unfruchtbar blieben. »Als Konsequenz folgt daraus eine fantastische Schlussfolgerung«, schrieb Linné in seiner Abhandlung. »Es kann geschehen, dass innerhalb des Pflanzenreichs neue Arten entstehen.«[9]
Neue Arten? Entstanden nach Gottes vollkommener Schöpfung? Glücklich wurde Linné mit dieser »fantastischen Schlussfolgerung« nicht. Kirchlichen Kreisen waren seine anzüglichen Beschreibungen der pflanzlichen Sexualität schon immer ein Dorn im Auge gewesen. Jetzt schlug ihm helle Empörung entgegen. »Ihre Peloria hat jeden verärgert«, schrieb ihm 1745 ein späterer Bischof.
Bald tauchten zudem neue Pflanzen auf, die gleichzeitig normale und pelorische Blüten trugen, ja, sogar verschiedene Übergangsformen zwischen den beiden Gestalten. Die Hybridtheorie ließ sich nicht aufrechterhalten. Linné war konsterniert. Was ging hier vor? Ungnädig mit sich selbst, schrieb er später in seiner Flora Suecica, »eine dumme Beschreibung« dieses außergewöhnlichen Gestaltwandels könne man in seiner Arbeit über Peloria nachlesen.[10] Linnés Sohn verriet einem deutschen Botaniker, sein Vater wolle von dieser Pflanze, die seine Erwartungen bitter enttäuscht habe, nichts mehr hören.
Als aufgeklärte Bürger des 21.Jahrhunderts hegen Sie sicher schon lange einen Verdacht: Was den großen Schweden so in Aufregung versetzt hat, war vermutlich eine schlichte Mutation. Aber gemach.
Zum einen kann man Linné seine Unkenntnis kaum vorwerfen. Alles, was wir heute über Vererbung und Evolution wissen, lag damals weit außerhalb seines Horizonts. Erst 1888, fast 150Jahre nach Linnés Peloria-Abhandlung, verwendete der deutsche Biologe Wilhelm Waldeyer zum ersten Mal das Wort Chromosom, wobei er allerdings, aus heutiger Sicht, nur eine außerordentlich vage Vorstellung davon hatte, wozu diese winzigen Kernfäden gut sind.
Zum anderen wird sich herausstellen, dass die Lösung des Rätsels weit komplizierter ist, als Sie vielleicht denken.
Linnés Pflanzenmonster blieb der Wissenschaft erhalten und beschäftigte über die Jahrzehnte viele große Geister. Goethe hinterließ der Nachwelt eine Zeichnung der beiden Blütenformen des Leinkrauts und fand, die Bezeichnung Monster sei von Linné sehr treffend gewählt. Aber aus Peloria, dem erstaunlichen Einzelfall, wurde mit der Zeit der Pelorismus, ein Phänomen, das viel weiter verbreitet war, als es zunächst den Anschein hatte. Immer mehr Pflanzenarten wurden entdeckt, mit denen Ähnliches geschah, viele davon aus der unmittelbaren Verwandtschaft des Leinkrauts. Auch bei ihnen tauchten scheinbar aus dem Nichts abweichende Blütengestalten auf, die sie zum Teil über keimfähige Samen weitervererbten. Besonders das als Gartenpflanze geschätzte Löwenmäulchen, Antirrhinum, sollte in diesem Zusammenhang zu einem Liebling der Forscher werden.
Einer, der mit dem Löwenmaul experimentierte, war Charles Darwin. In seinem 1868 erschienenen Buch The Variation of Animals and Plants Under Domestication berichtet er über eigene Kreuzungsversuche. Die Veröffentlichung seines Hauptwerks On the Origin of Species lag erst neun Jahre zurück, und noch immer erzitterte die Welt unter dem heftigen Schlagabtausch, den sich Gegner und Befürworter der Darwin’schen Gedanken lieferten. Die Wandelbarkeit der Arten, die Linné in Gestalt eines einzigen Gewächses, seiner Peloria, entgegentrat, war durch den Engländer 100Jahre später zum allumfassenden Prinzip des Lebendigen erhoben worden.
[2] Goethes Zeichnung der Peloria, links daneben das normalblütige Leinkraut.
Pflanzen- und Tierarten produzieren zu allen Zeiten einen Überschuss an Nachkommen. Diese sind aber keineswegs identisch und bloße Kopien ihrer Eltern, sondern unterscheiden sich in ihren Eigenschaften und Fähigkeiten. Es ist die Natur, die aus diesen Varianten die Bestangepassten heraussucht. Wer mit den Anforderungen, die Naturgesetze, Fressfeinde und Konkurrenten stellen, besser zurechtkommt als andere, wird mehr Nachkommen haben und somit die Eigenschaften, denen dieser Vorsprung zu verdanken ist, in größerer Zahl an folgende Generationen weitergeben. Evolution ist das Ergebnis von Überschuss, Variation und natürlicher Selektion.
Darwin hegte große Hochachtung für Linnés Arbeit, und natürlich kannte er das Phänomen der pelorischen Blüten, aber in seinem epochalen Werk erwähnte er sie mit keinem Wort.
Er wusste, was er den Menschen mit seiner Theorie zumutete, deshalb hatte er die Veröffentlichung lange hinausgezögert. Schon 1837 legte er ein erstes Notizbuch an, das sich mit der, wie er es nannte, Transmutation der Arten beschäftigte; über viele Jahre sammelte er Beweise, Beispiele und Argumente, um seine Thesen durch die Fülle der präsentierten Fakten überzeugend und unangreifbar zu machen. Er sammelte und arbeitete, bis ihm beinahe ein anderer, der auf seinen weiten Reisen zu ganz ähnlichen Ansichten gekommen war, zuvorzukommen drohte, sein Landsmann Alfred Russel Wallace. Als Darwin sich in dieser Situation und auf Drängen seiner Freunde aus der Wissenschaft endlich zur Veröffentlichung entschloss, gab er seinen ursprünglichen Plan eines mehrbändigen Werks auf und lieferte 1859 das, was er selbst in der Einleitung als »kurzen Auszug« bezeichnete, ein Auszug, der immer noch mehrere Hundert Seiten umfasste und zu einem der berühmtesten Bücher der Weltgeschichte wurde. Alles andere, einen Großteil seines im Laufe der Jahre zusammengetragenen Materials, legte er später in weiteren umfangreichen Schriften nach. Dazu gehörte vor allem das Buch, in dem von seinen Löwenmaul-Experimenten die Rede ist.
Es entstand in Down, einem kleinen Dorf in Kent. Die Darwins liebten das Landleben und hatten 1842, sechs Jahre nach Charles’ Rückkehr von seiner berühmten Weltreise mit der H.M.S. Beagle, der Hektik und schlechten Luft Londons den Rücken gekehrt. Darwin lebte hier bis zu seinem Tod ein zurückgezogenes Leben als Privatgelehrter, ein chronisch magenkranker, aber begüterter gentlemen naturalist oder, wie er sich selbst einmal beschrieb, ein »Millionär von seltsamen und wunderlichen kleinen Tatsachen«.[11] Nie hielt er einen öffentlichen Vortrag, nie besuchte er das europäische Festland. In diesen vier arbeitsreichen Jahrzehnten spielte der Garten des alten Pfarrhauses eine wichtige Rolle, als Ort der Entspannung und Schauplatz zahlreicher Beobachtungen und Experimente.
Die Variabilität der Arten war eine der entscheidenden Voraussetzungen für Darwins Lehre. Pflanzen- und Tierzüchter hatten gezeigt, zu welchen erstaunlichen Ergebnissen es führen kann, wenn man auf der Basis der natürlicherweise vorhandenen Variationen eine sorgfältige Zuchtwahl vornahm. »Wir müssen annehmen«, schrieb Darwin, »dass eine ungeheure Anzahl von Charakteren, welche der Entwicklung fähig sind, in jedem organischen Wesen verborgen liegen.«[12] Aber woher kam dieser Variantenreichtum, welche Eigenschaften und Gesetzmäßigkeiten steckten dahinter, und wo lag die Grenze?
Das Löwenmaul hatte, wie das Leinkraut, die Fähigkeit, zwei vollkommen unterschiedliche Blütengestalten hervorzubringen: die normale und, sehr viel seltener, die pelorische Blüte, in der Darwin die ursprüngliche Form erkannt zu haben glaubte, gewissermaßen das Urlöwenmaul.
Im Garten von Down House legte er ein großes Beet mit pelorischem Löwenmaul an und befruchtete die Pflanzen künstlich mit ihren eigenen Pollen. Aus den so gewonnenen Samen wuchsen Pflanzen, die wieder ausschließlich pelorische Blüten hervorbrachten. Kreuzte er sie jedoch mit normal blühendem Löwenmaul, zeigte der Nachwuchs nicht eine einzige Monsterblüte. Erstaunliches geschah, als er diese Pflanzen sich selbst überließ, denn im nächsten Jahr tauchten die Monster wieder auf, und zwar ziemlich genau im Verhältnis 1:3. Von 127Pflanzen waren 37 pelorisch. Darwin maß diesem Ergebnis allerdings keine große Bedeutung zu.[13]
Im tschechischen Brünn hätte es zur selben Zeit jemanden gegeben, dem dieses Zahlenverhältnis sofort bekannt vorgekommen wäre. Der Mönch Gregor Mendel hatte in seinem Klostergarten in jahrelangen Kreuzungsexperimenten einige fundamentale Gesetze der Vererbung entdeckt und 1866 in den Verhandlungen des naturforschenden Vereins zu Brünn veröffentlicht, aber kaum jemand hatte davon Notiz genommen, auch Darwin nicht, der stattdessen eine eigene, recht eigenwillige Theorie der Vererbung entwickelte, die Pangenesis-Hypothese, die heute nur noch für Wissenschaftshistoriker von Interesse ist. Umgekehrt entging Mendel, dass Darwin in seinen Versuchen mit dem Löwenmaul exakt bestätigte, was auch seine eigenen Experimente ergeben hatten. Er kannte Darwins Buch über die Domestikation von Pflanzen und Tieren, versah es sogar mit vielen Randbemerkungen und Kommentaren, aber das Kapitel, in dem es um die Peloria-Versuche geht, zeigt keine Eintragungen.
Zwei bedeutende Erneuerer der Biologie, Zeitgenossen, die sich gegenseitig hätten inspirieren können, forschten aneinander vorbei. Wäre die Geschichte der Wissenschaft anders verlaufen, wenn Mendel sorgfältiger gelesen und Darwin gründlichere Literaturrecherchen durchgeführt hätte?
Im Lichte der Mendel’schen Forschung stellt sich das, was Darwin mit seinem Löwenmaul-Experiment zutage förderte, als klassischer dominant-rezessiver Erbgang dar. Offenbar entscheidet ein einziger Erbfaktor darüber, heute würden wir sagen ein Gen, welche Blütengestalt die Pflanzen hervorbringen. Dabei dominiert der Faktor für die normale Blüte über die pelorische Variante, nur er kann sich ausprägen. Mendel berief sich auf neue Erkenntnisse der Zellbiologie, als er annahm, dass sich bei der Befruchtung »je eine Keim- und Pollenzelle zu einer einzigen Zelle« vereinigten, aus der dann eine neue Pflanze heranwuchs.[14] Daher lag jeder Erbfaktor in einer mütterlichen und einer väterlichen Variante vor. Darwin hatte bei Selbstbefruchtung von pelorischem Löwenmaul nur Monsterblüten erhalten. Anscheinend konnte das Merkmal sich ausprägen, wenn es reinerbig vorlag. Traf es, wie im Falle der Kreuzung, mit seinem normalen Pendant zusammen, wurde es von dessen Dominanz unterdrückt, blieb aber im Verborgenen erhalten, denn als Darwin die Hybriden untereinander kreuzte, tauchten die pelorischen Blüten wieder auf. Die Nachkommen hatten jeweils eine 50-prozentige Chance, von den Eltern das Monster-Gen zu erben. Nach Mendel sollten also ein Viertel aller Pflanzen wieder Pelorien hervorbringen, was sie, im Garten von Darwins Down House, auch taten.
Weder Darwin noch Mendel wussten, welcher Natur die Erbfaktoren waren, die für die Weitergabe der elterlichen Merkmale an kommende Generationen verantwortlich waren. Auch 40Jahre später, im beginnenden 20.Jahrhundert, als Hugo de Vries – Pflanzenphysiologe an der Universität Amsterdam und, wie seinerzeit Linné, Direktor eines Botanischen Gartens – mit pelorischen Pflanzen zu experimentieren begann, tappte man, was die materielle Basis der Vererbung anging, im Dunkeln. Aber de Vries, der als einer der Wiederentdecker der Arbeiten Mendels in die Geschichte einging, lieferte weitere Mosaiksteine zur Lösung des Rätsels.
»Als Mutationstheorie«, schrieb er in der Einleitung zu seinem gleichnamigen Werk, »bezeichne ich den Satz, dass die Eigenschaften der Organismen aus scharf voneinander getrennten Einheiten aufgebaut sind (…) Übergänge (…) gibt es zwischen diesen Einheiten ebenso wenig wie zwischen Molekülen der Chemie.«[15] Diese Einheiten konnten sich jedoch stoßweise verändern oder plötzlich neu entstehen, sodass die betroffenen Pflanzen wie aus dem Nichts über neue Eigenschaften verfügten, ein Vorgang, den de Vries als Mutation bezeichnete und als entscheidenden Grund für das Entstehen neuer Arten ansah. Damit hatte das Phänomen der plötzlich auftauchenden pelorischen Blüten einen Namen bekommen. Und es schien nur ein Beispiel von vielen zu sein, eine spezielle Erscheinungsform eines sehr viel allgemeineren Prinzips: Lebewesen mutieren, sie verändern sich.
Hugo de Vries stellte eine lange Liste von Pflanzenarten zusammen, bei denen man das Auftreten pelorischer Blüten beobachtet hatte. Häufig waren diese ungewöhnlichen Blütenbildungen die Folge einer Veränderung der Umweltbedingungen. Er beschrieb sehr variable Übergangsformen, die er »Hemipeloria« nannte – Pflanzenindividuen, bei denen sich sowohl in der Natur als auch im Gewächshaus unter vielen normalen einzelne pelorische Blüten fanden. Und er entdeckte eine weitere Mutante des Leinkrauts (genannt Anectaria), die sich ebenfalls über die Samen weitervererbte. Wie oft sie auftrat, konnte de Vries nicht ermitteln. Dafür bestimmte er in umfangreichen Pflanzungen die Häufigkeit, mit der Linnés mittlerweile klassische Peloria auf der Bildfläche erschien. Von 1750 Pflanzen, die zur Blüte kamen, entpuppten sich 16 als Monster, etwa ein Prozent. Aus Sicht heutiger Erkenntnisse wäre das eine sehr hohe Mutationsrate.[16]
Etwa zur selben Zeit, als de Vries seine »Mutationstheorie» veröffentlichte, erkannte man, dass die Gene in den Chromosomen der Zellkerne lokalisiert sind. Da Chromosomen zu etwa gleichen Teilen aus Proteinen und einem Stoff mit dem unaussprechlichen Namen Desoxyribonukleinsäure, kurz DNA, bestanden, musste eine dieser Verbindungen der chemische Träger der Erbinformation sein. Die meisten Forscher waren damals der Meinung, dass dafür nur die Proteine infrage kämen. Nur sie schienen über die Eigenschaften zu verfügen, die man von einem Kandidaten für diese höchst anspruchsvolle Aufgabe erwartete. Der DNA traute man nur eine stabilisierende Funktion zu. Sie war gewissermaßen das Rückgrat, das den Chromosomen ihre Struktur verlieh, »der hölzerne Rahmen hinter dem Rembrandt«, wie ein Kommentator damals schrieb.[17] Erst 1944 brachte ein berühmtes Experiment von Oswald Avery und seinen Mitarbeitern am Rockefeller Institute for Medical Research den entscheidenden Hinweis, dass die Forscher lange auf das falsche Pferd gesetzt hatten.
Seit einigen Jahren war bekannt, dass Bakterien Erbinformationen, wie immer die nun chemisch beschaffen sein mochten, aus dem umgebenden Medium aufnehmen und für sich selbst nutzbar machen konnten. Ein harmloser Stamm von Diplococcus pneumoniae, den man in Kontakt mit abgetöteten und zerstörten Zellen eines virulenten, also krank machenden Stammes, brachte, konnte plötzlich selbst eine Lungenentzündung auslösen – das Lamm mutierte zum Löwen. In dem Extrakt der ansteckenden Erreger musste sich irgendein »transformierendes Prinzip« befinden, das die ehemals harmlosen Zellen veränderte. Avery und seine Mitarbeiter setzten Enzyme zu, die alle Proteine verdauten, doch die als Versuchstiere benutzten Mäuse starben trotzdem. Proteine konnten demnach nicht für die Umformung der Zellen verantwortlich sein. Blieb nur die DNA. Und tatsächlich: Als die Forscher in einem weiteren Versuch statt der Proteine die DNA des Zellextrakts zerstörten, blieben die Nager am Leben. Das »Alphabet des Lebens« bestand also nicht aus 20Aminosäuren, den Bausteinen der Proteine, sondern aus nur vier Buchstaben – aus Adenin, Thymin, Guanin und Cytosin (A, T, G und C), den sogenannten Basen der DNA.
Am 7.März 1953 gelang James Watson und Francis Crick »der wichtigste Durchbruch in der Biologie während des 20.Jahrhunderts«[18], die Aufklärung der Doppelhelix-Struktur der DNA und des überraschend einfachen Mechanismus ihrer Verdopplung, die jeder Zellteilung vorausgeht. Das lange fadenförmige DNA-Molekül sieht aus wie eine gewundene Strickleiter. Die Sprossen dieser Strickleiter werden jeweils von einem Basenpaar gebildet, das durch eine relativ lockere chemische Bindung aneinandergekoppelt ist, in den beiden Seitensträngen wechseln sich Phosphatgruppen und Zuckermoleküle ab, an denen jeweils eine Base hängt. Den besonderen Clou dieser Konstruktion erkannten Watson und Crick in der festen Basenpaarung. Denn zur Bildung der Strickleitersprossen können sich die vier Basen der DNA nicht beliebig miteinander verbinden, sondern jede Base nur mit genau einem Partner: Adenin mit Thymin, Cytosin mit Guanin (und umgekehrt). Aus der Basenfolge eines DNA-Strangs ergibt sich also zwangsläufig die des anderen. Stellt man sich nun vor, der Doppelstrang würde sich wie ein Reißverschluss auftrennen, dann existiert nur eine Möglichkeit, die beiden Einzelstränge aus dem Vorrat der Zelle wieder zu vollständigen Strickleitern zu ergänzen. Aus einem DNA-Molekül sind durch die feste Basenpaarung zwei identische Tochtermoleküle entstanden.
Wenige Monate nach dem Geniestreich von Watson und Crick stieß ein schwedischer Botaniker am Originalfundort in Roslagen erneut auf eine Population von pelorisch blühendem Leinkraut.[19] Linnés Monster hatte sich dort also über 200Jahre gehalten. Mittlerweile füllte die Literatur über Mutationen bei Pflanzen ganze Regale. Das Rätsel schien weitgehend gelöst. Was noch fehlte, war sozusagen die molekularbiologische Feinarbeit, die Identifizierung des von der Peloria-Mutation betroffenen Gens und die Aufklärung seiner Basensequenz.
Machen wir also einen weiten Sprung in die Jetztzeit, ins Zeitalter der Sequenzierroboter, der Entzifferung des Genoms von Mensch, Schimpanse, Hefepilz und Honigbiene, des genetischen Fingerabdrucks und der gezielten Genmanipulation. Überspringen wir die vielfach nobelpreisgeadelten Leistungen ganzer Generationen von Wissenschaftlern, die der Natur Stück für Stück die Geheimnisse der Vererbung entrissen und dabei Dinge zutage förderten, von denen Linné, Darwin, Mendel und de Vries nicht einmal zu träumen gewagt hätten. Mit den Möglichkeiten moderner Labortechnik müsste es doch ein Leichtes sein, das letzte Kapitel in der langen Geschichte des Leinkraut-Monsters zu schreiben, die Buchdeckel zu schließen und das Ganze endlich ins Regal der Wissenschaftsgeschichte zu stellen.
Im John Innes Centre in Norwich, England, machte sich das Laborteam von Enrico Coen an die Arbeit. Wenige Jahre zuvor hatte man im Erbgut des Löwenmauls ein Gen namens CYCLOIDEA identifiziert, das die Symmetrie der Blüten kontrolliert (s. Kap. 5).[20] Es lag also nahe, nach einer Entsprechung beim Leinkraut zu suchen. Enrico Coen, Pilar Cubas und Coral Vincent isolierten die DNA aus jungen Blättern normalblütiger und pelorischer Pflanzen, suchten und fanden das Gen, schnitten es mit chemischen Messern in Stücke, sortierten die Fragmente, klonierten und vervielfältigten, setzten also die ganze raffinierte Maschinerie ihrer molekularbiologischen Hexenküche in Gang und hielten schließlich nach vielen Arbeitsschritten die automatisch ermittelten Sequenzen des LCYC genannten LeinkrautGens in der Hand. Sie verglichen die Basenfolge der beiden Genvarianten und fanden … nichts.
Die DNA-Sequenz dieser so unterschiedlich aussehenden Pflanzen ist identisch.[21] Peloria ist weder eine neue Art, wie Linné vermutete, noch eine Mutation, denn in beiden Fällen hätten sich die DNA-Sequenzen der Leinkraut-Varianten unterscheiden müssen. Stellt sich natürlich die Frage: Was ist sie dann?
Überrascht? – Enrico Coen und seine Mitarbeiter in Norwich waren überrascht. Da sie dies in ihrem 1999 in der Zeitschrift Nature veröffentlichten Aufsatz über Peloria explizit zum Ausdruck brachten, dürfte ihre Verblüffung tatsächlich groß gewesen sein. Bisher hatte man nur im Labor erzeugte Mutanten analysiert und »es war unklar, wie diese sich zu Mutanten in natürlichen Populationen verhielten«, wo unter den Bedingungen der natürlichen Selektion ganz andere Verhältnisse herrschen. Und dann, bei »der ersten natürlichen morphologischen Mutante, die charakterisiert wurde«, einer Pflanze noch dazu, die über zweieinhalb Jahrhunderte viele große Geister der Wissenschaft beschäftigt hatte, erhielten Coen und seine Kollegen dieses unerwartete Ergebnis: keine DNA-Sequenzunterschiede wie bei den bislang untersuchten Labormonstern. Identische Gene. »It is surprising.«[22]
Bei den Blüten handelt es sich nicht um irgendein unbedeutendes Merkmal. Das ganze Linné’sche Ordnungssystem basierte auf ihrer Anatomie, der Zahl und Struktur von Staubfäden und Fruchtblättern. Sie waren die entscheidende Neuentwicklung, die der größten, mehrere Hunderttausend Arten zählenden Gruppe von Gewächsen ihren Namen gab: den Blütenpflanzen. Die blühende Pflanze – für die meisten Menschen ist das die Pflanze schlechthin. Die Entwicklung der Blüte war ein wichtiger Schritt zur Eroberung des Landes und vermutlich der Grund für den überragenden Erfolg der sie hervorbringenden Gewächse, die heute einen Großteil der sichtbaren Pflanzenwelt ausmachen. Blüten ermöglichten die Bestäubung durch Tiere und lösten eine rasante, sich wechselseitig stimulierende Evolution von Pflanzen und ihren Bestäubern aus, die zum Teil aufs Engste miteinander liiert sind. (Man spricht von Koevolution.) Es scheint kaum vorstellbar, dass ausgerechnet dieses Organ von einer Gestalt in eine gänzlich andere umschlagen kann – man denke nur an Linnés Bild vom Kalb mit dem Wolfskopf –, ohne dass sich dies in einer Veränderung des genetischen Informationsträgers, der DNA, niederschlagen würde. Oder anders formuliert: Wenn unterschiedliche Gestalten einer so wichtigen Struktur nicht auf unterschiedliche DNA-Sequenzen zurückzuführen sind, was ist die Milliardensummen verschlingende Sequenziererei der letzten Jahre dann noch wert? Und was ist mit all den anderen, unendlich vielgestaltigen Strukturen im Tier- und Pflanzenreich? Identische Gene?
Noch etwas kommt hinzu. Die Merkmalsvariationen sind das Material, mit dem die natürliche Selektion arbeitet. Sie entscheiden über Erfolg oder Misserfolg eines Organismus, über die Zahl und das Überleben seiner Nachkommen, über das, was die Biologen Fitness nennen. Und die Variabilität der verschiedenen Merkmale, ob Blütengestalt, Hautfarbe oder Kältetoleranz, beruht auf der Variabilität der Gene, die ihnen zugrunde liegen. Sie sind es, die die Varianten in Gestalt bestimmter DNA-Sequenzen an kommende Generationen weitergeben.
Wie aber werden Merkmalsausprägungen vererbt, die keine genetische Basis haben?
Auch die überraschenden Ergebnisse aus Överkalix können nicht auf Mutationen und damit auf Veränderungen von Gensequenzen zurückgeführt werden. Darin liegt die Gemeinsamkeit zwischen Linnés Pflanzenmonster und den Zusammenhängen, auf die seine Landsleute von der Universität Umeå 250Jahre später stießen. Ein Mechanismus, der eine individuelle Erfahrung – und sei sie noch so einschneidend – zu Lebzeiten in die Buchstabenfolgen der DNA von Spermien und Eizellen übersetzt, ist nicht nur unbekannt, er liefe allen heutigen Vorstellungen zuwider. Eigentlich müssten Merkmale ohne genetische Basis mit dem Tod der sie tragenden Individuen unwiederbringlich verschwinden.
Doch obwohl Wildtyp und Mutante sich genetisch nicht unterscheiden, wird die Fähigkeit zur Bildung pelorischer Blüten über viele Generationen weitergegeben.[23] Und das Essverhalten präpubertierender schwedischer Großväter findet ein generationsübergreifendes Echo, das es gar nicht geben dürfte.
Enrico Coen und seine Mitarbeiter hatten also gute Gründe, überrascht zu sein. Wir alle haben Grund dazu.
3. HUGO und das große Schweigen
Nach dem unerwarteten Ende der Peloria-Geschichte und den erstaunlichen Ergebnissen aus Schweden drängt sich ein Verdacht auf, der im Zeitalter der Genomsequenzierungen geradezu ketzerisch klingt: Stehen den Organismen etwa, über die Basenfolge der DNA hinaus, weitere Methoden der Speicherung und Weitergabe biologisch relevanter Informationen zur Verfügung? Noch vor wenigen Jahren hätte man eine ungläubig gekräuselte Stirn zu sehen bekommen, wenn man gewagt hätte, diesen Verdacht zu äußern. Marcus Pembrey und seine schwedischen Kollegen können ein Lied davon singen. Aber die Zeiten haben sich geändert. Heute scheint dieser Verdacht mitten ins Herz der Forschung zu zielen. Denn diese Methoden gibt es tatsächlich, auch wenn sie in den letzten Jahren nicht gerade im Rampenlicht der Medien standen. Einige davon sind schon seit vielen Jahren bekannt, ihre wahre Bedeutung beginnt sich aber erst jetzt abzuzeichnen. Angesichts der überall betonten überragenden Rolle der Lebenswissenschaften im Allgemeinen und der molekularen Genetik im Besonderen – wie konnte es geschehen, dass man so wenig davon gehört hat?
Die Beantwortung dieser Frage erfordert einen Exkurs, der viel über das heutige Verhältnis von Wissenschaft und Öffentlichkeit erzählt. Gleichzeitig macht er mit einem wissenschaftlichen Megaprojekt bekannt, das die molekulare Genetik methodisch und inhaltlich auf eine neue Grundlage stellte und die Medienberichterstattung der Jahrtausendwende in einer Weise beherrschte, wie man es seit der Mondlandung der Amerikaner nicht mehr erlebt hatte. Gemeint ist das 1990 in den USA aus der Taufe gehobene Human Genome Project (dt. Humangenomprojekt, kurz HGP).[1] In einem auf fünfzehn Jahre angelegten Kraftakt sollten sämtliche Gene des Menschen identifiziert und die Sequenz seiner 3,2Milliarden DNA-Bausteine ermittelt werden. Parallel dazu galt es, die für die Bewältigung dieser Aufgabe erforderliche Technologie zu entwickeln. Über drei Milliarden Buchstaben, das entspricht einer stattlichen Bibliothek von 3.200 dicken Bänden, von denen jeder 500 dicht bedruckte Seiten enthält. Ein Mensch, der dies alles lesen wollte, müsste sich zwischen seinem zehnten und siebzigsten Lebensjahr jede Woche ein neues Buch vornehmen. Das menschliche Erbgut ist immerhin zehntausendmal größer als alles, was man bis zu diesem Zeitpunkt sequenziert hatte.[2]
Die Fixierung auf die Sequenz der DNA-Bausteine war so absolut, dass kaum Raum für differenziertere Betrachtungen und einen Blick über den Tellerrand blieb. Ende der 1990er-Jahre geisterten beinahe jeden Tag spektakuläre Gen-Neuentdeckungen durch die Presse. Eine verwirrte Öffentlichkeit erfuhr von Genen für Homosexualität, für Gewalttätigkeit, Alkoholismus und Depression, um nur einige aufzuzählen. »Wir hatten im Rahmen des Humangenomprojekts sicherlich so etwas wie einen aufkommenden genetischen Determinismus«, sagt Achim Plum, Sprecher eines bekannten Berliner Biotechunternehmens, »also den Glauben, dass die Gene für alles verantwortlich sind.«[3] Die lange Zeit offene und heftig diskutierte Frage: Veranlagung oder Umwelt?, Nature or nurture?