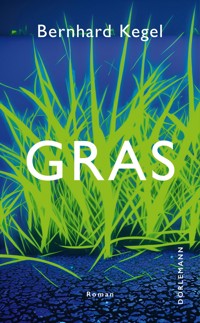9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: DUMONT Buchverlag
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Graureiher jagen neben einer Berliner U-Bahn-Station, Füchse dösen im Kölner Klingelpützpark in der Sonne, und vom Aussterben bedrohte Graukopf-Flughunde hängen in den Bäumen nahe der Oper von Sydney. Unübersehbar drängt die Wildnis in die Städte, ehemals scheue Tierarten werden Teil der Stadtnatur. Dabei findet sich zwischen Stein, Beton und Asphalt eine erstaunliche Vielfalt der Arten. Nirgendwo lassen sich so viele heimische Vogelarten (mehr als 150) auf so kleiner Fläche beobachten wie in Berlin – schon gar nicht in der viel gerühmten, aber intensiv genutzten freien Natur. Wie ist das zu erklären? Sind unsere Städte zu Oasen aufgeblüht, während das Land ringsherum zur Agrarwüste verkommt? Was sagt diese Vielfalt über die Qualität der Lebensräume in Stadt und Land aus? Was müssen Tiere mitbringen und wie müssen sie sich verändern, um in unserer Nachbarschaft überleben zu können? Und wie beeinflussen diese Begegnungen unseren Umgang mit der Natur? Mit eindrucksvollen, höchst anschaulich erzählten Geschichten nimmt uns Bernhard Kegel mit auf Forschungsreise in die Stadtnatur und öffnet unsere Augen für die Wildnis vor unserer Haustür.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 568
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Bernhard Kegel
TIERE IN DER STADT
Eine Naturgeschichte
eBook 2013
© 2013 DuMont Buchverlag, Köln
Alle Rechte vorbehalten
Umschlag: Zero, München
Umschlagabbildung:
© FinePic®; München / © plainpicture/Wild Wonders
Satz: Fagott, Ffm
eBook-Konvertierung: CPI – Clausen & Bosse, Leck
ISBN eBook: 978-3-8321-8736-1
www.dumont-buchverlag.de
Wenn Sie eine Stadt wie Tokyo auf den Kopf stellten und kräftig schüttelten – Sie würden staunen, was da an Tieren herausfiele. Nicht nur Katzen und Hunde.
Yann Martel,
Einleitung – Drei Städte in drei Kontinenten
Ich sehe ihn fast jeden Tag und doch habe ich mich noch immer nicht an seinen Anblick gewöhnt. Jedes Mal halte ich an und steige kurz vom Fahrrad. Anderen geht es genauso. Oft sehe ich Spaziergänger, die sich gegenseitig auf ihn aufmerksam machen und staunend stehen bleiben, um ihn aus nächster Nähe zu beobachten. Hinter ihm, im Park, sonnen sich an warmen Tagen müßige Großstädter auf der Wiese, spielen Kinder, führen Herrchen und Frauchen ihre Hunde spazieren, nähern sich lärmend Kindergartengruppen, um die Enten zu füttern – es scheint ihn nicht im Geringsten zu stören. Er stakst weiter am Rand des Schilfs entlang oder durch den flachen Uferbereich und fixiert dabei die Wasseroberfläche. Die Enten, auf die er aus einem Meter Höhe herabschaut, halten respektvoll Abstand.
Manchmal, vor allem morgens und am späten Nachmittag, kann man ihn mit seinen langen, dünnen Beinen hoch oben auf den langen, dünnen Ästen einer Trauerweide balancieren und sein Gefieder putzen sehen. Er ist immer allein, nie taucht ein Gefährte oder eine Gefährtin auf. Er hat dieses seltsame kleine Gewässer ganz für sich. Verbringt er die Nacht auf dem Baum? Oder schläft er irgendwo in Gesellschaft seiner Artgenossen, im Schutz der Kolonie, um dann fast jeden Tag hierherzufliegen, in sein eigenes kleines Reich, sein großstädtisches Jagdrevier an diesem geschichtsträchtigen Ort inmitten der deutschen Hauptstadt?
Nur einen Steinwurf entfernt, im Schöneberger Rathaus, schlug das politische Herz des alten West-Berlins. Auf seinem Balkon sprach John F. Kennedy am 26.Juni 1963 vor Zehntausenden von Menschen die berühmten Worte: »Ich bin ein Berliner«, stimmten am 10.November 1989 Bundeskanzler Helmut Kohl, Willy Brandt, Hans-Dietrich Genscher, Bürgermeister Walter Momper und andere gegen ein gellendes Pfeifkonzert eine denkwürdig verunglückte Fassung der deutschen Nationalhymne an. Helmut Kohl zeigte sich später ob der »linken Chaoten« nachhaltig verstimmt. Er hatte extra seine wichtige Polenreise unterbrochen, um nach Berlin zu kommen. Wenige Stunden zuvor war die Mauer gefallen.
Damals gab es unseren gefiederten Parkbesucher vermutlich noch nicht, obwohl die Tiere über dreißig Jahre alt werden können. Damals waren Graureiher in Berlin eine Seltenheit. Am östlichen Stadtrand gab es einige wenige Brutkolonien, für West-Berliner nahezu unerreichbar, heute müsste man nur ein paar Stationen mit der U-Bahn fahren. Im Jahr 2001 wurde in der Nähe der Robbenanlage des Zoologischen Gartens das erste innerstädtische Brutpaar beobachtet – und urbane Vogelfreunde sind in diesen Dingen sehr genau.
So gelassen, wie der stattliche Vogel sich jetzt gibt, würden ihn wohl auch die Buhrufe und Pfiffe Tausender Berliner nicht aus der Ruhe bringen. Ob man das auch über die Graureiher der 1960er-Jahre hätte sagen können, ist zu bezweifeln. Irgendetwas ist mit den Vögeln geschehen. Noch in den Kriegs- und Nachkriegsjahren wurden die Tiere landesweit intensiv verfolgt und die Bestände gingen stark zurück. Angler und Fischwirte sahen in den Reihern Konkurrenten, andere in Zeiten der Not nur potenzielle Nahrung. Doch als man Schonzeiten einführte, erholten sich die Bestände und mit ihrem Comeback zeigten die Graureiher plötzlich ein verändertes Verhalten. Nun drangen sie auch in Gebiete vor, die sie vorher wegen der Menschen gemieden hatten. Seit Mitte der 1990er-Jahre brüten sie im Ruhrgebiet und immer häufiger sind sie in Städten zu sehen. Ihre Fluchtdistanz verringerte sich auf wenige Meter. In Amsterdam warten sie auf Bürgersteigen darauf, von den Menschen mit Fischen gefüttert zu werden.1
Der kleine künstliche Teich, den sich unser Berliner Exemplar ausgesucht hat, ist erst vor wenigen Jahren gründlich saniert worden. Sein Boden wird von einer riesigen Plastikfolie gebildet, die an einigen Uferstellen zu sehen ist und unschöne dreckige Falten schlägt, was jede Illusion zerstört, dass man es hier mit einem halbwegs natürlichen Gewässer zu tun hat. Da hilft auch das an einer Seite gepflanzte Schilf nicht. Der Teich befindet sich am östlichen Ende eines schmalen, lang gestreckten Parks und grenzt unmittelbar an eine brückenartig gestaltete U-Bahnstation, die den Park in zwei ungleiche Hälften teilt. Durch große Glasscheiben können Parkbesucher die Züge zählen, die hier im Zehn-Minuten-Takt in den Bahnhof einfahren. Umgekehrt eröffnen sich den Fahrgästen, die in einer haltenden U-Bahn sitzen oder auf dem Bahnsteig warten, ungewöhnliche Blicke ins Grüne und damit auf den Teich und seinen Reiher. Ob es eine Sie oder ein Er ist, kann ich nicht sagen. Männliche und weibliche Tiere sind praktisch nur an der Größe zu unterscheiden.
Auf der Brücke, eine Etage über den U-Bahnfahrern, stehen Parkbänke, auf denen einige Hauptstädter diesen warmen Mainachmittag genießen, und von hier oben werde ich Zeuge, wie der manchmal auch Fischreiher genannte Vogel diesem Namen alle Ehre macht und erstmals sein wahres Gesicht zeigt. Er ist eben nicht hier, weil ihn deutsche Geschichte interessiert oder weil er die Gesellschaft der Menschen so schätzt, sondern weil diese den Teich mit großen Goldfischen bevölkert und darin sogar ihre in Ungnade gefallenen Haustiere entsorgt haben, wie die Anwesenheit mindestens einer Schildkröte beweist, die ich kürzlich durchs trübe Wasser paddeln sah.
Der Reiher steht regungslos im Schilf, wie so oft, plötzlich nimmt er ausgiebig maß und stößt zu. Im nächsten Moment zappelt etwas in seinem langen, spitzen Schnabel. Er hat ein Prachtexemplar erwischt, leuchtend rot und unterarmlang. Fast sieht es so aus, als begutachte er stolz seine Beute, als lege er Wert darauf, dass auch alle Zuschauer sie bestaunen. Es dauert eine Weile, bis er sie in die richtige Position befördert hat. Dann verschwindet der Fisch, mit dem Kopf voran, im scheinbar viel zu dünnen Hals.
»Wohl bekomm’s«, kommentiert ein älterer Herr, der neben mir an der steinernen Balustrade steht.
Ein anderer kann es gar nicht fassen. »Der hat eben ’n janzen Fisch vaschluckt«, sagt er verblüfft. Seine Stimme klingt amüsiert, aber es schwingt auch ein wenig Befremden mit. Darf man das – in einem öffentlichen Park und vor aller Augen einen friedlichen Zierfisch verschlingen? Wir tauschen einige stumme Blicke aus, als müssten wir uns gegenseitig vergewissern, dass wir das ungewöhnliche Schauspiel nicht geträumt haben. Fressen und Gefressenwerden mitten im Volkspark – was soll man davon halten?
Auch auf der anderen Seite des Erdballs, in den Metropolen Australiens, sind Parks Oasen der Ruhe, die im hektischen Getriebe der Großstädte zu Entspannung und Müßiggang einladen. Und wie in Berlin wird diese Einladung nicht nur von Menschen angenommen. Was sich in Sydney, Melbourne, Brisbane und einigen kleineren australischen Städten bei Einbruch der Dämmerung in den Himmel schwingt, kann zwar ausgezeichnet fliegen, trägt aber keine Federn, frisst keinen Fisch und sitzt auch nicht. Solange die Sonne scheint, hängt es kopfüber von den Ästen, bewegungslos und stumm wie überdimensionierte schwarze Früchte.
In Sydney baumeln diese seltsamen Gebilde auch im zentralen Hyde Park zwischen Elisabeth und College Street in den Bäumen, direkt neben dem Australian Museum. Die große Masse der über 20.000Tiere hat sich aber den nahe gelegenen Botanischen Garten ausgesucht und verschläft dort, in unmittelbarer Nähe von Hochhäusern und der berühmten Oper, die Tage. Wenn es über der Skyline langsam dunkel wird und die Menschen Restaurants, Kinos und Theater ansteuern, erwachen sie zum Leben. Mit der Ruhe ist es dann vorbei. Bald kommen sich die nervösen und dicht an dicht hängenden Tiere in die Quere und es wird lautstark gezankt und gezetert. Wenig später füllt sich der Himmel mit schwarzen Batman-Silhouetten.
Mit einer Flügelspannweite von etwa einem Meter sind die Graukopf-Flughunde eine der größten Fledermaus-Arten der Welt. Sie leben nur in einem relativ schmalen Küstenstreifen im Osten und Südosten des Kontinents, und weil ihre Zahl in den letzten Jahrzehnten stark zurückgegangen ist, hat sie die International Union for Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN) 2008 in ihre Rote Liste der gefährdeten Tierarten aufgenommen. Unglücklicherweise bevorzugen auch die menschlichen Bewohner Australiens diesen Küstenstrich, was den Flughunden nicht gut bekommen ist. Wenn man sieht, wie sich die Tiere inmitten einer Millionenstadt zu Tausenden in die Lüfte schwingen, um während der Nacht bis in die Vorstädte auszuschwärmen, kann man kaum glauben, dass Mensch und Flughund sich nicht vertragen. In Städten scheinen andere Gesetze zu herrschen.
Als der britische Vogelkundler und Tiermaler John Gould in den 1830er-Jahren durch den Süden des Kontinents streifte, um Material für sein berühmtes 36-teiliges Werk The Birds of Australia zu sammeln, fielen ihm auch die großen »Vampire« auf, die »in den weiter abgelegenen Gebieten des Waldes schliefen«. Gut hundert Jahre später kämpfte sich der Biologe Francis Ratcliffe durch einen dichten Dschungel aus Palmen und Feigenbäumen auf den Gipfel des Mt. Tamborine in Queensland, etwa 80Kilometer südlich von Brisbane, wo er auf eine große Kolonie von Flughunden stieß. Das Dschungelgebiet existiert noch heute, als Teil eines Nationalparks, aber die Flughunde sind verschwunden. Sie haben es vorgezogen, an die nahe und dicht besiedelte Goldküste umzuziehen, nach Broadbeach, in die Nachbarschaft von Golfclubs und Spielcasinos. Einige von ihnen schlafen nur wenige Meter neben dem vierspurigen Gold Coast Highway.2
Vampire sind die seltsamen Flattertiere nicht, und anders als die nahverwandten Fledermäuse nutzen Flughunde (oder »Flying Foxes«, wie die Australier sagen) auch keine Echoortung, um Insekten zu jagen. Sie sind Vegetarier, ernähren sich von Früchten, Blüten und Nektar und sind dabei als Bestäuber und für die Verbreitung von Pflanzenarten, deren Samen sie über ihren Kot ausscheiden, von großer ökologischer Bedeutung.
Doch wegen der fruchtbaren Böden sind die ursprünglich an der Ostküste wachsenden artenreichen Wälder vielfach gerodet und durch Obst- oder Zuckerrohrplantagen ersetzt worden, in denen die Flughunde als Schädlinge gelten und auch so behandelt werden. Im trockenen Landesinneren, dem Outback, können sie nicht überleben. Das treibt die Tiere in Richtung Küste und in die Städte des Homo sapiens, zumal üppig blühende und früchtetragende Büsche und Bäume genau das sind, was Menschen bevorzugt in ihren Gärten und Parks pflanzen und mit Wasser- und Düngemittelgaben zu Höchstleistungen bringen. Außerdem erwiesen sich die Flughunde als flexibel. Was sie bisher nicht kannten oder verschmähten, in den Städten schmeckt es ihnen. Hier sind die Wege viel kürzer als in der Wildnis und die Tiere können nicht gejagt werden. Mit kleinen Sendern ausgestattete Flughunde steuerten nachts immer wieder die gleichen Straßen und besonders ergiebige Bäume an. »Sie kennen Brisbane wie jeder gute Taxifahrer«, versichert der australische Biologe und Autor Tim Low.3 Wohlgelitten sind sie deshalb noch lange nicht.
In Sydney will man die Flughunde nun, gegen den erbitterten Widerstand zahlreicher Naturschützer, vertreiben.4 Warum mussten sie sich auch ausgerechnet im ehrwürdigen Royal Botanical Garden niederlassen? Ihr ätzender Kot schadet den wertvollen alten Baumriesen. Im Gegensatz zu den Flughunden seien die nicht einmal in Australien heimisch, protestieren die Naturschützer, und wo sollen die Tiere denn hin? 30Palmen und 28Bäume sind schon abgestorben, 300 zeigen Schäden. Das gab schließlich den Ausschlag.
Doch was außerhalb der Städte wie von selbst vonstatten ging, will in Sydney einfach nicht gelingen. Man hat es mit stinkender Fischpaste und Blitzlichtern versucht – die Flughunde blieben. Dann wurden mit Pythonkot gefüllte Säckchen in die Baumkronen gehängt, die großen Schlangen sind Todfeinde der Flattertiere. Wieder ein Fehlschlag. Jetzt versucht man es mit Baulärm, der zur Schlafenszeit der Flughunde aus versteckten Lautsprechern schallt. Bisher hilft auch das nicht. »Vielleicht müssen wir den Krach noch lauter drehen«, seufzte Mark Savio, der Direktor des Botanischen Gartens.5 Mit der Ruhe ist es jedenfalls vorbei. Wie wohl die Besucher darauf reagieren?
Brisbane, Australien
Ein mächtiger, fast lautloser Jäger streift nächtens durch Australiens Metropolen, ein Raubvogel, den die Australier respektvoll »Powerful Owl« nennen. Auch der Riesenkauz Ninox strenua, die größte Eule des Landes, macht sich zunehmend das üppige Nahrungsangebot der Großstädte zunutze. Noch vor wenigen Jahrzehnten wurden Riesenkäuze als »hochgradig nervös, außerordentlich scheu und wachsam« beschrieben, als eine Vogelart dichter Bergwälder. Sie brauche riesige Reviere von über tausend Hektar und sei in mindestens zwei Bundesstaaten gefährdet, hieß es. Heute jagt sie im Zentrum von Sydney und Melbourne. In der Umgebung von Brisbane gibt es so viele Riesenkäuze wie noch nie in den letzten hundert Jahren. In ihren Gewöllen hat man Oppossumfell und Flughundknochen gefunden. Nicht selten erwischen sie eine Katze. Fressen und Gefressenwerden also auch hier, wenn auch im Schutze der Dunkelheit.6
Auf dem Rückflug von Australien könnten wir in Thailands Hauptstadt Bangkok Station machen. Auch hier gibt es Parks mit spektakulären Bewohnern. Urlauber berichten im Internet von riesigen Echsen, so groß wie Alligatoren. N24 verkündet: Warane prägen das Stadtbild in Bangkok. Das sollten wir uns nicht entgehen lassen.
Die ersten Eindrücke sind enttäuschend. In den überfüllten Straßen der Riesenstadt ist alles Mögliche zu sehen, nur keine Echsen. Doch im Lumphini-Park werden wir endlich fündig. Hier lungern sie tatsächlich auf den Uferwiesen herum, klettern auf Bäume und schlängeln sich durchs Wasser: Bindenwarane, Varanus salvator, eine der größten Echsen der Welt. So groß wie Alligatoren sind sie nicht, aber auch die fangen ja mal klein an. Bindenwarane, die in Südostasien über ein riesiges Gebiet verbreitet sind, können über drei Meter Körperlänge erreichen, im Lumphini-Park sind sie maximal einen bis anderthalb Meter lang. Immerhin. Im Vergleich zu unseren mitteleuropäischen Eidechsen sind Bangkoks Warane zweifellos Giganten.
Die Einheimischen rümpfen die Nase. Die Tiere gelten bei ihnen als die niedersten und dreckigsten Wesen überhaupt. Hia, ihr Name in Thai, ist eines der schlimmsten Schimpfwörter, das man sich in diesem schönen Land an den Kopf werfen kann. Bindenwarane scheinen sich noch im größten Dreck wohlzufühlen und sie fressen gelegentlich Aas.
Was viele Thailänder ihnen aber wirklich übel nehmen, sind ihre Ausflüge in die Hühnerställe der Menschen, wo sie Eier und Federvieh stehlen. Man geht nicht gerade freundlich mit ihnen um. Schätzungsweise eine Million Bindenwarane werden Jahr für Jahr gefangen und zu Leder verarbeitet, nicht wenige bei lebendigem Leibe gehäutet. In manchen Gegenden wird ihr Fleisch gegessen. Trotzdem gelten ihre Bestände nicht als gefährdet.
Da die Tiere eigentlich geschützt sind, hat die Umweltbehörde kürzlich versucht, durch ihre Umbenennung zu einer Imageaufbesserung beizutragen, doch mit tua ngern tua tong konnten sich die Thailänder nicht anfreunden und auch Voranuch und Voranus setzten sich nicht durch, weil einige Menschen, die diese Namen tragen, empört in den Ämtern anriefen und protestierten. Also blieb alles beim Alten.
Lange haben die Behörden dem Treiben im Lumphini-Park tatenlos zugesehen. Den Bangkok-Touristen gefallen die Echsen. Als kürzlich jedoch ein verdammter Hia von einem Baum und einer Frau auf den Kopf fiel, war Schluss mit lustig. Normalerweise sind Bindenwarane sehr gute Kletterer. Der Sturz war sicher kein gezielter Angriff, sondern ein Unfall. Doch was tut man, ob Mensch oder Echse, wenn man beim Klettern herunterzufallen droht? Man versucht, sich festzuhalten, und genau das tat dieser Waran und fügte der Frau dabei mit seinen Krallen tiefe Wunden zu, die genäht werden mussten. Das sollte und durfte sich nicht wiederholen. Die auf vierhundert Tiere geschätzte Population im Lumphini-Park war einfach zu groß geworden. Im April 2011 wurden hundert Warane eingefangen, in Säcke gestopft und zum Wildlife Conservation Office in Bang Khen gebracht. Ein Schutzgebiet in der Provinz Uthai Thani in Nordthailand soll ihre neue Heimat werden.7
Wie die Tiere in den Lumphini-Park gekommen sind, weiß niemand. Vermutlich über die vielen Wasserstraßen der Thailändischen Hauptstadt, denn Bindenwarane sind ausgezeichnete Schwimmer. Denselben Weg haben wahrscheinlich auch die Echsen genommen, die man heute im Dusit-Zoo von Bangkok bewundern kann, unter ihnen ein imposantes Männchen von 2,5Metern Länge. Wie die Graureiher im Berliner Zoologischen Garten leben die Bindenwarane dort wild unter vielen gefangenen Tieren. Und da sie im Zoo sehr häufig sind, möglicherweise sogar die höchste Populationsdichte in ganz Thailand erreichen und sich leicht beobachten lassen, wurden sie zum Objekt zoologischer Forschung.
Normalerweise agieren die Tiere in Gegenwart von Menschen »extrem wachsam«. Deshalb, so Michael Cota8 vom Thailand Natural History Museum, sei es noch nie gelungen, das Paarungsverhalten wilder Bindenwarane zu dokumentieren. Doch auf den Uferwiesen des Dusit-Zoos konnte Cota fast alles beobachten, was sonst oft nur im Verborgenen geschieht: Kämpfe der Männchen, Werbung und Paarung, Polyandrie, Polygynie und die Jagd. Ein kopulierendes Echsenpärchen entdeckte er »in einem kleinen Pool im zweiten Stock eines am Wasser liegenden Restaurants«.9
Im Dusit-Zoo sind Bindenwarane die Top-Prädatoren, ihre bevorzugte Nahrung ist Fisch, den sie aus dem Wasser schleppen und auf der Wiese verzehren. Die Tiere sind eben an Menschen gewöhnt. Auf vielen von Cotas Fotos, die das Gerangel und Geschlängel der großen Echsen zeigen, sind im Hintergrund, oft nur wenige Meter entfernt, Zoobesucher zu sehen, die mit Tretbooten über das Wasser fahren.
Zurück ins kalte und trübe Berlin. Sie wollen noch mehr Großstadtvögel sehen? Jetzt, mitten im Winter?
Kein Problem, fahren wir ins Stadtzentrum! Nein, nicht in den Zoologischen Garten. Unser Ziel ist die nagelneue Berliner City.
Dort, im noch immer unfertigen Zentrum der deutschen Hauptstadt, erwarten uns Glas-, Keramik- und Klinkerfassaden. Wir blicken die neue Alte Potsdamer Straße entlang. Hinter uns liegt der Potsdamer Platz, einst, vor seiner kompletten Zerstörung, einer der verkehrsreichsten Plätze Europas.
Vor fünfundzwanzig Jahren gab es hier nichts außer Brachland, Mauern, Todesstreifen und Stacheldraht und ein einzelnes Haus, das heute inmitten der Neubauten kaum noch zu erkennen ist. Nur die Bäume, die jetzt die Alte Potsdamer Straße säumen, gab es damals schon. Sie haben nicht nur die Jahrzehnte der Teilung überstanden, sondern auch den hektischen Betrieb auf der größten Baustelle Europas, die Scharen von Touristen anlockte.
Es ist Februar und in den Baumkronen hängt noch der Weihnachtsschmuck, Sterne und Lichterketten, ansonsten sind die Äste kahl und leer. Weit und breit keine Vögel, von einer rätselhaften Häufung schwarzer Vogelsilhouetten auf den Balkons und Fenstern der Wohngebäude einmal abgesehen. Es ist kurz nach 16Uhr. Wir sind zu früh.
Da wir nun schon mal hier sind, schlage ich vor, wir vertreiben uns die Wartezeit auf andere Weise. Gleich rechter Hand, wo die vielen jungen Leute herumstehen, liegt der größte Kinokomplex der Stadt mit 19Sälen. Oder wie wäre es mit ein wenig Hochkultur? Zum Haus der berühmten Berliner Philharmoniker sind es nur fünf Minuten Fußweg … Ach, nein, ich vergaß, wir sind ja wegen der Vögel gekommen. Seltsam, hier laufen Tausende von Menschen aus aller Herren Länder herum, doch keinem von ihnen würde wohl in den Sinn kommen, an diesem Ort nach wilden Tieren Ausschau zu halten. Aber warten Sie nur ab, das wird sich bald ändern. Bis es so weit ist, behalten wir unser Motiv besser für uns, sonst hält man uns noch für Spinner.
Nutzen wir die Zeit, um uns mit einigen grundsätzlichen Überlegungen zum Thema vertraut zu machen. Gleich um die Ecke liegt ein Tempel der Gelehrsamkeit, der zu diesem Zweck wie geschaffen ist: Scharouns Staatsbibliothek. In spätestens zwei Stunden müssen wir wieder hier sein.
Planet Erde
Der Flächenverbrauch der Städte ist im globalen Maßstab nur schwer zu ermitteln. Die Schätzungen gehen weit auseinander. Während eine Studie der Weltbank nur auf 450.000Quadratkilometer kommt, geht das von vielen internationalen Institutionen getragene Global Rural Urban Mapping Project, das über Jahre versucht hat, zuverlässige Daten über städtische Regionen zu sammeln, von einer weit größeren Fläche aus. 3.673.155Quadratkilometer sollen es im Jahr 2000 gewesen sein, 2,8Prozent der globalen Landfläche, ein Gebiet, halb so groß wie Australien.10
In einem Buch, das von Städten handelt, sollte zu Beginn gesagt werden, was unter einer Stadt verstanden wird: Eine Stadt ist eine menschliche Siedlung mit mehr als 2.000Einwohnern. Ob in Deutschland, Australien, Thailand oder sonst wo auf der Welt, seit 1887, festgelegt vom Internationalen Institut für Statistik, gilt: In Mittelstädten leben 20.000 bis 100.000Menschen, in Großstädten sind es mehr, mitunter viel mehr.
Städte sind die ökonomischen, kulturellen und politischen Schaltzentralen unserer modernen Gesellschaften, hektische, laute, hoch technisierte und Energie fressende Knotenpunkte von ungeheuren Verkehrs- und Warenströmen aller Art. Sie müssen für ihre Bewohner Lebens- und Arbeitsstätten sein und stehen miteinander in Konkurrenz. Einen dynamischen Wirtschaftsstandort und gleichzeitig ein lebenswertes Wohnumfeld zu schaffen und zu erhalten, ist ein schwieriger Balanceakt, der immer wieder von Neuem austariert werden muss. Manchen Städten gelingt dieser Spagat besser als anderen. Ihre Umgebung, ihre Lage (z.B. in einem Talkessel, am Meer) und historische Ereignisse (z.B. Kriegszerstörungen) spielen dabei eine wichtige Rolle.
Weil es immer schwerer wird, außerhalb der urbanen Zentren ein Auskommen zu finden, verschieben sich die Bevölkerungszahlen überall in der Welt zu Ungunsten der ländlichen Räume. Die Urbanisierung, das Wachsen, ja, Wuchern der Städte scheint unaufhaltsam. In den Industriestaaten leben bereits weit mehr Menschen in den Städten als auf dem Land, in Afrika und Asien ist die Situation noch umgekehrt. Um das Jahr 1800 waren nur 3Prozent der Weltbevölkerung Städter, 1950 waren es 29Prozent, 1985 42Prozent, im Jahr 2025, so der Weltbevölkerungsbericht der Vereinten Nationen, werden es 60Prozent sein. Irgendwann im ersten Jahrzehnt des neuen Jahrtausends ist die 50-Prozent-Schwelle überschritten worden.
Vor allem an den Meeresküsten, etwa in China und Nordamerika, verschmelzen die Städte zu riesigen Gebilden. An der Ostküste der Vereinigten Staaten entsteht eine einzige tausend Kilometer lange und einhundert Kilometer breite Megalopolis, die im Süden mit Washington und Baltimore beginnt und sich über Philadelphia und New York bis nach Providence und Boston erstreckt. »Eine kontinuierliche Schicht von Beton und Asphalt«, prophezeit der renommierte Stadtbiologe William Robinson11, »wird auf den größeren Kontinenten bald die dominante Landschaftsform der Küsten bilden.« Im Delta des Perlflusses im Süden Chinas soll durch die Verschmelzung von neun Großstädten eine Mega-City mit 42Millionen Einwohnern entstehen. Sie wird einmal eine Fläche doppelt so groß wie Wales einnehmen.
Auch die Deutschen werden zu einem Volk der Stadtbewohner. Knapp drei Viertel der Bundesbürger sind Städter, ein Drittel lebt in einer Großstadt, im Osten etwas weniger als im Westen. Dabei nehmen alle Großstädte, zusammen mit den kleineren Städten, Dörfern, Autobahnen und Landstraßen, ›nur‹ gut 12Prozent der Landesfläche ein. Diese sogenannte Siedlungs- und Verkehrsfläche ist in den letzten dreißig Jahren um ein Drittel gewachsen und nimmt weiter zu, in den Jahren 2001 bis 2005 um durchschnittlich 116Hektar pro Tag.
Die Gründe für die weltweit zu beobachtende Völkerwanderung in die Städte liegen auf der Hand: bessere Schulen, bessere Gesundheitsversorgung, besseres Kulturangebot, vor allem Jobs, die Möglichkeit, Geld zu verdienen, oder zumindest die Hoffnung darauf. In den armen Ländern ist es die pure Verzweiflung. 23 der 25 größten städtischen Ballungsräume der Welt werden 2025 in Asien, Afrika und Lateinamerika liegen. Es wird etliche Großstädte geben, in denen mehr als zwanzig oder sogar dreißig Millionen Menschen leben.
Für die Pflanzen- und Tierwelt bleibt diese weltweite Urbanisierung natürlich nicht ohne Folgen. Der immense Flächen- und Ressourcenverbrauch der Städte ist einer der wichtigsten Gründe für die dramatische Biodiversitätskrise, auf die unser Planet zusteuert. Glaubt man den Prognosen, werden wir eine massive Aussterbewelle erleben, die mit den schlimmsten Katastrophen in der Geschichte des Lebens vergleichbar ist. Es ist eine traurige Tatsache, dass das, worum es in diesem Buch gehen wird, dagegen kaum ins Gewicht fällt.
Als Siedlungsform der sozialen Spezies Homo sapiens sapiens ist die Stadt die extremste Manifestation ihres Bestrebens, sich von einer wilden und bedrohlichen Natur unabhängig und unangreifbar zu machen. Trotzdem will und kann der Mensch auch in der Stadt nicht ganz allein leben.
Wer unter »Natur« ausschließlich etwas vom Menschen Unberührtes versteht, wird in Städten kaum fündig werden. Er müsste allerdings auch andernorts, weit weg von den urbanen Zentren dieser Welt, lange suchen. Wer durch unsere von Äckern, Weideflächen und Forsten geprägte Landschaft fährt und dies als ›Natur pur‹ erlebt, könnte kaum gründlicher danebenliegen. Die mitteleuropäische Landschaft ist nahezu flächendeckend vom Menschen verändert worden und daher nicht ›natürlicher‹ als ein Stadtpark oder -wald.
Noch gibt es sie, die ursprüngliche, nahezu unberührte Natur, aber es dürfte sich herumgesprochen haben, dass nichts auf diesem Planeten menschlicher Einflussnahme entzogen ist, und das nicht erst seit der Klimaerwärmung. Im Verlauf der vergangenen Jahrhunderte wurden große Teile der Welt in Kulturlandschaften umgestaltet, oder anders formuliert: in eine Millionen Quadratkilometer umfassende Produktionsfläche für Nahrungsmittel, Viehfutter und Holz.
Trotz gravierender Veränderungen existieren in all diesen von menschlichen Aktivitäten geprägten Landschaften wild lebende Tiere und Pflanzen und auch in Städten gedeiht nicht-menschliches Leben: Parks, Rasenflächen, Vorgärten, Stadtwald, verwilderte Brachen, Strände, Seen. Und überall gibt es Tiere: vor allem Tauben, Hunde und Ratten, aber auch Amseln, Mauersegler, Ameisen, Mücken, Regenwürmer, Katzen, jede Menge Katzen, sogar Tiger und Löwen. Und da wir gerade dabei sind: Es gibt auch Elefanten und Haie, bunte Anemonenfische, Giraffen, giftige Quallen und Schlangen, Delfine, Neonfische, sogar lebende Drachen und animierte und präparierte Dinosaurier – man muss nur wissen, wo man zu suchen hat.
Sie werden einwenden, man könne nicht alles in einen Topf werfen, das sei ein heilloses Durcheinander. Und ich müsste Ihnen antworten: Sie haben recht, genau das ist Stadtnatur, ein heilloses und faszinierendes Durcheinander, ein aus aller Welt stammendes Sammelsurium von Lebensformen, die es, in mehr oder weniger großer Abhängigkeit vom Menschen, irgendwie geschafft haben, miteinander auszukommen.
Natürlich muss man differenzieren. In der Welt der ›wilden‹ Stadtlebewesen, von denen die meisten sich gegen unseren Willen mit uns vergesellschaftet haben, herrschen vollkommen andere Gesetze als in der Kunstwelt der Haustiere, der Zoologischen und Botanischen Gärten und Aquarien. In vergleichsweise grünen Außenbezirken herrschen andere Lebensbedingungen als in den dicht bebauten und nahezu komplett versiegelten Innenstädten, aus denen nicht nur die Tiere, sondern auch viele Menschen fliehen. Aber nur in Städten findet sich all das gleichsam unter einem Dach.
Die große Masse der Tiere in der Stadt sind wild lebende Kreaturen – wie ihre Verwandten in Wald und Wiese. Viele leben von den Krümeln, die den Menschen von ihren üppig gefüllten Tellern fallen, ihrem in unvorstellbaren Mengen produzierten Abfall und Müll. Der Tisch ist reich gedeckt und weder Kakerlake noch Krähe noch Mehlkäfer, Waran, Möwe, Fuchs oder Flughund können dem Angebot widerstehen. Andere nutzen einfach den geheizten Wohnraum, den wir ihnen großzügig zur Verfügung stellen, oder sie leben in den Gärten, Parks und Gewässern, die wir anlegen. Manchmal verraten ihre Namen – Felsentaube, Steinmarder, Steinschmätzer –, was die Menschen aus Sicht vieler Tier- und Pflanzenarten mit den Städten in die Welt gesetzt haben. Es sind riesige, aus Gigatonnen von Stein, Asphalt, Beton und Glas aufgetürmte Kunstfelsmassive, voller Höhlen, Nistplätze und Unterschlüpfe, warm und trocken und vergleichsweise sicher.
Beileibe nicht jede Art ist für ein solches Leben geschaffen, es sind aber überraschend viele, viel mehr, als in der Erfahrungswelt durchschnittlicher Großstädter vorkommen, obwohl sie direkt vor ihrer Nase existieren. Die Geschichte der Annäherung dieser Tierarten an den Menschen ist gewissermaßen ein Nebenstrang in der großen Erzählung von der Sesshaftwerdung des Menschen. Was wir heute sehen, ist das Ergebnis eines langen, Jahrtausende währenden Prozesses. Natur ist stets in Bewegung, in Veränderung begriffen, und so hat sich auch die Stadtnatur verändert und verändert sich noch immer, zusammen mit den Städten. Vor kaum mehr als einer Menschengeneration konnte man aus den Hinterhöfen meiner Heimatstadt Berlin noch das Muhen von Milchkühen hören und Gespanne mit stämmigen Brauereipferden waren ein alltäglicher Anblick. Heute wären sie eine Sensation. Wie sah die Stadtnatur vor hundert oder fünfhundert Jahren aus und wie wird sie sich in Zukunft verändern?
Die Wildnis drängt in die Städte und ehemals scheue Tierarten, die sich, solange man denken konnte, vom Menschen fernhielten, werden zu einem Teil der Stadtnatur. Füchse trotten seelenruhig über die Bürgersteige, Wildschweine übernehmen die Gestaltung der Vorgärten, Waschbären plündern die Mülltonnen und poltern auf dem Dachboden, Steinmarder legen Autos lahm. Die Amsel, bei uns einer der Stadtvögel schlechthin, war Mitte des 19.Jahrhunderts noch ein scheuer Waldbewohner.
Berlin
Unter Ornithologen kursiert ein Witz, bei dem man allerdings bei näherer Überlegung nicht weiß, ob man ihn wirklich komisch finden soll: Wenn ein südamerikanischer Kollege nach Deutschland käme, um die hiesige Vogelwelt kennenzulernen, schickte man ihn am besten …, ja, wohin? In die Nationalparks und Biosphärenreservate, in den Harz oder Bayerischen Wald, nach Hiddensee, ins Untere Odertal? Nein, in die Hauptstadt, nach Berlin! An kaum einem anderen Ort in diesem Land, schon gar nicht in der viel gerühmten, aber intensiv genutzten Kulturlandschaft, lassen sich so viele Vogelarten (151) auf so kleiner Fläche (892Quadratkilometer) beobachten.12
Bei der Bestandsaufnahme vieler Tier- und Pflanzengruppen schneiden die Städte sehr gut oder wenigstens nicht schlecht ab, ob uns das nun gefällt oder nicht. Oft gefällt es uns gar nicht. Im Gebiet von Berlin leben 75Prozent aller Stechmückenarten Mitteleuropas. Unsere Städte blühen scheinbar zu Oasen auf, während das weite Land ringsherum zur Agrarwüste verkommt. Wie ist das zu erklären? Werden da Äpfel mit Birnen verglichen? Wird diese Vielfalt überhaupt wahrgenommen? Sagt sie etwas über die Qualität der Lebensräume in Stadt und Land aus?
Wie so häufig, wenn interessante und wichtige Fragen gestellt werden, ist man erstaunt, wie schwer es ist, Antworten zu finden. Das hat viele Gründe. Eine Untersuchung der Beziehung von Mensch und Natur in der Stadt war lange Zeit nichts, womit sich Geld verdienen oder Ruhm und Ehre erwerben ließe. Es ist eine entmutigend komplexe Fragestellung und bräuchte die Zusammenarbeit von Experten unterschiedlichster Fachgebiete. Biologie, Anthropologie, Soziologie, Psychologie, Human- und Veterinärmedizin, Politik-, Kultur- und Geschichtswissenschaften, sogar Architektur und Kunst, sie alle müssten ihren Beitrag leisten und miteinander kooperieren.
Wer Biologie studiert, möchte vermutlich mit möglichst ungestörten Systemen arbeiten, mit Warzenschweinen in der Serengeti, Anglerfischen in der Tiefsee oder Gorillas im tropischen Regenwald. Die Erforschung von Kellerasseln, Hauswinkelspinnen und Küchenschaben steht mit Sicherheit ganz unten auf der Wunschliste. Den Lebensräumen der Städte hat sich die Wissenschaft nur zögerlich, wenn nicht gar widerwillig zugewandt. »Cities were seen as anti-life«, schrieb der Berliner Botaniker Herbert Sukopp.13 Mittlerweile sind die wild lebenden Pflanzen und Tiere der Städte jedoch zum Gegenstand einer eigenen Wissenschaftsdisziplin geworden: der Stadtökologie oder urban ecology.
Vermutlich tut man ihnen damit Unrecht, doch anfangs sind wohl vor allem jene zu Stadtökologen geworden, denen gar nichts anderes übrig blieb, wie zum Beispiel den Wissenschaftlern im Ballungsraum Ruhrgebiet, wo man sich notgedrungen mit den Bergbaufolgelandschaften beschäftigen musste, mit stillgelegten Zechen und Industrieanlagen. Oder wie mir und meinen Kollegen im früheren West-Berlin, wo beinahe jede ökologische Arbeit als ein Beitrag zur Stadtökologie gelesen werden konnte. Im grünen Villenviertel Dahlem, im Institut für Ökologie der Technischen Universität Berlin, blühte eine insbesondere botanisch orientierte Stadtökologie auf. Hier lag die Wirkungsstätte von Herbert Sukopp und seinen Mitarbeitern, dem diese Wissenschaft nicht nur in Deutschland entscheidende Impulse verdankt.
Heute bietet das Institut einen zweijährigen Studiengang Stadtökologie (Urban Ecosystem Sciences) in englischer Sprache an. Angesprochen werden Studierende aus der ganzen Welt. In den letzten vierzig Jahren, in denen immer klarer wurde, welche zentrale Rolle die Städte für das Schicksal von Mensch und Natur spielen werden, hat die Stadtökologie einen enormen Aufschwung genommen. Die Veranstalter einer der vielen internationalen Tagungen zum Thema schrieben, sie habe sich »von einem wissenschaftlichen Zweig der Biologie hin zu einem interdisziplinären Forschungsfeld mit Anwendungen in der lokalen und regionalen Planung entwickelt.«14 Da dies aber ein Buch über die Lebewesen der Städte ist und von Tieren, Pflanzen und Menschen handelt, wird die Stadtökologie nur da einen Schwerpunkt bilden, wo sie noch Biologie geblieben ist.
Bei der Frage nach der Beziehung von Mensch und Natur geht es um nicht weniger als um unser Überleben, das Überleben unserer Zivilisation. Die wachsende Naturferne der Städter und ihrer Lebensweise wird oft beklagt und tatsächlich grassiert dort erschreckendes Unwissen. Die Menschen kennen kaum Pflanzen und Tiere, wissen wenig über die heimischen Lebensräume, von exotischen ganz zu schweigen.
Aber das ist nur ein Teil der Wahrheit. Denn in den Städten leben die Käufer ökologisch erzeugter Lebensmittel, ohne die diese Form der Landwirtschaft gar nicht existieren könnte, hier leben die Mitglieder der Natur- und Tierschutzverbände, die Vegetarier und Veganer, die Unterstützer und Sympathisanten von Greenpeace, WWF und Robin Wood, hier flimmern bei jedem Naturfilm die Mattscheiben, werden ökotouristische Fernreisen gebucht, Ultraleicht-Zelte und jedes nur denkbare Outdoor-Equipment verkauft, und fast ausschließlich hier leben auch die Wähler der Grünen Parteien. Wären sie auf die Stimmen aus den ländlichen Räumen angewiesen, hätten sie es bis heute bestenfalls in einzelne Gemeinderäte geschafft.
In Städten residieren die Medien und hier lebt auch der Großteil ihrer Konsumenten. In Städten werden Wahlen entschieden und die meisten der Männer und Frauen, die heute an den Schalthebeln der Macht sitzen und in Rio oder Johannesburg über die Zukunft dieser Welt debattierten, sind Städter oder haben dort wichtige Phasen ihres Lebens verbracht. In Städten wachsen die meisten unserer Kinder auf, die Eliten von morgen, hier nehmen sie Beziehungen zu anderen lebenden Wesen auf, zu Mensch, Tier oder Pflanze (vermutlich in dieser Reihenfolge), und in noch größerer Zahl als die Generation ihrer Eltern heute werden sie einmal in Städten leben und ihre ersten prägenden Erfahrungen mit der großen Natur im Kleinen, nämlich mit der in ihrem Wohnviertel existierenden Stadtnatur machen. Die Städte sind zu einer, vielleicht sogar der entscheidenden Schnittstelle zwischen Natur und Mensch geworden. Obwohl Städte und Natur üblicherweise als Gegensätze gesehen und wahrgenommen werden – vielleicht ist ja der Wunsch der Vater dieses Gedankens –, sind die Kunstfelsgebirge unserer Städte längst Teil der Natur geworden und waren es im Grunde schon immer.
Wie ist diese Stadtnatur beschaffen und was macht sie mit ihren Bewohnern, die darin leben wie in gigantischen, komplexen und hoch technisierten Ameisenbauten? Wie beeinflusst Stadtnatur das Denken über und den Umgang mit der großen Natur, unserer Lebensgrundlage, der Gesamtheit aller belebten und unbelebten Dinge, die lange vor uns waren und noch lange nach uns existieren werden?
Berlin-Adlershof, 2011
Ein 61-jähriger Hausmeister holte sich kürzlich blutige Ohren, als er sich in bester Absicht einem Krähenküken näherte, das aus dem Nest gefallen war, was den Altvögeln gar nicht gefiel. Die von ihm gerufene Polizei las das Küken auf und trug es in ein nahe gelegenes Waldstück. Den Beamten brachte das nicht etwa Lob und Schulterklopfen ein, sondern eine Strafanzeige. Ein Vogelschutzverein wertete die Tat als eklatanten Verstoß gegen den Tierschutz. Mitarbeiter hätten das arme Tier kurz darauf im Wald gesucht und gefunden, »völlig entkräftet und voller Fliegen.« Es hatte verkrüppelte Füße. »Die Polizei hätte den Vogel zum Tierarzt bringen müssen.« Jetzt ermittelt das Landeskriminalamt.15
So, es ist 18:00Uhr. Wir sollten nachsehen, was sich in der Alten Potsdamer Straße getan hat. Vermutlich haben wir ihre Ankunft verpasst. Sie kommen mit der Dämmerung. Aber bis Tagesanbruch werden sie sich nicht mehr von der Stelle rühren. Es besteht also kein Grund zur Eile.
Wir begeben uns diesmal an das andere Ende der Straße, zum Marlene-Dietrich-Platz, laufen also um das lang gestreckte Gebäude der Staatsbibliothek herum. Auf der sechsspurigen Potsdamer Straße, einer der wichtigsten Ost-West-Verbindungen der 3,5-Millionen-Stadt, herrscht dichter Feierabendverkehr. Gegenüber spannt sich das futuristische Zeltdach, das im Minutentakt seine Farbe ändert, an dem Gebäudekomplex darunter funkeln die Glasfassaden.
Für Zugvögel sind diese gläsernen Kolosse gefährliche Hindernisse, verwirrende Spiegelkabinette und tödliche Fallen. Aus Berlin gibt es keine Zahlen, 1.500 sterben aber jedes Jahr allein am Sears Tower in Chicago, in der Innenstadt Torontos sind es 70.000. In ganz Nordamerika verunglücken jährlich schätzungsweise 100Millionen Vögel an Gebäuden.16 Neben dem Verkehr sind sie für Vögel in der Großstadt eine der größten Gefahrenquellen.
Wir wenden uns nach rechts, laufen durch das jüngste Hauptstadtzentrum der Welt direkt auf das Musicaltheater zu, wo am kommenden Donnerstag rote Teppiche ausgerollt und die Internationalen Filmfestspiele eröffnet werden. In Erwartung der Leinwandstars herrscht gegenüber im Hyatt-Hotel bereits Hochbetrieb. Auf dem Platz vor dem Theater parken ein Dutzend Lkws. Equipment wird ausgeladen, Stühle, schwere Kisten mit Kabeln und Technik, Schaulustige stehen an der Absperrung und sehen zu. Vor dem Eingang zum Theater flimmert ein riesiger Bildschirm, auf dem in diesem Moment weder Jack Nicholson noch Nicole Kidman, sondern seltsamerweise antarktische Pinguine zu sehen sind. Richtig, in all dem Trubel hätten wir fast vergessen, dass wir wegen einer Vogelkolonie gekommen sind. Wir drehen uns um, blicken die Alte Potsdamer Straße entlang zum Potsdamer Platz und konzentrieren uns auf die Bäume rechts und links. Ja, sie sind eingetroffen. Die Kronen der Straßenbäume sind schwarz von Krähen. Eigentlich sind die Vögel dafür bekannt, dass sie gerne umziehen, doch hier scheint es ihnen besonders gut zu gefallen. Mit bemerkenswerter Beständigkeit kehren sie seit Jahren zurück.
Wenn man die Augen schließt, hört man den Soundtrack von Hitchcocks »Die Vögel«, verstärkt durch Reflexionen an den schicken neuen ockerfarbenen Keramikfassaden, die den Vögeln vielleicht etwas Wärme spenden. Irgendwie unheimlich – in letzter Zeit war ja häufiger zu lesen, dass Krähen unvermittelt auf arglose Spaziergänger herabstoßen.
Krähen sind nun mal für jeden Blödsinn zu haben. In Berlin-Dahlem klemmten sie Knochen hinter die Wischerblätter von Autos, um sie dort besser bearbeiten zu können. Gegen solche Zumutungen sind die Behörden machtlos. »Krähen«, so der Berliner Tagesspiegel, »dürfen das«. Die Jagd auf sie ist ohnehin nicht erlaubt. Sie stehen unter Naturschutz.17
Aber keine Angst. Die Vögel sind nicht zum Potsdamer Platz gekommen, um über Menschen herzufallen. Sie wollen nur schlafen. Und sie wollen nichts verpassen. Oder wie soll man sich sonst erklären, dass nur wenige Meter entfernt, in den alten Bäumen am Landwehrkanal kein einziger Vogel sitzt, obwohl es dort wesentlich ruhiger zugeht und keine Schaufenster, Restaurants und Leuchtreklamen die Nacht zum Tage machen?
»Die Tiere stören sich nicht an den Menschen, wenn sie in Ruhe gelassen werden«, sagte der Ornithologe Hans-Jürgen Stork der Berliner Morgenpost.18 Das beruhigt uns natürlich ungemein. Wir haben uns schon Sorgen gemacht. Doch seien wir ehrlich, die Anwesenheit der Vögel wird von den Menschen – von ein paar Krähenfreunden wie Hans-Jürgen Stork abgesehen – zutiefst missbilligt, was sich darin äußert, dass die Tiere (und ihre Hinterlassenschaften) so weit wie möglich ignoriert werden. Allerdings ist dies nicht immer möglich. Vor dem Eingang des Ritz Carlton, eines Superluxus-Hotels auf der anderen Seite des Potsdamer Platzes, wird gerade ein Auto übergeben. Der Gast verzieht angewidert das Gesicht. Auf dem Dach des flotten Sportwagens haben ignorante Vögel mehrere unschöne Haufen hinterlassen, was das Hotelpersonal zu wortreichen Entschuldigungen veranlasst. Tut uns leid, muss auf dem kurzen Weg von der Garage zum Eingang passiert sein.
Gar nicht weit von hier, auf dem Glasdach des schmucken neuen Hauptbahnhofs, vergnügen sich die Krähen neuerdings mit porös gewordenen Gummidichtungen. Vielleicht haben sich einige gelöst und bewegen sich nun verführerisch im Wind. »Wenn Krähen etwas zum Spielen gefunden haben, sind sie sofort dabei«, kommentierte Anja Sorges, Geschäftsführerin des Naturschutzbundes Berlin. Sie macht »Junggesellentrupps« verantwortlich. Natürlich, die sind immer die Schlimmsten, ob bei Krähen oder bei Menschen. Leidtragende sind die Reisenden auf den Gleisen 11 bis 16, denen es nun im nasskalten Berliner Winter auf die Köpfe tropft. Ein repräsentatives Eingangstor in die Deutsche Hauptstadt sollte der neue Bahnhof werden, nun dient er als Spielplatz für »Übelkrähen«.19
Man kann wohl davon ausgehen, dass auch die neue Alte Potsdamer Straße an diesem symbolträchtigen Ort der Stadt von den Planern nicht als Nachtquartier für Schwärme von großen schwarzen Vögeln gedacht war. Die Bäume, die Zeugen der dramatischsten Veränderungen des letzten Jahrhunderts waren, sollten vermutlich Boulevard-Atmosphäre verbreiten und nicht zu weiß gesprenkelten Vogeltoiletten verkommen. Und die Bewohner des neuen Stadtviertels wünschten sich sicher eine andere Geräuschkulisse und andere Nachbarn als ausgerechnet einige Hundertschaften Krähen. Um sie abzuschrecken, haben sie die Vogelsilhouetten angebracht. Genützt hat es nichts. Mit vielen anderen Vogelarten hätte man sich leichter arrangieren können, gekommen aber ist die Rabenverwandtschaft, der noch heute ein Ruf als Galgen- und Todesvögel anhängt. Vielleicht sind sogar einzelne der viel selteneren Dohlen darunter, doch für derartige Details interessiert sich hier niemand. Keiner der Passanten hebt den Kopf und beobachtet, was in den Bäumen vor sich geht. Man straft sie mit Missachtung, und doch wissen natürlich alle, dass sie da sind. Sie sind nicht zu überhören.
Noch sind die Tiere munter. Weitere Krähen treffen ein und die Vorhut rückt zusammen, was nicht ohne Gezänk vonstatten geht. Und plötzlich rauscht es über den Dächern, ein großer Trupp gleitet quer über die Straßenschlucht und wieder zurück und die Krähenrufe werden für einen Moment so laut, dass sie den Ort beherrschen, das modernste und jüngste Hauptstadtzentrum der Welt. Es sind Hunderte, wenn nicht Tausende, in jedem Baum sitzen dreißig bis fünfzig große schwarze und graue Vögel. Aber es sind bei Weitem nicht alle. Sie sind nur ein Ableger der riesigen Schlafkolonie im nahe gelegenen Großen Tiergarten, der nach Wien zweitgrößten in Mitteleuropa. Am 2.März 1991 nächtigten hier 62.400Krähenvögel. In den Achtzigerjahren, als die Kolonie noch nicht in die Innenstadt umgezogen war, wurden schon einmal über 80.000 gezählt.20
Es sind Saat- und Nebelkrähen, die östliche, grau gefärbte Unterart der Aaskrähen, und die meisten kommen aus Russland und Osteuropa, um in Berlin zu überwintern.
München, 1960
In den 1960er-Jahren wurde der Stachus, einer der verkehrsreichsten Plätze Münchens, von zahlreichen Staren heimgesucht. Josef Reichholf, Zoologe und bekannter Buchautor, beschreibt ihre Invasion in seinem Buch über die Stadtnatur als »dichte Geschwader, die wie schwarze Wolken anrückten, bis alles in eine lärmende und wogende Masse schwarzer Vögel gehüllt war.«21 Auf Leuchtreklamen, Hausfassaden und in Baumkronen verbrachten die Stare die Nacht. Seltsamerweise geschah dies nicht während der Hauptflugzeiten im Frühjahr und Spätsommer, sondern mitten in der Brutperiode, in der die Tiere eigentlich etwas anderes zu tun haben sollten. In Hochzeiten schliefen auf dem Stachus mehr als 13.000Vögel. Anfang der 1970er-Jahre war der Spuk plötzlich zu Ende. Die Stare blieben aus und sind seitdem nicht wieder zurückgekehrt. Warum, weiß niemand.
Nun wird es aber höchste Zeit für ein Geständnis. Die eben geschilderte Szene hat sich schon vor zehn Jahren abgespielt. Heute werden Sie bei einem Besuch des winterlichen Potsdamer Platzes nicht mehr so viele Krähen zu Gesicht bekommen. Sie sind umgezogen, ein spektakuläres Beispiel für die Dynamik der Stadtnatur. Nur wohin? »Offensichtlich sind Tausende von Krähen selbst in Berlin nachts nicht so leicht zu finden«, stellt der Biologe und Buchautor Cord Riechelmann fest.22 Sie sollen jetzt im Ostteil der Stadt schlafen; die Zahl der Saatkrähen, die in Berlin überwintern, ist aber insgesamt kleiner geworden. Wahrscheinlich sparen die Vögel sich den weiten Weg und bleiben heute weiter östlich in Westrussland und Polen, möglicherweise eine Folge der Klimaerwärmung. Die Anwohner der Alten Potsdamer Straße werden darüber nicht unglücklich sein.
Auch aus den Vereinigten Staaten kennt man riesige urbane Schlafgemeinschaften von mehreren Zehntausend Krähen.23 Paul Gorenzel und Terry Salmon von der University of California haben die Vermutung geäußert, hell beleuchtete Stadtquartiere seien als Schlafquartiere für die schwarzen Vögel deshalb so beliebt, weil sie sich dort vor den Nachstellungen durch Eulen sicher wähnen. Jeder plagt sich eben mit seinen eigenen tief sitzenden Ängsten herum.
Bindenwarane in Bangkok, grauköpfige Flughunde und Riesenkäuze in Sydney, Graureiher und Krähen in Berlin – drei Schlaglichter auf die überaus dynamische Natur in den Städten unserer Welt. Die Liste ließe sich beliebig fortsetzen und viele weitere Beispiele werden folgen.
Was geht da vor, nicht nur in Mitteleuropa, sondern überall in der Welt? Erleben wir eine Invasion, wie sie der Schweizer Kabarettist und Schriftsteller Franz Hohler in seiner Erzählung »Die Rückeroberung« ausmalte? Hohler schildert darin, wie Zürich aus heiterem Himmel von Adlern, Hirschen, Wölfen, Bären und alles überwucherndem Efeu heimgesucht wird.24 Pure Fantasie könnte man meinen, oder etwa nicht?
Die Erzählung entstand vor dreißig Jahren und war vermutlich als eine verschmitzte Rachegeschichte gemeint. Die Natur holt sich zurück, was man ihr genommen hat. Von dem, was sich heute abspielt, konnte Franz Hohler nichts wissen.
Im Berlin des Jahres 2012 gibt es zwar keine Adler25, aber der Habicht macht hier neuerdings Jagd auf Tauben und schreibt nicht nur in dieser Stadt eine bemerkenswerte Erfolgsgeschichte. Wölfe haben es zwar nicht in persona in die Städte geschafft, wohl aber in Gestalt ihrer Gene, wovon noch ausführlich die Rede sein wird. In den wuchernden Vorstädten von Los Angeles leben die Menschen seit vielen Jahren in (übertriebener) Angst vor Berglöwen oder Pumas, die es gelegentlich hierhin verschlägt.26
Anders sieht es mit den Bären aus. Im Norden Kanadas und in Alaska häufen sich Berichte von hungrigen Eisbären, die sich in menschlichen Siedlungen über Mülltonnen hermachen. Auf dem makellosen Rasen einer Vorstadtsiedlung in Longwood, Florida, prügelten sich kürzlich zwei kapitale Schwarzbären und wurden dabei von einem Nachbarn gefilmt. Ein anderes wackliges Amateurvideo aus South Lake Tahoe, Kalifornien, sorgt dieser Tage auf YouTube für Aufsehen. Ein junger Schwarzbär turnt darin in einer Garage herum, bevor seine Mama das Tor nach oben schiebt, um ihm zu helfen. Weiter im Norden, im Westkanadischen Vancouver, wunderten sich viele Besucher der 21. Olympischen Winterspiele 2010 über die bärensicheren Müllcontainer, die überall herumstehen. Vor allem im 10.000-Einwohner-Städtchen Whistler, wo am Blackcomb Peak die Alpinen Wettbewerbe ausgetragen wurden, gehören Bärenbesuche fast zum Alltag. Sie plündern die Mülltonnen und baden in den Hotelpools. In den Bergen der Umgebung lebt eine der größten Bärenpopulationen Kanadas und ausgerechnet hier hat man das größte Skigebiet Nordamerikas aus dem Boden gestampft. Allein im Olympiajahr wurde elf Schwarzbären diese ihnen aufgezwungene Nähe zum Menschen zum Verhängnis. Einige unterernährte Tiere waren im Ort auf Nahrungssuche gegangen, andere wurden von Autos angefahren. Sie mussten erschossen werden.27
Indien, 2012
Im Januar 2012 spazierte ein Leopard in eine viel besuchte Einkaufsstraße von Guwahati, der mit fast einer Million Einwohnern größten Stadt Nordostindiens, und skalpierte dort einen Passanten. Drei weitere Menschen wurden zum Teil schwer verletzt, bevor es nach fast zweistündiger Jagd gelang, das Tier in einem Geschäft einzusperren und zu betäuben. Auch in der Millionenstadt Nasik in Westindien kam es zu einem Zwischenfall mit einem Leoparden. Wütende Menschen prügelten das panische Tier mit Stöcken zu Tode. In Indien werden Konflikte dieser Art immer häufiger. Allein in den zwei Wochen vor dem Zwischenfall in Nasik wurden nach indischen Medienberichten zehn Leoparden getötet.28
Wenn Wildtiere uns in unsere Häusermeere folgen, sprechen Biologen von Verstädterung. Was steckt hinter diesem Begriff? Kaliforniens Pumas, Nordamerikas Bären und Indiens Leoparden sind Irrgäste, hungrige Verzweiflungsbesucher gewissermaßen, denen man zunehmend ihren Lebensraum nimmt und die ihr leerer Magen in die Nähe der Menschen treibt. Zu echten Stadtbewohnern werden sie sich nie entwickeln. Anderen Tierarten, auch kleineren Raubtieren wie Füchsen, Kojoten und Mungos, gelingt das durchaus. Was müssen Tiere mitbringen und wie müssen sie sich verändern, um in unserer unmittelbaren Nachbarschaft dauerhaft zu überleben?
Lassen Sie uns die Stadtnatur erforschen. Tauchen wir ein ins Meer der Häuser und halten dabei die Augen offen. Denn obwohl uns verständlicherweise die großen Lebewesen besonders faszinieren, die meisten der nicht-menschlichen Bewohner unserer Städte sind, wie draußen in der ›richtigen‹ Natur, klein und leicht zu übersehen.
Vor allem sollten wir uns vor einem weit verbreiteten Fehler hüten und nicht nur das Schöne registrieren, das, was uns gefällt, die Nachtigallen in den Parks und die Schwäne und Mandarinenten auf den Seen. Gerade in den Häusern werden wir auf eine Vielzahl von Mitbewohnern stoßen, die sich für alle Zeiten unseres abgrundtiefen Abscheus sicher sein können. Eine Stadtnatur ohne Bettwanzen, Hausstaubmilben, Ratten und streunende Hunde gibt es nicht und wird es wohl auch nie geben. Auf sie zu verzichten, wäre in etwa so, als würde man Neapel als ein einziges Architekturwunder schildern, als idyllischen Ort des Friedens und Beispiel für eine gelungene Stadtplanung, ohne ein Wort über Arbeitslosigkeit, Müllberge, Aktivitäten der Camorra und die immerwährende Bedrohung durch den Vesuv zu verlieren. Zu einer Stadt gehören gerade auch ihre Schattenseiten, gehören Dreck und Müll, Gestank und Verwahrlosung, Staub und Zersetzung, Verfall und Zerstörung.
Das folgende Kapitel wird von einer fiktiven Geschichte mit unverkennbar autobiografischen Zügen begleitet. Sie spielt Anfang der 1990er-Jahre im Westteil Berlins und handelt von der Arbeit eines Biologen in der Stadt. Es wimmelt darin von Übertreibungen und überspitzten Formulierungen, von Urteilen und Vorurteilen über Stadt und Land. Die Geschichte enthält aber weit mehr als nur ein Körnchen Wahrheit und vermittelt an einem eher unscheinbaren Beispiel eine Ahnung davon, was Stadtnatur ist, wie man ihr auf die Schliche kommt und was einem als Stadtökologe so alles durch den Kopf geht.
1. Die Entstehung der wilden Stadtnatur
Wir sind besiedelt!
Jörg Blech
Bei allen augenfälligen Unterschieden haben Natur und Stadt eines gemeinsam: Es gibt keinen Stillstand. Städte und Natur verändern sich ununterbrochen, wenn auch mit unterschiedlicher Geschwindigkeit. Es sind dynamische Systeme. Sie haben eine Geschichte.
Städte entstanden in der Natur und nicht umgekehrt. Wo Menschen sich niederließen, drängten sie das ursprünglich Vorhandene zurück, ersetzten es im Laufe der Zeit, Schritt für Schritt, durch selbst geschaffene Strukturen und beanspruchten dabei immer mehr Raum. Natur in der Stadt von heute ist aber nicht einfach nur eine verarmte Variante dessen, was früher existierte. Die Tiere und Pflanzen, die sich hier versammeln, stammen aus der ganzen Welt. Im Verlauf von Jahrhunderten ist etwas Neuartiges entstanden, eine Lebensgemeinschaft, die, bevor es Städte gab, so nirgendwo existiert hat. Und dieser Prozess geht weiter, ja er beschleunigt sich. Stadtnatur von heute ist nur eine Momentaufnahme. Die Stadtnatur von morgen wird anders aussehen.
Erdgeschichtlich betrachtet ist die Entstehung dieser Stadtnatur ein außergewöhnlicher, wenn nicht einmaliger Vorgang, sogar gemessen an den Maßstäben der Evolution, die viele spektakuläre Umwälzungen gesehen hat. Organismenarten sind niemals nur passive Teilnehmer an, sondern auch aktive Gestalter von Natur. Sie verändern die chemische Zusammensetzung von Atmosphäre und Boden, bauen Nester, legen Straßen und unterirdische Tunnelsysteme an, verhindern das Wachstum von Bäumen und verbreiten die Samen ihrer Nahrungspflanzen. Aber seit der Frühzeit des Lebens, als Mikroorganismen eine sauerstoffhaltige Atmosphäre schufen, hat es kein Lebewesen wie den Menschen gegeben, das den Planeten derartig nach seinen Bedürfnissen umgestaltet. Überall setzt er riesige neuartige Konstrukte in die Welt: die Städte. In tropischen und gemäßigten Klimazonen ragen sie als steinerne Inseln aus einer nahezu geschlossenen Vegetationsdecke.
Wie kommt es, dass in diesen künstlichen ›Landschaften‹ überhaupt ein eigenständiges Pflanzen- und Tierleben existiert, Landschaften, die erst seit einem erdgeschichtlichen Wimpernschlag existieren und die wir selbst mitunter geringschätzig als Beton- und Asphaltwüsten bezeichnen? All die unbestreitbaren Vorteile, die Menschen in die Städte locken, das Angebot an Ausbildungs- und Kultureinrichtungen, die Geschäfte, Krankenhäuser und vor allem die Arbeitsplätze, all das ist doch für Pflanzen und Tiere ohne Bedeutung. Warum also ›entscheiden‹ Wildtiere sich dafür, in der Stadt zu leben, in unmittelbarer Nähe des Menschen, in der ›Höhle des Löwen‹, wenn sie genauso gut oder besser draußen in Wald und Flur ihre Ruhe und Freiheit genießen könnten, wie in den Jahrtausenden zuvor, als es noch keine Städte gab?
Die meisten Menschen freuen sich über ein buntes Vogelleben in der Stadt – bei den Krähen und den Tauben gehen die Meinungen sicher auseinander –, aber nicht wenige sind regelrecht befremdet, wenn sie erfahren, dass etwa die immer seltener werdenden bodenbrütenden Haubenlerchen ihre Jungen inmitten dichtesten Autoverkehrs aufziehen. In Braunschweig fand man in einem drei Quadratmeter großen, spärlich bewachsenen Blumenbeet ein Nest, das nur 39Zentimeter von der Zufahrt zu einem großen Hotel entfernt lag, 150Zentimeter von der Fahrbahn einer stark befahrenen Straße und 240Zentimeter von Fuß- und Radweg. Häufig sah man die Vogeleltern zu Fuß zwischen den Autos über die Straße spurten, um auf der Rasenfläche zwischen den Fahrbahnen nach Nahrung zu suchen. Derart idyllisch gelegene Nistplätze sind heute für diese Vogelart keineswegs untypisch. Noch vor 150Jahren wäre ein solches Verhalten undenkbar gewesen. Haubenlerchen hielten sich vom Menschen fern und waren in Städten praktisch unbekannt.1
Die Wissenschaft verwendet für solche Erscheinungen oft das Wort »Wohlstandsverwahrlosung«. Geprägt hat diesen Begriff der bekannte österreichische Verhaltensforscher Otto König. Bei einer Kuhreiher-Kolonie, die auf dem Gelände seiner Forschungsstation Wilhelminenburg gehalten und reichlich mit Nahrung und Nistmaterial versorgt wurde, hatte er akute Auflösungserscheinungen beobachtet. Die permanente Anwesenheit der Elterntiere, die sich um nichts mehr kümmern mussten, führte zu Aggressionen und zu unreifen Jungtieren, die ihre Eltern selbst dann noch um Futter anbettelten, als sie schon für den eigenen Nachwuchs verantwortlich waren. »Der Zustand der Kolonie wird immer schlimmer«, sagte König 1965 bei einem Vortrag in Hamburg, über den das Hamburger Abendblatt2 berichtete. Es ging buchstäblich drunter und drüber, auch beim Brutgeschäft. »Prof.König sah bis zu drei Reiher übereinanderhocken, zuunterst die kräftigste Reiherfrau, die sich mit ihrem Brutbetrieb durchgesetzt hatte, oft die Großmutter der verwahrlosten Gesellschaft«, schrieb der Zeitungsreporter unter der Überschrift »Süßes Leben in der Kuhreiher-Kolonie«. Die Zuhörerschaft debattierte lebhaft. Lässt sich das Ganze womöglich sogar auf den Stadtmenschen übertragen? »Geht die automatisierte Gesellschaft solcher Verwahrlosung entgegen?«
Schon zu Zeiten des Nationalsozialismus hatte man sich ähnliche Gedanken und Sorgen gemacht. »Nirgends als bei den Großstadtvögeln treffen wir mehr Entartungen«, stellte Heinrich Frieling3 in seinem Buch Großstadtvögel. Krieg/Mensch/ Natur fest, das 1942 erschien. Der Mensch habe mit den Städten einen für viele Tiere »unnatürlich günstigen Lebensraum« geschaffen, der die Gesetze der Selektion erheblich milder auslege, sodass negative Entwicklungen nicht »aus dem Erbgang ausgeschaltet« werden. »Insbesondere erscheinen Entartungen des Trieblebens bei den Großstadtvögeln als seltsame Parallele zum Menschen, denn die Verdopplung der normalen Brutenzahl beim Haussperling, die ebenfalls grössere Nachkommenschaft der Amsel ist eine ›Proletarisierung‹. Mehr als man heute im Allgemeinen ahnt, scheint mir das Studium der Großstadtvögel dazu angetan zu sein, die Bedingungen zu prüfen, die auch beim Menschen zu der Veränderung des Großstädters gegenüber dem Scholleverwurzelten eingetreten sind.«
Abenteuer eines Großstadtökologen (Teil 1)
»Was machen Sie denn da?«
Die kleine alte Dame, Pelzkragen, ein Hütchen auf dem Kopf, hat Mühe, ihren winzigen Hund festzuhalten, den es unwiderstehlich zu mir auf den Rasen zieht. Sein zarter weißer Körper steckt in einem braunen Hundewollpullover.
Es ist Ostersonntag, gegen halb sechs Uhr früh. Ich bin extra um 4Uhr30 aufgestanden, damit mir niemand diese Frage stellt.
Ich folge dem misstrauischen Blick der alten Dame und lande auf der Schippe in meiner Hand. An einem eisigen Ostersonntagmorgen knie ich auf einer kleinen Rasenfläche, einem begrünten Hundeklo, mitten zwischen den beiden Fahrbahnen der Kreuzberger Gneisenaustraße und grabe kleine runde Löcher in den Boden.
»He, Sie! Ich habe Sie etwas gefragt!« Die Frau steht noch immer auf dem Kiesweg und lässt nicht locker. Hat auch sein Gutes, wenn man es sich recht überlegt. Sie interessiert sich wenigstens dafür, was in der Nachbarschaft passiert. Am Nachmittag dieses Tages werde ich nämlich um die Erkenntnis reicher sein, dass ein solches Interesse nicht sehr verbreitet ist. Ich hätte in der ganzen Stadt sonst was vergraben können, es wäre niemandem aufgefallen.
Aber das weiß ich natürlich jetzt noch nicht. Angesichts der Dame mit dem Pelzkragen und ihrem nervösen Hundeknirps geht mir nur der schreckliche Gedanke durch den Kopf, dass das mit dem Was-machen-Sie-denn-da die nächsten Stunden so weitergehen könnte. Also keine Zeit verlieren.
Das Methodeninventar der Ökologie setzt vielfach auf Bewährtes, in meinem Fall auf eine Miniaturausgabe der jungsteinzeitlichen Fallgrube. Die Joghurt-Becher, die ich normalerweise verwende, erschienen mir für diesen besonderen Anlass wenig geeignet. Sie sind weiß, und weißen, im Boden steckenden Joghurtbechern prophezeite ich in den stark frequentierten Straßengrünstreifen einer Großstadt keine lange Lebensdauer.
Also verwende ich diesmal durchsichtige. Sie sind viel zu weich. Jeder zweite zerbricht beim In-den-Boden-Stecken. In dem alten Farbeimer, den ich für meine Fangutensilien benutze, befinden sich schon genauso viele zersplitterte wie intakte Plastikbecher. Es ist nicht das erste Loch, das ich grabe, und ich lasse die kaputten Becher natürlich nicht herumliegen. Als Biologe hat man eine gewisse Vorbildfunktion wahrzunehmen. Wenn ich allerdings gewusst hätte, dass ich in vierzehn Tagen bei enormem Vegetationszuwachs Stunden damit zubringen werde, durchsichtige, im Boden nahezu unsichtbare Plastikbecher wiederzufinden, hätte ich wohl doch weiße benutzt.
Ich stopfe den Becher schnell in das vorbereitete Loch. Er zerbricht. Ich ziehe ihn wieder heraus. Ein Grubenunglück ist die Folge. Sand rieselt von den Rändern. Ich stochere hastig mit der kleinen Schippe im Boden herum, schleudere die Erde in ein nahegelegenes Gebüsch, damit keine verräterischen Erdhaufen zurückbleiben, stecke einen neuen Becher hinein. Er passt und bleibt ganz.
Ausgerechnet, als ich den Kanister aufschraube und etwas von seinem Inhalt in den Becher gieße, steht sie samt Hündchen neben mir. Wenn sie mich nun fragt, was in dem Kanister ist … bei der Angst, die die Leute vor Chemie haben …
»Junger Mann«, sagt die nun ungehaltene alte Dame, »ich werde …«
Angriff ist die beste Verteidigung, denke ich, und bete herunter, was ich mir für diesen, an einem Ostersonntag um halb sechs extrem unwahrscheinlichen Fall zurechtgelegt habe. Es entspricht sogar der Wahrheit.
Ich sage Worte wie Wissenschaft, Forschungsprojekt, nenne die beauftragende Senatsverwaltung, spreche von Tieren, die hier leben oder leben könnten, und sie schaut mich mit großen Augen an. Darüber vertiefen sich die Falten. Sie ist verwirrt. Ein Rest von Zweifel scheint sich in ihr aufzulehnen.
Aber sie sagt nur: »Ach so …«, und dann »Pfui!«, zieht energisch an der Hundeleine, deren am Hals des kleinen Köters befestigtes Ende sich samt Hundeschnauze direkt über dem durchsichtigen Plastikbecher und der von Schaum bedeckten Flüssigkeit befindet, in der das Kleingetier des Gneisenaustraßenmittelstreifens ersaufen soll. Dann macht sie auf dem Absatz kehrt und geht mit ihrem verstörten Hündchen davon.
Ich bleibe allein zurück und atme tief durch. Das hätte mir gerade noch gefehlt. Um ein Haar hätte der Minihund aus dem Becher geschleckt, womöglich ob seiner Formalin-betäubten Zunge herzzerreißend aufgejault, die ganze abgöttisch Hunde liebende Nachbarschaft aufgeweckt, einen Riesenmenschenauflauf verursacht und hier mitten auf der Gneisenaustraße seinen kleinen Geist aufgegeben. Und, wer weiß, vielleicht hätte sich die alte Dame gleich dazugelegt, vom Ende ihres geliebten Fiffi zu Tode erschreckt. Und ich mittendrin, hasserfüllten Blicken der Gneisenausträßler ausgesetzt, die Tatwaffe, einen offenen Formalinkanister, sozusagen das blutbeschmierte Messer, in der Hand.
Dabei hatte ich noch Glück. Das kleine weiße Hündchen im Wollpullover hätte ja auch ein Kampfhund in voller Montur sein können, eines dieser monströsen Muskelpakete mit Kiefern wie Bärenfallen, und das Kreuzberger Muttchen ein Gang-Mitglied, die Taschen voller Butterfly-Messer.
Später, zu Hause, träume ich von Forschungsarbeit in einem großen, friedlichen Schutzgebiet, wo meilenweit kein Mensch zu sehen ist, nur stille Wälder, Wiesen, massenhaft Tiere, darunter etliche Raritäten, nicht diese Allerweltsarten, diesen großstädtischen, mit Hundekot kontaminierten Käfermüll, den ich in vierzehn Tagen in meinen durchsichtigen Plastikbechern zu finden vermute.
Wochen später stolpere ich über eine kurze Zeitungsmeldung. Es geht um Kontaminationen anderer Art. Ein russischer Wissenschaftler hat vorgeschlagen, das Gebiet um Tschernobyl zum Nationalpark zu erklären. Riesenratten, mutierte Eichen, Insekten mit seltsamen Extremitäten. Abstrus, denke ich, Schnapsidee. Vermutlich Wodka.
Ich lege die Zeitung kopfschüttelnd zur Seite und knöpfe mir die nächste Insektenleiche vor. Die Straßenkäfer haben mich angenehm überrascht. Auf den Grünstreifen wimmelt es von Getier. Einige Flächen verdienen das Prädikat Biotop. Es gibt Arten der Roten Liste. Die Wiederentdeckung eines in Tierbauten lebenden Käferwinzlings sorgt für Unruhe auf den Institutsgängen. Zwanzig Jahre lang hat ihn niemand zu Gesicht bekommen. Expertenbefragung, akribischer Vergleich mit verstaubten Sammlungsexemplaren. Tatsächlich! Er ist es. Ausgerechnet auf einem Mittelstreifen. Wären es keine belanglosen Straßenränder gewesen, man hätte sie glatt unter Schutz stellen müssen, Käferkleinstschutzgebiete mitten im Metropolentrubel.
Trotzdem, meine Sehnsucht nach dem Studium unverfälschter Natur bleibt ungestillt. Den Straßenkäfern nehme ich ihre kaum nachvollziehbare Großstadttoleranz nicht ab, ich nehme sie ihnen sogar übel. Wissen sie denn nicht, welche Schadstoffkonzentrationen sie ihrem zarten Nachwuchs zumuten? Vermutlich gibt es für sie einfach keine Alternative. Natürlich, so muss es sein. Sie sind irgendwie hineingeraten und nun gefangen im Labyrinth der Straßen. Also verstecken sie sich in den Grünstreifen. Eine Verzweiflungstat.
In Berlin gebären Wildschweinmütter ihre Jungen in einem wenige Meter breiten Waldstreifen zwischen der Autobahn und einer Parallelstraße, auf der jedes Wochenende Tausende von Fitnessfans mit Rädern oder Rollerskates entlangrasen. Kaninchen fühlen sich in unmittelbarer Ku’dammnähe auf einer kaum fußballplatzgroßen, mit Rasen und Büschen bepflanzten Verkehrsinsel wohl, die den ganzen Tag auf mehreren Spuren von dichtem Verkehr umtost wird. Wanderfalken nisten mitten in der Innenstadt an den Türmen, die die Zentren politischer und religiöser Macht markieren. In der Nähe von Köln ließen sie sich in einem gigantischen Braunkohlebagger nieder, der sich während der Brutperiode um fünfzig Kilometer bewegte.4 Haubentaucher, die die Amsterdamer Grachten für sich entdeckt haben, tragen ihr Prachtkleid, das ländliche Artgenossen nur im Sommer anlegen, das ganze Jahr über.5 Feiern sie auf diese Art das ›süße‹ Großstadtleben? Und denken Sie an die Straßenkäfer, an die nicht nur mit Hundekot kontaminierten Käferoasen inmitten des Metropolentrubels. Die Käfer sind nur die Spitze des Eisbergs. Sie stehen für eine große Zahl an Kleintieren, Spinnen, Asseln, Tausendfüßlern und unterschiedlichsten Insektengruppen, vom eigentlichen Bodengetier, das kaum je ein Mensch zu Gesicht bekommt, ganz zu schweigen. Was selbst die Menschen aus ihrem selbst geschaffenen Wohn- und Arbeitsumfeld fliehen lässt – Lärm, Dreck, Verkehr, Abgase, Beton, Menschenmassen, Hektik –, all das scheint vielen Tieren und Pflanzen völlig gleichgültig (geworden) zu sein.