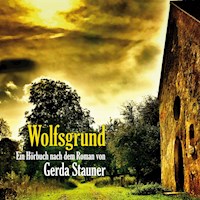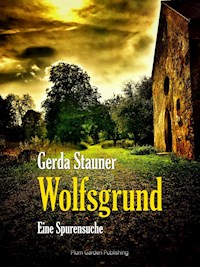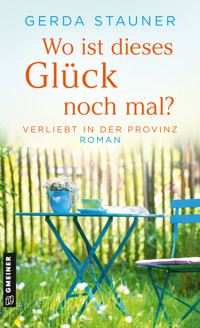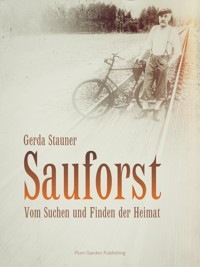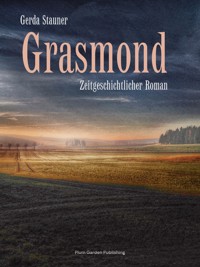
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Plum Garden Publishing
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Opportunisten, die über Leichen gehen, Verschleppte, die um ihr Leben fürchten, Angepasste, Aufrechte und Widerständige treffen kurz vor Ende des Zweiten Weltkriegs im kleinen Fichtenried aufeinander. Knapp 30 Jahre später verlässt der junge Volontär Melchior das Dorf und die Enge seines Elternhauses, um in Regensburg neu anzufangen. Bei einer zufälligen Begegnung mit dem Staatssekretär Schmiedl stößt er auf ein bedrohliches Familiengeheimnis aus dem Zweiten Weltkrieg, über welches sein zunehmend dementer Großvater Anderl beharrlich schweigt. Irritiert versucht Melchior die zwischenmenschlichen Verstrickungen zu entwirren. Bald wird ihm jedoch klar, dass seine Familie unter einem gefährlichen Machtgeflecht leidet, das bis in die Nazizeit zurückreicht. Der frühere Ortsgruppenleiter und jetzige Staatssekretär Schmiedl scheint dabei eine zentrale Rolle zu spielen. Anderl, der gedanklich immer wieder in die letzten Kriegstage abgleitet, stellt mit einem Mal eine Gefahr für den intriganten Schmiedl dar. Die drohende Zerstörung des Dorfes im April 1945 und das Verschwinden Anderls im Sommer 1973 hängen plötzlich zusammen und werden zum dramatischen Höhepunkt. "Ein Lesegewinn!" urteilt BR Heimat. Grasmond ist die altdeutsche Bezeichnung für den Monat April, ist aber heute nicht mehr gebräuchlich.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 279
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die Autorin
Gerda Stauner lebt in Regensburg, ist aber in der ländlichen Oberpfalz aufgewachsen. Mittlerweile fährt sie regelmäßig zum Schreiben in ihre alte Heimat zurück und geht dort oft im Wald spazieren. Dabei entstehen die Figuren und Handlungen ihrer Geschichten. Literarisch widmete sie der Oberpfalz eine dreibändige Familiensaga, die zwischen 2016 und 2019 publiziert wurde. 2021 wurde daraus eine gekürzte Hörbuchfassung veröffentlicht.
Die Autorin schreibt Romane, Hörspiele, Theaterstücke und Beiträge für Anthologien und ist selbst auch immer wieder Herausgeberin verschiedener Texte. Außerdem arbeitet sie mit Kindern und Jugendlichen bei verschiedenen Autorenwerkstätten und gibt ihr Wissen in Schreibseminaren und Workshops weiter. Zudem schreibt Gerda Stauner für ein digitales Nachrichtenportal und hostet einen Podcast.
Weitere Infos gibt es auf der Webseite www.gerda-stauner.de
Das Buch
Opportunisten, die über Leichen gehen, Verschleppte, die um ihr Leben fürchten, Angepasste, Aufrechte und Widerständige treffen kurz vor Ende des Zweiten Weltkriegs im kleinen Fichtenried aufeinander. Knapp 30 Jahre später verlässt der junge Volontär Melchior das Dorf und die Enge seines Elternhauses, um in Regensburg neu anzufangen. Bei einer zufälligen Begegnung mit dem Staatssekretär Schmiedl stößt er auf ein bedrohliches Familiengeheimnis aus dem Zweiten Weltkrieg, über welches sein zunehmend dementer Großvater Anderl beharrlich schweigt. Irritiert versucht Melchior die zwischenmenschlichen Verstrickungen zu entwirren. Bald wird ihm jedoch klar, dass seine Familie unter einem gefährlichen Machtgeflecht leidet, das bis in die Nazizeit zurückreicht. Der frühere Ortsgruppenleiter und jetzige Staatssekretär Schmiedl scheint dabei eine zentrale Rolle zu spielen. Anderl, der gedanklich immer wieder in die letzten Kriegstage abgleitet, stellt mit einem Mal eine Gefahr für den intriganten Schmiedl dar. Die drohende Zerstörung des Dorfes im April 1945 und das Verschwinden Anderls im Sommer 1973 hängen plötzlich zusammen und werden zum dramatischen Höhepunkt.
Grasmond
Roman
von Gerda Stauner
I M P R E S S U M
Titelfoto: Christian SegererGrasmond – Zeitgeschichtlicher Roman
Autorin: Gerda Stauner
ISBN: 9783689956608
© 2024 Plum Garden PublishingAlle Rechte vorbehalten.plumgarden.de
93047 Regensburg, [email protected]
www.gerda-stauner.de
Für meine Großmutter Sabina, dir mir die Liebe zu Büchern geschenkt hat.
Grasmondist die altdeutsche Bezeichnung für den Monat April, wird aber heute nicht mehr verwendet.
Alle in diesem Roman handelnden Personen und der Ort Fichtenried sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder verstorbenen Personen sind rein zufällig.
Prolog – 15. Juli 1973
Ich muss sie aufhalten, sonst sind wir verloren! Der Satz schleicht wie eine Schlange durch seine Gedanken, packt ihn blitzschnell – und ist im nächsten Moment verschwunden. Er steht ratlos da, schaut sich im Wald um, und weiß nicht, was er hier sucht. Die trockenen Äste knacken bei jedem Schritt im lichten Unterholz. Die Gegend ist nicht so feucht und kalt wie im Frühjahr, vielmehr strahlt der Boden eine angenehme Wärme aus. Die herrlich roten Brombeeren versprechen eine reiche Ernte und auch die Schlehensträucher biegen sich schon unter der Last der dunkelblauen und verlockend glänzenden Früchte. Wie gerne wäre er wieder ein Kind an der Hand seiner geliebten Großmutter und würde ihr dabei helfen, die Schleherbirrln einzusammeln, um daraus einen köstlichen Saft zu kochen. Bei dem Gedanken an etwas zu trinken merkt Anderl wie trocken seine Kehle ist, und er wünscht sich nichts sehnlicher als einen Schluck Wasser.
Für einen Moment wird sein Kopf klar, kehrt ins Jetzt zurück. Er ahnt, dass die Schlange ihn in einen Strudel von längst Vergessenem und Verdrängtem hineinziehen will. Er muss sich dagegen wehren, muss im Hier bleiben, darf nicht abgleiten. Er muss stark bleiben für seine Tochter, muss ihr endlich die Wahrheit sagen und somit den Schwur brechen, den er seiner geliebten Theres geleistet hat. Ich darf nicht zulassen, dass dieses Verbrechen weiter zwischen uns steht, ermahnt er sich selbst.
Der klare Augenblick, und mit ihm der feste Vorsatz, sich der Vergangenheit zu stellen, verfliegt genauso schnell, wie er gekommen ist. Gebettet auf einem Nest aus Tannennadeln und trockenem Moos, fällt er in einen zufriedenen Dämmerzustand. Die Vögel um ihn singen, wie ihm scheint, nur für ihn. In der Ferne untermalt das Rauschen eines Baches die wunderbare Musik. Durch das lichte Blätterdach fallen die Sonnenstrahlen beruhigend auf Anderls Haut. Er hat seinen Frieden gefunden, ist mit allem im Einklang. Die unangenehmen Gedanken sind mit der Schlange verschwunden und haben einer großen Müdigkeit Platz gemacht. Jetzt ist der Moment gekommen, um sich endgültig von dieser Welt zu verabschieden.
In dieser Sekunde spürt er, wie eine Wolke die Sonne über ihm verdunkelt, und macht die Augen wieder auf. Verwirrt bemerkt er, dass neben ihm seine Tochter kniet und seine Hand hält. Gerne würde er sich der Verlockung hingeben, die Augen wieder zu schließen und das Ungesagte ruhen zu lassen. Aber tief in seinem Inneren weiß er, dass nun die Zeit gekommen ist, den Bann zu brechen.
Teil I – Juni 1973: Walburga
„Vaatter, Vaaatteeer!“, tönt es in der stillen, sternklaren Nacht. Walburga geht die enge Dorfstraße entlang, niemand ist um diese Zeit unterwegs. Vereinzelt brennt Licht hinter geschlossenen Gardinen. Nirgendwo kann sie den Vater entdecken. Überall auf dem Hof hat sie gesucht, im Haus, im alten Heuschober, im verwaisten Kuhstall, im klammen Kartoffelkeller, in der kleinen Werkstatt. Langsam breitet sich Panik in ihr aus. Anfangs war es nur ein Flattern im Magen, doch je mehr Zeit vergeht, und je länger der Vater verschwunden bleibt, desto mehr ergreift sie vom gesamten Körper Besitz. Bis in die Fingerspitzen kann sie mittlerweile die lähmende, kalte Angst spüren. Trotz der lauen Sommernacht fröstelt sie in ihrer weißen Schwesterntracht. Kopflos ist sie losgelaufen. Ohne sich umzuziehen oder eine Weste mitzunehmen.
Vor ihr tauchen zwei Scheinwerfer auf. Ein Auto rollt heran und bleibt vor ihren Füßen stehen. Ihr Mann Clemens kommt direkt aus dem Krankenhaus. Er kurbelt das Fenster herunter und schaut Walburga fragend mit seinen sanften, grauen Augen an.
„Hast du ihn immer noch nicht gefunden? Na komm, steig ein. Wir suchen zusammen das Dorf ab. Er läuft uns bestimmt über den Weg.“
Dankbar lässt sich die brünette Frau auf den beigen Beifahrersitz fallen und dreht den Temperaturregler des Fahrzeugs auf die höchste Stufe. Nach einigen Minuten entspannt sie sich, ihre Fingerspitzen werden wieder warm. Sie gibt ihre verkrampfte Haltung auf und schmiegt sich in den weichen Sitz. Langsam fahren sie jede Straße und jeden Weg im Dorf ab, leuchten mit den Scheinwerfern in jeden Hof und jeden Winkel hinein. Doch niemand ist zu sehen, keine Menschenseele ist unterwegs. Die Anspannung kommt zurück. Nervös fingert sie an den goldenen Ohrringen herum. Ein Geschenk von Clemens zum zehnten Hochzeitstag. Seitdem trägt sie den Schmuck täglich und nimmt ihn auch unter der Dusche nicht ab.
Vor einiger Zeit hatte sie schon bemerkt, dass der Vater immer vergesslicher wurde. Wirklich beunruhigt hat es Walburga bisher nicht. Mit 75 Jahren ist er nicht mehr der Jüngste, stellt sie nüchtern fest. Im Krankenhausalltag trifft sie ständig Menschen seines Alters, die weitaus verwirrter und desorientierter sind, sich alleine nicht mehr zurechtfinden. Aber so schlimm steht es um den Vater noch lange nicht. Ab und zu liegt sein vorbereitetes Mittagessen unangetastet im Kühlschrank, wenn sie abends von ihrer Schicht heimkommt. Dann macht sie ihn nachdrücklich darauf aufmerksam und er verspricht, in Zukunft besser auf sich zu achten. Seine Kurzatmigkeit und seine Müdigkeit machen ihr dagegen Sorgen.
Wieder fühlt sie das leichte Flattern am ganzen Körper. Sie richtet sich in ihrem Sitz auf, reibt die Handflächen aneinander und will so das klamme Gefühl vertreiben. Aber es hilft nichts. Der unangenehme Eindruck verstärkt sich, ihr Magen krampft. Sie sackt auf dem Sitz zusammen und presst die Arme fest vor den Bauch. Eine Erinnerung blitzt auf. Die gleiche Empfindung hatte sie schon viel früher in ihrem Leben. Damals, als ihr auf der Flucht der Liebste genommen wurde.
Ferdi. Als Schulmädchen war sie unsterblich in ihn verliebt. Er war ihr Anker, gab ihr Halt in der schwierigsten Zeit ihres Lebens. An seiner Seite malte sie sich eine glückliche Zukunft aus.
Wieder hört sie den Schuss in ihrem Kopf. Damals drang er zwar nur sehr gedämpft durch die dichtstehenden Bäume. In ihrer Fantasie aber entstand ein schallendes Echo, welches sie lange Jahre bis in ihre Träume verfolgte und sich fest in ihr Gedächtnis einbrannte. Ihr Freund Ferdi wurde kaltblütig erschossen und hat sie alleine zurückgelassen.
„Halt an!“, ruft sie ihrem Mann zu und reißt die Beifahrertür auf. „Ich brauche frische Luft.“
Sie stürzt aus dem Wagen und lehnt sich mit Stirn und Handflächen an die Holzwand des einsamen Bushäuschens am Straßenrand. Clemens kommt eilig um den Wagen herum und berührt zart ihren Rücken. Sie atmet die Nachtluft in tiefen Zügen ein. Die Nähe ihres Mannes wirkt entspannend und gibt ihr Halt.
„Geht's wieder?“, fragt er besorgt und beugt sich zu ihr hinunter, um ihr einen Kuss auf die Wange zu drücken. Dabei fallen ihm seine dunkelblonden Haare in die Stirn und er streicht sie mit einer lässigen Handbewegung wieder nach hinten.
Sie nickt langsam. Clemens strahlt Ruhe und Gelassenheit aus, überträgt diese auch auf seine Umgebung. Dafür liebt sie ihn.
„Na, dann steig ein. Wir fahren zurück. Vielleicht steht dein Vater mittlerweile vor der Haustür und wartet auf uns. Einen Schlüssel hat er bestimmt nicht mitgenommen.“
Dankbar über die aufmunternden Worte richtet sie sich auf und nimmt im Auto Platz. Sie streift die Sandalen von den Füßen und vergräbt die Zehen im flauschigen Teppich. Der helle Stoffbezug des Beifahrersitzes ist angenehm weich unter ihren Händen. Wie ein Kokon umhüllt sie das luxuriöse Innere des Fahrzeugs. Walburga fühlt sich beschützt und behütet. Mit einem Mal ist die Schwere verschwunden und mit ihr all die düsteren Gedanken. Als sie auf den Hof fahren, streifen die Scheinwerfer für eine Sekunde die verwitterte Holzbank vor dem Haus und lassen die Umrisse von Anderl erkennen, der mit eingesunkenen Schultern dort sitzt. Nachdem das Auto zum Stehen gekommen ist, stürzt Walburga erleichtert auf den Vater zu.
„Wo wart ihr denn? Ich sitz hier scho seit einer halb'n Ewigkeit, und kein Mensch is dahoam.“
Sein Tonfall ist dabei nicht verärgert, eher verstört. Nervös zupft er kleine Holzspäne von seiner Arbeitshose. Sein Gesichtsausdruck erinnert die Tochter an den eines kleinen Jungen, der ängstlich vor den Scherben eines Vorratsglases mit zerstreuten Süßigkeiten steht.
„Aber Vater, wir haben dich überall g'sucht. Du warst wie vom Erdboden verschwund'n.“
„Des kann gar ned sei. Ich hab' die ganze Zeit hier g'sessn.“
Mit hochgezogenen Brauen und tiefen Falten auf ihrer sonst so glatten Stirn greift sie dem alten Mann unter die Arme und geht mit ihm ins Haus.
Melchior
Hellwach geht Melchior über den Domplatz. Es ist noch früh am Morgen, aber die Hitze der kommenden Stunden lässt sich bereits erahnen. Die Pflastersteine unter seinen Füßen geben noch angenehm die Wärme der vergangenen Tage ab. Blinzelnd blickt der Zwanzigjährige mit den auffallend grünen Augen zu den Domspitzen, welche rußig schwarz und glitzernd vom Tau in den tiefblauen, bayerischen Himmel ragen. Wie hat dieser alte Kasten wohl vor Hunderten von Jahren ausgesehen, als er noch nicht unerbittlich von stinkenden Abgasen bedroht und zerstört wurde, kommt es ihm in den Sinn. Ist das wirklich das Schicksal eines mühselig und unter größten Anstrengungen von Menschenhand erschaffenen Meisterwerks? Dass es langsam vom Dreck in der Luft und von Taubenkot zerfressen wird?
Das, was in der gotischen Kirche veranstaltet wird, interessiert Melchior wenig. Schon als Dreikäsehoch hat er sich lieber auf dem Fußballplatz als in der Nähe der Kirche herumgetrieben. Die Begeisterung für diesen Sport hat ihm sein österreichischer Vater Clemens in die Wiege gelegt und ihm bei seiner Geburt den passenden Namen gegeben. Der Lieblingsspieler seines Vaters war in den 1950er Jahren Ernst Melchior. Da ihm der Vorname Ernst zu ernst war, hat er kurzerhand den Nachnamen des Fußballers für seinen Filius ausgewählt, und nun darf sich Melchior, Jahrgang 1953, mit diesem etwas ungewöhnlichen Rufnamen herumschlagen.
Mit der Kirche an sich, und der katholischen im Besonderen, will er nichts mehr zu tun haben. Als Kind auf dem Land kannte er freilich nichts anderes. Nur durch einen Zufall entging er dem Schicksal, zum Ministranten ausgebildet zu werden. Nach seiner Kommunion stand für die Mutter fest, dass er einen Großteil seiner Freizeit in der Kirche und nicht auf dem Fußballplatz verbringen sollte. Für den damals Neunjährigen kam es dank eines kleinen Unglücks anders. Im April 1962 war von Frühling nichts zu spüren und der Dorfweiher noch sehr kalt. Ein Ausrutscher beim Spielen am Ufer und einige Minuten im zehn Grad kalten Wasser hatten für eine deftige Lungenentzündung gereicht. Seine dreiwöchige Bettlägerigkeit fiel just auf den Zeitraum, in dem die neuen Messdiener angelernt und in die Kirchengemeinde aufgenommen wurden. Im darauf folgenden Jahr kam niemand mehr auf die Idee, ihm das sakrale Amt aufbürden zu wollen. So konnte er sich weiterhin ohne Einschränkung auf dem Bolzplatz vergnügen.
Schon komisch, welchen Aufstand die frommen Katholiken in und außerhalb ihres Doms an Feiertagen veranstalten. Das Gebäude an sich ignorieren sie und lassen es sogar verkommen, stellt er fest und betrachtet die zerbröckelnde, schwarze Außenmauer des Doms. Sein Chef, der Redakteur Neubauer, hatte ihm gerade erst erzählt, dass das gotische Bauwerk die einzige Kathedrale Bayerns sei, die nicht dem Bistum, sondern dem Freistaat gehöre. Der Erhalt von St. Peter hat wohl nicht oberste Priorität, vermutet Melchior. Aber wieso sollte es dem Dom anders ergehen als der restlichen Altstadt, die marode unter Auspuffgewölk dahindümpelt.
Er löst sich aus seinen Gedanken und macht sich gespannt auf den Weg zum Termin. Kurz überprüft der junge Mann, ob er alles dabeihat und sein Aussehen auch dem eines ordentlichen Journalisten entspricht. In der ledernen Aktentasche, einem Erbstück seines Großvaters, findet er seinen Block und diverse Schreibwerkzeuge verstaut. Eine Kamera hat er nicht dabei. Es soll nur ein kurzer Text erscheinen, ohne Foto. Er fährt durch seine blonden, schulterlangen Haare, streicht das ungebügelte T-Shirt über seinem flachen Bauch glatt, begutachtet seine helle Cordhose und die ausgelatschten Turnschuhe und befindet sein Äußeres für gut.
Endlich ist es soweit, freut er sich und spürt, wie eine angenehme Aufregung seinen Körper durchströmt. Nun kann ich zeigen, dass ich nicht der weltfremde Junge bin, für den die Mutter mich hält. Ich werde ihr zeigen, dass ich erwachsen bin und sehr wohl mit Schreiben mein Geld verdienen kann! Sie wird akzeptieren, dass ich meinen eigenen Weg finden muss! Ich werde ihr beweisen, dass mein Entschluss richtig war und ich ein guter Journalist werden kann.
Der Haidplatz ist voller Menschen, als er verspätet und erhitzt dort ankommt. Er spürt sofort die spannungsgeladene Atmosphäre. Wie durch eine unsichtbare Wand sind zwei Gruppen voneinander getrennt. Auf der einen Seite befindet sich das illustre Völkchen rund um den Verein der Altstadtfreunde, bestehend aus bärtigen, langhaarigen Studenten, Müttern mit Kleinkindern in farbenfrohen Tragetüchern, Männern in Schlaghosen und Frauen in Blumenkleidern. Viele von ihnen kennt er von den Vereinstreffen, die er seit einem halben Jahr regelmäßig besucht. Er nickt ihnen freundlich zu.
Auf bunte Leinentücher haben sie in großen, schwarzen Buchstaben ihre Forderungen geschrieben: „Kein Durchgangsverkehr in der Altstadt!“, „Der Haidplatz ist kein Parkplatz!“ und „Erhaltung der mittelalterlichen Bauten!“. Einige in der Gruppe stehen ihren Gegnern lachend gegenüber, andere unterhalten sich angeregt. Melchior kann ihnen ansehen, wie wichtig sie ihr Engagement nehmen und mit welchem Eifer sie ihre Stadt verteidigen wollen. Sie scheinen bereit für den Kampf um den Erhalt der Patriziertürme, der engen Gassen und der verwinkelten Hinterhöfe.
Dem gegenüber registriert Melchior eine graue Masse von konservativen Bürgern mittleren Alters. Die meisten Männer tragen dunkle Anzüge und Hüte, die Frauen einfarbige Kostüme in gedeckten Farben und Handtaschen. Mit versteinerter Miene stehen viele von ihnen wartend da. Ein rotgesichtiger, untersetzter Mann verleiht seinem Unmut mit den Worten „G'schlamperte Hippiebrut“ Ausdruck, wird aber sofort von seiner Frau zur Ruhe gemahnt. Die werden wohl eher den Oberbürgermeister und seine Abbruchpolitik unterstützen, folgert der angehende Redakteur. Geistige Stadtzertrümmerer hatte sie Stadler, einer der Vorstände der Altstadtfreunde, beim letzten Vereinstreffen genannt.
Kurz vor Veranstaltungsbeginn geht ein unruhiges Murmeln durch die Reihen. Angespannt warten alle auf den Oberbürgermeister, der diesen Termin einberufen hat. Die Stadt will sich zum Bayerischen Denkmalschutzgesetz, welches im Oktober in Kraft treten wird, und die Folgen für Regensburg äußern. Der junge Journalist ist gespannt, wie sich die Abrisspläne der Verwaltung mit dem Denkmalschutz vereinen lassen.
Melchior ist im Auftrag der Zeitung vor Ort, er soll seinen ersten Artikel schreiben. Er hat sich vorgenommen, unparteiisch zu bleiben und die Leser objektiv über die möglichen Städtebaumaßnahmen zu informieren. Der Entwicklungsplan der Verwaltung sieht für ihre autofahrerfreundliche Variante viele Abrisse und Neubauten vor. Für die Gruppe der Altstadtfreunde kommt der Abbruch der jahrhundertealten Bauwerke nicht in Frage. Sie wollen den Verkehr weitgehend aus der Innenstadt verbannen und durch ein planvolles und sorgfältiges Sanieren der heruntergekommenen Häuser Wohnraum mit modernem Standard für jedermann schaffen. Privateigentümern, die ihre Altstadtanwesen lieber gezielt verfallen lassen, um die Grundstücke anschließend mit hohem Spekulationsgewinn zu verkaufen, soll ein Riegel vorgeschoben werden.
Als er den Oberbürgermeister mitsamt Gefolge auf den Platz treten sieht, bekommt er plötzlich Zweifel, ob er sich seine Neutralität bewahren kann. Die vier Männer sind ihm von Grund auf unsympathisch. Siegessicher begrüßen sie vereinzelt Befürworter ihres Stadtentwicklungsplans. Ihre Gegner betrachten sie geringschätzig und mit abwertenden Blicken, wie der junge Journalist verärgert zur Kenntnis nimmt. Melchior ermahnt sich selbst im Stillen, seine eigene Empfindung außer Acht zu lassen und holt den kleinen Notizblock und den Bleistift aus der abgegriffenen Ledertasche. Als die Vierergruppe an ihm vorbeikommt, schnappt er einen Gesprächsfetzen auf.
„Hätten die Amis 1945 ein paar Bomben mehr über der Altstadt abgeladen“, so raunzt ein dicker, stark schwitzender Mann dem Oberbürgermeister unter vorgehaltener Hand zu, „dann könnten wir uns den ganzen Zirkus hier sparen!“
Der Dicke legt dem Oberbürgermeister vertrauensvoll die Hand auf den Unterarm und flüstert ihm zu: „Wenn du es nicht schaffst, diese zerzausten Widerständler mundtot zu machen, dann endet hier deine politische Laufbahn, in diesem Provinznest. Die Regierung duldet in dieser Sache keine Einmischung von Seiten der Bürger.“
Diese offensichtliche Drohung scheint das Stadtoberhaupt nicht aus dem Konzept zu bringen, gut gelaunt nimmt er den Platz vor der wartenden Menge ein und beginnt seine Ansprache: „Grüß Gott meine lieben Mitbürger! Ich freue mich sehr, dass Sie sich so zahlreich hier eingefunden haben. Unsere schöne Heimat soll für die Zukunft gerüstet und als Wirtschaftsstandort ausgebaut werden. Aber gleichzeitig wollen und müssen wir dies im Hinblick auf das geplante Denkmalschutzgesetz sehr behutsam angehen. Dies alles kann natürlich nicht ohne kleinere Einschnitte geschehen. Gerade unsere Altstadt bedarf einer zeitgemäßen und autofahrerfreundlichen Verkehrsführung und einer architektonischen Aufwertung. Dies kann man wunderbar am Beispiel des 1965 entstandenen Kaufhauses am Neupfarrplatz vom Merkur-Horten-Konzern mit seiner ansprechenden Wabenfassade erkennen.“
Sofort bricht ein kleiner Tumult unter den Gegnern aus. „Die scheußlichen Hortenkacheln kannst du dir an den Hut stecken! Wie ein Feigenblatt klebt die Alte Wache vor der hässlichen Fassade dieser Konsumburg. Wir wollen eine verkehrsberuhigte Innenstadt und keine riesigen Kaufhäuser. Weg mit den Autos und den Parkplätzen!“, schreit ein junger Student dem Bürgermeister aufgebracht entgegen und beginnt, selbst gedruckte Flugblätter zu verteilen. Auch Melchior bekommt eines davon in die Hand gedrückt und liest aufmerksam die darauf wiedergegebene Rede, die erst vor ein paar Tagen der Bundeswohnungsbauminister Dr. Hans Jochen Vogel in Bamberg gehalten hatte: „Ich glaube, hinter der Bewegung der Altstadtsanierung steckt ein tiefer menschlicher, ein humaner Protest. Ein Protest gegen die zu ökonomische Stadt, die ihren Erfolg zu einseitig am Wachstum des Sozialproduktes misst ... Demgegenüber stellen sich unsere historischen Altstädte als eine Art Gegenmodell dar. Als Modell einer menschlichen Stadt, die den Einzelnen nicht überwältigt, sondern ihm Halt gibt, die ihm Identifizierung erlaubt und seinen Bedürfnissen nach Schönheit, nach Harmonie, nach edlen Formen und wohl proportionierten Flächen und Räumen Rechnung trägt. Solche Altstädte rechtfertigen besondere Anstrengungen unserer Gesellschaft. Wir brauchen solche Alternativmodelle als Mahnung, als Herausforderung, als Anschauungsobjekte, die es uns erleichtern, die Mängel und Fehler unserer gegenwärtigen Stadtentwicklung zu erkennen und den Kurs dieser Entwicklung zu korrigieren.“
Der Oberbürgermeister, jetzt etwas unschlüssig, dreht sich zu dem schwitzenden, dicken Mann mit Halbglatze und bespricht unter vorgehaltener Hand mit ihm die Lage. Kurz darauf wendet er sich wieder der Menge zu: „Ich übergebe nun das Wort an den Staatssekretär Schmiedl, der heute extra aus München angereist ist.“
Daraufhin tritt der Dicke souverän vor die Zuhörer.
„Guten Morgen, viele von Ihnen werden mich bereits kennen. Als Staatssekretär vertrete ich unsere bayerische Regierung in München. Uns liegt dieses heikle Thema genauso am Herzen wie Ihnen hier vor Ort. Wir wollen unser Bayern gemeinsam stark für die Zukunft machen und unser historisches Erbe dabei nicht vergessen“, beginnt er seine Ansprache.
Der Redner hat eine ungemeine Präsenz, diese spürt auch Melchior stark und blickt sich verwundert um. Auf einmal ist es in der Menschenmenge ganz ruhig geworden. Gebannt warten die Zuhörer, was als Nächstes kommt. Doch leider entpuppt sich der Politiker als reiner Phrasendrescher. Melchior schreibt sich die Stichworte „Ausbau zum attraktiven Wirtschaftsstandort“, „Marktfähigkeit“, „Zukunftsorientierung“ und „neue Wege gehen“ auf. Wie die mittelalterliche Stadt dabei erhalten werden soll, erwähnt Schmiedl mit keinem Wort. Das war auch nicht anders zu erwarten, denkt der junge Volontär mürrisch. Erhalten ist wohl das Letzte, was die Stadtverwaltung und die Staatsregierung wollen.
Die Rede von Vogel hat ihn berührt. Ja, er will in einer menschlichen Stadt leben, einer Stadt, die ihm Halt gibt. Allein schon diese Worte rufen ein tiefes Bedürfnis nach Gemeinschaft in ihm hervor. Ist er deshalb aus dem Dorf geflüchtet, wo er sich immer als Außenseiter fühlte? Er kann sich noch gut an seine erste Versammlung bei den Altstadtfreunden erinnern. Neu und etwas verloren in Regensburg, ohne enge Kontakte und mit nur wenigen, flüchtigen Bekannten, hatte er dort eine Ansammlung von Gleichgesinnten vorgefunden, die ihn herzlich aufnahmen, und ihm ein Gefühl von Heimat gaben. Sofort hatte er sich wohlgefühlt.
Er ist so in das Flugblatt vertieft, dass er das Raunen nicht wahrnimmt, das durch die Reihen geht. Als dieses immer lauter wird, blickt er auf und richtet seine Aufmerksamkeit wieder dem Redner zu.
„Solche Umstrukturierungsmaßnahmen sind mit einem erheblichen, finanziellen Aufwand verbunden. Dies kann der Freistaat natürlich nicht alleine schultern. Einen Teil werden Zuschüsse vom Bund decken, einen Teil, liebe Mitbürger, muss auch die Stadt selbst dazu beitragen. Ich bin mir sicher, dass der Stadtentwicklungsplan mittelfristig zu unserer Zufriedenheit umgesetzt werden kann. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und überlasse das Wort nun wieder dem Herrn Oberbürgermeister. Leider rufen mich meine Verpflichtungen zurück nach München!“
Gelassen wendet er der Gruppe seinen Rücken zu und schreitet mit großen Schritten vom Platz. Trotz seiner kleinen Statur ist er erstaunlich schnell unterwegs. Melchior kann ihn gerade noch einholen. Er will in den Artikel ein Interview mit dem Politiker einbauen.
„Guten Morgen, Herr Staatssekretär, ich arbeite für die örtliche Zeitung und würde Sie gerne um ein oder zwei Sätze für meinen Artikel bitten.“ Als Melchior seinen Nachnamen nennt, bleibt der Dicke stehen und schaut ihn prüfend an. Schließlich gestattet er dem hochgewachsenen Volontär seine Fragen.
„Wie lässt sich das geplante Denkmalschutzgesetz mit den Plänen der Regierung hier in Regensburg vereinen?“, will er als Erstes wissen.
Kurz überlegt der andere. „Ich kannte mal einen Anderl mit dem gleichen Nachnamen wie du, vor langer Zeit. Irgendwie hast du eine Ähnlichkeit mit dem. Kannt des sei, dass Du mit dem verwandt bist?“, antwortet der Dicke stattdessen in einem breiten, oberpfälzer Dialekt.
„Ja, des is mei Großvater“, erwidert Melchior erstaunt. „Woher kennen Sie den?“ Auch er wechselt vom Hochdeutschen in seinen Heimatdialekt.
„Mei, des war vor langer Zeit, im Krieg. Geht‘s ihm guad?“
Melchior berichtet, dass der Großvater gesund sei, er in letzter Zeit aber immer vergesslicher werde. Schmiedl scheint sich bei der Schilderung ein schadenfrohes Grinsen nicht verkneifen zu können.
„Sei doch so nett, und sog ihm an schönen Gruß mir. Und seiner Frau, der Theres, auch.“
Der Staatssekretär überlegt kurz, dann fügt er noch hinzu: „I persönlich halt‘s ja mit der Kahlschlag-Ideologie vom Le Corbusier: Der Kern unserer Städte muss zerschlagen und durch Wolkenkratzer ersetzt werden. Und wo gehobelt wird, da fallen nun mal Späne! Des is aber mei eigene Meinung, des schreibst ned in deiner Zeitung!“
Mit diesen Worten dreht Schmiedl sich grußlos um und eilt in seinem zu engen, braunen Anzug davon. Das Hemd spannt über dem dicken Bierbauch, das Haar um seine Halbglatze klebt auf dem verschwitzen Gesicht und seine kurzen, dicken Finger holen aus der Jackentasche Zigaretten hervor. Melchior beobachtet, wie der Politiker gierig ein paar Züge inhaliert und dann in eine wartende, dunkle Limousine mit Münchner Kennzeichen steigt.
Melchior schaut ihm verdutzt hinterher. Er kam nicht zu Wort, konnte dem anderen nicht sagen, dass seine Großmutter Theres letztes Jahr gestorben ist. Was hatte dieser Mensch im Krieg mit den Großeltern zu tun, wundert er sich. Er selbst weiß nur wenig von damals. Weder seine Mutter noch die Oma oder der Opa haben viel darüber geredet. Immer, wenn dieses Thema zur Sprache kam, reagierten sie verstockt und abweisend. Unter den engen Verwandten gab es keine Opfer, das hat er erfahren. Kämpfe haben in seiner Heimat nicht stattgefunden, die Amerikaner haben Fichtenried ohne Widerstand eingenommen, auch das ist ihm bekannt. Ob ihnen auf eine andere Art und Weise Leid zugefügt wurde und sie deshalb nicht darüber reden wollen? Was weiß dieser Schmiedl?
Die kurze Begegnung mit dem unsympathischen Politiker hat etwas in ihm angestoßen. Es ist, als ob eine lange versperrte, schwere Türe einen Spalt breit aufgegangen wäre. Er kann erahnen, dass sich dahinter etwas Wichtiges verbirgt. Melchior will herausfinden, was es ist. Vielleicht kann er dann die Zurückhaltung überwinden, die er in seiner Familie und vor allem bei seiner Mutter oft spürt.
Aber im nächsten Moment ist er in Gedanken beim späteren Treffen der Altstadtfreunde, die ihre Ideen zum geplanten, ersten Bürgerfest in Regensburg vorstellen wollen. Darauf freut er sich schon seit Tagen.
Anderl
Sehnsüchtig schaut Anderl in seinem dunkelblauen Kittel von seiner alten Holzbank vor dem Haus den Bauern zu, wie sie ihr Heu einholen. Wie gerne wäre er jetzt mit ihnen draußen auf dem Feld und würde sein Tagwerk verrichten. Ihm ist klar, dass er mit 75 Jahren zu alt für diese Art von Arbeit ist. Seine Gelenke sind schon etwas eingerostet und der Rücken schmerzt oft in letzter Zeit. Auch fallen ihm Namen nicht mehr auf Anhieb ein und er wiederholt sich. Walburga macht ihn bei jeder Gelegenheit mürrisch darauf aufmerksam. Dass er in letzter Zeit häufig Kopfschmerzen hat und ihm beim Treppensteigen die Luft ausgeht, erzählt er der Tochter lieber nicht. Auch nicht, wie müde er sich tagsüber oft fühlt.
Sein Wunsch war, die Tochter hätte den Hof übernommen. Die wollte davon allerdings nichts wissen und so wurden nach und nach die Kühe und Schweine verkauft, ebenso die vielen, nun nutzlosen landwirtschaftlichen Geräte. Nur gegen den Verkauf des Traktors wehrte er sich stoisch. Dieser ist ihm nach all den Jahren ans Herz gewachsen und er kann sich nicht vorstellen, das uralte Dieselgefährt wegzugeben. Schon als junger Mann war er fasziniert von der damals neuartigen Technologie und hatte alles darüber gelesen. Und als sich in den 1930er Jahren der erste Fichtenrieder Bauer ein Fendt-Dieselross zugelegt hatte, war er immer zur Stelle gewesen, wenn es am Motor etwas zu schrauben gab. Mit seinem eigenen Traktor, den er sich Mitte der 1950er Jahre gekauft hat, darf er längst nicht mehr fahren, das hat ihm die Walburga verboten. Er würde sich auf den neu angelegten Flurbereinigungsstraßen verirren und nicht mehr heimfinden.
„So a Schmarrn“, schmollt er vor sich hin. „Ich leb' hier seit 75 Jahren. Blind find' ich mich in meiner Heimat z'recht!“
Obwohl, Fichtenried hat sich in den letzten zehn Jahren schon sehr verändert, überlegt der alte Mann mit dem löchrigen Strohhut, unter dem sich sein schütteres, graues Haar verbirgt. Er ist nicht besonders groß gewachsen und sehr schlank. Er hat in all den Jahren sein Gewicht konstant gehalten, worauf er heimlich stolz ist. Wenn er die Bierbäuche seiner Nachbarn und Altersgenossen sieht, ist er froh darüber, dass er fast immer nach einer Maß zu trinken aufgehört hat. Wenn er lächelt, erhellen sich seine braunen Augen, sein aufgeschlossenes, fast faltenloses Gesicht strahlt und sein spitzbübisches Wesen lässt sich erahnen. In dem 800-Seelen-Dorf gab es früher einmal 50 Bauernhöfe, die alle von der Landwirtschaft lebten. Heute wird nur noch die Hälfte davon als Vollerwerbsbetrieb bewirtschaftet. Und es werden noch weniger werden, sieht der alte Bauer traurig in die Zukunft.
Welch glücklicher Umstand, findet Anderl, dass die Bahnlinie direkt an Fichtenried vorbeiführt, und es sogar einen eigenen Bahnhof gibt. Somit haben diejenigen, die nun anderweitig ihr Geld verdienen müssen, eine gute und einfache Möglichkeit in die Stadt zu kommen.
Mit den vielen Berufspendlern ist leider auch eine Kälte in das kleine Dorf gekommen, die früher für Anderl unvorstellbar gewesen wäre. Die Zeiten, in denen man bei einem aufziehenden Unwetter gemeinsam die Ernte eingeholt und sich gegenseitig bei der schweren Arbeit ausgeholfen hatte, haben die Dorfgemeinschaft eng zusammenrücken lassen. Jetzt begegnet er vielen Nachbarn höchstens am Morgen oder nach Feierabend und mehr als ein „Grüß Gott“ kommt oft nicht zustande. Tagsüber wirkt das kleine Dorf wie ausgestorben. Ob sich die alte Josefa noch lange mit ihrem Lebensmittelladen halten kann, fragt sich der Bauer. Kundschaft hat sie kaum noch.
Die Stille um ihn herum irritiert ihn. Was hat die Burgi gesagt, wo sie hinfährt? Es fällt ihm einfach nicht ein. Wollte sie zum Einkaufen oder zum Frisör? Das Auto, das schwungvoll auf den Hof fährt, unterbricht seine Gedanken. Ja genau, den Buben wollte sie vom Bahnhof abholen, freut er sich.
„Mei Bub, lang warst scho' nimmer dahoam. G'fallts dir in der Stadt so guad?“, fragt er, mehr scherzend als ernst gemeint. Seiner Meinung nach sollen die jungen Leute heutzutage etwas Richtiges lernen. Und wenn man dazu weg muss aus dem Dorf, dann ist das gut so. Auf einem Bauernhof konnte er sich den Buben nie vorstellen.
„Mit deine zwoa link'n Händ' bist besser bei da Zeitung aufgehob'n als drauß'n auf'm Feld“, sagt er dem Enkel immer wieder. Die Tochter wollte zwar auch nicht, dass Melchior Bauer wird. Walburga hatte ihren Sohn dazu gedrängt, wie sein Vater Clemens Medizin zu studieren und nach dem Studium im selben Krankenhaus zu arbeiten. Und er sollte während des Studiums daheim wohnen bleiben. Sie wollte ihn nicht ziehen lassen. Insgeheim vermutet Anderl, dass seine Tochter den Buben nicht hergeben kann. Für sie wird Melchior immer der kleine Junge bleiben, über den sie bestimmt. Ihr Verhalten dem Buben gegenüber ist mehr durch Härte, als durch Herzlichkeit geprägt, bedauert Anderl.
„Aber was soll's, sie hat ja partout auch ned des g'macht, was ich mir für sie vorg'stellt hab‘. Der Bub hat scho' recht, wenn er macht, was er will!“
Lächelnd rückt Anderl ein Stück, um seinem Enkel auf der Bank Platz zu machen und bedeutet diesem mit einem Klopfen auf das verwitterte Holz, sich neben ihn zu setzen. Melchior ist die Freude darüber anzumerken, dass er den Großvater wiedersieht. Wortlos geht Walburga zum Haus, um das Abendessen vorzubereiten. An der Türe hält sie kurz inne und dreht sich um.
„Hilfst' mir?“, will sie von ihrem Sohn wissen.
„Ich komm' gleich nach“, gibt er zurück. „Ich setz' mich nur noch zwoa Minuten zum Opa her.“
Anderl freut sich, dass er mit seinem Enkel auf der alten Bank sitzen kann und eine kleine Weile seine Gesellschaft genießen darf. Auch wenn der nun auf eigenen Beinen steht, und sein Leben selbst in die Hand nimmt, hat er trotzdem das Gefühl, für den Jungen da sein zu müssen. Früher hat Burgi den Buben schon wegen einer einzelnen, schlechten Note sehr stark kritisiert und die vielen, guten Zensuren nicht richtig gewürdigt. Viel Tadel und wenig Lob, das stand häufig auf der Tagesordnung. Vor allem Theres hat dem Enkel in diesen Situationen Mut zugesprochen und ihn tröstend in den Arm genommen. Und seit sie nicht mehr da ist, hat er diese Aufgabe übernommen, auch wenn Melchior schon längst nicht mehr darauf angewiesen ist. Walburga gegenüber konnte er nie so herzlich und einfühlsam sein. Macht ihn das Alter weicher, fragt er sich.
„Du Opa, kennst du eigentlich den Schmiedl, den Staatssekretär?“, erkundigt sich Melchior aufgeregt und unterbricht damit jäh Anderls Überlegungen.
Der Name trifft ihn wie ein Blitz. Wie lange hat er nicht mehr an diesen Heuchler, diesen Verbrecher gedacht? Kurz nach dem Krieg war dieser mit Röschl aus dem Dorf verschwunden. Der Röschl kam nach der Entnazifizierung, reingewaschen durch den Persilschein zurück und wurde wieder zum allgemein geschätzten Dorflehrer. Der Schmiedl blieb verschollen. Jetzt ist er also in München untergekommen, der Sauhund! Als Staatssekretär!
Der Groll gegen Schmiedl weicht sofort einem schlechten Gewissen und dem Gefühl, versagt zu haben. Zum wiederholten Mal hadert er damit, damals mit Schmiedl gemeinsame Sache gemacht zu haben. Dann taucht das Bild seiner Frau Theres vor ihm auf und er weiß, dass er keine Wahl hatte.
Der alte Bauer kann sich noch genau an den Prozess vor der Spruchkammer erinnern, in dem über die Täterschaft von Schmiedl während der NSDAP-Diktatur verhandelt wurde. Er selbst musste als Zeuge aussagen und hat wider besseres Wissen dem Angeklagten ein gutes Leumundszeugnis ausgestellt. Den Wortlaut des Protokolls hat er noch im Kopf: „Ich erkläre hiermit an Eidesstatt, dass der frühere Ortsgruppenleiter der NSDAP, Herr Schmiedl, sich allen Widrigkeiten zum Trotz sehr für die im Ort untergebrachten Zwangsarbeiter eingesetzt hat. Nur ihm ist es zu verdanken, dass diesen kein Unrecht geschah.“
Und auch den heuchlerischen Ton von Schmiedls Stellungnahme wird er nie vergessen: „Von Germanisierung und Verfolgung der Juden während des Krieges hatte ich keine Kenntnis. Bei uns gab es keine Juden. Kriegsgefangene und Fremdarbeiter habe ich immer gut behandelt. Erst nach der Kapitulation habe ich von den schrecklichen Verbrechen erfahren. Ich fühle mich nicht schuldig.“