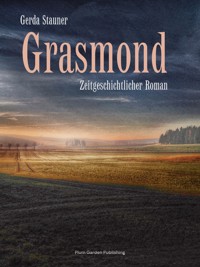Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Plum Garden Publishing
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein einsamer Wolf. Ein verlassenes Dorf. Zwei Menschen am Scheideweg.
Der Journalist Melchior Beerbauer steht vor einem Scherbenhaufen. Er ringt mit der Frage, ob er das Geheimnis um seinen unehelichen Sohn lüften soll, denn damit würde er seinen besten Freund verlieren. Zeitgleich beginnt er mit der Recherche über die ungeheuerliche Enteignung von fast fünftausend Menschen, die 1951 einem Truppenübungsplatz weichen mussten. Melchior findet heraus, dass eine Urgroßmutter ebenfalls aus dieser Gegend stammte und damals ihre Jugendliebe zurücklassen musste. Ein einsamer Wolf, der immer wieder auf dem naturgeschützten Gelände gesichtet wird, weckt Melchiors Interesse. Das wilde Tier, mit dessen Schicksal sich der heimatlose Melchior seltsam verbunden fühlt, deckt verschüttete Sehnsüchte in ihm auf.
"Ein Lesegewinn!" urteilt BR Heimat über Grasmond und Sauforst, die ersten beiden Bücher dieser Familiensaga.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 322
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die Autorin
Gerda Stauner lebt in Regensburg, ist aber in der ländlichen Oberpfalz aufgewachsen. Mittlerweile fährt sie regelmäßig zum Schreiben in ihre alte Heimat zurück und geht dort oft im Wald spazieren. Dabei entstehen die Figuren und Handlungen ihrer Geschichten. Literarisch widmete sie der Oberpfalz eine dreibändige Familiensaga, die zwischen 2016 und 2019 publiziert wurde. 2021 wurde daraus eine gekürzte Hörbuchfassung veröffentlicht.
Die Autorin schreibt Romane, Hörspiele, Theaterstücke und Beiträge für Anthologien und ist selbst auch immer wieder Herausgeberin verschiedener Texte. Außerdem arbeitet sie mit Kindern und Jugendlichen bei verschiedenen Autorenwerkstätten und gibt ihr Wissen in Schreibseminaren und Workshops weiter. Zudem schreibt Gerda Stauner für ein digitales Nachrichtenportal und hostet einen Podcast.
Weitere Infos gibt es auf der Webseite www.gerda-stauner.de
Das Buch
Ein einsamer Wolf. Ein verlassenes Dorf. Zwei Menschen am Scheideweg.
Der Journalist Melchior Beerbauer steht vor einem Scherbenhaufen. Er ringt mit der Frage, ob er das Geheimnis um seinen unehelichen Sohn lüften soll, denn damit würde er seinen besten Freund verlieren. Zeitgleich beginnt er mit der Recherche über die ungeheuerliche Enteignung von fast fünftausend Menschen, die 1951 einem Truppenübungsplatz weichen mussten. Melchior findet heraus, dass eine Urgroßmutter ebenfalls aus dieser Gegend stammte und damals ihre Jugendliebe zurücklassen musste. Ein einsamer Wolf, der immer wieder auf dem naturgeschützten Gelände gesichtet wird, weckt Melchiors Interesse. Das wilde Tier, mit dessen Schicksal sich der heimatlose Melchior seltsam verbunden fühlt, deckt verschüttete Sehnsüchte in ihm auf.
„Ein Lesegewinn!“ urteilt BR Heimat über Grasmond und Sauforst, die ersten beiden Bücher dieser Familiensaga.
Wolfsgrund
Eine Spurensuche
Roman von Gerda Stauner
I M P R E S S U M
Titelfoto: Adi Spangler
Wolfsgrund – Eine Spurensuche
Autor: Gerda Stauner
ISBN: 9-783-98522-943-7
© 2021 Plum Garden PublishingAlle Rechte vorbehalten.plumgarden.de
93047 Regensburg, [email protected]
www.gerda-stauner.de
Prolog
Aus dem Dickicht pirscht lautlos ein imposantes Jungtier heran. Zögerlich hebt es den Kopf, die Augen blicken neugierig über das abfallende Gelände. Es schleicht in geduckter Haltung den Hang hinunter, bleibt immer wieder stehen, wittert. Unvermittelt setzt es zum Sprung an und landet auf dem vom vermodernden Herbstlaub der hundertjährigen Linde gepolsterten Boden. Der Wolf ist wohl auf der Suche nach einem neuen Revier die vielen Kilometer aus Tschechien über den Bayerischen Wald hierher in dieses Niemandsland gekommen. Nach mehr als 135 Jahren hat dieses majestätische Geschöpf erstmals wieder heimgefunden. Damals hatten die Menschen in Bayern alles daran gesetzt, die Wolfsrudel endgültig auszurotten.
Zwei tagscheue Hufeisennasen auf ihrem Weg ins Schlafquartier im Turm der kleinen Kirche schrecken kurz auf, drehen eine Extrarunde und schlüpfen dann in das alte Gemäuer. Vor Kurzem erst haben Menschen das Kirchlein wieder instand gesetzt, den Turm erneuert und in den Fensteröffnungen Einflughilfen für die geschützte Fledermausart angebracht. Im Inneren der Kirche ist es stockdunkel. Das zaghafte Rosa des kommenden Tages, das sich im Osten bemerkbar macht, dringt noch nicht durch die Ritzen der groben Holzplatten, die die Tür verschlossen halten. Doch ganz hinten, versteckt im ehemaligen Altarraum, flackert das rote Licht elektrischer Grableuchten. Wie lange mögen die Batterien schon halten? Der letzte Gottesdienst hat vor über acht Monaten stattgefunden. Es wurde Kirchweih gefeiert von denen, die einst hier lebten, und denen, die niemals hier leben dürfen.
Der schwache Schein des elektrischen Lichts lässt die Namen derer erahnen, die es nicht mehr geschafft haben, letzten Sommer hierherzukommen. Auf einer Holzplatte reihen sich die Sterbebilder der einstigen Bewohner aneinander. Einige wenige Plätze sind noch leer. Letztendlich, nach all den Jahren, sind die ehemaligen Nachbarn wieder vereint.
Neben den Sterbebildern fällt das Licht auf Namen, die direkt in den zerklüfteten Putz der alten Kirche geritzt wurden. Sie wirken ungewöhnlich an diesem Ort: James, Jefferson, Greg. Dabei stehen Jahreszahlen, die bezeugen sollen, wann diese Männer hier waren: 1986, 1992, 2000.
Ein Kratzen, ein Windhauch, wieder hat eine Hufeisennase den Weg in ihr Versteck gefunden. Der Marder hat bisher vergeblich versucht, durch die Einflughilfe ins Innere der Kirche zu gelangen. Er scheitert an der glatten Oberfläche der schwarzen Platten. Fände er mit seinen Krallen Halt, würde er wohl in einer Nacht die vom Aussterben bedrohten Tiere töten, die sich nur an wenigen Orten angesiedelt haben, wie hier in der Oberpfalz.
Draußen schleicht der Wolf näher an das verfallene Dorf heran. Vielleicht kann er noch einen Hauch des Lebens wittern, das hier vor fast siebzig Jahren pulsierte. Eine Kirche mit angebauter Kegelbahn, eine Dorfhüll, eine Brauerei mit Wirtschaft, eine Schmiede. Etliche Bauernhäuser, Stallungen und Bauerngärten mit angrenzenden Feldern und Wiesen schmiegten sich an die alte Dorfstraße.
Der Wolf spitzt die Ohren, bleibt reglos stehen. Hört er die Geister derer, die zurückgekommen sind, um hier ihre letzte Ruhe zu finden? Oder spürt er, dass die Menschen an diesem Ort im Wettstreit mit der Natur verloren haben? Dass sich hier, wo Bäume aus Fenstern wachsen und am Sonntag nur noch Fledermäuse die Kirche bevölkern, ein einzigartiges Schauspiel ereignet? Andernorts längst ausgestorbene Apfelsorten blühen Jahr für Jahr in der Abgeschiedenheit dieses Fleckens und bringen Herbst für Herbst reiche Ernte. Vögel, Insekten und die Tiere des Waldes genießen dieses überbordende Angebot an süßem Obst.
Das zaghafte Rosa hat sich in ein prächtiges Morgenrot verwandelt. Der Wolf scheint das Interesse an der Kirche und den Häusern verloren zu haben und schleicht auf seinen rauen Pfoten zurück ins Unterholz. In diesem Moment trifft das erste Licht des Tages auf die Reste eines Hauses, das ohne Dach schutzlos der Witterung und dem Verfall ausgesetzt ist. Im Bruchteil einer Sekunde werden die schillernden Überreste der blauen Wandbemalung sichtbar. Und man erhält eine Ahnung davon, wie es an diesem Ort einmal ausgesehen hat, mit wie viel Leben das Dorf erfüllt war. Hier wurden Menschen geboren und beerdigt, haben gelitten, gelacht und geliebt.
Eins
Die Einsamkeit ist seit Jahren Melchiors ständiger Begleiter. Er hat sich damit arrangiert. Wie ein alter, abgetragener Mantel umfängt ihn das vertraute Gefühl. Mit der Zeit hat es immer mehr Raum in seinem Leben eingenommen. Nun, kurz vor seinem Renteneintritt, hat er seinen Frieden damit gemacht, allein zu bleiben. In der Redaktion kursieren diverse Gerüchte über ihn: er sei schwul, seine Familie habe ihn schon vor Jahren wegen seines unzugänglichen Wesens verlassen, er sei beziehungsunfähig. Er selbst trägt nichts zu diesen Mutmaßungen bei, weder zu deren Unterstützung noch zu deren Entkräftung. Seit fast 45 Jahren arbeitet er für dieselbe Zeitung. Bald gibt es einen großen Empfang, sein 65. Geburtstag und gleichzeitig sein letzter Arbeitstag werden zusammen mit seinem Firmenjubiläum gefeiert. Aber keiner seiner alten Weggefährten wird da sein, um mit ihm anzustoßen. Seine Freunde aus alten Tagen sind entweder schon tot oder arbeiten seit Langem anderswo. Nur er ist geblieben, hat Krisen und Umzüge erlebt, hat Verleger, Redaktionsleiter und Volontäre kommen und gehen sehen. Außer ihm hat es nur der Pförtner ähnlich lange bei der Zeitung ausgehalten.
Schmidheim. Ein ganz gewöhnlicher Ortsname. Er verrät nichts über das tragische Schicksal des kleinen Dorfes. Melchior hat bereits in den Unterlagen geblättert, die ihm der Pressesprecher der Hohenfels Military Community zur Vorbereitung des Interviews zukommen ließ. Wieso der Chefredakteur ausgerechnet ihn für diese Aufgabe ausgewählt hat, bleibt ihm ein Rätsel. Andere, viel jüngere und engagiertere Redakteure hätten sich gefreut über diese Besichtigungstour durch das verlassene Niemandsland, weit weg vom eintönigen Büroalltag. Endlich mal rauskommen aus dem überdimensionierten Newsroom, in dem niemand mehr einen festen Arbeitsplatz hat. Aber ausgerechnet er, das Überbleibsel aus einer anderen Zeit, findet sich scheinbar am leichtesten mit dieser Neuerung zurecht. Um arbeiten zu können, braucht er nur einen gespitzten Bleistift und sein Notizbuch. Kein neumodisches Modell mit Gummibandverschluss und Hardcover, sondern ein einfaches Heft mit Deckeln aus stabilem Karton. Melchior hat etwa ein Dutzend davon in seinem Büroschrank verstaut. Das sollte bis zum Ende seiner Karriere als Zeitungsschreiber reichen.
Kurz bevor er aufbricht, erscheint unten rechts auf seinem Bildschirm das Symbol für eine neue Email. Käme die Nachricht nicht von seiner Redaktionsleiterin, würde er sie in diesem Moment wohl ignorieren. So aber überfliegt er sie:
PRESSEMITTEILUNG
Nr. 05 / 2019 10. März 2019
Natur
Landesamt für Umwelt: Wolfsriss im Landkreis Neumarkt i. d. Oberpfalz bestätigt
+++ Anfang Januar wurde auf dem Gelände des Truppenübungsplatzes Hohenfels im Landkreis Neumarkt i. d. Opf. ein erwachsenes weibliches Rotwild tot aufgefunden. Zur weiteren Abklärung beauftragte das Landesamt für Umwelt die genetische Analyse gesicherter Speichelspuren an den Bissstellen im Halsbereich. Nach den nun vorliegenden Ergebnissen können diese eindeutig einem Wolf aus der zentraleuropäischen Tieflandpopulation zugeordnet werden. Die Qualität der Probe war jedoch für eine Bestimmung des Geschlechts und der Rudelzugehörigkeit nicht ausreichend. +++
„Wölfe in der Oberpfalz“, denkt er beim Herunterfahren des Computers, „wenn das mal kein verfrühter Aprilscherz ist.“
Melchior hat sich gegen eine Anreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln entschieden. Es wäre zu umständlich gewesen und hätte zu lange gedauert, bis er an Tor–Zwei, dem vereinbarten Treffpunkt, angekommen wäre. Stattdessen hat er sich an das nicht minder mühselige Prozedere zur Bestellung eines Poolfahrzeugs gewagt und eines für den heutigen Vormittag reserviert. Beim Einsteigen in den Kleinwagen muss er sich hinter das Lenkrad quetschen, sucht dann an der falschen Stelle nach dem Hebel für die Sitzverstellung, findet ihn endlich, fährt ruckartig nach hinten und hat schließlich Platz für seine langen Beine. Penibel stellt er Rück- und Seitenspiegel ein, kontrolliert Blinker und Warnblinkanlage und startet den Wagen. Augenblicklich schreit ihm aus dem Radio die penetrante und durchdringende Stimme einer Ansagerin entgegen. Sofort stellt er das Gerät auf stumm.
Er wählt die kürzeste Route, die aber länger dauert und ihn über das Land führt. Die Straße ist noch nass von einem Regenschauer, der in der Nacht niedergegangen ist. Nach zehn Minuten hat er die Stadt hinter sich gelassen und fährt einem erwachenden Tag entgegen. Das Grau der letzten Tage scheint durch den Wolkenbruch wie fortgespült und der Himmel strahlt in einem Blau, das einen wunderbaren Frühlingstag verspricht. Dafür ist es jetzt im März eigentlich noch zu früh. Die Landschaft selbst ist eintönig und nur ganz selten blitzt etwas Grün am Straßenrand oder ein zartes Rosa an einem früh blühenden Strauch auf.
In Gedanken geht Melchior die Informationen durch, die er über Schmidheim gesammelt hat. Die Einwohner des Dorfes mussten ihren Grund und Boden im Herbst 1951 innerhalb von drei Monaten verlassen und erhielten eine Entschädigung. Sie konnten nur ihr transportfähiges Hab und Gut mitnehmen, alles andere blieb zurück. Waldbesitzer durften gerade noch ihre Bäume schlagen, mussten diese jedoch aufgrund des stark gestiegenen Angebots günstig an einen Großhändler verkaufen, der sich damit den Grundstein für sein späteres Industrieunternehmen vergoldete. Schulkinder hatten bald nach den Sommerferien erneut ihren letzten Schultag und wurden von ihrem Lehrer in eine ungewisse Zukunft entlassen. Die Eltern daheim waren ihnen in dieser unsicheren Zeit ebenso wenig eine Stütze wie die Nachbarskinder oder der Pfarrer. Die letzte Ernte musste eingefahren werden, ein neuer Hof, ein neues Haus, eine neue Heimat gefunden werden. Kisten mussten gepackt, Verträge unterschrieben und ganze Dächer abgedeckt werden. Zäune mussten abmontiert, Kühe und Schweine verkauft und Transportunternehmen gefunden werden.
Melchior hat neben den Zahlen und Fakten, die er vom Public Affairs Specialist bekommen hat, auch noch Artikel aus dem hauseigenen Zeitungsarchiv gelesen und sich Bücher über diese Zeit besorgt. Er geht niemals unvorbereitet zu einem Interviewtermin. Was er bisher aber nicht herausfinden konnte, ist, weshalb sein Gesprächspartner ausgerechnet dieses kleine Dorf für die Besichtigung vorgeschlagen hat. Insgesamt verschwanden während zwei Aussiedlungswellen in den Jahren 1938 und 1951 über hundert Weiler und Dörfer von der Landkarte und knapp fünftausend Menschen mussten sich eine neue Heimat suchen. Was macht Schmidheim so besonders?
Ein regionaler Sicherheitsdienst ist für die Überwachung von Tor-Zwei zuständig. Melchior wundert sich im ersten Moment darüber und sucht vergeblich nach Soldaten der U.S. Army. Bevor er aussteigt, wirft er noch einen kurzen Blick in den Rückspiegel und prüft sein Aussehen. Der Journalist streicht über seine glattrasierten Wangen, fährt durch seine grauen, halblangen Haare und rückt seine schwarze Kunststoffbrille zurecht, die seine grünen Augen perfekt umrahmt. Seine Optikerin hatte ihn darauf aufmerksam gemacht und ihm dieses Modell wärmstens ans Herz gelegt, er selbst legt keinen Wert auf diese Details. Er steigt aus, holt seinen Presseausweis aus der Tasche und fragt nach seiner Kontaktperson. Nach kurzem Warten fährt der Pressesprecher in einem Geländewagen vor und begrüßt ihn mit einem bayerischen „Grüß Gott, Herr Beerbauer“. Erklärend fügt er hinzu, er komme aus der Gegend und arbeite seit fast dreißig Jahren für die amerikanischen Streitkräfte. Melchior ist enttäuscht. Insgeheim hatte er sich auf einen weitgereisten, weltgewandten und interessanten Gesprächspartner gefreut. Nun sitzt er in einem japanischen Jeep, in dem auf der Rückbank die Utensilien eines Hobbyjägers verstaut sind, und unterhält sich mit einem Oberpfälzer Original. Er muss aufpassen, dass er selbst beim Hochdeutsch bleibt und ihm nicht hin und wieder versehentlich Dialektbrocken über die Lippen kommen. Die Sprache des anderen ist ihm vertraut und er ist permanent versucht, ihm in derselben Art und Weise zu antworten.
Der Jeep passiert das streng bewachte Tor und sie befahren das gut abgeriegelte Gebiet. Vor Kurzem hatte Melchior einen Satz gelesen, der ihm jetzt wieder einfällt: Durchlässige Grenzen kann man sich nur erlauben, wenn man sich der eigenen sicher ist. Bei den amerikanischen Streitkräften scheint das nicht der Fall zu sein.
Sie fahren einige Kilometer und bald schon ist da nur noch verwaistes Land. Das Gelände wird nur selten von Schotterstraßen durchbrochen, darüber hinaus finden sich keine Spuren menschlicher Zivilisation. Seltsamerweise sind zwischen den Waldstücken mit Nadelgehölz, den kleinen felsigen Anhöhen und den sumpfigen Tälern keine Einschlagkrater oder sonstige Kampfspuren zu sehen. Nichts weist darauf hin, dass hier an dreihundert Tagen im Jahr internationale Einsatztruppen ihre Wehrübungen abhalten. Gestern zog wohl eine Einheit aus Osteuropa ab, Soldaten aus Übersee sind im Anmarsch.
Eine Staubwolke in gut zwei Kilometer Entfernung kündigt ein weiteres Fahrzeug in dieser Einöde an. Der Pressesprecher drosselt sein Tempo und bleibt auf Höhe des entgegenkommenden Geländewagens stehen. Misstrauisch beäugt dessen Fahrer den Journalisten. Melchior fühlt sich augenblicklich fehl am Platz. Nach einem kurzen Gespräch zwischen den beiden Männern geht es weiter. Es handelte sich um einen Förster, der genau wissen wollte, was der Redakteur hier zu suchen hatte. Wieder ist Melchior verwirrt. Er dachte, er würde hier ausschließlich auf Amerikaner treffen. Das kurze Gespräch der beiden Männer drehte sich außerdem noch um einen Wolf, dessen Spuren vor ein paar Tagen in diesem Gebiet nachgewiesen werden konnten. Wölfe in der Oberpfalz? Die Meldung von vorhin war also doch kein verfrühter Aprilscherz! Es ist ihm schon lange nicht mehr passiert, dass er in so kurzer Zeit derart oft überrascht wurde. Dieser Termin scheint doch interessanter zu werden, als er dachte.
Sie biegen von der Schotterpiste in einen unbefestigten Weg ein und fahren leicht bergab. Nach einer Linkskurve liegt ein lang gestreckter Platz vor ihnen, der beidseitig von dornigem, haushohem Gestrüpp eingegrenzt wird. Dort steigen sie aus.
In der Mitte des Platzes thront eine alte Kirche, die auf Melchior ungewöhnlich wirkt. Der Glockenturm scheint auf halber Höhe gekappt worden zu sein und die großformatigen Fenster sind mit dunkel glänzenden Platten verschlossen. Neben der Kirche befinden sich die Überreste eines lang gezogenen Gebäudes, gegenüber ein Tümpel mit braunem Wasser, auf dem noch stellenweise dünne Eisplatten schwimmen. In der letzten Nacht sind die Temperaturen unter den Gefrierpunkt gesunken. Etwas entfernt liegen kleine Haufen nutzloser Ziegelsteine verstreut, hinter der Kirche reckt eine stattliche Linde ihre mächtige, noch blattlose Krone gen Himmel.
Der Pressesprecher scheint in seinem Element zu sein. Er erzählt begeistert vom Wiederaufbau der Kirche und ihrer Umnutzung zum Schlafplatz für eine fast ausgerottete Fledermausart, der Großen Hufeisennase. Er erzählt von Pomologen, die einmal im Jahr scharenweise das Gelände stürmen und die alten Streuobstwiesen mit Taschen voller Ableger seltener Apfelsorten wieder verlassen. Er schwärmt von der Kirchweih, die seit einigen Jahren wieder wie früher an jedem ersten Juliwochenende zu Ehren des Schutzheiligen Willibald auf dem Platz vor der Kirche von den ehemaligen Dorfbewohnern und ihren Nachfahren gefeiert wird. Und von den vielen Tierarten, die sich in dieser von Menschenhand weitgehend unberührten Natur entfalten können, insbesondere vom erst kürzlich gesichteten Wolf. So viel Leben an einem so ausgestorbenen Ort - Melchior kann sich nicht vorstellen, dass sich hier Menschen aufhalten, geschweige denn bei einer Kirchweih vergnügen. Für ihn hat dieser Platz vielmehr etwas Meditatives, Beruhigendes. Er will sich nicht vorstellen, wie hier alles mit Sonnenschirmen, Bierbänken und laut agierenden Menschen bevölkert ist.
Melchior gibt vor, einige Fotos machen zu wollen, und entfernt sich ein Stück vom alten Dorfplatz. Hinter der Kirche, an der alten Linde vorbei, steigt er eine Anhöhe hinauf und blickt schließlich auf die Reste von Schmidheim. Der Pressesprecher und auch der Geländewagen sind aus seinem Blickfeld verschwunden. Die Stille umfängt ihn wie eine sanfte Brise an einem heißen Sommertag. Ab und zu wird sie von Balzrufen eifriger Vögel durchbrochen, die sich gerade auf Brautschau befinden.
Schlagartig wird ihm klar, wie allein er ist. Hier in dieser Einöde kann er es sich endlich eingestehen. Er war nie daran interessiert, eine Familie zu gründen, in Gemeinschaft zu leben, zu teilen, weder Tisch noch Bett. Zumindest nicht auf Dauer. Seine wenigen Freundschaften pflegt er gut. Doch bis auf regelmäßige Treffen mit drei engen Vertrauten hat er kaum soziale Kontakte. Im Grunde kann er nur auf Franzi zählen, seinen besten Freund seit Kindertagen. Aber der hat, im Gegensatz zu ihm, einen anderen Weg eingeschlagen. Franzi hat geheiratet und eine Familie gegründet.
Von einem Augenblick auf den anderen weicht die Einsamkeit einer Traurigkeit, die ihn ohne Vorankündigung überfällt und ihm Tränen in die Augen treibt. Melchior wischt sich mit dem Handrücken den feuchten Schleier weg, holt abrupt die Kamera aus der Tasche und beginnt wahllos zu fotografieren. Er kann und will sich nicht damit beschäftigen, was vor über dreißig Jahren passiert ist. Er hat damit abgeschlossen, hat es tief in sich vergraben und den Schlüssel weggeworfen. Nur in ganz seltenen Momenten, wenn er nicht wachsam genug ist, versuchen sich die Geschehnisse von damals ihren Weg zurück in sein Bewusstsein zu bahnen.
Der Pressesprecher kommt wieder in sein Blickfeld, winkt ihn zu sich und deutet auf sein Handgelenk. Melchior hastet zu ihm zurück, dankbar, sich mit dem bevorstehenden Interview ablenken zu können. Obwohl es die Sonne nun endlich geschafft hat, über den wild wuchernden Bäumen aufzugehen, ist es im Freien dennoch kalt. Sein Begleiter schlägt vor, das Gespräch im Jeep zu führen. Beide lassen sich auf den abgewetzten Sitzen nieder und Melchior holt seinen angespitzten Bleistift und sein Notizbuch aus der Tasche. Er verzichtet auf das kleine digitale Aufnahmegerät, das er nur sehr selten benutzt. Ihm ist es lieber, die Gespräche anhand seiner Notizen zu rekonstruieren. Wenn er später lesend von Zeile zu Zeile, von Seite zu Seite springt, tauchen in seinem Kopf die Bilder des Interviews auf. Er erinnert sich an die jeweilige Situation und sein Gefühl sagt ihm genau, was für seinen Text wichtig ist und was er weglassen kann.
„Wieso haben Sie eigentlich diesen Ort für die Besichtigung ausgewählt?“, beginnt der Journalist einleitend seine Fragerunde. Er achtet darauf, neutral zu klingen. Noch weiß er nicht, welche Richtung ihre Unterhaltung einschlagen wird.
„Wissen Sie, Herr Beerbauer“, beginnt der andere zögerlich, „uns allen hier ist klar, dass die Aussiedlung der Menschen und die Ablösung ihres Grund und Bodens im Jahr 1938 tiefe Wunden geschlagen hat. Ich will gar nicht davon sprechen, was im Jahr 1951, bei der zweiten Enteignungswelle, hier passiert ist. Doch das alles ist lange her und die Verantwortlichen von heute sind auch ein Stück weit entgegenkommender. Auf deutscher und auf amerikanischer Seite. Und dieses Entgegenkommen ist bei den alten Schmidheimern auf fruchtbaren Boden gefallen.“
„Soll das heißen, es gibt immer noch Menschen, die die Vertreibung selbst erlebt haben?“
„Also von Vertreibung würde ich nicht sprechen … Aber ja, es gibt noch viele davon. Und die Menschen aus eben diesem Dorf nahmen von Anfang an unser Angebot, ihre ehemalige Heimat besuchen zu dürfen, dankbar an. Eine Win-win-Situation für beide Seiten.“
„Und wie haben sich diejenigen verhalten, die ihr überaus freundliches Angebot nicht annehmen wollten?“ Melchior gelingt es nicht, den sarkastischen Unterton zu verbergen.
„Um Ihnen das zu erklären, muss ich etwas ausholen. Wissen Sie, ich arbeite seit dreißig Jahren hier auf dem Stützpunkt. In all den Jahren bin ich vielen Menschen begegnet. Ehemaligen Gefangenen, sogenannten Displaced Persons, die mit ihren Kindern und Enkeln hierher zurückgekehrt sind, um die Vergangenheit aufzuarbeiten. Soldaten, die im und nach dem Zweiten Weltkrieg hier gedient haben, darunter Amerikaner, Kanadier, aber auch Polen und Deutsche. Und natürlich Menschen, die von hier vertrieben wurden, wie Sie es ausdrücken. Und bei all diesen Begegnungen wurde mir klar, dass es zwei Möglichkeiten gibt, mit diesem Schicksal umzugehen. Die einen versuchen, sich mit dem Geschehenen auseinanderzusetzen, nach vorn zu schauen und sich etwas Neues aufzubauen. Für sie hat dieser Ort seinen Schrecken verloren, sie sind auf der Suche nach positiven Erinnerungen, versuchen, mit einem guten Gefühl in ihre neue Heimat zurückzukehren.“
„Und die anderen?“ Der Redakteur ist neugierig geworden.
„Die kommen mit einer unbändigen Wut, einem jahrelang unterdrückten Groll hier an. Sie sind auf der Suche nach Wiedergutmachung. Einige führen langwierige Prozesse, sammeln, recherchieren und veröffentlichen ihren Schriftverkehr in Büchern. Wieder andere versuchen, die Presse für sich zu gewinnen. Ich persönlich glaube, dass wir hier diese Wiedergutmachung nicht leisten können. Dieser Prozess muss in den Menschen selbst stattfinden. Wir können ihnen unsere Anteilnahme zeigen, uns ihre Schilderungen anhören und ihnen unsere Zeit schenken. Ein neues Leben aufbauen, in einer neuen Heimat glücklich werden, mit der Vergangenheit ins Reine kommen, das müssen sie selbst schaffen.“
Melchior schaut auf seinen Block. Er hat nicht ein einziges Wort mitgeschrieben. Er ist verwundert, verblüfft von seinem Gegenüber. Das Gespräch entwickelt sich ganz anders, als erwartet. Er hat sich auf Schönfärberei und taktische Monologe über die strategisch wichtige Position der Militärbasis eingestellt – ohne Wenn und Aber. Was er dagegen zu hören bekommt, sind die psychologischen Beobachtungen eines empathischen Mannes in den Fünfzigern. Es bringt ihn aus dem Konzept. Für den Moment weiß er nicht, wo er ansetzen soll, welche Frage er stellen soll. Er überlegt sich, wie er sich verhalten hätte, wie er mit dem Verlust der Heimat umgegangen wäre. Beim Gedanken an Fichtenried und den ehemaligen Bauernhof seines Großvaters überkommt ihn wie immer ein ungutes Gefühl. Als Zwanzigjähriger ist er von dort in die Stadt geflüchtet und nie mehr zurückgekehrt. Er hat sein Zuhause verraten. Zumindest gab ihm seine Mutter immer dieses Gefühl.
Sein Begleiter hat wieder zu sprechen begonnen. Melchior muss sich zwingen, ihm weiter zuzuhören. Er bringt seine ganze Konzentration auf und macht sich Notizen. Es fallen Jahres- und Einwohnerzahlen, Familien- und Hausnamen und in Kurzform klärt ihn der Pressesprecher über die Handwerksbetriebe, die Bauernhöfe und die Pfarreizugehörigkeit des Ortes auf, der einst in Ober- und Unterschmidheim aufgeteilt war. Der Begriff Oberschmidheim ruft eine Erinnerung in Melchior hervor. Er weiß, dass er den Namen schon einmal gehört hat. Er schließt kurz die Augen und sucht in seinem Gedächtnis nach der fehlenden Verbindung, wird aber nicht fündig. Mittlerweile ist er unruhig geworden. Der Journalist hadert mit sich selbst, weil er sein unprofessionelles Verhalten nicht tolerieren kann. Er hasst es, wenn jemand bei einem Gespräch nicht bei der Sache ist. Und nun passiert ihm genau das. Er kann sich einfach nicht auf sein Gegenüber konzentrieren, er muss den Termin irgendwie hinter sich bringen.
„Gibt es vielleicht noch Unterlagen, die für den Artikel hilfreich sind?“
„Ja, ich habe jede Menge alter Fotos gesammelt, die ich Ihnen mailen kann. Wir müssten auch noch den amtlichen Schriftverkehr aus dieser Zeit irgendwo abgelegt haben. Ich suche das gern für Sie heraus und lasse es Ihnen zukommen.“
„Darf ich Ihnen noch eine abschließende Frage stellen?“ Melchior hat sich wieder einigermaßen im Griff, seine Neugierde ist wieder da, seine wichtigste Eigenschaft als Journalist.
„Klar.“
„Wie würden Sie damit umgehen, wenn Sie von heute auf morgen ihre Heimat verlassen müssten?“
Der andere blickt ihn unverwandt an. Die rechte Augenbraue zuckt leicht nach oben und verleiht ihm einen erstaunten Ausdruck.
„Wissen Sie, ich bin hier in der Nähe geboren und aufgewachsen. Ich mache meine Heimat aber nicht an einem Haus oder Dorf fest. Ich fühle mich dort zu Hause, wo ich ich selbst sein kann.“
„Und das wäre dann wo?“
„Jetzt gerade, in diesem Moment, ist es genau hier. An diesem Ort, den vielleicht vor ein paar Stunden ein Wolf durchstreift hat. Diese Vorstellung macht mich glücklich. Wie Sie sehen können, bin ich Jäger. Ich will den Wolf aber nicht jagen. Vielleicht teilen wir uns künftig die Arbeit und das Revier und er reißt ein paar Wildschweine, die ich dann nicht zur Strecke bringen muss. Hier an diesem Ort habe ich das Gefühl, dass alles in Einklang ist. Vielleicht liegt es daran, dass sich der Mensch hier weitgehend aus dem natürlichen Lauf der Dinge heraushält.“
„Also könnten Sie ohne diesen Ort hier nicht leben? Ist hier ihre Heimat?“
„Das habe ich so nicht gesagt. Hier fühle ich mich im Moment wohl, hier erlebe ich glückliche Augenblicke und spüre eine Art Verbindung mit meiner Umgebung. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass ich diese positive Assoziation auch anderswo erfahren kann. Ich stelle mir vor, dass Heimat ein Teil von mir ist, den ich in mir trage. Ich nehme ihn also immer mit, egal wohin ich gehe.“
Melchior ist schon wieder sprachlos. Der Mann ihm gegenüber ist weit davon entfernt, in das stereotype Bild eines oberpfälzer Ureinwohners zu passen. Wenn der Redakteur ehrlich ist, hatte der Begriff „Heimat“ bisher immer etwas Negatives für ihn: Heimatromane, Heimatlieder, Heimatbräuche. Bisher verband er damit Menschen, die sich um jeden Preis ihrem Herkunftsort und ihrer Umgebung unterordneten, um sich zugehörig fühlen zu können. Dass dieses Wort auch positiv besetzt, dass es in einer Person selbst verankert sein kann und somit nicht einschränkt, nicht zur Unterordnung aufruft, auf diese Idee wäre er nie gekommen.
Zwei
Auf der Rückfahrt zum Verlag lassen Melchior die Bilder der brachliegenden Gegend, der wiederaufgebauten Kirche, der verlassenen und eingefallenen Häuser Schmidheims nicht mehr los. Seit er sich vom Pressesprecher verabschiedet hat, fühlt er eine ungeahnte Ruhe in sich. Es ist, als ob dieser einsame Ort alles in ihm zum Stillstand gebracht hätte. Alle drängenden Fragen sind verstummt. Der Spruch „Mit sich im Reinen sein“ fällt ihm ein. Ist er das?
Er fährt in die Tiefgarage der Zeitung, trägt penibel genau die Uhrzeit und die Anzahl der gefahrenen Kilometer in das Fahrtenbuch ein und gibt den Schlüssel an der Empfangstheke ab. Auf dem Weg zum Fahrstuhl, der ihn innerhalb von Sekunden in das Großraumbüro bringen wird, hält er plötzlich inne und gähnt. Der Gedanke an die Suche nach einem freien Platz im lauten Getöse des sterilen und kalten Großraumbüros wirkt lähmend auf ihn. Schlagartig werden seine Glieder tonnenschwer und er fürchtet, dass ihm schwarz vor den Augen werden könnte. Melchior ist sich sicher, dass sich sein Zustand mit dem Eintreten in den Newsroom noch weiter verschlechtern würde. Die Müdigkeit überfällt ihn oft in ganz unvorhergesehenen Situationen, manchmal sogar im Gespräch mit anderen. Er macht auf dem Absatz kehrt, nickt der Empfangsdame kurz zu und verlässt das Gebäude durch die lautlos auseinandergleitenden Glastüren des Haupteingangs. Die frische Luft vertreibt das taumelige Gefühl sofort.
Er blinzelt einer grellen, aber kalten Märzsonne entgegen. Gegenüber, vor dem gerade neu eröffneten Café, legt eine junge Frau rote Wolldecken auf die dunklen Stühle hinter den silbernen Metalltischen. Er überquert die Straße, setzt sich auf einen leeren Platz und holt sein Smartphone aus der Tasche. Umständlich tippt er eine Nachricht an die Redaktionsleiterin, die zwanzig Jahre jünger sein muss als er selbst, und verspricht ihr den Text mit den passenden Bildern bis Redaktionsschluss. Sekunden später kommt ein schlichtes „OK“ zurück. Sie kennt ihn als gewissenhaften Redakteur und hat die Geschichte wahrscheinlich schon in diesem Moment wieder vergessen. Wo und wann er seine Berichte schreibt, ist ihr egal. Für sie zählt nur, wie viel Platz sie freihalten muss, wie viele Pixel das Bild hat und wie viele Spalten der Text. Alles Weitere überlässt sie seinem Können und vertraut auf seine jahrelange Erfahrung, das weiß er.
Melchior bestellt einen doppelten Espresso, ein Garant, um sich wachzuhalten, dazu ein Glas Leitungswasser. Er lässt seinen Blick über das Gelände auf der anderen Straßenseite wandern. Ein riesiges Stück Bauland, eingegrenzt von Eisenbahnschienen, dem Verlagsgebäude und Wohnbauten, tut sich vor ihm auf. Im Showroom nebenan sind die Wohnträume zahlreicher Doppelverdienerfamilien auf Hochglanzprospekten ausgestellt. Schon bald werden riesige Bagger die braune Erde aufreißen und Unmengen von Beton in die dunklen Löcher hinabfließen. Arbeitskräfte aus Osteuropa, die während der Bauzeit in schmucklosen Containern neben der Baustelle hausen müssen, werden in Schichtarbeit Fertigbauteile zusammenfügen und so die unverschämt teuren Gebäudekomplexe errichten. Hatte sich nicht ein örtlicher Bauträger letzte Woche in der Presse damit gebrüstet, ein kürzlich realisiertes Stadtquartier mit Neubebauung ohne nennenswerte Gewinne veräußert zu haben? „Zum Wohle der Stadt“, das waren seine Worte. Melchior fragt sich ernsthaft, wie dieser dies trotz der schwindelerregend hohen Quadratmeterpreise und der billigen Arbeiter aus dem Osten oder sonst woher schaffen konnte. Bei dem Gedanken daran, wie sich scheinbar alle Bauvorhaben in dieser Stadt zu gleichförmigen, gesichtslosen Wohntürmen entwickelt haben, schüttelt Melchior den Kopf und versucht, sein Unwohlsein mit dem letzten Schluck Espresso zu vertreiben.
Er steht auf und macht sich zu Fuß auf den Weg zu seiner Wohnung. In drei Stunden muss der Artikel stehen.
Zuhause am Schreibtisch holt er seine Notizen heraus und überfliegt diese. Sein Mobiltelefon piept und zeigt eine neu eingegangene Email an. Er tippt umständlich den sechsstelligen Code zum Entsperren ein und ruft die Nachricht ab. Der Pressesprecher hat ihm wie versprochen jede Menge Material über Schmidheim geschickt. Auf gut Glück öffnet Melchior die Datei „Ehemalige Bewohner.doc“ und scrollt durch die Liste mit Familien- und dazugehörigen Hausnamen. Bei „Bichlmeier - Hausname Blombauer“ bleibt er intuitiv stehen. Melchior schaut in seinen Notizen nach, ob der Pressesprecher diesen Namen erwähnt hatte. Fehlanzeige. Woher kennt er ihn nur? Ein ungutes Gefühl überkommt ihn. Hat es etwas mit Fichtenried zu tun? Mit seiner ehemaligen Heimat verbindet der Redakteur eher unschöne Gedanken. Allein seine Großeltern Anderl und Theres und seinen besten Freund Franzi hat er in positiver Erinnerung. Aber in Fichtenried gab es keine Familie Namens Bichlmeier. Oder doch? Ihm fällt der Stammbaum ein, den ihm seine Großcousine Annette vor einiger Zeit zugeschickt hatte. Schnell hat er den Ordner gefunden, in dem das Papier abgeheftet ist. Er nimmt das DIN A3 Blatt heraus, faltet es auseinander und findet tatsächlich den gesuchten Namen gleich zweimal notiert: Sabina Bichlmeier und Agathe Bichlmeier. Mit dem rechten Zeigefinger fährt er die feinen Linien und Verästelungen nach, bis er schließlich auf seinen eigenen Namen stößt. Beide Frauen waren mit seinem Urgroßvater Anton Beerbauer verheiratet, Agathe hat sich mit dem Witwer nach dem Tod von Sabina vermählt und ist in direkter Linie seine Urgroßmutter und Mutter seines Großvaters Anderl. Geboren wurde sie im Jahr 1874 in Schmidheim.
Tausend Bilder und Erinnerungsfetzen tauchen vor seinem inneren Auge auf. Mit eingesunkenen Schultern, nach unten geneigtem Kopf und geschlossenen Augen sitzt Melchior da und wird von einer Welle aus Emotionen überspült. Es fühlt sich wohlig und warm an, als er an seine Kindheit zurückdenkt, an die liebevollen Großeltern und an Franzi, den besten Freund, den er je hatte. Doch schnell wird die Wärme von der Angst um den Großvater verdrängt. Dieser war an einem heißen Sommertag im Juli 1973 spurlos verschwunden. Melchiors Handflächen werden kalt und schweißnass und er spürt, wie das beklemmende Gefühl von seinem ganzen Körper Besitz ergreift. Die Erinnerung an die Suche nach dem vermissten Anderl, das Polizeiaufgebot, die Helfer vom Roten Kreuz, die Taucher, ist so präsent, als ob es erst gestern passiert wäre. Seine Mutter konnte ihm damals keinen Halt geben, sie war selbst wie paralysiert. Nur Franzi wich keine Sekunde von seiner Seite, er half ihm durch die schweren Stunden der Ungewissheit und stand ihm bei, als sie den leblosen Großvater im dornigen Gestrüpp endlich fanden. Erst Tage später, nachdem Franzi Melchior zurück in die Stadt, in sein kleines, abgeschiedenes Zimmer im Goldenen Turm gebracht hatte, weit genug weg vom Schrecken und von Fichtenried, trennten sie sich. Das war der Zeitpunkt, an dem ich erwachsen wurde, denkt er nun unvermittelt.
Melchior redet sich ein, dass ein Telefongespräch mit seiner Großcousine Annette Teil seiner Recherchearbeit über Schmidheim wäre. Doch tief im Inneren weiß er, dass das nicht stimmt. Nur weil sie ihm den Stammbaum geschickt hat, heißt das noch lange nicht, dass sie etwas über den Ort weiß. Trotzdem sucht er auf dem ebenfalls im Ordner abgehefteten Anschreiben nach ihrer Telefonnummer. Zu seinem Erstaunen wohnt sie nur ein paar Straßen weiter. Wie kann es sein, dass ihm diese Tatsache nicht schon vorher aufgefallen ist? Ist er Annette womöglich schon einmal über den Weg gelaufen und hat sie nicht erkannt? Natürlich hätte er sie nicht erkannt! Es muss schon Jahrzehnte her sein, seit er sie zum letzten Mal gesehen hat. Es muss Anfang der 1970er Jahre gewesen sein, bei der Beerdigung ihrer gemeinsamen Großtante Sabina. Annette war damals ein schüchternes Kind, er selbst nur ein paar Jahre älter. Die Erinnerung an diesen Tag ist mit einem Mal wieder da. Er stand bei seinen Großeltern Theres und Anderl am Grab, seine Großcousine gegenüber. Sie wirkte einsam und verlassen, obwohl ihre Mutter direkt hinter ihr war. Als schließlich die erste Schippe Erde hohl auf dem Sarg aufschlug, fiel das Mädchen auf die Knie und begann zu schluchzen. Doch niemand kümmerte sich um sie, nicht einmal ihre Mutter nahm sie tröstend in die Arme. Vielmehr hatte Melchior den Eindruck, als ob diese sich ablehnend wegdrehte. Irgendetwas verband wohl die alte Frau und das Kind, sonst hätte der Tod die Kleine nicht so mitgenommen. Dass er sich nur kurze Zeit später selbst so einsam und verlassen fühlen würde, am Grab seiner Großmutter Theres, hatte er damals noch nicht ahnen können.
Würde er nicht bereits sitzen, hätte Melchior Angst davor umzukippen. Der Boden schwankt unter seinen Füßen. Es ist wirklich lächerlich, versucht er sich selbst Mut zuzusprechen. Ich rufe ständig Menschen an, wichtige und unwichtige, interviewe sie, kitzle Geheimnisse aus ihnen heraus, spreche über unangenehme Dinge. Wieso sollte dieses Gespräch anders sein? Aber er kann sich nichts vormachen, diese Situation war anders. Mit diesem Anruf würde er eine Verbindung zu seiner Vergangenheit herstellen, einen Draht zurück in eine Zeit spannen, die er lieber verdrängen und vergessen würde.
Er spürt wieder seine klammen, schweißnassen Hände und sein Blut scheint ausschließlich im unteren Drittel seines Körpers zu zirkulieren. Komm schon, es ist nur ein Anruf! Der Gedanke daran, dass nur ein paar Straßen entfernt Annettes Telefon läutet, lässt Melchior zurückzucken und den Hörer aus der Hand gleiten. Jetzt sei nicht kindisch! Es ist wieder die strenge Stimme, die zu ihm spricht. Sklaventreiber, nennt der Redakteur sie oft zum Spaß. Er hat ein ambivalentes Verhältnis zu dieser Stimme. Meist hilft sie ihm dabei, seine Artikel rechtzeitig fertigzustellen, Termine einzuhalten und an Sachen dranzubleiben. Doch in Momenten wie diesen verflucht er sie. Am liebsten würde er zurückbrüllen: Halt dein Maul, verzieh dich! Doch die Neugierde hindert ihn daran. Er denkt wieder an den verlassenen Ort, die verfallene Wirtschaft, das zur Fledermaushöhle umfunktionierte Kirchlein. Und an den Namen Bichlmeier.
Ruckartig steht er auf, springt zweimal hoch und reibt seine Handflächen aneinander. Das Blut beginnt wieder im ganzen Körper zu zirkulieren, seine Finger werden gelenkig und warm. Ohne sich noch weitere Gedanken zu machen, hebt er sein Handy auf und tippt ungelenk die Nummer seiner Großcousine ein.
„Ja? Hallo?“
Eine angenehme Frauenstimme dringt gedämpft an sein Ohr.
„Ja! Hier ist Melchior. Melchior Beerbauer. Wir sind …“, er räuspert sich. „Wir sind verwandt.“ Eine noch blödere Einleitung ist dir wohl nicht eingefallen, höhnt der Sklaventreiber.
Für zehn Sekunden herrscht Schweigen. Dann raschelt es in der Leitung. Melchior nimmt wahr, wie Enttäuschung sich in ihm ausbreitet. Sollte das Gespräch damit schon beendet sein? Doch im nächsten Moment hört er wieder die wohltuende Stimme, glasklar, als ob sie direkt neben ihm stehen würde.
„Wir müssen uns dreißig Jahre oder länger nicht mehr gesehen haben! Hast du meine Post bekommen?“
In ihrer Aussprache liegt ein vertrauter Klang, in dem Wärme mitschwingt. Melchior wird augenblicklich von einer Woge der Zuneigung erfasst. Wie kann das sein?
„Ja. Danke dafür.“ Auch er versucht freundlich und zugewandt zu klingen. „Das ist eigentlich der Grund meines Anrufs. Geht es dir gut? Wo bist du?“
„Mir geht es sehr gut. Ehrlich gesagt so gut wie schon seit Jahren nicht mehr. Im Moment bin ich in Malta und arbeite dort ehrenamtlich für eine Hilfsorganisation in der Seenotrettung.“
„Auf dem Mittelmeer?“
Die glasklare Verbindung hat ihn getäuscht. Er merkt, wie traurig er darüber ist.
„Nein. Ich helfe im Hafen von Malta beim Crewwechsel. Auf See hab ich mich noch nicht getraut.“
„Und wie lange wirst du weg sein?“
„Das kann ich noch nicht genau sagen. Die Saison hat gerade erst angefangen. Die Einsätze gehen bis in den Herbst hinein. Mal sehen, wie lange ich es hier aushalte.“
Enttäuschung überkommt ihn. Irgendwie hatte er angenommen, dass er Annette persönlich treffen könnte. Das war nun schlecht möglich.
„Aber du wolltest etwas ganz anderes wissen? Etwas über den Stammbaum, den ich dir geschickt habe?“
„Ja. Stimmt. Stell dir vor! Ich schreibe gerade einen Artikel über die Vertreibung der Menschen rund um den Truppenübungsplatz Hohenfels Mitte des 20. Jahrhunderts. Ich habe heute das ehemalige Dorf Schmidheim besucht und bin dabei auf den Namen Bichlmeier gestoßen. Diesen Namen habe ich nun auf unserem Stammbaum wiedergefunden! Unsere Urgroßmutter stammte aus diesem Dorf!“
Nun fühlt er sich wie ein Zauberer, der dem Publikum einen besonders spektakulären Trick gezeigt hat.
„Also genau gesagt ist es nur deine Urgroßmutter. Unser Urgroßvater war dreimal verheiratet. Ich stamme aus direkter Linie seiner ersten Frau ab.“
Ein angenehmes Lachen dringt durch den Hörer.
„Aber wir haben immerhin denselben Urgroßvater.“
Im nächsten Moment wird Annette wieder ernst.
„Und wir beide sind die letzten aus dieser Familie. Wusstest du das?“
Nun ist der Redakteur verwirrt. Er war immer der Meinung, dass er aus einer weitverzweigten Familie abstammte und es noch unzählige Verwandte gibt. Er geht zum Schreibtisch zurück und schaut sich den Stammbaum an. Es stimmt, außer ihm und Annette scheint niemand mehr da zu sein.
„Bist du dir da sicher? Vielleicht hat einfach jemand vergessen, den Stammbaum weiterzuführen?“
„Ich bin mir sicher. Nach dem Tod meiner Mutter habe ich mich lange mit unseren Vorfahren und deren Geschichte beschäftigt. Ich habe alte Briefe gelesen, Fotos sortiert und Geburts- und Sterbeurkunden studiert. Es ist niemand mehr da. Nur wir beide. Wie es scheint, sterben die Beerbauers mit uns aus. Soviel ich weiß, hast du keine Kinder. Und dass ich keine habe, kann ich dir mit Sicherheit sagen.“