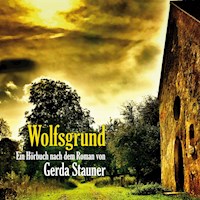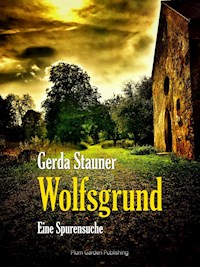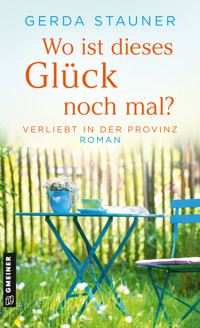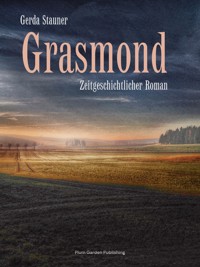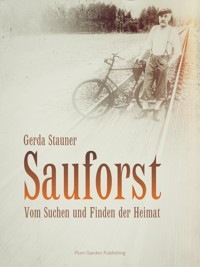
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Plum Garden Publishing
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein vaterloser Junge. Ein rätselhafter Stammbaum. Eine Frau, die das Geheimnis ihrer Herkunft lösen will. Anton Beerbauer wird an Mariä Lichtmess 1856 im Sauforst als Sohn einer ledigen Mutter geboren. Der Eisenbahnbau, eine neu entstandene Fabrik und die späte Industrialisierung der kargen Oberpfalz verändern den ärmlichen und bäuerlichen Alltag für immer. Nach dem Tod der Mutter stellt Anton die Weichen für seine Zukunft ebenfalls neu. Der junge Mann will endlich seinen Vater finden und begibt sich auf eine Suche mit unbekanntem Ziel, die sein Leben komplett verändern wird. Über 150 Jahre später eröffnet sich auch für seine Urenkelin Annette die Chance, ihr Leben neu zu überdenken. "Gerda Stauner schildert im 21. Jahrhundert die Geschichte ihrer fiktiven Vorfahren in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Spannend erzählt, gründlich recherchiert, mit dem nötigen Lokal-Kolorit, aber auch eine Art Soziogramm kleiner Leute in der Oberpfalz der damaligen Zeit. Ein Lesegewinn!" (Bayerischer Rundfunk)
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 304
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die Autorin
Gerda Stauner lebt in Regensburg, ist aber in der ländlichen Oberpfalz aufgewachsen. Mittlerweile fährt sie regelmäßig zum Schreiben in ihre alte Heimat zurück und geht dort oft im Wald spazieren. Dabei entstehen die Figuren und Handlungen ihrer Geschichten. Literarisch widmete sie der Oberpfalz eine dreibändige Familiensaga, die zwischen 2016 und 2019 publiziert wurde. 2021 wurde daraus eine gekürzte Hörbuchfassung veröffentlicht.
Die Autorin schreibt Romane, Hörspiele, Theaterstücke und Beiträge für Anthologien und ist selbst auch immer wieder Herausgeberin verschiedener Texte. Außerdem arbeitet sie mit Kindern und Jugendlichen bei verschiedenen Autorenwerkstätten und gibt ihr Wissen in Schreibseminaren und Workshops weiter. Zudem schreibt Gerda Stauner für ein digitales Nachrichtenportal und hostet einen Podcast.
Weitere Infos gibt es auf der Webseite www.gerda-stauner.de
Das Buch
Ein vaterloser Junge. Ein rätselhafter Stammbaum. Eine Frau, die das Geheimnis ihrer Herkunft lösen will.
Anton Beerbauer wird an Mariä Lichtmess 1856 im Sauforst als Sohn einer ledigen Mutter geboren. Der Eisenbahnbau, eine neu entstandene Fabrik und die späte Industrialisierung der kargen Oberpfalz verändern den ärmlichen und bäuerlichen Alltag für immer. Nach dem Tod der Mutter stellt Anton die Weichen für seine Zukunft ebenfalls neu. Der junge Mann will endlich seinen Vater finden und begibt sich auf eine Suche mit unbekanntem Ziel, die sein Leben komplett verändern wird. Über 150 Jahre später eröffnet sich auch für seine Urenkelin Annette die Chance, ihr Leben neu zu überdenken.
„Die Autorin schildert im 21. Jahrhundert die Geschichte ihrer fiktiven Vorfahren in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Spannend erzählt, gründlich recherchiert, mit dem nötigen Lokal-Kolorit, aber auch eine Art Soziogramm kleiner Leute in der Oberpfalz der damaligen Zeit. Ein Lesegewinn!“ (Bayerischer Rundfunk)
Sauforst
Vom Suchen und Finden der Heimat
Roman von Gerda Stauner
I M P R E S S U M
Titelfoto: Christian Segerer
Sauforst – Vom Suchen und Finden der Heimat
Autor: Gerda Stauner
ISBN: 978-3-96661-100-8
© 2024 Plum Garden PublishingAlle Rechte vorbehalten.plumgarden.de
93047 Regensburg, [email protected]
www.gerda-stauner.de
Für meinen Urgroßvater Karl Stauner
Sauforst: Ein karges Stück Land in der Oberpfalz, auf dem 1851 eine Eisenbahnschienenfabrik errichtet wurde, jetzt Maxhütte-Haidhof.
Alle in diesem Roman handelnden Personen und der Ort Fichtenried sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder verstorbenen Personen sind rein zufällig.
Jetzt
Vor dem Häuschen mit den verwitterten, grünen Holzläden hatte ich schon immer Angst. Es thronte auf einer Anhöhe, dem Hundsbichel, und war fast vollständig durch wuchernde Hecken und stachelige Brombeersträucher verdeckt. Nur in geduckter Haltung gelangte man an den dornigen Zweigen vorbei über einen kleinen Pfad zum Eingang. Der abbröckelnde weiße Lack an der Haustüre verleitete dazu, ihn in splitternden Streifen vom rissigen Holz zu kratzen, während man stumm darauf wartete, eingelassen zu werden.
Bereits im Kindergartenalter wurde mir die Aufgabe zuteil, jeden Freitag kurz vor dem Zwölfuhrläuten eine warme Eisenpfanne mit duftenden Rohrnudeln in diesem kleinen Hexenhäuschen abzuliefern. Eine Erklärung, warum und wieso dies zu geschehen habe, wurde mir nicht gegeben. Damals waren Kinder lästige Rotznasen, gerade gut genug, um Dienstbotengänge wie diesen zu erledigen. Ohne also nur die geringste Ahnung zu haben, wieso ich das lockere Hefegebäck in dieses düstere Haus mit der holzvertäfelten, im selben dunklen Grünton wie die Fensterläden gestrichenen Giebelfassade bringen sollte, machte ich mich jeden Freitag nach dem Kindergarten auf den Weg.
Später, als ich schon weit über das Alter einer Jugendlichen hinaus war und die Sprache in meiner Familie auf eben dieses Haus und die wunderliche, alte Großtante kam, die dort bis in die 1970er Jahre lebte, fiel oft der Satz: „Ja, weißt du das denn gar nicht?“
Nein, damals wusste ich nichts. Nichts über die Großtante und nichts darüber, woher sie kam und wieso sie dort lebte. Woher auch? Als ich ein Kind war, hatte man es nicht für nötig befunden, mit mir darüber zu sprechen. Und später, als Heranwachsende, hat man es einfach vorausgesetzt, mein Wissen um die Familiengeschichte. Oft kam ich mir wegen meiner mangelnden Kenntnisse schlecht vor. Wie ein Schulkind, das den Stoff nicht richtig gelernt hat und beim Ausfragen dabei ertappt wird. Natürlich suchte ich die Schuld dafür bei mir. Dass die Erwachsenen um mich herum, meine Eltern, meine Großmutter, meine Tanten und Onkeln, es einfach versäumt hatten, mit mir über die Vergangenheit zu sprechen, auf diese Idee wäre ich gar nicht erst gekommen. Stattdessen fühlte ich mich unwissend und in vielen Situationen geradezu dumm. Vor allem dann, wenn der Satz: „Du weißt ja wirklich gar nichts!“, wieder einmal fiel. Irgendwann hörte ich auf, Fragen über unsere Familiengeschichte zu stellen, um diesen niederschmetternden Satz nicht mehr hören zu müssen.
Heute, als erwachsene Frau, hätte ich den Mut, all diese verbotenen Fragen zu stellen. Aber nun ist es zu spät. Meine Mutter Adele, die letzte aus meiner Familie, mit der ich über unsere Geschichte hätte sprechen können, ist vor wenigen Wochen gestorben. Sie hat mir eine verstaubte Kiste mit alten Dokumenten hinterlassen. Das ist alles, was von unserer Linie übrig ist.
Aber wie Adele spricht diese Schatulle nicht mit mir. Sie steht stumm und anklagend vor mir, als ob sie sagen möchte: Wieso weißt du das denn nicht? Du hast dich nie wirklich für deine Familie interessiert, sonst hättest du einen Weg gefunden, unsere Geschichte zu erfahren!
Viele Jahre dachte ich, dass es normal war, wie ich aufgewachsen bin. Doch irgendwann habe ich erkannt, dass das Gegenteil der Fall ist. Ein Vater, der sich vor dem Leben versteckt, und eine Mutter, die stumm alles erduldet um den Anschein der Normalität aufrechtzuerhalten, das war eher die Ausnahme, wie ich heute weiß. Trotzdem hat Adele bis zum letzten Augenblick an diesem Zustand des stoischen Schweigens festgehalten und mir somit die Chance auf eine Aussprache für immer verwehrt.
Die Möglichkeit auf eine Klärung der Vergangenheit, meiner Vergangenheit, schwindet. Letzten Endes bleiben mir nur vergilbte Papiere, die unsere Chronik schnörkel- und farblos dokumentieren. Aber reicht das aus? Werde ich so all die Antworten auf die Fragen finden, die mich von klein auf begleitet haben?
Damals regten die Besuche in dem kleinen Häuschen mit den grünen Fensterläden mein kindliches Gemüt an, mir Fantasiegeschichten auszudenken. Sie eröffneten mir den Weg in eine wunderbare Traumwelt. Jetzt, viele Jahre später, wird mir klar, dass meine unbändige Fantasie die Annalen meiner Familie weit treffender erfasst hat, als mein eng gesteckter Realitätssinn oder staubige Dokumente dazu in der Lage wären.
Die Bewohnerin des Hexenhäuschens, die greise Großtante, war anfangs verbissen wortkarg. Sie nahm die duftende Mehlspeise entgegen, hob kurz das blütenweiße Geschirrtuch an, warf einen kritischen Blick auf die hellbraunen Rohrnudeln und schickte mich mit einem Nicken wieder nach Hause. Aber von Besuch zu Besuch bekam ihre abweisende Haltung kleine Risse. Anfangs passte sie mich an der Eingangstüre ab. Dann durfte ich - angsterfüllt - in den dunklen, muffigen Flur treten. Später ließ sie mich in die etwas hellere, aber ebenso verstaubte Küche ein. Aber auch wenn mein Eintreffen mittlerweile wohlwollend zur Kenntnis genommen wurde, sprachen wir keinen einzigen Satz miteinander.
Vielleicht ein halbes Jahr nach meinem ersten Besuch fand ich die Haustüre unverschlossen vor. Auf mein zaghaftes Klopfen hin sprang sie einen Spalt weit auf. Aus dem Inneren war nichts zu hören. Angespannt lauschend haderte ich minutenlang mit mir, ob ich eintreten sollte. Ein Krächzen aus der Küche ließ mich hochschrecken und meine Angst verdrängen. Ich schlich ins Haus und fand die alte Frau vor zwei dampfenden Teetassen am Küchentisch sitzend vor. Mit ihren knotigen, verkrümmten Händen wies sie auf einen Stuhl und bedeutete mir, mich zu setzen.
Zum ersten Mal traute ich mich, ihr in die Augen zu sehen. Sie waren dunkelbraun und von dichten Brauen gekrönt. Ihr Haar war ebenfalls sehr dunkel und von einigen grauen Strähnen durchzogen. Sie musste vom Alter her zur Generation meiner Großeltern gehören, aber im Gegensatz zur Mutter meines Vaters trug diese Frau einen modischen Pagenschnitt, der jedoch etwas aus der Form geraten war. Ebenfalls anders als meine Großmutter hatte sie eine graue Flanellhose und einen grob gestrickten Pullover anstelle eines Kleides oder einer Kittelschürze an. Ihre Gesichtszüge weckten eine vage Erinnerung in mir, vor allem die tiefliegenden, dunklen Augen zogen mich in ihren Bann. Die ausgeprägten Wangenknochen und das spitz zulaufende Kinn gaben ihrem Gesicht eine besondere Form. Aber als sie zu sprechen anfing, nahm ich all das nicht mehr wahr. Vom ersten Augenblick an fand ich mich in einer Abenteuergeschichte wieder, die mich fesselte und von deren Fortsetzung ich die ganze kommende Woche träumte.
Meine Großtante begann ihre wundersame Erzählung mit den Worten: „Für Anton Beerbauer gab es keinen besseren Tag als Mariä Lichtmess, um anno 1856 das Licht der Welt zu erblicken. Dieser Tag, an dem sich Mägde und Knechte auf den Weg machten, um bei einem neuen Dienstherrn ihr Glück zu finden, an dem die gewohnte Ordnung für kurze Zeit aus den Fugen geriet und anstelle von harter Arbeit und Entbehrung Tanz und Gesang den Takt bestimmten, passte wie kein anderer zum Charakter und Gemüt des Anton Beerbauer. Doch fangen wir am Anfang an ...“
Giacomo Verducci
Den jungen Giacomo trieben der Hunger und das Elend aus dem zugigen, unwirtlichen Tal nahe des Comer Sees über die Alpen nach München. Wäre er einige Jahre später ausgewandert, sein Weg wäre weit weniger beschwerlich gewesen. Aber als sich der junge Giacomo Verducci aufmachte, um sein Glück im fernen Bayern zu finden, gab es noch keine Bahnverbindung über den Brenner, die das Reisen leicht und bequem gemacht hätte. Stattdessen quälte er sich tage- und wochenlang zu Fuß oder, sofern es die Reisekasse zuließ, auf dem Kutschbock eines einfachen Pferdegespanns durch die steilen, engen Berg- und Passstraßen. Auf Höhe von Rosenheim, wo die Berge langsam in saftigen, grünen Tälern ausliefen und den Blick auf eine bisweilen hügelige Landschaft freigaben, wollte er seine Reise fast schon abbrechen und sich als Knecht anstellen lassen. Dann jedoch gab er sich einen Ruck, biss die Zähne zusammen und marschierte zügig die letzten sechzig Kilometer Richtung Norden. Er wollte als reicher Mann in das Tal nahe des Comer Sees zurückkehren, und nicht als Knecht in einem oberbayerischen Dorf enden.
München sollte aber nicht das Ende seiner Wanderschaft bedeuten. Kaum dort angekommen, ließ er sich von einer belgischen Firma anwerben, um für deren neu gegründete Eisenbahnschienenfabrik im Sauforst bei Burglengenfeld zu arbeiten. Dem kleinen, drahtigen Italiener wurde bei Vertragsunterzeichnung ein recht stattlicher Wochenlohn für eine Sechstagewoche, die Unterbringung in einer vernünftigen Stube und täglich eine Maß Bier für seine Tätigkeit als Puddler versprochen. Die Regeln, an die er sich als Fabrikarbeiter halten musste, waren dagegen recht umfangreich. Er durfte am Arbeitsplatz nicht rauchen, nicht zu spät kommen, über die Maß Bier hinaus keine weiteren, hochprozentigen Getränke konsumieren, zu keinen Raufereien anstiften, musste bei Engpässen über die üblichen Zwölfstundenschichten hinaus arbeiten und sich im Großen und Ganzen still verhalten. Verstöße gegen diese Auflagen wurden mit Lohnkürzungen oder, bei schlimmeren Vergehen, mit der sofortigen Liquidation des Arbeitsverhältnisses und der Einbehaltung des ausstehenden Lohns quittiert.
Da er weder die deutsche Sprache verstand, noch des Lesens oder Schreibens mächtig war, setzte er nach der kurzen Belehrung durch einen Angestellten der belgischen Firma ein krakeliges „V“ unter den Vertrag und beließ es bei einem Kopfnicken.
Seine Weiterreise zur Eisenbahnschienenfabrik in die tiefste oberpfälzische Provinz verzögerte sich um einige Tage, da das Anwerben der noch fehlenden Arbeiter schleppend verlief. Der Vertreter der belgischen Firma, ein recht mürrischer Geselle in einer Tweed-Kombination mit braunem Karomuster, hatte als einzigen Trumpf für die Übersiedlung in den Wald die stattliche Entlohnung zu bieten. Da Giacomo nicht im Entferntesten eine Vorstellung davon hatte, wie und wo der Sauforst lag, war dieses eine Argument ausschlaggebend für ihn.
Der Schock, als er nach einer Woche des Wartens, die er sich mit Kartenspielen und süffigem Münchner Bier vertrieben hatte, im Sauforst ankam, war groß. Der Wald, wie die Einheimischen die Gegend nannten, in der er fortan leben sollte, war eine Wildnis. Bis vor Kurzem hatten sich noch Räuber in den dichten, dunklen Wäldern versteckt und einen Teil der Bevölkerung in Angst und Schrecken versetzt. Ein besonders furchtloser Schurke, von allen nur der Heigl genannt, war ein Jahr zuvor gefasst und in Straubing zum Tode verurteilt worden. Er hatte vor allem reiche Bauern und Geistliche bestohlen. Die einfachen Leute sprachen mit großem Respekt von diesem Mann, der wohl auch den einen oder anderen Nachkommen als Findelkind auf Türschwellen im ganzen Land hinterlassen hatte. All das machte den Räuber auch für Giacomo recht sympathisch. Schade drum, dachte er bei sich, als er nach einiger Zeit das einsilbige Leben und Arbeiten im Sauforst leid war, so einem hätte ich mich gerne angeschlossen.
Schon nach wenigen Monaten in der Eisenbahnschienenfabrik war Giacomo klar geworden, dass er hier nicht lange bleiben würde. Laut Vertrag war er als Puddler eingestellt worden und sollte am Puddelofen aus dem geschmolzenen Roheisen mit langen Kratz- und Rührstangen zirka vierzig Kilogramm schwere Klumpen von Eisen, sogenannte Luppen, zusammendrücken. Diese blumenkohlförmigen Brocken wurden anschließend im heißesten Teil des Ofens für fünf Minuten der größtmöglichen Hitze ausgesetzt, um hinterher in der Halle mit dem wasserbetriebenen Fallhammer bearbeitet zu werden. Doch das Anlernen Giacomos wurde von Woche zu Woche verschoben. Er kam einzig und allein in die Nähe des Puddelofens, um die schweren Eisenklumpen im Akkord zum Fallhammer zu schleifen. Sein Verdienst war der niederen, jedoch nicht minder kräfteraubenden Tätigkeit entsprechend angepasst worden.
An den jungen, kräftigen Burschen um ihn herum schien die schwere Arbeit, die glühende Hitze der Hochöfen, der stickige Qualm und die langen Schichten noch spurlos vorüberzugehen. Die älteren Männer waren jedoch bereits gezeichnet. Buckelig, asthmatisch hustend oder mit entzündeten, tränenden Augen traten sie ihren Dienst an. Die paar Groschen, die jedem Arbeiter von seinem Wochenlohn für die Kranken- und Sterbekasse einbehalten wurden, waren auch dringend für deren Behandlung oder für deren Beerdigung nötig.
Aber Giacomo wollte sich nicht beschweren. Die feinen Herren von der Fabrikleitung versuchten ihr Bestes, um die Arbeiter bei Laune zu halten. In den Hallen wurde darüber gemunkelt, dass in naher Zukunft Werksbaracken in unmittelbarer Nähe zur Fabrik gebaut werden würden, um Familien vor Ort anzusiedeln. Sogar von einer eigenen Werksschule für die Arbeiterkinder war die Rede. In dem finsteren Tal, aus dem Giacomo kam, war weit und breit keine Schule zu finden. Gören waren gerade gut genug, um sich als Kuh- oder Schafhirten zu verdingen. Nicht selten mussten bereits Zehnjährige monatelang und mutterseelenalleine auf einer zugigen Alm ausharren. Zumindest dieses Schicksal hatte den jungen Italiener nicht getroffen, auch wenn das Leben in der kleinen Hütte mit den Eltern und den sieben Geschwistern nicht einfach war. Vor allem im Herbst und Winter, wenn sich Nässe und Kälte ungemütlich im Tal breitmachten und monatelang nicht weichen wollten, wurde es eng in der kleinen, verräucherten Stube. Wie oft lag er als Kind hungernd und frierend auf seinem feuchten Strohsack und träumte von einem anderen Leben.
Angefeuert wurde die Fantasie des damals zwölfjährigen Giacomo von zwei merkwürdig gekleideten Engländern, die sein Dorf auf dem Weg zum Monte Legnone passierten. Sie rasteten für ein paar Stunden im Ort und versorgten sich mit Proviant für den beschwerlichen Aufstieg. Die in feinen Stoff gekleideten Männermit den genagelten Schuhen und den schweren Seilen um die Schultern konnten sich durch ein paar Brocken Italienisch verständlich machen. Und so erfuhren die Dorfbewohner, dass der reine Abenteuergeist die furchtlosen Engländer auf den Berg trieb. Giacomo war überwältigt. Diese Vorstellung sprengte das enge Weltbild des Jungen. Damals wurde ihm klar, dass es im Leben mehr gab als einen Stall voller Kinder, die man nicht zu ernähren wusste.
Den Mut, sein Vorhaben später auch wirklich in die Tat umzusetzen, verliehen dem Jungen seine Träume. Schon von klein auf hatte er gemerkt, dass vieles, was er im Schlaf sah, später Wirklichkeit wurde. Ein Schaf, welches auf der Weide verloren gegangen war, fand Giacomo mit einem gebrochenen Fuß am nächsten Tag genau an der Stelle zwischen den Felsen, die er im Traum gesehen hatte. Dass seine kleine Schwester Giulia, die ein heftiger Husten plagte, nicht mehr aufstehen würde, träumte er ebenfalls. Und so sah er es auch voraus, dass er nicht wie seine Eltern in dem Tal enden, sondern sein Glück weit weg finden würde. Darüber zu sprechen, traute sich der kleine Giacomo nicht. Wie eine Zecke auf der Suche nach einem Wirt wartete er still und genügsam so lange, bis die Zeit für ihn gekommen war. Das Wissen darum, dass das Schicksal für ihn einen anderen Weg als den seiner Geschwister vorgesehen hatte, ließ ihn geduldig im Tal ausharren. Er war schon über zwanzig, als ihm ein wiederkehrender Traum von dampfspuckenden Stahlrössern, einem undurchdringlichen, dunklen Wald und glühendem, flüssigem Eisen den Weg über die Berge wies. Und so war er eines Morgens aufgebrochen, hatte sich mit einem Kopfnicken von seiner Familie verabschiedet und war losmarschiert.
Die geplanten Neuerungen im Sauforst waren für den jungen Italiener kein Grund, sich dauerhaft dort niederzulassen. Denn in Gedanken trat er bereits seine nächste Reise an, auf einem der großen Schiffe, die, wie er gehört hatte, von Bremerhaven aus in Massen weit nach Westen fuhren. Fortan lockten ihn in seinen Träumen leuchtend weiße Segel, die sich strahlend vom tiefblauen Meer abhoben, und er meinte, die salzige Gischt auf seiner Zunge zu schmecken. Doch dann wurde seine Aufmerksamkeit auf etwas anderes, weitaus Anziehenderes gelenkt und verdrängte die Bilder der Schiffe kurzzeitig.
Maria Beerbauer
Maria Beerbauer war eine unbeschwerte, junge Frau. Mit ihren klaren, tiefblauen Augen und den hellblonden Locken, die links und rechts ihr schmales Gesicht umrahmten, bot sie einen bezaubernden Anblick. Sie verrichtete ihre Arbeit als Dienstmädchen im Haus des Direktors der Eisenbahnschienenfabrik mit großer Sorgfalt und Genauigkeit. Sobald ihr Dienst endete, waren ihre Gedanken aber beim nächsten anstehenden Tanzabend oder einer anderen geselligen Veranstaltung. Zwar lagen zwischen der Kirchweih, dem Maitanz oder dem Schützenfest viele Wochen, oft Monate, aber das hinderte Maria nicht daran, ebenso lange davon zu schwärmen und sich darauf zu freuen. Es war für sie die einzige Möglichkeit, in Kontakt mit den jungen Burschen aus der Fabrik zu kommen. Nach diesen Begegnungen träumte sie nächtelang von den aufregenden Drehungen und den kurzen Wortwechseln mit den schneidigen Tänzern. Tagelang hatte sie deren Geruch noch in der Nase und spürte in Nacken und Taille die glühenden Hände und Finger der Verehrer. Doch bis jetzt hatte sie noch bei keinem nachgegeben, alles Werben endete für sie mit dem letzten Tanz.
Auf Fremde wirkte sie jedoch verschlossen und schüchtern, so wie eben Oberpfälzer oft abweisend und mit Zurückhaltung auf Unbekannte reagierten. Irgendein Gelehrter hatte die Wesensart des Oberpfälzers offenbar einmal mit den Worten „Abgeschlossen nach außen, ist er desto offener unter den Seinigen“ beschrieben, wie Maria bei einem Gespräch in der Villa aufgeschnappt hatte. Sie musste sich arg anstrengen, um die hochdeutsche Aussprache ihres zugezogenen, protestantischen Arbeitgebers zu verstehen. Dies war im Arbeitsalltag auch nicht nötig. Ihre Anweisungen bekam Maria von der aus Burglengenfeld stammenden Mamsell, der ältesten Dienstmagd. Und die sprach im heimischen Dialekt. Der Herr Direktor und seine Frau beachteten das niedere Personal in der Regel nicht und redeten es auch nie persönlich an.
Auch wenn Maria nicht ganz genau sagen konnte, ob die Beschreibung ihrer Landsleute nun eher gut oder schlecht gemeint war, fühlte sie sich in diesem Moment nicht wohl. Dies war ihre Heimat, ihr Zuhause. Wieso sollte jemand das Verhalten der Menschen infrage stellen? War es nicht recht, wie die Menschen hier lebten? Mit einem Mal bekam sie Angst vor den Neuerungen, die die Fabrik mit sich brachte. Ihre Eltern hatten sie zu der Anstellung in der Villa gedrängt. Sie waren der Meinung, dass dies für die Tochter einfacher Häusler der einzige Weg in eine sichere Zukunft sein würde. Die Aussicht darauf schien ihr mit einem Mal ungewiss und düster und war vielleicht mit Veränderungen verbunden, die ihr die Heimat fremd machen würden.
Der Hausherr führte seiner Frau gegenüber weiter aus, dass der karge, nur schwer zu bestellende Boden, das Ausgeliefertsein an die vielen, verschiedenen Herrscher in den letzten Jahrzehnten und Jahrhunderten und all die Kriegsübel, die im Laufe der Zeit diese von Haus aus unwirtliche Region heimgesucht hatten, wohl nicht spurlos am Charakter der Einheimischen vorbeigegangen wären. Und deshalb, meinte er aufmunternd an seine Frau gerichtet, sei es nicht verwunderlich, wenn ein Volk, dem von seiner Obrigkeit wenig Halt und Unterstützung zuteilwurde, das mit Leib und Seele dienstbar gemacht wurde, mit misstrauischem Blick auf alles Unbekannte lieber unter sich bliebe. Sie solle nicht traurig darüber sein, keinen Anschluss unter den Einheimischen gefunden zu haben, und stattdessen freundschaftliche Zuwendung im Briefwechsel mit ihrer Schwester suchen.
Maria verstand nur die Hälfte der Ausführungen des Direktors. Aber es reichte aus, um die herablassende Sicht zu begreifen, mit der er die Oberpfälzer wahrnahm. Die junge Frau war verwirrt. Was war schlecht daran, wenn man das Unbekannte kritisch beurteilte? Was wäre ihr wohl widerfahren, wenn sie auf alles und jeden offen zugegangen wäre? Nein, die Menschen hier hatten das Herz am rechten Fleck. Sie waren nicht unfreundlich. Zumindest nicht in ihrer gewohnten Umgebung.
Die beschriebenen Wesenszüge der Oberpfälzer waren auch der jungen Maria eigen. Oft konnte man sie freudig-tuschelnd mit einem anderen, einheimischen Dienstmädchen in der Villa antreffen. Wurde sie dabei aber vom Hausherrn oder dessen Frau überrascht, verstummte sie sofort und errötete, um kurz darauf mit versteinerter Miene ihre Arbeit zu verrichten.
Was Maria aber grundsätzlich von allen anderen unterschied, war ihre Fähigkeit, die Aura eines Menschen visuell wahrzunehmen. Von klein auf leuchteten die Menschen um sie herum in unterschiedlichen Farbschattierungen. Sie konnte schon von Weitem sagen, wer ihr auf dem Weg entgegenkommen würde. Dazu brauchte sie nicht einmal das Gesicht zu sehen. Ihr reichte der Farbton, den die Person ausstrahlte, zur Identifizierung aus. Diese Art der Wahrnehmung funktionierte auch nachts, was besonders ihre Eltern verblüfft hatte. Maria konnte in der dunklen Hütte immer genau benennen, wer sich ihrem Bettchen näherte.
Es wäre ihr aber niemals eingefallen, diese Gabe als etwas Besonderes zu bezeichnen. Sie war der Meinung, dass alle die graue, braune, beige oder in seltenen Fällen auch orange, grüne oder blaue Färbung erkennen konnten, die ihre Mitmenschen umgab. Deshalb verlor sie nie ein Wort darüber.
Mit der wachsenden Nachfrage an Arbeitskräften in der zur Aktiengesellschaft umfirmierten und damit vor dem Bankrott bewahrten „Eisenwerkgesellschaft Maximilianshütte“ kamen nun immer mehr Fremde in den Sauforst. Man munkelte, dass sich unter ihnen auch Südländer befinden würden, Italiener um genau zu sein. Allein schon der Klang des Namens rief in Maria gleichzeitig Angst und Erregung hervor. Sie fieberte dem Maitanz 1855, bei dem sie hoffte –
und auch fürchtete – einem von ihnen zu begegnen, mit schwankenden Gefühlen entgegen. Einmal stellte sie sich vor, wie ein gutaussehender, großgewachsener Italiener sie beim Tanz um den Maibaum fest umklammert hielt und sie unter seinem schweißnassen Hemd die kraftvollen Muskeln spüren konnte. Dann wieder übermannte sie die Angst vor den fremden Männern und in ihrer Fantasie stürmten diese den Tanzboden und rissen die jungen Frauen unsanft und jäh zu Boden, um ihnen Gewalt anzutun.
Die Gerüchteküche tat ihr Übriges, um die Situation weiter anzuheizen. Es hieß, die Fremden hätten keine Manieren, keinen Glauben und keinen Anstand.
Dies alles führte nun dazu, dass die erste Begegnung von Maria Beerbauer mit Giacomo Verducci unter denkbar schlechten Vorzeichen stattfand. Aber als die junge Frau den Italiener schließlich traf, war es um sie geschehen. Giacomo war der erste Mensch, dessen Aura in allen Regenbogenfarben schillerte. Er musste etwas Besonderes sein. Sie war ebenso überwältigt von Giacomos entschlossenem Werben um sie, seinen intensiven Blicken aus den tiefliegenden, dunklen Augen und seiner Behändigkeit beim Tanz. All dies zusammen war schließlich der Grund, wieso sie letzten Endes seinem Drängen nach- und sich ihm hingab.
Die Nachricht über die Schwangerschaft, die Maria dem Italiener einige Wochen später überbrachte, kam für diesen keineswegs überraschend. Beide saßen an ihrem geheimen Treffpunkt, einer Waldlichtung einige hundert Meter von den Werkshallen entfernt, und schwiegen sich an. Maria traute sich nach ihrer Beichte nicht, Giacomo in die Augen zu sehen. Sie schämte sich. Er dagegen sprach nicht, weil er nicht wusste, wie er ihr seinen Zwiespalt erklären sollte. Er hatte in der Nacht zuvor schon von seinem Kind geträumt. Nun befand er sich in einem Dilemma. Er wollte den Plan von seiner Auswanderung nicht aufgeben. Zwar war er bis über beide Ohren in Maria verliebt, doch konnte er sich keine gemeinsame Zukunft mit ihr vorstellen, weil sie es kategorisch ablehnte, ihre Heimat zu verlassen. So hatte er schon seit Stunden hin und her überlegt, wie er dieses Problem lösen konnte. Und weil seine Sprachkenntnisse immer noch recht lückenhaft waren machte er sich gar nicht erst die Mühe, mit Maria darüber zu sprechen. Schließlich gingen sie wieder auseinander, ohne ein weiteres Wort über die Zukunft verloren zu haben.
Giacomo wählte die Flucht nach vorne. Bei Nacht und Nebel brach er kurz darauf auf, um in Bremerhaven einen Segler Richtung Westen zu besteigen, wie Maria tags darauf von einem Fabrikarbeiter erfuhr. Sie fühlte sich wie vor den Kopf gestoßen. Ihr hatte er nicht einmal Lebewohl gesagt.
Anton Beerbauer kam als uneheliches Kind an Mariä Lichtmess anno 1856 zur Welt. Maria erschrak, als sie den kleinen Wurm das erste Mal in den Armen hielt. Seine Aura strahlte denselben regenbogenfarbigen Schimmer aus wie die seines Vaters, wenngleich auch noch etwas schwächer. Aber bald schon hatte sie sich an diesen besonderen Anblick gewöhnt und nahm ihn mit der Zeit gar nicht mehr wahr.
Die Geburt stand unter dem Stern der Wanderung, die Mägde und Knechte der Umgebung durften sich eine neue Arbeitsstelle für das kommende Dienstjahr suchen. Für ein paar Tage wurde die sonst geltende Standesordnung außer Kraft gesetzt und die Frauen und Männer konnten sich frei und unbeschwert bewegen. Das ungestüme, fast rebellische Verhalten des Jungvolks wurde für die wenigen Tage rund um den zweiten Februar von der Dorfgemeinde geduldet. Mit Dienstantritt begann wieder die Zeit des unbedingten Gehorsams.
Maria aber lag im Wochenbett und bekam von dem heiteren Treiben nur wenig mit. Wie gerne wäre sie nun ebenfalls in ausgelassener Stimmung in der Wirtschaft gewesen und hätte sich mit den jungen Frauen über das vergangene Dienstjahr ausgetauscht oder sich ausgemalt, was der kommende Frühling wohl bringen würde. Stattdessen lag dieser verrunzelte Wurm an ihrer Brust und saugte alle Energie aus ihr heraus. Nur der gelegentliche Griff zum Rosenkranz und ein Gebet vertrieben ihre trüben Gedanken für kurze Zeit. Gleichzeitig erhoffte sie sich von dieser selbst auferlegten Strafe die Vergebung für ihre Sünde. Mit verkniffenem Mund und verkrampftem Kiefer zählte sie Perle um Perle vom Gebetskranz ab und murmelte fast tonlos die auswendig gelernten Verse. Am liebsten war ihr der Schmerzhafte Rosenkranz, weil ihr die Vorstellung gefiel, dass Jesus all seine Leiden in Kauf genommen hatte, um die Menschen zu erlösen. Den Freudenreichen Rosenkranz vermied sie, zu sehr schmerzte dabei die Erinnerung an ihren eigenen Fehltritt und die Niederkunft vor wenigen Tagen.
Der Sauforst veränderte sich in dieser Zeit stark. Das bäuerliche Leben, das jahrhundertelang den Alltag der Einheimischen bestimmt hatte, wurde durch allerhand neumodische Erfindungen und die sogenannte „Industrialisierung“, die zügig den Wald eroberte, gehörig durcheinandergebracht und auch von Maria kritisch beäugt.
Obwohl Maria ihre Stellung im Haus des Direktors behalten konnte, war es kein leichtes Leben, welches auf sie und den aufgeweckten Jungen wartete. Finanziell waren beide durch ihr Gehalt ausreichend versorgt. Aber der Kindsvater fehlte an allen Ecken und Enden. Das Getuschel und die anklagenden Blicke, welchen sie als ledige Frau ausgesetzt war, konnte die junge Mutter bald schon nicht mehr ertragen, und so zog sie sich immer mehr zurück. In dieser Zeit verwünschte Maria den treulosen Italiener jeden Tag aufs Neue und klammerte sich wie eine Ertrinkende an ihren Glauben.
Als sie nach dem Wochenbett den Dienst in der Villa antrat, deponierte sie das schlafende Bündel in der wohligen Wärme, die der große Holzofen der Gesindeküche spendete. Angespannt und gehetzt verrichtete sie fortan ihre Arbeit, bereit, um beim kleinsten Schrei in die Küche zu stürzen und den Säugling zur Ruhe zu mahnen. In dem großen, stillen Haus war jedoch nie ein Klagelaut zu hören. Ob dies an den unzähligen, verzweifelten Bittgebeten lag, die die Dienstmagd an die Mutter Gottes schickte, oder ob das routinierteHandanlegen der Köchin das Kind stundenlang im Reich der Träume hielt, war nicht auszumachen. Maria zumindest hielt die permanente Anspannung schlecht aus und sie alterte in diesen Jahren rasant. Ihre blonden Locken, die früher so lieblich ihr herziges Gesicht umrahmt hatten, lösten sich nun in hellgrauen, fast farblosen Strähnen aus der blütenweißen Haube, die zu ihrer Diensttracht gehörte. Die Wangen waren aschfahl und eingefallen, die Lippen fast immer zu einem schmalen Strich zusammengepresst. Anton hingegen blühte auf. Alle Frauen in der Villa, eingeschlossen die Frau des Direktors, herzten das propere, rosige Bündel bei jeder Gelegenheit. Die Hausherrin gab die Anweisung, den Jungen mit guter, rahmiger Milch zu versorgen. Ihr war wohl klar, dass Maria mit ihrem schlaffen, ausgezehrten Busen nicht imstande war, ihrer Mutterpflicht in dieser Hinsicht nachzukommen.
Die Mamsell, die dem Direktor beim Frühstück seine tägliche Morgenlektüre zurechtlegte, konnte hin und wieder eine Schlagzeile der Tageszeitung erhaschen und teilte ihren Wissensvorsprung auf eine triumphierende und genüssliche Weise mit den anderen Bediensteten. So erfuhr Maria, dass der Fürst von Thurn und Taxis aus dem nahen Regensburg und der Frankfurter Bankier Rothschild Anteilseigner der neuen Ostbahngesellschaft wurden, die den Ausbau der Bahnlinien in Bayern, und vor allem in der Oberpfalz, vorantreiben wollte. Im gleichen Jahr erhielten Rothschild und Thurn und Taxis von König Maximilian II. die Genehmigung zum Bau der Bahnstrecke Nürnberg-Amberg-Regensburg. Der geplante Wegverlauf führte nahe am Sauforst vorbei, und das nur wenige Kilometer entfernte Haidhof erhielt sogar einen Bahnhof.
Maria war fasziniert von der Vorstellung, innerhalb weniger Stunden so bedeutende Orte wie München oder Nürnberg bequem mit der Dampflok erreichen zu können. Ob sie je diese neue Reisemöglichkeit für sich selbst in Anspruch nehmen würde, darüber war sie unsicher. Was hätte sie, das Mädchen aus der Oberpfälzer, in einer großen Stadt zu suchen? Alles wäre dort neu und unbekannt. Womöglich würde sie überfallen und ausgeraubt werden. Man hörte von den ungeheuerlichsten Zuständen. Von Fräulein, die sich für Geld zur Schau stellten und noch schlimmere Dinge taten. Maria bekreuzigte sich beim Gedanken daran. Im Grunde hatte sie Angst davor, den Sauforst zu verlassen. Noch dazu war sie alleinstehend und für ein kleines Kind verantwortlich. Ohne einen Mann an ihrer Seite schien es ihr unvorstellbar, in einer anderen Welt zurechtzukommen.
Es gab aber auch Stimmen, die diese Technologie schlecht redeten und keine Zukunft darin sahen. Vor allem die Mamsell war strikt dagegen. Wie viele Burglengenfelder Bürger wetterte sie gegen die dampfspeienden Ungetüme, die die Landschaft verschandelten und das Reisen zu einer unnatürlich schnellen Hetzerei machten. Die Eisenbahnangst oder das Eisenbahnfieber würde alle befallen, die sich der Dampfmaschine auch nur näherten. Deren rasche Bewegungen würden geistige Unruhe hervorrufen und der Staat müsse, wenn schon nicht die Reisenden, dann doch die Zuschauer davor schützen. Die Gegner aus der benachbarten Kleinstadt setzten nach wie vor auf Pferdefuhrwerke und die bestehende Handelsstraße, die durch ihren Ort führte. Am Ende verweigerten die Bürger und die Stadtverwaltung die Streckenführung der Bahnlinie über Burglengenfeld und verhinderten den Bau eines Bahnhofs.
Für die Manufaktur brachen nach etlichen Rückschlägen und Anlaufschwierigkeiten dagegen gute Zeiten an. Das konnte Maria an der Stimmung im Haus erkennen. Früher waren aus dem Arbeitszimmer oft hitzige Laute gedrungen und der Direktor hatte den Raum mit zerrauften Haaren und versteinertem Gesichtsausdruck verlassen. Nun schien er gelassener, hatte manchmal sogar ein Lächeln auf den Lippen, wenn er durch die Villa schritt. Auch wurde nun während einer Konferenz wesentlich weniger Cognac verbraucht als vorher. Nur die Zigarren qualmten in einem Ausmaß wie eh und je. Maria lief mit angehaltenem Atem durch den Raum und öffnete zuerst alle Fenster, bevor sie sich an das Aufräumen machte.
Der Bedarf an Eisenbahnschienen, Bandagen, Achsen und schweren Radreifen, wie sie in der Maxhütte produziert wurden, nahm stetig zu. Und mit ihm die Nachfrage an Fabrikarbeitern. Galt bei der Errichtung des Eisenbahnschienenwerkes noch die Vorgabe, dass außer dem Fach- und Aufsichtspersonal nur einheimische Kräfte eingesetzt werden sollten, konnte man den steigenden Bedarf bald schon nicht mehr aus den Männern und Frauen der Höfe und Weiler der Region decken.
Mit dem Zuzug der Auswärtigen häuften sich aber neue Probleme im Sauforst. Für nicht einheimische, alleinstehende Männer und Frauen war es wegen der bestehenden Gesetze fast unmöglich zu heiraten und eine Familie zu gründen. Dazu hätten sie eine Ansässigmachungserlaubnis gebraucht, eine Berechtigung, um im Sauforst oder einer umliegenden Gemeinde heimisch werden zu können. Es hieß, man könne die Ansässigmachung erst nach achtjährigem Aufenthalt vor Ort beantragen. Ohne diese Erlaubnis konnte man wiederrum nicht heiraten. Aber für Maria spielte das keine Rolle mehr. Sie hätte zwar aufgrund ihrer Anstellung in der Villa und ihrer Geburt im Sauforst die Erlaubnis ohne Weiteres erhalten, jedoch hatte sie sich fortan jeden Gedanken an einen Mann verboten.
Dass sich die Zeiten änderten, und das starre Ständesystem im Begriff war aufzubrechen, wurde der jungen Mutter eines Nachmittags bei ihrer täglichen, routinierten Arbeit in der Villa bewusst. Sie saß an einem kleinen Beistelltisch im großen Salon und polierte die silberne Teekanne. Um diese Zeit war es im Haus besonders ruhig, der geschäftige Teil des Tages war vorüber und bis zum Abendessen sollten noch einige Stunden vergehen.
Der Direktor, gefolgt von seinem Sekretär, kam türknallend in den Salon, warf Hut und Stock polternd auf den großen Esstisch und ging auf das Kabinett mit den geschliffenen Karaffen zu. Nachdem er sich ein großes Glas mit einem bernsteinfarbenen Likör eingegossen hatte, machte er seinem Unmut Platz. Maria, deren Gehör mittlerweile an den hochdeutschen Dialekt des protestantischen Fabrikverwalters gewöhnt war, hatte er keine Sekunde lang beachtet.
„Schon wieder einer, der als Fachkraft angelernt werden sollte, hat sich auf und davon gemacht! Diese verdammte Ostbahngesellschaft! Fluch und Segen bringt sie uns. Wie sollen wir nur die Lieferfristen einhalten, wenn uns die Arbeiter dafür abhandenkommen!“, wetterte er los.
„Herr Direktor, beruhigen Sie sich doch. Die Nachfrage an Stellen in der Fabrik ist nach wie vor ungebrochen. Auch wenn, sofern ich das sagen darf, die Entlohnung immer wieder Anlass zu Gram und Unfrieden gibt. Dennoch ist es für viele junge Burschen und auch mittellose Weibsbilder aus der Umgebung die einzige Möglichkeit, dem Schicksal im Armenhaus zu entkommen. Viele von ihnen hätten ohne die Fabrik keine Chance, ein geregeltes Auskommen zu erzielen“, versuchte der Sekretär seinen Vorgesetzten zu beruhigen.
„Aber wenn das so ist, verstehe ich nicht, wieso uns einige von ihnen immer wieder verlassen!“, empörte sich der untersetzte Mann mittleren Alters und schwenkte dabei den zähflüssigen Likör in seinem Kristallglas hin und her.
„Sie müssen verstehen, Herr Direktor, die Gesetze! Vielen ist es nicht möglich, zu heiraten und eine Familie zu gründen. Entweder bringen sie die Heimatberechtigung nicht mit, haben keinen Grund und Boden vorzuweisen oder ihnen fehlt schlichtweg die Einwilligung der Eltern. Unter der Hand hat mir der katholische Pfarrer der Pfarrgemeinde Leonberg gesteckt, dass sich das Verhältnis von ehelichen zu nichtehelichen Kindern mittlerweile auf eins zu drei erhöht hat!“
Er machte eine Pause und schnaubte hörbar ein: „Man stelle sich das vor: Die bestehenden Gesetze sollten genau diesen nicht steuerbaren Anstieg der Bevölkerung verhindern. Doch das Gegenteil scheint der Fall zu sein.“
„Und was hat nun die Ostbahngesellschaft damit zu tun? Gelten diese Gesetze dort nicht?“, fragte der Direktor barsch zurück.
Der Sekretär, ein farbloser, junger Mann mit bereits stark ausgeprägten Geheimratsecken und hellem, krausem Haar, druckste unruhig herum: „Nun ja, es verhält sich wohl so, dass dort eine gewisse Art von – wie soll ich sagen – Duldung herrscht. Man sieht geflissentlich darüber hinweg, wenn Mann und Frau ohne Trauschein um Arbeit bitten. Es wird nur darauf geachtet, dass ihre Unterbringung getrennt erfolgt, um dem Vorwurf der Kuppelei vorzubeugen. Bei Familien mit Kindern macht man wohl eine Ausnahme.“
Weiter konnte Maria das Gespräch nicht verfolgen, die beiden Herren verließen den Salon und begaben sich ins Arbeitszimmer des Direktors. Zurück blieb eine verwirrte junge Frau. Hatte sie doch jahrelang geglaubt, dass es für sie und Giacomo keine gemeinsame Zukunft gegeben hätte, selbst wenn er im Sauforst geblieben wäre. Der Italiener hätte hier niemals eine Heiratserlaubnis bekommen.
Sie hielt inne, ließ den Putzlappen und die Kanne kraftlos auf ihren Schoß sinken und starrte den feinen Männern hinterher. Mit einem Mal fühlte sie sich noch einsamer, alleine gelassen in einer ihr immer fremder werdenden Welt. Bis vor ein paar Augenblicken war sie im Grunde zufrieden mit ihrem Schicksal, sogar dankbar, und ertrug den Makel, eine ledige Mutter zu sein, tapfer. Sie hatte ihren Platz in der Gesellschaft gefunden, auch wenn der nicht gerade auf der Sonnenseite des Lebens war. Nun wurden ihr die Ausmaße des neu angebrochenen Zeitalters erst klar und damit die Möglichkeiten, die sich für ihr eigenes Leben hätten ergeben können.
„Nicht mehr alleine sein, nicht mehr die Mutter eines Bangerts