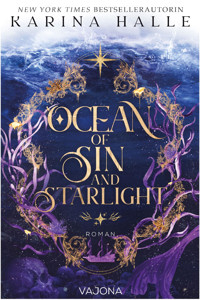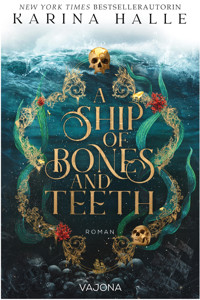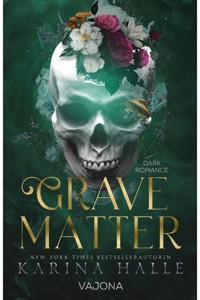
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: VAJONA
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Als sich ihr eine Traumchance bei einer renommierten Stiftung bietet, lässt die Doktorandin Sydney Denik ihr chaotisches Leben hinter sich und schließt sich einem Dutzend anderer Studenten in einer abgelegenen Lodge an, die versteckt in einer nebelverhangenen Bucht auf Vancouver Island liegt. Doch die Madrona Foundation beherbergt mehr als nur brillante Köpfe. Alle um sie herum verbergen ein schreckliches Geheimnis – auch der Psychologe, in den sie sich verliebt. Ein Student verschwindet, und niemand außer Sydney scheint sich dafür zu interessieren. Geister wandeln durch die Flure. Mitten im Sommer fällt Schnee. Tote Tiere bewegen sich wie Lebende. Je mehr Sydney über die Stiftung herausfindet, desto mehr beginnt sie, an ihrer eigenen geistigen Gesundheit zu zweifeln. Doch wenn Sydney nicht verrückt wird, dann sind die Schrecken in den umliegenden Wäldern real, und die Madrona Foundation könnte das größte Monster von allen sein.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 529
Veröffentlichungsjahr: 2026
Ähnliche
Karina Halle
Grave Matter
Übersetzung von Katherina Kisner
Grave Matter
Die Originalausgabe erschien unter dem Titel
»Grave Matter«.
Copyright © 2024 by Karina Halle
Published in agreement with the author, c/o BAROR INTERNATIONAL, INC., Armonk, New York, U.S.A.
Deutschsprachige Ausgabe © 2026. Grave Matter
by VAJONA Verlag GmbH
Übersetzung: Katherina Kisner
Korrektur: Anne Masur und Lisa Schönfeld
Umschlaggestaltung: Stefanie Saw
Satz: VAJONA Verlag GmbH, Oelsnitz
VAJONA Verlag GmbH
Carl-Wilhelm-Koch-Str. 3
08606 Oelsnitz
Teil der SCHÖCHE Verlagsgruppe GmbH
Für Scott und Perry, die besten Segelkameraden,
die man sich nur wünschen kann.
»Uns selbst zu belügen ist tiefer verwurzelt,
als andere zu belügen.«
DOSTOJEWSKI
Playlist
Die folgenden Lieder (in keiner bestimmten Reihenfolge) haben mir beim Schreiben dieses Buches geholfen, obwohl ich auch verschiedene Soundtracks gehört habe, darunter »The Girl With the Dragon Tattoo« von Trent Reznor & Atticus Ross, »Westworld: Season 3« von Ramin Djawadi und »Inception« von Hans Zimmer.
»The Beginning of the End« – +++ (Crosses)
»The Day the World Went Away« – Nine Inch Nails
»Change (In the House of Flies)« – Deftones
»Dissolved Girl« – Massive Attack
»Alibi« – BANKS
»Bury a Friend« – Billie Eilish
»Cinnamon Girl« – Lana Del Rey
»The Wake-Up« – How to Destroy Angels
»This is a Trick« – +++ (Crosses)
»Summertime Sadness« – Lana Del Rey
»We Come 1 (Radio Edit)« – Faithless
»Is That Your Life« – Tricky
»Butterfly Caught« – Massive Attack
»Sour Times« – Portishead
»Girls Float, Boys Cry« – +++ (Crosses)
»The Space in Between« – How to Destroy Angels
»The Night Does Not Belong to God« – Sleep Token
»Matador« – Faith No More
»Cadavre Exquis« – +++ (Crosses)
»How Long?« – How to Destroy Angels
»Body Electric« – Lana Del Rey
»Snow on the Beach« – Taylor Swift
»We’re in This Together« – Nine Inch Nails
»Vivien« – +++ (Crosses)
»Ashes to Ashes« – Faith No More
»Head Like a Hole« – Nine Inch Nails
»Tomb of Liegia« – Team Sleep
»Runner« – +++ (Crosses)
»Into My Arms« – Nick Cave and the Bad Seeds
Hinweis
Grave Matter enthält Szenen mit Blut, Body Horror, Tier-/Kreaturen-Body Horror, Tiersterben (nicht detailliert beschrieben), Erwähnung von Suizid, Suizidvisionen, Gesprächen über Alzheimer, Verlust von Eltern und Elternfiguren, Trauer, Schwierigkeiten mit Neurodiversität, unausgewogenen Machtverhältnissen und einer recht derben Sprache.
Es gibt auch ein paar Dark-Romance-Elemente, wie moralisch fragwürdige Hauptfiguren, Machtmissbrauch und explizite Sexszenen, darunter Erniedrigung, Lob-Kink, Würgespiele, Fesselspiele mit Seilen und Gürteln und verschiedene andere milde BDSM-Elemente. Wenn du dich mit einer sexuell freizügigen weiblichen Hauptfigur oder einem unmoralischen, obsessiven männlichen Hauptcharakter, der sie als »dreckige kleine Schlampe« bezeichnet, bevor er sie auf die Knie zwingt, nicht wohlfühlst, solltest du dir vielleicht noch mal überlegen, ob du dieses Buch lesen möchtest.
Deine psychische Gesundheit ist mir wichtig, und dieses Buch enthält alle möglichen Abartigkeiten, also gib bitte auf dich acht.
Das Mädchen, mit dem ich mich den ganzen Flug über unterhalten habe, ist verschwunden.
Ich bin aus dem Wasserflugzeug gestiegen, aber die Propeller drehen sich noch, als ich die Hand eines schlanken Mannes ergreife. Er trägt eine Regenjacke und stellt sich als David Chen, Manager der Madrona Lodge, vor. Doch als ich mich nach der fröhlichen Amani in ihrem hellrosafarbenen Hijab umdrehe, die gerade noch auf dem Sitz mir gegenüber saß und mit der ich fast eine Stunde lang geplaudert habe, ist sie nicht mehr im Flugzeug. Die beiden anderen Passagiere sind noch an Bord – ein Mann mit buschigen Augenbrauen und eine Frau mit schmalen Lippen, die laut dem Co-Piloten beide neue Mitarbeiter der Madrona Foundation sind. Sie sitzen in der hinteren Reihe und beobachten mich mit unverhohlenem Interesse.
Aber von Amani fehlt jede Spur.
»Alles okay?«, fragt David und drückt meine Hand etwas zu fest, sodass ich meine Aufmerksamkeit wieder auf ihn richte. »Ich sagte gerade, mein Name ist David Chen.«
»Oh. Sydney Denik«, stelle ich mich immer noch abgelenkt vor und ziehe meine Hand so unauffällig wie möglich zurück. Ich habe Mühe, mein Gleichgewicht auf dem Steg zu finden, während ich einen Moment lang seinen fragenden dunklen Augen begegne. Dann schaue ich erneut zum Flugzeug. »Entschuldigung, ich … ich habe mich gerade mit jemandem im Flugzeug unterhalten, und jetzt ist sie weg.«
»Amani?«, fragt er, und ich nicke. »Sie ist vor dir ausgestiegen.«
Ich schaue zum Dock hoch. Wegen der Ebbe gibt es eine steile Rampe zu einem langen Steg, der bis ans Land führt, aber von ihr ist weit und breit nichts zu sehen. Ich runzle die Stirn. Wie kann das sein?
»Das hast du wahrscheinlich nicht bemerkt«, fährt er fort. »Es wäre nicht das erste Mal, dass ein neuer Student zu fasziniert von der Landschaft hier ist. Wir hatten sogar schon jemanden, der vor lauter Ablenkung vom Dock gefallen ist. Das war sicher ein toller Empfang«, fügt er mit einem Lachen hinzu.
Aber ich bin als Erste aus dem Flugzeug gestiegen, will ich ihm sagen. Ich schwöre es, da bin ich mir sicher. Aber mir ist klar, dass es nicht gerade der beste Start wäre, mich mit dem Manager der Lodge anzulegen, vor allem, weil die Lage schon so angespannt ist. Und vielleicht hat er sogar recht. Vielleicht habe ich gar nicht bemerkt, wie Amani vor mir ausgestiegen ist. Mein Kopf fühlt sich etwas benebelt an. Wahrscheinlich, weil ich so erleichtert bin, endlich problemlos hier angekommen zu sein.
Amani hat den ganzen Flug lang davon geschwärmt, wie sehr sie sich freut, für das Studierendenprogramm der Madrona Foundation ausgewählt worden zu sein. Dass ich selbst kaum zu Wort kam, machte mir nichts aus. Ich versuche beim ersten Treffen immer, möglichst still zu bleiben – um herauszufinden, wie ich mich geben und meinem Gesprächspartner gegenüber verhalten soll. Also hörte ich zu und schaute während des Fluges von Vancouver zu dieser abgelegenen Bucht an der Nordwestküste von Vancouver Island aus dem Fenster auf die Landschaft. Wir flogen über die glitzernden Meerengen mit den zahlreichen weißen Fähren, dichte grüne Wälder, milchig-blaue Alpenseen und schroffe, schneebedeckte Gipfel hinweg, die selbst unter der Maisonne noch nicht getaut waren.
Aber je weiter wir nach Norden kamen, desto häufiger wurde die Landschaft von Wolken und Nebel verdeckt. Unser Pilot musste sogar etwa zwanzig Minuten lang kreisen, bevor wir landen konnten, während er wartete, bis sich der Nebel genug gelichtet hatte, um eine klare Sicht auf das Wasser zu bekommen.
»Wunderschön, nicht wahr?«, bemerkt David. Er verschränkt die Hände hinter dem Rücken und wippt auf den Fersen seiner schicken Anzugschuhe, die auf dem Steg irgendwie fehl am Platz wirken, auf und ab. Dann hält er seine Nase in die Luft, als wolle er mich dazu ermuntern, die Landschaft zu betrachten.
Ich dachte, dieser Ort würde mich an Zuhause erinnern – ich bin in Crescent City, Kalifornien, aufgewachsen, also bin ich mit Nebel, dem Meer und hohen Bäumen vertraut –, aber hier wirken die Elemente irgendwie intensiver, als hätte alles eine besondere Note. Der Nebel ist dichter und doch zart. Er erinnert mich an Spinnweben, die sich nicht zu bewegen scheinen, obwohl sie sich weit bis über die Baumwipfel erstrecken. Die Bäume selbst – Douglasien, Zedern und Sitka-Fichten – sind nicht so breit wie die Redwoods, aber sie sind höher, ihre Äste sind schwerer und ihre Stämme mit Moos und Flechten bewachsen. Auch das Unterholz ist wild überwuchert, und meine Augen haben Mühe, all die verschiedenen Pflanzen in ihren bunten Grüntönen zu erfassen – Scheinbeeren, Oregon-Trauben, wilder Ingwer und riesige Schwertfarne.
Der Traum eines jeden Biologen.
Und genau deshalb bin ich hier.
»Ich nehme an, du hattest vom Flugzeug aus keinen besonders guten Blick auf die Brooks-Halbinsel«, sagt David und beobachtet mich, während ich mich umschaue. Er deutet auf die schmale Bucht, deren Wasser dunkelgrün, spiegelglatt und ruhig ist, und dann auf die Wolkenbank auf der anderen Seite, die vermutlich einen bewaldeten Hang verdeckt. »Keine Sorge, du wirst die Gegend bald aus nächster Nähe erkunden. Sämtliche Heilmittel für die Leiden der Menschheit liegen direkt hinter diesem Nebel.« Ich beobachte, wie die Schwaden über das Wasser auf uns zukommen.
Endlich bist du angekommen, sage ich zu mir selbst. Du hast es geschafft. Jetzt entspann dich.
Das seltsame Gefühl von vorhin verfliegt. Mein ADHS-Gehirn lässt sich immer leicht ablenken, selbst wenn ich Medikamente nehme, also ist es gut möglich, dass Amani vor mir aus dem Flugzeug gestiegen ist und ich nur nicht aufgepasst habe.
»Wir machen eine kleine Tour durch die Lodge, dann zeige ich dir dein Zimmer«, sagt David und deutet in Richtung des dunklen, imposanten Holzgebäudes am Ende des Stegs.
»Was ist mit meinem Gepäck?« Ich schaue hinter mich zu den Piloten, die gerade eine Luke des Flugzeugs öffnen und mein Gepäck herausholen: einen metallisch schwarzen Handgepäck-Trolley mit einem wackeligen Rad und eine Reisetasche, die ich in der Schule gewonnen habe und auf deren Seite das Wappen des Basketballteams von Stanford prangt.
»Die Stewards kümmern sich um dein Gepäck«, sagt er. Ich zögere und schaue zu, wie sie es auf den Steg neben dem Flugzeug abstellen. Irgendetwas stimmt hier nicht, aber ich kann nicht den Finger darauflegen.
»Na komm, Miss Denik«, fügt er mit einem Anflug von Ungeduld hinzu.
Er deutet erneut den Steg entlang, und schließlich lächle ich entschuldigend. »Ja, tut mir leid. Ich versuche nur gerade, mich zu orientieren.«
»Das ist völlig normal«, sagt er wieder mit fröhlicher Stimme. »Und nach der Führung findest du dich sicher schnell zurecht.«
Doch als wir den Steg entlanggehen, muss ich noch einmal über meine Schulter schauen. Die beiden anderen Passagiere sitzen immer noch hinten im Flugzeug, starren aus dem Fenster und beobachten mich. Obwohl ich mich frage, warum sie nicht aussteigen, weiß ich, dass ich David nur verärgern würde, wenn ich noch mehr Fragen stelle. Ich muss mir wirklich mehr Mühe geben, mich bei ihm beliebt zu machen.
Er ist zwar nicht der Leiter der Madrona Foundation, aber er ist für die Lodge verantwortlich, in der ich die nächsten sechzehn Wochen verbringen werde, und ich will hier niemandem einen Grund geben, Nachforschungen bei meiner Uni anzustellen und die Wahrheit herauszufinden.
Schweigend gehen wir den Steg entlang. Neben dem Wasserflugzeug, das an dessen Ende festgemacht ist, gibt es ein paar Motor- und Fischerboote, die in einer so abgelegenen Gegend echt wichtig sind, sowie ein großes, elegantes Segelboot namens Mithrandir und mehrere Kajaks und Paddleboards, die auf dem Steg gestapelt wurden. Am Ende einer Anlegestelle steht ein kleines Gebäude mit der Aufschrift »Schwimmendes Labor«.
Vom Wasser steigt kühle Luft auf und streicht mir über die Wangen, und ich ziehe meine geliebte Patagonia-Jacke zu, die ich im Ausverkauf ergattert habe.
Er bemerkt es. »Schön, dass du dich passend angezogen hast. Du würdest dich wundern, wie viele Leute hier ankommen und im Sommer warmes, trockenes Wetter erwarten.«
»Ich lebe seit ein paar Jahren in der Bay Area. Ich bin daran gewöhnt«, sage ich ihm, obwohl es in der Gegend um Stanford im Sommer echt heiß werden kann. Auf den trockenen Wanderwegen unter dem Stanford Dish kann man richtig in der Sonne braten, während San Francisco unter einer Wolkendecke liegt.
»Ich werde versuchen, die Führung kurz zu halten, um dich am Anfang nicht zu überfordern«, sagt David, ohne zu wissen, dass ich mich generell schnell überfordert fühle. »Ich nehme an, du hast dich schon ein bisschen informiert?«
»So viel wie möglich«, gebe ich zu. Doch ich will ihm nicht offenbaren, dass ich stundenlang alles gelesen habe, was ich über die Madrona Foundation finden konnte. »Wer auch immer der Texter ist, könnte auch Romanautor sein. Er hat die Landschaft so schön beschrieben.«
Und das war auch schon so ziemlich alles, was dort zu finden war. Die Madrona Foundation ist bekannt dafür, ziemlich geheimnisvoll zu sein. Für die Medien gibt es auf ihrer Website nur kurze Ausschnitte ihrer bahnbrechenden Forschungsergebnisse. Über die Mitarbeiter oder den täglichen Betrieb wurde kaum etwas geschrieben – sogar der Abschnitt über Gaststudenten und Praktikanten war nur ein paar Zeilen lang. Aber die Landschaft und die Artenvielfalt wurden mit viel Liebe zum Detail beschrieben, offensichtlich von jemandem, der die Gegend wirklich liebt.
David gluckst. »Oh, das war Kincaid.« Dann runzelt er die Stirn und sein Gesicht wird seltsam ernst, als er mich ansieht. »Dr. Kincaid.«
»Auf der Website konnte ich keine Infos über die Mitarbeiter hier finden«, sage ich, um ihm klarzumachen, dass ich keine Ahnung habe, wer Dr. Kincaid ist, obwohl ich an Davids Gesichtsausdruck erkenne, dass er ihn nicht besonders mag.
»Na ja, du weißt ja, wie streng wir mit unseren Forschungsdaten umgehen«, sagt er. »Deshalb musst du auch als Erstes dein Handy abgeben.«
Ich wusste, dass das kommen würde, trotzdem macht mir der Gedanke, ohne Internet und Handy zu sein, echt Angst. Jeder Student, der in dieses spezielle Programm aufgenommen wird, wird darüber informiert, dass wir aufgrund der Natur der Stiftung nicht nur eine Geheimhaltungsvereinbarung unterschreiben müssen – was ich neulich bereits getan habe –, sondern auch unsere Handys abgeben müssen und bis zum Ende des Programms Ende August keine Laptops, Tablets oder andere elektronische Kommunikationsgeräte verwenden dürfen.
Das wird dir guttun, sage ich mir. Du brauchst diese Pause. Von einfach allem.
David räuspert sich. »Keine Sorge, du wirst dich daran gewöhnen, nicht erreichbar zu sein. Du wirst es sogar begrüßen. Wir haben festgestellt, dass es als Bonus zu einem besseren Zusammenhalt unter den Studenten führt. Und natürlich kannst du jeden Freitag telefonieren, und deine Familie kann dir jederzeit eine Nachricht hinterlassen.«
Er muss wissen, dass ich keine Familie habe. Ich schätze, das war einer der Gründe, warum ich überhaupt angenommen wurde; sie haben von meinem Einkommen und meinem Waisenstatus erfahren und hatten Mitleid mit mir. Andererseits kennt David vielleicht nicht die ganze Hintergrundgeschichte jedes einzelnen Schülers. Ich beiße mir auf die Zunge und schaffe es, nichts zu erwidern – obwohl es mir schwerfällt, Leute nicht zu korrigieren, wenn sie etwas Falsches sagen.
»Da du auf der Website warst, bist du bestimmt schon mit der Geschichte dieses Ortes vertraut, oder?«, fragt er, als wir uns der Lodge zu unserer Rechten nähern. Selbst bei Tageslicht wirkt das Gebäude düster und bedrohlich. Es ist zweistöckig, und das verwitterte Holz wurde erst kürzlich schwarzbraun gestrichen. Es erstreckt sich über die Felsen oberhalb der Küste und erinnert mich an ein Raubtier, das zum Sprung ansetzt. Vor dem Gebäude schlängelt sich eine schmale Veranda entlang, auf der vereinzelt Holzbänke stehen. An dem Geländer hängen Blumenkörbe mit zarten Farnen, deren Spitzen vom Tau benetzt sind.
»Das war doch mal eine alte Konservenfabrik, oder?«, sage ich. Das Einzige, was ich höre, ist das gelegentliche, eindringliche Rufen eines Zaunkönigs und das Plätschern des Wassers an den Felsen am Ufer. Ich hatte erwartet, dass es hier von anderen Studenten und Forschern wimmeln würde, aber stattdessen scheint die ganze Lodge den Atem anzuhalten, als würde sie auf etwas warten.
Als würde sie auf dich warten. Der Gedanke schießt mir durch den Kopf und lässt meine Nackenhaare zu Berge stehen. Sogar die vierflügeligen Fenster entlang der Vorderseite erinnern mich an eine vieläugige Kreatur, die alles beobachtet, was um sie herum geschieht.
»Korrekt.« Davids ruhige Stimme reißt mich aus meinen Gedanken. »Bis in die 1940er Jahre war es eine Konservenfabrik, zuerst für Krabben und Muscheln, später für Lachs und Heilbutt. Danach wurde es zu einer Fischerhütte umgebaut, bis wir vor fünfzehn Jahren hierherkamen und es in die heutige Lodge und den Hauptsitz der Stiftung verwandelten.«
»Bin ich die Erste, die hier angekommen ist?«, frage ich, während ich ihm zu der schwarzen Holztür folge und eine kleine Kamera über der Tür bemerke, die direkt auf mich gerichtet ist. Selbstbewusst straffe ich die Schultern.
»Eigentlich bist du die Letzte«, sagt er, was mich komplett überrascht. »Alle anderen sind bereits im Lernzentrum und werden eingewiesen.«
Mir dreht sich der Magen um. Ich hasse es, die Letzte zu sein, auch wenn das bei meinem Zeitmanagement häufiger vorkommt. Deshalb stelle ich mir eine Million Wecker, plane immer weit im Voraus und komme trotzdem noch zu spät. Aber ich habe genau das Flugzeug genommen, das ich nehmen sollte, also habe ich diesmal gar keinen Einfluss darauf gehabt.
»Also bin ich zu spät?«, flüstere ich, als er nach dem Türknauf greift.
»Nicht zu spät. Genau pünktlich.«
Er öffnet die Tür und führt mich ins Gebäude.
Sofort schlägt mir der Geruch von Zedernholz und Holzrauch entgegen. Der Eingangsbereich sieht genau so aus, wie man sich eine alte Fischerhütte vorstellt. Am hinteren Ende ist ein Kamin, in dem kleine Flammen knistern, und über dem Kaminsims hängt ein Elchkopf. Vor den abgenutzten Holzwänden stehen Regale voller Bücher, dazwischen hängen kleine Schnitzereien lokaler Künstler. In der Mitte des riesigen Raumes stehen Ledersofas und gepolsterte Sessel mit karierten Decken über den Rückenlehnen und ein paar grob gezimmerte Couchtische aus Zedernholz. Von der Ecke aus führt eine Treppe in den zweiten Stock.
»Das hier ist der Gemeinschaftsraum«, sagt er und deutet in den gemütlichen Raum hinein.
Links von mir befindet sich eine geschlossene Tür mit einem Schild, auf dem »Rezeption« steht. David führt mich gerade darauf zu, als sie aufgeht und eine Frau heraustritt. Sie ist ungefähr so klein wie ich, vielleicht eins sechzig, Mitte vierzig, und der braune Bob-Schnitt mit dem dicken Pony rahmt ihr engelsgleiches Gesicht ein. Sie trägt ein blaues Flanellhemd und eine Menge silberner Armreifen um die Handgelenke.
»Sydney, das ist Michelle«, stellt er sie vor. »Michelle, Sydney Denik ist da.«
»Unser letzter Ankömmling«, sagt Michelle und nickt eifrig. Sie lächelt von Ohr zu Ohr, es wirkt ein bisschen zu breit. Als sie mir ihre Hand entgegenstreckt und wir einen kurzen, verschwitzen Händedruck austauschen, klimpern ihre Armreifen. Ihre Hand zittert leicht in meiner.
»Ich habe Sydney gerade gesagt, dass sie nicht zu spät ist. Sie ist genau pünktlich«, sagt er, während ich den Drang unterdrücke, die Handfläche an meiner Jeans abzuwischen.
»Natürlich, natürlich!«, ruft Michelle laut. »Nein, du bist überhaupt nicht zu spät. Nur pünktlich, pünktlich. Schön, dich endlich kennenzulernen.«
»Hat Amani sich schon angemeldet?«, frage ich sie.
Michelle runzelt kurz die Stirn und schaut David verwirrt an, bevor sie sagt: »Oh, Amani. Ja. Die mit dem Kopftuch.«
»Das ist ein Hijab«, korrigiere ich sie.
»Ja, ein Hijab.« Sie nickt energisch und lächelt wieder. »Ja. Natürlich. Jep. Sie ist direkt auf ihr Zimmer gegangen. Möchtest du das auch machen? Die Stewards werden deine Koffer dorthin bringen. Oder David könnte dich direkt zum Lernzentrum bringen und dich allen anderen Studenten vorstellen und …«
»Bevor wir das machen«, wirft David ein, »ist es Zeit, dass Sydney ihr Handy abgibt.«
»Natürlich«, sagt Michelle und läuft rot an. Sie wirft mir einen besorgten Blick zu.
»Tut mir leid, Schätzchen, ich weiß, dass das echt wehtut.« Dann streckt sie mir erwartungsvoll die Hand entgegen.
Ich seufze und ziehe mein Handy aus meiner Jackentasche. Ich tippe einmal auf den Bildschirm, nur um noch ein letztes Mal das Hintergrundbild mit dem lächelnden Gesicht meiner Großmutter zu sehen. Aber als ich das tue, stimmt etwas mit dem Bildschirm nicht. Bevor ich es richtig erkennen kann, hat Michelle mir mein Handy bereits aus der Hand genommen.
»Warte, kann ich das noch mal sehen?«, sage ich und versuche, es ihr wieder abzunehmen.
»Entschuldige«, sagt sie mit einem nervösen Lachen, als sie es schnell in ihre Gesäßtasche schiebt. »Ich weiß, dass es schwer ist, aber du wirst dich daran gewöhnen. Alle sagen, dass sie es viel mehr schätzen, mit dem Festnetz zu telefonieren. Du wirst dich auf deine Freitagabende freuen. Und natürlich gibt es noch …«
Davids Räuspern schneidet ihr das Wort ab. »Jetzt, wo das Schwierige geschafft ist, zeige ich dir dein Zimmer«, sagt er zu mir, legt seine Hand auf meinen Rücken und nickt Michelle knapp zu. »Danke, Michelle.«
»Ja, natürlich«, sagt sie und huscht zurück in ihr Büro.
Aber ich kann nicht aufhören, an mein Handy zu denken. An das, was ein Foto meiner Großmutter hätte sein sollen, etwa ein Jahr vor ihrem Tod. Es war einer der schwierigeren Tage, an denen ihr Alzheimer sie fast vollständig beherrschte, aber plötzlich erinnerte sie sich an mich. Sie sah mich an und lächelte. »Sydney«, sagte sie mit so viel Liebe in der Stimme, dass es mir das Herz brach. Es war so schön und rein und echt. Diesen Moment habe ich auf einem Foto festgehalten, das seitdem mein Hintergrundbild ist.
Aber als ich gerade auf das Display tippte, sah ich für den Bruchteil einer Sekunde ein anderes Bild. Es war ein anderes Foto von meiner Oma, das am selben Tag aufgenommen worden war. Auf diesem Bild sah sie wütend und verwirrt aus, starrte direkt in die Kamera und wollte, dass ich ging.
Wie eine Warnung.
»Hier wohnen deine Kommilitonen«, sagt David, als wir den Flur im zweiten Stock betreten. Obwohl es Tag ist, ist es dunkel hier oben. Nur ein paar Lampen an den hölzernen Wänden spenden ein schwaches Licht im Flur, der auf beiden Seiten von jeweils sechs Türen gesäumt wird, und ganz am Ende prangt eine Doppeltür. Die Atmosphäre hier ist unheimlicher, als ich erwartet hatte, was jedoch auch daran liegen könnte, dass mich das Foto meiner Großmutter so nervös gemacht hat.
Du bildest dir das nur ein, sage ich mir. Du weißt doch, dass es sich nicht von selbst geändert hat. Und selbst wenn du es tatsächlich gesehen hast, hast du das andere Bild wahrscheinlich aus Versehen ausgewählt.
»Und dein Zimmer ist genau hier«, sagt er und zeigt auf die Tür direkt neben der Treppe.
Auf einem Holzschild steht in Schreibschrift »Zimmer Eins« und darunter ist die Schnitzerei eines Amerikanischen Erdbeerbaums. »Die Duschen sind ganz am Ende des Flurs. Für diejenigen, die tauchen waren, gibt es auch eine Dusche im Schwimmenden Labor. Aber jedes Zimmer verfügt über ein eigenes Waschbecken und eine Toilette.«
Er holt ein paar altmodisch aussehende Schlüssel hervor, wie man sie aus Gothic-Filmen kennt, nimmt einen vom Ring und überreicht ihn mir. »Ich weiß«, sagt er, als er meinen skeptischen Blick bemerkt, »aber diese Zimmer waren früher für die Arbeiter der Konservenfabrik – warum sollte man die Schlüssel austauschen?«
Ich räuspere mich und nehme den Schlüssel entgegen. »Und den anderen behältst du?«, frage ich.
»Wir betreten niemals ohne Erlaubnis die Zimmer unserer Studenten«, sagt er mit einem leichten Lächeln. »Aber da Schlüssel leicht verloren gehen können, behalten wir zur Sicherheit einen bei uns. Keine Sorge, für den Zugang zum Labor bekommst du deine eigene codierte Schlüsselkarte. Anders als hier wurde die Technik dort deutlich verbessert.«
Das will ich doch hoffen, denke ich und stecke den Schlüssel in das Schloss. Er dreht sich mit einem befriedigenden Klicken.
Dann schiebe ich die Tür auf und trete ein. Der Raum ist klein, aber gemütlich, mit einem Fenster, von dem aus man auf eine riesige Zeder blickt. Hinter ihren Ästen kann man noch andere Gebäude sehen. An den Wänden hängt auf der einen Seite ein Ölgemälde von einem Seestern in einer Gezeitengrube, auf der anderen Seite sitzt ein Rabe auf einem Zweig einer Hemlocktanne. Gegenüber einem Doppelbett mit einer rot-schwarz bestickten Tagesdecke steht ein großer Eichenschrank.
»Die wurden von den Quatsino First Nations gemacht«, erklärt David stolz. »Die Lodge grenzt an ihr Gebiet, und wir sind sehr stolz auf unsere traditionelle Zusammenarbeit mit ihnen.«
Aha. Es klingt, als würde er aus einem Skript vorlesen. Normalerweise ziehen die Anwohner den Kürzeren, wenn Unternehmen in oder um ihr angestammtes Land siedeln. Und ich erwarte nicht, dass eine Einrichtung wie die Madrona Foundation mit ihrem Geld und ihren Forschungszuschüssen die Interessen der Ureinwohner beachtet.
Davids Apple Watch piept, er wirft einen schnellen Blick darauf und runzelt die Stirn.
»Bitte entschuldige, Sydney, aber ich muss los«, sagt er und schenkt mir ein kurzes, aber angespanntes Lächeln. »Fühl dich ganz wie zu Hause. Ich werde nach deinem Koffer sehen und bin gleich wieder da, um die Führung fortzusetzen.« Er greift in seine Jackentasche, holt einen gefalteten Zettel heraus und drückt ihn mir in die Hand. »Hier ist eine Karte, damit du dich besser zurechtfindest. Auf der Rückseite findest du deinen Wochenplan, wobei sich einige Dinge noch ändern können. Und in der Schublade deines Nachttischs liegt eine Uhr. Die wirst du brauchen.«
Damit dreht er sich um, geht aus dem Zimmer und knallt die Tür hinter sich zu.
Mit der Karte in den Händen starre ich einen Moment lang auf die Tür, überrascht von seinem plötzlichen Abgang. Dann ziehe ich die Nachttischschublade auf und hole eine Armbanduhr mit dem Logo der Madrona Foundation heraus. Sie ist aus Plastik und so billig und einfach, dass sie keinen Wecker hat, was mir noch zum Verhängnis werden könnte, aber wenigstens steht ein separater Wecker auf meinem Nachttisch.
Ich stecke die Uhr in die Tasche und beschließe, das Badezimmer zu erkunden, wo gerade mal Platz für ein kleines Waschbecken und eine Toilette ist. Über der Toilette hängt eine alte Stickerei, die aussieht wie mein Lieblingspilz, Omphalotus nidiformis, dessen Umrisse in leuchtendem Grün gestickt sind, als wäre er biolumineszent. Ich starre sie einen Moment lang an, seltsam fasziniert von dem Bild. Diese Pilze sind besser bekannt als Geisterpilze, trotzdem sind sie normalerweise nicht Gegenstand von Stickereien oder Kunstwerken, und sie kommen in dieser Gegend auch definitiv nicht vor. Ich frage mich, ob ich bei meiner Anmeldung unbewusst die Frage »Was ist dein Lieblingspilz?« beantwortet habe und man dann versucht hat, das Zimmer so persönlich wie möglich zu gestalten. Falls dem so war, war das sehr nett von ihnen.
Ich setze mich auf die Toilette und breite die Karte aus, doch bevor ich sie mir genauer anschauen kann, klopft es an der Tür.
»Ich komme!«, rufe ich, beende mein Geschäft, wasche mir die Hände und gehe zurück in mein Zimmer. Als ich die Tür öffne, sehe ich eine umwerfende Frau vor mir, groß, mit langen, hellblonden Haaren, die eine knallrote Regenjacke trägt. Ihre schlanken Beine sind in Leggings gehüllt und endlos lang, und an den Füßen hat sie Burberry-Stiefel im Karomuster.
Sie hat mein Gepäck dabei.
»Hallo«, sagt sie mit einer rauen, sinnlichen Stimme, die auch zu einer Femme fatale aus einem Film passen würde. »Ich habe hier dein Gepäck.« Ihre leuchtend grünen Augen mustern mich erwartungsvoll, und ich habe das Gefühl, sie schon mal irgendwo gesehen zu haben.
»Hi. Ja, danke. Ich sollte dir wohl Trinkgeld geben«, sage ich und krame in meiner Umhängetasche herum, obwohl ich weiß, dass ich kein Kleingeld dabei habe.
»Das ist nicht nötig«, sagt sie, während sie meinen Koffer und meine Reisetasche ins Zimmer trägt. Ihr Haar, das direkt aus einer Pantene-Pro-V-Werbung entsprungen sein könnte, duftet leicht nach Jasmin. »Ich bin nicht die Stewardess. Ich habe nur die Taschen auf dem Dock gesehen und dachte, ihr könntet vielleicht Hilfe gebrauchen.«
Ich starre sie an, unsicher, ob mich ihre Schönheit blendet oder ob es an etwas anderem liegt. »Woher kenne ich dich?«, frage ich und merke erst dann, dass ich das laut ausgesprochen habe.
Sie starrt mich einen Moment lang an, ihre Miene ist seltsam ausdruckslos. Dann lächelt sie wieder. »Du hast mich wahrscheinlich schon mal auf dem Campus gesehen. Stanford, oder? Ich habe schon einige Vorträge im Fachbereich Biologie gehalten, allerdings auf Doktorandenebene.« Sie macht eine Pause. »Du machst deinen Master in Biologie mit Schwerpunkt Neurobiologie, stimmt’s?«
Ich starre sie an. »Du arbeitest für Madrona.«
»Wir alle arbeiten für Madrona«, sagt sie. »In den nächsten sechzehn Wochen wirst du das auch tun.« Sie hält inne und streckt mir die Hand entgegen. »Ich bin Everly. Dr. Everly Johnstone.«
Ich ergreife ihre Hand schwach.
Dr. Everly Johnstone ist ein anerkanntes Genie und die Leiterin der Madrona Foundation. Kein Wunder, dass sie mir bekannt vorkam. Es war ihr Vater, Brandon Johnstone, der die Stiftung damals gegründet hat.
»Natürlich«, sage ich, ziehe meine Hand zurück und komme mir dumm vor. »Es tut mir so leid, ich habe Sie nicht erkannt.«
Sie strahlt mich an, ihre Zähne sind so weiß und perfekt, dass es sich nur um Veneers handeln kann. »Oh, das ist völlig in Ordnung. Ich erwarte nicht, dass die Leute mich kennen. Ich bleibe lieber im Schatten meiner Arbeit.«
»Trotzdem, Sie sind Dr. Johnstone«, sage ich entschuldigend. »Das hätte ich wissen müssen.« Ich habe sie hin und wieder in Interviews gesehen, auch wenn sie das in letzter Zeit nicht mehr so häufig macht. Seit ihr Vater die Tochterfirma Madrona Pharmaceuticals gegründet und die Stiftung und deren Forschung seiner Tochter überlassen hat, steht er wieder mehr im Rampenlicht – zumindest habe ich das gelesen.
»Bitte«, sagt sie mit einer eleganten Handbewegung. »Nenn mich Everly. Wir werden hier in der nächsten Zeit eine Familie werden, und mir sind die Vornamen lieber.«
»Sydney«, sage ich und zeige unbeholfen mit dem Daumen auf mich. »Aber das wusstest du sicher schon.«
»Ich weiß alles über dich, Sydney Denik«, sagt sie. »Ich habe deine Bewerbung persönlich geprüft und genehmigt.« Ihr Blick huscht einen Moment lang über mich, als würde sie mich wirklich zum ersten Mal sehen, dann wird ihr Gesichtsausdruck weicher. »Ich bin wirklich froh, dich hier zu haben, Sydney. Du bist ein ganz besonderes Mädchen.«
Ich spüre, wie meine Wangen rot werden. Ich konnte noch nie gut mit Zurschaustellungen von Gefühlen oder Komplimenten umgehen, und ihrem Gesichtsausdruck nach zu urteilen, scheint es sich um eine Mischung aus beidem zu handeln.
»Es freut mich auch sehr, hier zu sein«, sage ich. Sogar noch mehr, als sie ahnen könnte. Vor allem, weil mir das alles jeden Moment wieder genommen werden könnte.
Im Januar habe ich mich bei der Madrona Foundation beworben, als Teil meines Abschlussprojekts. Die Stiftung bietet in den Sommermonaten regelmäßig Praktika für Studenten an, also habe ich es einfach versucht, obwohl ich wusste, dass das Auswahlverfahren echt hart ist.
Zu meiner Überraschung wurde ich angenommen. Ich wusste, dass meine Noten gut genug waren, und ich wusste, dass mein Projekt mit dem Dark-Fungus im letzten Jahr in Mykologiekreisen viel Aufmerksamkeit erregt hat. Aber ehrlich gesagt bin ich immer überrascht, wenn es gut bei mir läuft, wenn nicht sogar misstrauisch. Das Leben prägt einen, und wenn man ständig Rückschläge einstecken musste, rechnet man auch weiterhin mit ihnen.
Als der erste Schock verflog, war ich vor allem erleichtert, weil ich ein Stipendium bekommen würde, außerdem sind Unterkunft und Verpflegung inklusive. Und ich würde den Wissenschaftlern hier bei ihrer Arbeit helfen, Pilze für neurologische Fortschritte zu nutzen. Sie hatten bereits vielversprechende Fortschritte bei der Behandlung von Alzheimer mit einem lokalen, bisher unbekannten Pilz erzielt, der auf ihrem Gelände gefunden wurde. Da mir Alzheimer so sehr am Herzen liegt, wusste ich, dass ich hier vielleicht etwas bewirken oder zumindest etwas Erstaunliches für meine Abschlussarbeit lernen könnte.
Aber dann kam der Rückschlag, wie immer.
Ich hab’s vermasselt.
Ich hab’s richtig vermasselt und einen riesigen Fehler gemacht.
Selbstsabotage war schon immer mein Ding.
Und so bekam ich vorgestern den gefürchteten Anruf, mit dem ich dennoch sicher gerechnet hatte.
Ich habe mein Stipendium für Stanford verloren.
Das bedeutet, dass ich mein letztes Studienjahr nicht beenden kann, weil ich total pleite bin und mir die Studiengebühren nicht leisten kann. Aber diese Chance wollte ich mir auf keinen Fall entgehen lassen. Ich hatte keine Gelegenheit nachzufragen, ob das mein Praktikum bei Madrona beeinflussen würde, also beschloss ich, es zu riskieren. Und als ich gestern die E-Mail von der Fluggesellschaft erhielt, in der ich aufgefordert wurde, für meinen Flug nach Vancouver einzuchecken, gab ich meinen Schlüssel für das Studentenwohnheim ab, packte den Rest meiner Sachen in die Garage meiner Freundin Chelsea und stieg heute Morgen mit meinem Gepäck in den Flieger.
Als ich in Vancouver landete, bin ich schnell zum Wasserflugzeugterminal geeilt und habe gehofft und gebetet, dass ich auch den letzten Flug nach Madrona nehmen dürfe. Der Pilot fragte nach meinem Namen, und dann bin ich mit den beiden Mitarbeitern und Amani ins Flugzeug gestiegen.
Irgendwie habe ich es gerade noch so geschafft, hier anzukommen.
Ich weiß nicht, wie viel Zeit ich habe, bis jemand dahinterkommt. Bisher scheinen weder David noch Everly oder die Empfangsdame irgendwas zu bemerken. Alle behandeln mich, als gehöre ich hierher. Vielleicht meldet sich die Uni gar nicht bei der Stiftung; vielleicht sind sie so froh, mich loszuwerden, dass sie es absichtlich vergessen haben. Vielleicht können sie nichts unternehmen, weil sie mir mein Stipendium schon als Pauschalbetrag ausgezahlt haben.
Oder vielleicht ist David so schnell aus dem Zimmer geeilt, weil er gerade einen Anruf aus Stanford bekommen hat und ich nur noch wenige Minuten Zeit habe, bevor ich mich wieder in dieses Wasserflugzeug setzen muss.
Der Gedanke daran ist wie ein Schlag in die Magengrube. Blanke Angst. Ein Traum wird wahr, man bekommt einen kleinen Vorgeschmack darauf, bevor einem alles wieder entrissen wird.
Diesen Sieg hatte ich so bitternötig.
Everly räuspert sich und lenkt meine Aufmerksamkeit wieder auf sich, bevor sie auf die Karte in meinen Händen deutet. »Ich weiß, dass David irgendwohin gerufen wurde, es hatte etwas mit der Solarfarm zu tun. Aber ich würde dich gerne herumführen. Möchtest du dich erst mal einrichten und deine Sachen wegpacken oder …?«
»Nein!«, sage ich schnell und stecke die Karte in meine Jeanstasche. »Das kann ich später machen.« Wenn mir die Leiterin der Stiftung anbietet, mir alles zu zeigen, werde ich mir das nicht entgehen lassen. David war ganz in Ordnung, wenn auch ein bisschen seltsam, aber Dr. Everly Johnstone ist eine Ikone.
»Okay«, sagt sie mit einem weiteren freundlichen Lächeln. »Dann lass uns gehen.«
Sie öffnet die Tür und schaut über ihre Schulter zu mir, als wolle sie sicherstellen, dass ich ihr folge.
Zitternd atme ich aus. Ein Teil von mir hält die Lügen kaum aus und würde am liebsten alles gestehen, nur damit es mich nicht mehr belastet und ich nicht jeden Tag damit verbringe, mich zu fragen, wann mir der Boden unter den Füßen weggerissen wird.
Der andere Teil von mir will die Lüge so lange wie nur möglich aufrechterhalten, in der Hoffnung, dass ich sie vielleicht, nur vielleicht, davon überzeugen kann, mich bleiben zu lassen, selbst wenn sie es irgendwann herausfinden.
Also zwinge ich mich dazu, die Angst in mir zu behalten.
Ich schlucke die Wahrheit herunter.
Verstecke sie.
Und dann folge ich ihr.
Bezaubernd.
Üppig.
Verdammt launisch.
Die Madrona Lodge, wie Everly das ganze Anwesen nennt, ist wie aus einem Grimm-Märchen entsprungen. Ich glaube, vorher war ich zu überwältigt, um einen richtigen Eindruck zu bekommen, vielleicht weil David meine Reaktionen so genau beobachtet hat, aber jetzt dringt alles langsam zu mir durch. Die Anlage ist makellos gepflegt, mit sauberen Steinwegen, die sich unter duftenden Zedernzweigen hindurchschlängeln, während getrocknete Nadeln den Boden bedecken. Der Nebel hängt noch immer über den Baumwipfeln – hier und da flattern Raben wie schattenhafte Geister umher –, aber jetzt gleitet er auch zwischen den dunklen, rustikalen Gebäuden hindurch und lässt den Ort wie aus einem Traum erscheinen.
Everly führt mich nach links, vorbei an einem riesigen Totempfahl, der wie ein Wächter an der Bootsanlegestelle steht, dann zur Kantine, wo die Studenten und Gastforscher essen, und schließlich zur Westlodge, die als Unterkunft und Speisesaal für die Mitarbeiter dient. Ich sehe auch die vielen privaten Hütten, in denen die Wissenschaftler wohnen. Everly zeigt mir ihre Hütte mit Blick auf die Bucht: Hütte Nummer sechs. Ich hätte gedacht, dass die Leiterin der Organisation, die wahrscheinlich ein wahres Vermögen wert ist, etwas extravaganter wohnen würde, aber so macht es sie viel sympathischer.
»Du kannst mich jederzeit besuchen«, sagt sie zu mir, als ich ihr den Weg entlang folge und wir uns wieder von ihrer Hütte entfernen. »Ich meine es ernst. Jederzeit, egal ob tagsüber oder mitten in der Nacht, wenn du jemanden zum Reden brauchst, jemanden, der dir zuhört, bin ich da. Du bist nicht allein.«
Ich weiß, dass sie das wahrscheinlich so meint wie »Hey, sieh mich nicht als deine Vorgesetzte an, in Wirklichkeit bin ich total zugänglich«, aber ich frage mich trotzdem, warum ich mitten in der Nacht jemanden zum Reden brauchen sollte.
Sie bleibt stehen und zeigt den Weg hinauf, wo die Bäume lichter werden, und ich kann eine große Rasenfläche mit einigen Booten und leeren Anhängern sehen. »Mit diesen Schuhen wirst du ein Soaker, wenn wir weitergehen.«
»Ein Soaker?«, frage ich.
Sie lacht. »Ach ja, ich habe ganz vergessen, dass das ein kanadischer Ausdruck ist. Das heißt, dass deine Schuhe nass werden. In den letzten Tagen hat es wie aus Eimern geschüttet, deshalb gleichen die Felder im Moment eher einer Seenlandschaft. Aber abgesehen vom Vermehrungslabor wirst du sowieso nicht viel dort oben sein müssen. An einem sonnigen Tag kann man auf dem Feld unterhalb der Solarfarm bei einem Bier Boccia spielen. Irgendwann wird das Wetter aufklären. Wie auch immer, alles andere dient dazu, diesen Ort am Laufen zu halten.«
Sie führt mich zurück zur Hauptlodge und erzählt mir, wie unabhängig sie dank ihrer Solaranlage, ihrer eigenen Abwasser- und Trinkwasseraufbereitungsanlagen sowie einem neuen, riesigen Gewächshaus sind, das sie als Ergänzung zu ihrem Garten gebaut haben, zusammen mit einem Hühnerstall, einer Scheune und einer Weide, auf der sie ein paar Schweine und Ziegen halten.
»Wenn du mal von Schreien geweckt wirst, sind das wahrscheinlich die Ziegen«, sagt sie lachend. Sie schaut mich über ihre Schulter hinweg an und bemerkt meinen verwirrten Gesichtsausdruck. »Weil sie laut und widerspenstig sind, nicht weil wir sie schlachten.«
Gut zu wissen.
»Was hat es mit dem Schwimmenden Labor auf sich?«, frage ich, als wir in der Nähe des Kais anhalten und den Schuppen unten am Dock betrachten. Das Wasser ist jetzt noch weiter zurückgegangen, sodass die Rampe fast senkrecht steht, trotzdem steigt mir der salzige Geruch des Meeres in die Nase.
»Darin befinden sich abgepumptes Meerwasser, Tanks und Tische, um kurzzeitig Proben aufzubewahren«, erklärt sie. »Ein paar unserer Forscher beschäftigen sich ausschließlich mit der Artenvielfalt im Meer und an der Küste und den Lebensräumen in Küstennähe. Plankton, Seesterne, Seetang. Sie beobachten, wie sich der Klimawandel auf Bakterien und Viren im Wasser auswirkt.«
Das Geräusch eines knackenden Zweigs lenkt meinen Blick hinter mich.
Ein großer Mann tritt zwischen den Bäumen hervor und geht direkt an uns vorbei den Kai hinunter. Er schaut nicht einmal in unsere Richtung, und aufgrund seines entschlossenen Blicks bin ich mir nicht sicher, ob er uns überhaupt bemerkt hat.
Ich wünschte mir, er würde es tun, wenigstens nur für eine Sekunde, denn er ist einer der faszinierendsten Männer, die ich je gesehen habe. Breitschultrig und in einen schwarzen Mantel gehüllt. Sein kurzes Haar ist von einem dunklen Rotbraun, fast wie die Farbe von Zedernrinde in der Abenddämmerung. Sein Gesicht sieht aus, als hätte es ein berühmter Künstler aus Marmor gemeißelt, und ist mit leichten Bartstoppeln übersät. Seine Wangenknochen sind markant, sein Kinn ist kräftig, und trotz der abwesenden Miene ist sein Blick kalt und intensiv, während er die neblige Bucht absucht und die steile Rampe hinuntergeht.
»Das ist Professor Kincaid«, sagt Everly leise und doch bestimmt. »Er wird zusammen mit Professor Tilden die Studien im Lernzentrum leiten.«
Ich beobachte, wie Professor Kincaid den Steg entlanggeht – sein Gang ist entschlossen und gleichzeitig anmutig. Dann steigt er auf die Yacht, die ich bei meiner Ankunft gesehen habe.
»Ist das sein Boot?«
Sie nickt. »Er wohnt darauf.«
»Mithrandir«, sage ich und erinnere mich gut an den Namen des Segelboots. Wie könnte ich den vergessen? Er muss ein Tolkien-Fan sein. »Moment mal, ist das derselbe Kincaid, der den Text auf der Website geschrieben hat?«
David hat ihn als Doktor bezeichnet. Ich wusste nicht, dass er auch unterrichten würde.
Everly sagt einen Moment lang nichts, während mein Blick ihm weiter folgt, bis er an Deck verschwindet.
»Ja. Er wird auch dein Psychologe sein«, sagt sie sachlich.
Ich blinzle, weil ich nicht sicher bin, ob ich sie richtig verstanden habe. Ich drehe mich zu ihr um. »Mein was?«
Ihre zarten taupefarbenen Augenbrauen ziehen sich zusammen, als sie mich mustert. »Kincaid wird dein Psychologe sein. Hast du deinen Lehrplan noch nicht eingesehen? Jeder Student bekommt eine wöchentliche Beratungssitzung. Im Laufe der Jahre haben wir festgestellt, dass das für die Neulinge sehr hilfreich ist. Die Isolation, nicht nur in Bezug auf den Ort, sondern auch die Abgeschiedenheit von sozialen Medien und dem Internet, kann den Studenten ziemlich zusetzen, vor allem nach einiger Zeit. Dazu kommt noch das launische Wetter hier, und schon hat man die perfekte Mischung für, nun ja, mir fällt kein besseres Wort ein: psychischen Druck. Auch wenn man nicht damit rechnet, dass das eine große Sache werden kann, aber wenn hier etwas schiefgeht, dann geht es meistens schnell bergab, und dann …« Sie verstummt, ihre Miene verdüstert sich, bevor sie die Schultern strafft und wieder zu Professor Kincaids Boot blickt. »Wie auch immer, es ist zu jedermanns Sicherheit und Wohlbefinden. Dir werden die Sitzungen gefallen. So geht es allen hier.«
»Dieser Mann ist also mein Lehrer und mein Psychologe?«
»Ja. Anfangs ist er etwas kratzbürstig, aber du wirst ihn mögen. Keine Sorge.«
Ich mache mir tatsächlich Sorgen. Er sieht zwar gut aus, aber das einzige Mal, dass ich freiwillig zu einem Facharzt gegangen bin, wurde ich mit ADHS diagnostiziert.
»Und wenn ich mich nicht daran halte?«, frage ich.
Ihr Mundwinkel zuckt nach oben. »Die Sitzungen sind obligatorisch, Sydney«, sagt sie so bestimmt, dass ich weiß, was die Alternative wäre: Ich würde mit dem ersten Flugzeug zurückgeschickt werden.
Trotzdem ist mein erster Gedanke immer, mich aufzulehnen – egal, wie gut oder schlecht es ankommt. Meine Anspannung steigt, und bin bereit zu protestieren. Erzwungene Therapiesitzungen bei einem Psychiater? Nein, danke!
Everly scheint das zu spüren. Sie dreht sich zu mir und lehnt sich ein wenig näher vor, gerade so weit, dass ich einen Hauch von Jasmin riechen kann und das Gefühl habe, in die grünen Tiefen ihrer Augen gezogen zu werden. Sie ähneln dem Moos auf den Bäumen, denke ich abwesend.
»Wir haben hier ein Sprichwort«, sagt sie leise. »Versuch nicht, die Lodge zu verändern. Lass zu, dass die Lodge dich verändert.«
Ein wirklich einprägsamer Spruch.
Aber trotzdem frage ich mich …
Was genau soll sich an mir verändern?
Als ich acht Jahre alt war, habe ich beschlossen, dass ich eine verrückte Wissenschaftlerin werden will. Nicht irgendeine, sondern eine richtig verrückte. Meine Oma hatte eine tolle Sammlung von alten Filmen auf VHS, und ich erinnere mich, dass ich die Kassetten mit dem klassischen »Frankenstein« mit Boris Karloff und Mel Brooks »Frankenstein Junior« immer und immer wieder angesehen habe, bis die Bänder ganz abgenutzt waren. Es war mir egal, dass der eine ein Horrorfilm und der andere eine Komödie war – beide haben mir klar gemacht, dass es ein lohnenswertes Ziel für mich war, selbst eine Dr. Frankenstein zu werden. Ich wollte Leben erschaffen – ich wollte mich an der Magie der wissenschaftlichen Schöpfung erfreuen, die Grenzen überschreitet und an Wahnsinn grenzt. Ich wollte so einzigartig von etwas besessen sein, dass nichts anderes um mich herum mehr eine Rolle spielt. Ich wollte meine Spuren in der Welt hinterlassen, koste es, was es wolle – selbst wenn ich dabei meinen Verstand verliere. Meine Oma hat alles gegeben, um meine Leidenschaft schon früh zu fördern. Vielleicht nicht meine geheimen Wünsche, dem Wahnsinn zu verfallen, aber zumindest den wissenschaftlichen Teil. Wir lebten von einem sehr bescheidenen Budget, das aus ihrer mageren Rente und dem Gehalt meines Vaters als Fischer bestand – okay, wir waren arm. Er war nie zu Hause, also kümmerte sie sich die meiste Zeit um mich. Sie erzählte mir oft, dass sie als junge Frau Botanikerin werden wollte, aber ihre Eltern darauf bestanden, dass sie Hausfrau werden sollte. Also wollte ich das tun, was sie nie erreichen konnte.
Sie hat mir billige Wissenschaftslehrsets aus dem Dollar-Store gekauft, mit denen man Insekten oder Blumen sammeln und beobachten konnte. Manchmal hat sie sie auch selbst gebastelt, während ich an dem beigefarbenen Linoleumtisch in unserem Wohnwagen saß. Dann beobachtete ich ihre Hände, die beinahe so knorrig waren wie die Zedernwurzeln draußen vor dem Fenster. Sie befestigte eine Lupe an einer Zange und erzählte mir, dass Wissenschaftler so ihre Feldforschungen durchführten. Ich rannte in den Wald hinter dem Trailer-Park in Crescent City und kam erst zurück, wenn der Himmel die Farbe von zerdrücktem Obst hatte und meine nackten Beine von Brombeersträuchern zerkratzt und mit Schlamm verschmiert waren.
Ich würde gern sagen, dass meine Entdeckungen langweilig und harmlos waren, aber das waren sie nicht. Ich habe nicht etwa nur so zum Spaß Schmetterlingen die Beine ausgerissen oder Ameisen unter dem Mikroskop gebraten, während ich dabei böse lachte. Meine Bemühungen waren methodisch und gut durchdacht. Ich habe Pilze, die an verrotteten Baumstümpfen wuchsen, in Scheiben geschnitten und ihre Ränder mit einem Streichholz verbrannt, um zu sehen, ob sie sich zusammenziehen oder Anzeichen von Schmerz zeigen würden. Das taten sie natürlich nicht, aber ich war einfach neugierig. Wenn meine Großmutter ihren Gemüsegarten verteidigen musste, streute ich Salz auf die Schnecken, aber eigentlich nur, um zu sehen, wie sie starben. Ich wollte keine Lebewesen quälen – alles geschah aus Neugier und im Namen der Wissenschaft.
Und aufgrund der verdammten Langeweile, die Armut mit sich brachte.
Trotzdem war mir bewusst, dass ich meiner Großmutter besser nicht davon erzählen sollte, wenn sie mich fragte, wie meine wissenschaftlichen Experimente liefen. So sehr ich auch den Begriff »verrückte Wissenschaftlerin« mochte, wusste ich doch, dass ich Ärger bekommen würde, wenn ich ihr erzählte, was ich alles tat. Klar, einem kleinen Jungen kann man kaltherzige Grausamkeit verzeihen, aber wenn ein Mädchen dasselbe tut – selbst im Namen der Forschung – gerät es in große Schwierigkeiten.
Jungs dürfen also verrückte Wissenschaftler sein. Aber Frauen? Die werden einfach nur als wahnsinnig abgestempelt. Und selbst mit acht Jahren wusste ich schon, dass es dabei einen Unterschied gibt.
Wahrscheinlich ist das der Grund, warum mir der Gedanke an obligatorische Psychositzungen so gegen den Strich geht: Weil mir schon so oft gesagt wurde, ich solle »mal einen Psychiater aufsuchen«. Nicht weil ich eine Frau bin – obwohl mir aufgefallen ist, dass Männer nie dazu aufgefordert werden, ihren Kopf untersuchen zu lassen –, sondern weil ich so lange mit einer nicht diagnostizierten ADHS zu kämpfen hatte. Ich hasste es, wie schnell ich wütend wurde, dass sich die kleinste Kritik oder Ablehnung anfühlte, als würde die Welt untergehen, dass mich an manchen Tagen – besonders während meiner Periode – die kleinste Nichtigkeit in eine Abwärtsspirale stürzen konnte. Ich wurde von mehr als ein paar Ex-Freunden (und einer Ex-Freundin, die es besser hätte wissen müssen) als »verrückt«, »durchgeknallt« und »verdammter Psycho« bezeichnet, nur weil ich meine Emotionen nicht regulieren konnte.
Als ich endlich die Diagnose bekam, war es, als hätte jemand einen Schalter in meinem Kopf umgelegt. Endlich hatte ich eine Erklärung dafür, warum ich so bin, wie ich bin. Aber obwohl immer mehr Leute in irgendeiner Form als neurodivers diagnostiziert werden, ist das Stigma immer noch da. Viele Neurotypische denken, dass die meisten von uns nur so tun, als ob – sie verstehen nicht, dass wir nicht faul sind, sondern dass es Mauern gibt, die uns daran hindern, Dinge zu tun. Sogar Dinge, die wir eigentlich tun wollen. Wenn sie uns sagen, wir sollen uns keine Sorgen machen oder es nicht persönlich nehmen, merken sie nicht, dass wir das oft gar nicht können. Und am Ende meiden sie uns, werfen uns misstrauische Blicke zu und machen abfällige Bemerkungen darüber, wie »psychisch labil« wir sind, vor allem, wenn wir zufällig weiblich sind.
Ich will nicht, dass Everly denkt, ich sei psychisch labil. Das soll auch Professor Dr. Kincaid nicht denken. Aber wenn sie die Wahrheit erfahren, wird genau das passieren. Wenn ich nicht einmal die moralischen Standards von Stanford erfülle, werde ich hier ganz sicher nicht bestehen.
Zum Glück ist David nicht aufgetaucht und hat verlangt, dass ich mit dem nächsten Wasserflugzeug zurückgeschickt werde. Everly setzte die Tour fort und führte mich zu einer kleinen Klippe mit Blick auf die Bucht, an deren Ende ein mit Zedernholzschindeln gedeckter Pavillon stand. Es war ein Ort, an dem man sich vor dem Regen verstecken und an einem Picknicktisch setzen konnte, der mit Hunderten von Initialen und Schnitzereien zerkratzt war, direkt am Madrona Beach. Heller Sand erstreckte sich am Strand, der von dem einzigartigen Erdbeerbaum überragt wurde, von dem er auch seinen Namen hatte.
»Wir nennen sie hier auch Arbutusbäume«, sagte Everly, während sie mit den Händen über die papierartige, abblätternde rote Rinde fuhr. »Aber mein Vater fand, dass der amerikanische Name Madrona besser klingt. Bevor er die Fischerhütte gekauft hat, hieß die Stiftung Johnstone Institute, doch dieser Baum hat die Namensänderung bewirkt. Normalerweise findet man diese Bäume nicht so weit nördlich auf Vancouver Island – sie wachsen eher in der Gegend um Victoria und den Gulf Islands, wo es trockener ist –, aber mein Vater meinte, dieser Baum habe etwas Besonderes an sich, genau wie dieser Ort. Und er hatte recht.«
Was ich auf dieser Tour tatsächlich geschafft habe, ist, etwa eine Million Fragen für mich zu behalten. Ich würde sie gerne nach dem Pilz fragen, den es nur hier gibt und der diesen Ort so besonders macht. Die Stiftung ist so geheimnisvoll, dass ich nicht mal weiß, wie der Pilz aussieht. Vielleicht bin ich schon daran vorbeigelaufen, ohne ihn zu erkennen, was ich allerdings bezweifle – obwohl ich unter einer Sitka-Fichte ein paar Regenbogen-Pfifferlinge entdeckt habe.
Nachdem Everly mich an den Panabode-Hütten, die für die vorübergehend anwesenden Forscher gebaut wurden, und der Nordhütte, in dem sich die Verwaltungsbüros und Unterkünfte für verschiedene Besucher befinden, vorbeigeführt hat, halten wir vor zwei Gebäuden, die durch einen Weg miteinander verbunden sind.
»Und hiermit erreichen wir das Ende unserer Tour und die beiden wichtigsten Orte«, sagt sie. Sie nickt zu dem Gebäude auf der linken Seite. »Das ist das Labor. Dort wirst du einmal pro Woche sein, wenn der Unterricht von Dr. Janet Wu stattfindet. Sie ist unsere Leiterin des Genomik-Labors.«
»Nur einmal pro Woche?«, frage ich. »Ich dachte, ich würde Tag und Nacht dort verbringen.«
Everly mustert mich einen Moment lang. »Für die meisten Studenten geht der Einstieg ins Labor langsam vonstatten«, sagt sie vorsichtig. »Wir haben dort rund um die Uhr viel Arbeit, die wir auf unsere eigene Art und Weise bewältigen. Ich weiß, dass du viel Laborerfahrung hast, vor allem mit Umwelt-DNA und deinem Projekt mit Archaeorhizomyceten, das übrigens fantastische Ergebnisse gebracht hat. Ich kann es kaum erwarten, das mit dir im Detail zu besprechen. Aber trotzdem läuft es in der Lodge etwas anders. Nichtsdestotrotz bin ich mir sicher, dass du am Ende des Sommers genauso oft dort sein wirst wie ich.«
Obwohl sie ihre Worte mit einem strahlenden Lächeln unterstreicht, bin ich ein wenig enttäuscht. Ich brauchte dieses Praktikum, um den nächsten Schritt machen zu können. Die Vorstellung, mit diesem Hintergedanken im Labor zu arbeiten, wirklich etwas bewegen und mit den Technikern und Doktoren – die wahre Genies sind – zusammenarbeiten zu können, hätte für mich bedeutet, dass ich es geschafft habe. Es reicht mir nicht, nur meinen Abschluss zu machen; ich will mehr sein als nur eine weitere Absolventin.
Dieser Ort sollte mich zu etwas Größerem machen.
Und nachdem es nun so aussieht, als würde ich in nächster Zeit keinen Abschluss machen, brauche ich das mehr denn je.
»Also, was genau werde ich hier machen?«, frage ich und versuche, die Gereiztheit nicht in meine Stimme durchdringen zu lassen. Mein Adderall läuft auf Hochtouren, um meine Gefühle im Zaum zu halten.
»Eine ganze Menge, keine Sorge«, sagt sie und zeigt auf das zweite Gebäude. »Das ist das Lernzentrum. Dort wirst du morgens Unterricht bei Professor Kincaid oder Professor Tilden haben. Nachmittags finden Expeditionen statt.«
»Expeditionen? Um noch mehr von euren Pilzen zu finden?«
»Nun, ja, das gehört auch dazu«, sagt sie vorwurfsvoll, und mir wird bewusst, dass ich zu voreilig war. »Wir haben versucht, das Exemplar im Vermehrungslabor zu züchten, aber es scheint nicht zu gedeihen. Doch die Studenten hier sind keine besseren Pilzsammler, falls du das befürchtest. Ihr sucht nach der nächsten großen Entdeckung, was auch immer das sein mag. Die Brooks-Halbinsel liegt direkt vor unserer Haustür. Ein Stück Land, das so wild und ungezähmt und unerforscht ist wie kaum ein anderes auf dieser Erde. Die Gipfel dort sind seit der letzten Eiszeit unberührt, mit einer Flora und Fauna und Pilzen, die es nirgendwo sonst gibt und die noch entdeckt werden müssen.«
»Hast du so auch deinen Pilz entdeckt?«
»Amanita excandesco«, antwortet sie.
Ich brauche einen Moment, bis ich verstehe. »Ist das der offizielle Name?«
Sie nickt, und ich übersetze die lateinischen Begriffe schnell in meinem Kopf. »Excandesco. Also leuchtet er? Er ist lumineszent?«
Jetzt wirkt ihr Lächeln nahezu schüchtern. »Das wirst du schon noch herausfinden. Wie wäre es, wenn wir dich den anderen Studenten vorstellen?« Sie legt mir leicht die Hand auf die Schulter und deutet zur Tür des Lernzentrums.
Ich bleibe wie angewurzelt stehen. Das Letzte, was ich will, ist, den anderen Studenten vorgestellt zu werden, als wäre es mein erster Tag im Kindergarten. Ich bin viel zu spät gekommen; bestimmt waren sie mit dem Unterricht schon fertig.
»Ist schon gut, Sydney«, sagt Everly. Sie drückt meine Schulter etwas fester, um mich vorwärts zu führen. »Das sind nur deine Kommilitonen. Sie beißen nicht. Obwohl es in jeder Saison einen faulen Apfel gibt, nicht wahr?«
Solange ich das nicht bin, denke ich. Ich atme tief durch. Mein Unwohlsein ist wahrscheinlich so stark wie nie zuvor, meine Handflächen sind feucht und das Herz schlägt mir bis zum Hals, aber ich darf mich nicht vor ihr blamieren. Ich werde meine Verlegenheit einfach herunterschlucken müssen.
Sie führt mich zur Tür, öffnet sie für mich und lässt mich eintreten.
Der Raum wirkt viel lockerer, als ich gedacht hatte. Ich hatte eine Art Hörsaal erwartet, aber hier ist es eher wie bei einem Meditations-Retreat. Es gibt einen Schreibtisch und ein Whiteboard, davor steht ein Mann in einem roten Flanellhemd mit einem Marker in der Hand, und sein langes blondes Haar hat er sich hinter die Ohren geklemmt. Vermutlich ist er der Professor, obwohl er eher aussieht wie ein Surfer in den Dreißigern. Der ultimative Guru.
Vor ihm sitzen die Studenten, einige an ein paar langen Tischen, andere auf riesigen Kissen auf dem harten Holzboden, der mit verschiedenen Teppichen bedeckt ist. Im Hintergrund lodern Holzscheite in einem Kamin und knistern, während sie den Raum mit Wärme erfüllen. Ich zähle schnell zehn Studenten und stelle fest, dass Amani nicht unter ihnen ist. Ich bin wohl doch nicht die Letzte.
»Ah, du musst Sydney sein«, sagt der Lehrer mit freundlicher Stimme und klatscht in die Hände. »Besser spät als nie. Ich bin Professor Tilden, aber du kannst mich einfach Nick nennen.«
Ich winke schüchtern in die Runde und lächle ihn verlegen an.
Am liebsten würde ich im Boden versinken.
»Keine Sorge«, sagt er, »ich werde dich nicht nach vorne bitten und dem Kurs drei interessante Dinge über dich erzählen lassen.«
Gott sei Dank.
Dann fügt er hinzu: »Ich werde das für dich übernehmen.«
Verflixt.
Sofort steigt mir Hitze in die Wangen. »Hallo zusammen, das ist Sydney Denik«, sagt er langsam und spricht meinen Namen aus, als wäre ich schwerhörig. »Sydney kommt von der Stanford University. Sie spielt gern Tuba. Und ihr Lieblingspilz ist der Geisterpilz.«
Schnaubend schüttle ich den Kopf.
»Was?«, fragt er. »Stimmt das etwa nicht?«
»Ich habe noch nie in meinem Leben Tuba gespielt«, sage ich und schaue mich verwirrt in der Klasse um. Ich erwarte, dass sie lachen, weil sie natürlich wissen, dass er scherzt, aber sie starren mich alle mit einem komischen Ausdruck an, als wären sie besorgt. Wahrscheinlich leiden sie unter einer schweren Art von Fremdschämen.
»Oh, ich verstehe, da habe ich wohl etwas durcheinandergebracht«, sagt Nick. »Aber Sydney hier hat die Gattung eines bisher unbekannten Dark-Fungus klassifiziert.« Er sieht mich mit hochgezogenen Augenbrauen an. »Stimmt’s?«
Ich nicke und werfe ihm einen Blick zu, der sagen soll: Würden Sie bitte die Klappe halten?
»Okay, ich hör schon auf, dich zu quälen«, sagt Nick lachend.
Everly drückt meinen Arm. »Ich muss los, aber es war schön, dir alles zeigen zu können. Bis später, Syd.«
Dann geht sie, und plötzlich fühle ich mich total verloren. Ich wünschte, Amani wäre hier, damit wenigstens jemand da wäre, den ich ein bisschen kenne.
Zum Glück zieht ein Mädchen, das am Ende des Tisches sitzt, den leeren Stuhl neben sich hervor und nickt mir freundlich zu.
Ich husche hinüber und setze mich neben sie.
»Danke«, sage ich mit möglichst leiser Stimme, während Nick etwas über die Generatorleistung der Solarfarm erzählt. Er erwähnt, dass der Strom in den Lodges ab und zu abgeschaltet wird, damit die Labore immer mit Strom versorgt werden können. Deshalb haben wir anscheinend ein ganzes Arsenal an Taschenlampen und Kerzen in unseren Zimmern.
»Ich bin Lauren«, sagt das Mädchen. Sie ist hübsch und hat lange Beine. Ihre kinnlangen blonden Haare sind ein paar Nuancen heller als die meinen.
»Sydney«, sage ich, obwohl sie das bereits weiß.
»Ja, die Tubaspielerin«, sagt sie ernst, dann grinst sie breit.
»Ja«, sage ich zögerlich. »Das war echt peinlich.«
»Ach, mach dir keine Sorgen. Das hat er mit uns allen gemacht«, sagt sie. »Einer nach dem anderen war dran. Wie am ersten Tag im Ferienlager. Was es wohl auch irgendwie ist.«
»Jetzt fühle ich mich schon etwas besser«, gebe ich zu. Lauren scheint mir sehr sympathisch zu sein. »Was habe ich noch verpasst?«
»Nur eine Führung über das Gelände«, sagt sie. »Dann sind wir hierher zurückgekommen, und seitdem erklärt er uns genauer, wie die Lodge funktioniert.«
»Ah, okay. Everly hat mir gerade alles gezeigt«, sage ich.
Als sie mir einen beeindruckten Blick zuwirft, wird mir bewusst, dass ich vielleicht etwas angeberisch rübergekommen sein könnte.
Aber dann lächelt Lauren. »Also, wenn ich die Wahl gehabt hätte, hätte ich mich auch für eine private Tour entschieden. Aber ich schätze, dafür kennst du jetzt nicht drei Dinge über jede Person in diesem Raum, oder? Zum Beispiel …« Sie zeigt auf einen Typen mit kurzgeschnittenen braunen Haaren ganz vorne. »Das ist Albert. Er ist total verrückt nach Seeigeln. Und siehst du den Japaner da drüben? Das ist Toshio, er hat mit seinem Kumpel ein Videospiel entwickelt, das von Microsoft oder so gekauft wurde. Das Mädchen mit den langen dunklen Haaren, das auf dem Kissen sitzt? Das ist Natasha, sie hat drei Möpse zu Hause und vermisst sie schon jetzt. Und der Typ am Ende des Tisches? Er heißt Munawar und meinte, er habe nur Shirts mit Pilzwitzen darauf eingepackt.«
»Hey, ich bin Munawar Khatun und komme aus Bangladesch«, sagt der Mann und winkt ihr zu, bevor er sich am anderen Ende des Tisches nach vorne lehnt. »Heute trage ich dieses Shirt. Da steht ›I’m a real fungi‹. Verstanden?«
Er zeigt auf sein Shirt.
»Außerdem hat Munawar ein echt gutes Gehör«, flüstert Lauren und beugt sich zu mir hinüber.
Darüber muss ich lachen, bevor ich meine Aufmerksamkeit wieder auf den Lehrer richte. Nick erklärt weiter, wie alles auf dem Gelände abläuft, und dass unser Müll jeden Morgen von ihrem Handwerker Keith – der nur als »Handwerker Keith« angesprochen werden darf – in eine Verbrennungsanlage geworfen wird. Außerdem erfahre ich, dass wir uns an den Wochenenden in bestimmten Bereichen frei bewegen dürfen.
»Heißt das, wir können am Wochenende Party machen?«, fragt Munawar. Seine Stimme klingt ernst, aber seine Augen funkeln.
»Das heißt, ihr könnt machen, was ihr wollt, solange es im Rahmen bleibt«, sagt Nick. »Ihr seid alle erwachsen, aber trotzdem ist und bleibt das hier Privatbesitz. Wir wollen nicht, dass ihr euch zu weit entfernt, und das nicht nur, weil es ohne offizielle Aufsicht gefährlich werden kann, sondern auch, weil das Land eines Eingeborenenstammes an unser Grundstück grenzt. Es ist verboten, ihr Reservat zu betreten, und wir wollen uns doch nicht respektlos zeigen, oder?«
Lauren hebt die Hand. »Gehört dieses Gebiet nicht eigentlich auch zu deren Land?« Ein weiterer Punkt für Lauren.
»Wir pachten das Land von der Quatsino Nation«, antwortet Nick. »Aber ja, du hast recht, Lauren. Wir leben auf ihrem Gebiet.«
»Ich würde gerne wissen, warum es ohne offiziellen Begleiter gefährlich werden kann«, sagt ein Kerl am Tisch vor mir. Seine Stimme ist mit jedem Wort immer tiefer geworden, als wollte er einschüchternd wirken, während er sich lässig in seinem Stuhl zurücklehnt. »Sie haben gerade gesagt, dass wir viel Zeit im Wald verbringen und während der Expeditionen sogar dort campen werden.«
»Hast du schon mal mit Bären zu tun gehabt? Oder Wölfen? Oder mit Roosevelt-Wapitis, die so territorial sind, dass sie dir die Eingeweide rausreißen, wenn du ihnen über den Weg läufst?«, fragt Nick, der zum ersten Mal auch nur ansatzweise streng aussieht.
Lauren schreibt etwas auf ein Blatt Papier und schiebt es mir zu: Das ist Clayton. Er ist ein Arschloch. Mehr musst du über ihn nicht wissen.