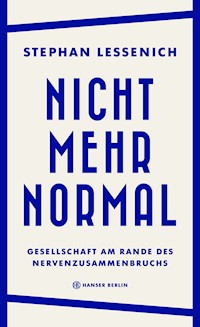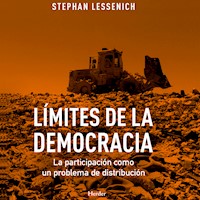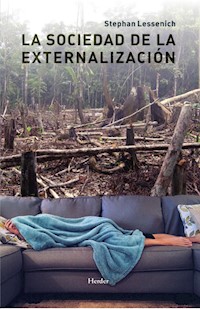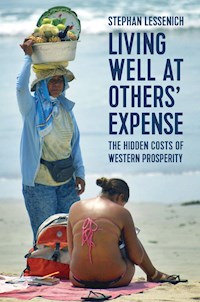6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Reclam Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Reclams Universal-Bibliothek – [Was bedeutet das alles?]
- Sprache: Deutsch
Demokratie ist ein allseits anerkannter Hochwertbegriff, möglicherweise der Hochwertbegriff der westlichen Moderne überhaupt. Aber die real existierende Demokratie ist auch ein System der Grenzziehungen – der sozialen Ausgrenzungen ebenso wie der ökologischen Entgrenzungen. Vor dem Hintergrund dieser Einsicht entwirft Stephan Lessenich Perspektiven für eine solidarische, inklusive und nachhaltige Demokratie.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 113
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Stephan Lessenich
Grenzen der Demokratie
Teilhabe als Verteilungsproblem
Reclam
Leseproben der beliebtesten Bände unserer Reihe [Was bedeutet das alles?] finden Sie hier zum kostenlosen Download.
2019 Philipp Reclam jun. Verlag GmbH, Siemensstraße 32, 71254 Ditzingen
Covergestaltung: Cornelia Feyll, Friedrich Forssman
Gesamtherstellung: Philipp Reclam jun. Verlag GmbH, Siemensstraße 32, 71254 Ditzingen
Made in Germany 2019
RECLAM ist eine eingetragene Marke der Philipp Reclam jun. GmbH & Co. KG, Stuttgart
ISBN 978-3-15-961511-0
ISBN der Buchausgabe 978-3-15-019625-0
www.reclam.de
Inhalt
1 Postdemokratie?
Demokratie – wer wäre nicht dafür? ›Demokratie‹ ist ein allseits anerkannter Hochwertbegriff, möglicherweise der Hochwertbegriff der westlichen Moderne schlechthin. Moderne Gesellschaften sind demokratische Gesellschaften: Diese schlicht anmutende Gleichung ist grundlegender Bestandteil des modernen Selbstverständnisses. Erst die fortschreitende gesellschaftliche Demokratisierung hat weitere Grundwerte wie Freiheit und Gleichheit allgemein zu realisieren erlaubt. Erst sie hat ›moderne‹ Gesellschaften tatsächlich, im Sinne ihrer historisch zeitgemäßen Verfasstheit, modern werden lassen.
Integration trotz Differenz, Einheit in der Vielfalt, Selbstbestimmung in Gemeinschaft: All diese scheinbar widersprüchlichen Leitideen moderner Vergesellschaftung sind an die ›Erfindung‹ und Existenz demokratischer Institutionen und Verfahren gebunden. Winston Churchills berühmter Ausspruch, die Demokratie sei das kleinste Übel unter den bekannten Formen politischer Regierung,1 trifft in seiner nüchternen, sich jeder idealisierenden Emphase enthaltenden Zuspitzung den Punkt gut: Es ist die Demokratie, die die ansonsten reichlich unwahrscheinliche Tatsache der sozialen Beherrschbarkeit gesellschaftlicher Komplexität überhaupt möglich macht.
Dass Demokratie, allen wiederkehrenden Kritiken an ihrer Funktionalität zum Trotz, normativ nach wie vor einen guten Stand hat, zeigt sich nicht zuletzt daran, dass kaum jemand als un- oder gar antidemokratisch gelten möchte. Nicht zufällig reklamieren selbst ausgewiesene Autokraten das Gütesiegel für sich und ihre Intentionen. Die »gelenkte Demokratie«, für die heute das Russland des »lupenreinen Demokraten« Putin steht, die aber schon Ende der 1950er Jahre vom damaligen indonesischen Präsidenten Sukarno praktiziert wurde, ist nur einer der zahlreichen Versuche von Regierenden aller Herren Länder, demokratische Prinzipien an nationale Gepflogenheiten bzw. an die vermeintlichen Eigenarten des jeweiligen ›Volkscharakters‹ anzupassen (sprich: diese aufzuweichen). Und sogar General Augusto Pinochet, der im Chile des Jahres 1973, unter tätiger Mithilfe eines der Mutterländer der Demokratie, die Volksdemokratie Salvador Allendes hinwegputschte und seither Tausende von Menschenleben auf dem Gewissen hatte, ließ es sich nicht nehmen, seine Regierungsweise quasi-demokratisch als eine »dictablanda« auszuweisen, also als ein sanftes politisches Diktat, das eigentlich der Bewahrung bzw. Wiederherstellung bürgerlicher Rechte diene.
Wenn daher die Demokratie mittlerweile auch hierzulande in Gefahr zu sein scheint, wenn gegenwärtig allenthalben von einer Krise, ja vom Niedergang und Verfall der liberalen Demokratie die Rede ist, dann müssen in der Tat die gesellschaftlichen Alarmglocken läuten – denn dann geht es ans Eingemachte, ans Herzstück der Moderne.
Politikverdrossenheit
Nun werden allfällige Erschöpfungserscheinungen der mindest-schlechten unter den Regierungsformen wahrlich nicht erst seit gestern öffentlich thematisiert. Ganz im Gegenteil: Die Debatte um die »Politikverdrossenheit« der Bürger*innen begleitet das politische Geschehen schon seit langem. In der Bundesrepublik prägte der Begriff bereits Ende der 1980er Jahre die öffentliche Meinung – also noch vor dem Einsetzen etwaiger Wiedervereinigungsenttäuschungen. 1992 erklärte ihn die Gesellschaft für deutsche Sprache zum »Wort des Jahres«, das dann nur zwei Jahre später auch Eingang in den Duden fand.
Begrifflich in einem gemeinsamen Assoziationsraum mit Gefühlen der Frustration, der Unlust und der Unzufriedenheit gelagert, verweist die Diagnose der Verdrossenheit durchaus auch auf die Nähe zu sinnverwandten, aber aggressiveren Stimmungen wie Verbitterung, Groll und Zorn. Und doch blieb der wissenschaftlich-politische Verweis auf den Verdruss der Leute an ›der Politik‹ über lange Zeit und für gewöhnlich irgendwie an der Oberfläche der Phänomene: Aus grundlegender Politik- wurde im politischen Diskurs selbst oft die personalisierbare Politikerverdrossenheit, für die jede*r ohne weiteres das passende Beispiel zu finden vermochte. Oder aber sie mutierte zum Topos der Parteienverdrossenheit, der durch den Verweis auf allgemein anschlussfähige Stereotype des Ortsvereinslebens und der ›Ochsentour‹ scheinbare Lebensnähe suggerierte und mit einem letztlich folgenlosen, augenzwinkernden Achselzucken quittiert werden konnte.
Die offenbar schon damals populäre Distanzierung vom politischen Geschehen wurde so auch lange Zeit nicht mit einer Nähe breiter Bevölkerungskreise zu populistischen Anwandlungen in Verbindung gebracht. Vielmehr galt sie als Ausweis der Wohlstandsapathie einer mit anderen Dingen, etwa Familienplanung und Konsumhandeln, beschäftigten Bevölkerung. Oder aber sie wurde der jeweils nachwachsenden ›jungen Generation‹ zugeschrieben, der die herrschenden demokratischen Verhältnisse schlicht selbstverständlich geworden seien und die daher, anders als noch ihre Eltern, politisch einfach auch einmal fünf gerade sein lasse. Die weniger harmlos anmutende Deutungsvariante hingegen blieb zumeist unausgesprochen: Dass sich nämlich hinter der fortschreitenden, an Wahlabenden nach jedem weiteren Rückgang der Wahlbeteiligung vor laufenden Kameras mit Krokodilstränen beklagten (und dann wieder ad acta gelegten) Entpolitisierung eine fundamentale, einstweilen passiv bleibende Systemkritik verbergen könnte.
Dem ist mittlerweile durchaus anders: Die öffentliche Sorge um die Demokratie geht heute tiefer. Bisweilen geht es ihr gar ums Ganze. Nicht selten werden historische Parallelen zu den 1920er Jahren und dem Scheitern der Weimarer Republik – als »Demokratie ohne Demokraten« – gezogen. Der Aufstieg der Neuen Rechten in Deutschland und Europa, die Verbreitung autoritärer Demokratien in den postsozialistischen Gesellschaften und die rechtspopulistische Regierungspolitik in Österreich und Italien, der öffentliche Auftritt selbst- und fremdernannter ›Wutbürger‹, die in den ›sozialen Medien‹ sich bahnbrechenden Eruptionen von Verachtung und Hass, die letztlich leerlaufende transmediale Aufregungsmaschinerie, die Unversöhnlichkeit des Umgangstons in der politischen Debatte, schließlich die bis hinein ins Private vordringende Dynamik des Kommunikationsabbruchs zwischen unvereinbar erscheinenden Meinungen: All das erinnert auch (und vielleicht gerade) den, der oder die politisch unruhige Zeiten allenfalls vom Hörensagen kennt, auf unheimliche Weise an ›früher‹.
»Postdemokratie«
In gewisser Weise hat der britische Politikwissenschaftler und Soziologe Colin Crouch quasi das Buch zu dem Film geschrieben, der vor dem geistigen Auge der um die Nachkriegsdemokratie Fürchtenden abläuft. Mit Post-Democracy, erstmals 2004 und vier Jahre später auch in deutscher Übersetzung erschienen,2 hat Crouch ganz offensichtlich den Nerv der Zeit getroffen – und einen Begriff gesetzt, der nicht nur eine Flut wissenschaftlicher Folgeliteratur ausgelöst hat, sondern zur gängigen Münze auch in der politisch-medialen Debatte geworden ist. Wo heute zwei oder drei versammelt sind im Namen demokratischer Besorgnis, da ist Crouchs »Postdemokratie« nicht weit.
Als letztlich überlebt bezeichnet Crouch die real existierende Demokratie unserer Tage, weil sich hinter der Fassade einer funktionierenden demokratischen Ordnung – mit allem, was dazu gehört: Gewaltenteilung, Regierungswechsel, Parlamentsvorbehalt – faktisch eine schleichende Aushöhlung und Entwertung politischer Meinungsbildungs- und Entscheidungsprozesse vollziehe. Der entscheidende Grund dafür sei die zunehmend ungezügelte Dominanz ökonomischer Interessen, die sich auf mindestens zweifache Weise äußere: Zum einen in Form eines allein der oberflächlichen Aufmerksamkeitsproduktion dienenden medienindustriellen Komplexes; zum anderen in Gestalt einer Heerschar von unter Ausschluss der Öffentlichkeit auf den Hinterbühnen der Politik operierenden Wirtschaftslobbyisten. Die ›eigentlichen‹ Entscheidungen, so die Essenz des Arguments, fällen nicht die von den Bürger*innen gewählten demokratischen Repräsentanten, sondern mächtige Interessenvertreter*innen mit direktem Zugang zu Amtsinhabern und Administratoren, Expertengremien und Regulierungsbehörden. Dieser Sachverhalt werde dem Publikum durch ein politisches Schauspiel verhüllt, in dem es kaum mehr um Substanzielles, sondern ganz überwiegend um ›Menschliches, allzu Menschliches‹ geht: um lukrative Posten und reichweitenerweiternde Posts statt um inhaltliche Positionen, um das Ringen um die größte Aufmerksamkeit statt um die besten Lösungen. In einem Wort: Nicht um Politik, sondern um Politainment.
Jenseits des Wahrheitsgehalts dieser Analyse – und der Anschlussfähigkeit des Konzepts für kritisch-progressive ebenso wie für antidemokratisch-verschwörungstheoretische Ausdeutungen – ist hier vor allen Dingen von Interesse, vor welchem Gegenhorizont Crouchs Bild von postdemokratischen Verhältnissen seine bedrohlich-düstere Wirkung entfaltet. Als das Andere der postdemokratischen Gegenwart konstruiert er nämlich eine noch nicht allzu ferne Vergangenheit, in der vielleicht nicht alles besser, in jedem Fall aber die Welt der Demokratie noch in Ordnung war. Crouch selbst kondensiert seine Erzählung von Aufstieg und Fall der Demokratie in den westlichen Industriegesellschaften in der Figur einer Parabel: Während diese über Jahrzehnte hinweg beständig mehr Demokratie gewagt hätten, stellten die 1970er Jahre einen historischen Wendepunkt dar, seit dem die demokratische Qualität der politischen Gemeinwesen Westeuropas und Nordamerikas im steten Sinkflug begriffen sei.
Als Gegenbild der Postdemokratie dient somit der Rückblick auf ein vergangenes, ›goldenes Zeitalter‹, in dem – so heißt es – eine breite, ja tendenziell gesellschaftsweite demokratische Partizipation nachhaltig gewährleistet gewesen sei. Es war dies die Zeit der Volksparteien- und Großgruppendemokratie, eine Zeit, in der nicht nur die Wahlbeteiligung hoch war und die Wählerstimmen sich auf die politischen Repräsentant*innen der bürgerlichen und lohnabhängigen Milieus der ›Mitte‹ – auf Christ- und Sozialdemokratie, Tories und Labour – konzentrierten, sondern in der zudem Kapital und Arbeit hochgradig, im Zweifel zentral organisiert waren und als solchermaßen organisierte Interessen an demokratischen Aushandlungsprozessen mitwirkten – und zwar nicht nur im Binnenverhältnis, also mit Blick auf die sozialpartnerschaftliche Gestaltung von Produktions- und Arbeitsbedingungen, sondern, weit darüberhinausgehend, auch im Dreiecksverhältnis mit staatlichen Instanzen, die wichtige politische Vorhaben in Rücksprache und möglichst im Einvernehmen mit den maßgeblichen gesellschaftlichen Interessenorganisationen angingen – also in der »korporatistischen« Koordination mit Gewerkschaften und Arbeitgeberverbänden.
Nach allem, was man weiß, ist dieses Narrativ vom kurzen Sommer der Demokratie, hier nur leicht überstilisiert wiedergegeben, in seinem Realitätsgehalt durchaus fragwürdig. Nicht, dass es völlig aus der Luft gegriffen wäre – keineswegs. Doch in seiner Überhöhung der effektiven Beteiligung und Teilhabe des ›produktiven Kerns‹ der industriellen Nachkriegsgesellschaft an den Schaltstellen und Segnungen der korporatistischen Demokratie blendet es zumindest wesentliche Teile der sozialen Realität dieser Gesellschaft aus: Die demokratische Schattenexistenz von Frauen, Migrant*innen oder Nicht-Erwerbstätigen kommt in den retrospektiven Mystifizierungen der ›guten alten Zeit‹ – wenn überhaupt – nur am Rande vor. Selbst eindrückliche Studien, die das sozialstrukturelle Wahlbeteiligungsgefälle zwischen sozial privilegierten und benachteiligten Milieus dokumentieren, legen häufig nahe, dass der faktische Ausschluss der ärmeren Schichten von politischer Partizipation erst mit dem Siegeszug des ›Neoliberalismus‹ eingesetzt habe.3
Vor allem aber hat das befremdliche Idealisieren des Korporatismus, das sich – so ein empirisch nicht systematisch überprüfter Eindruck – gehäuft im Schrifttum älterer, männlicher, sozialdemokratiezugewandter Sozialwissenschaftler findet, auch Konsequenzen, was die Frage wünschenswerter Repolitisierungs- und Demokratisierungsprozesse betrifft. Im Lichte der bedrückenden Gegenwart erscheint eine bessere Zukunft dann gleichsam als Verlängerung der Vergangenheit. Die Wiederherstellung der industriekapitalistischen Konstellation des Nationalkeynesianismus wird zum demokratiepolitischen Rettungsschirm, denn die »imaginierte Demokratie nach der Postdemokratie ähnelt in vielem der in den 1980er-Jahren verlorenen korporativen Demokratie.«4
Die Dialektik der Demokratie
Gegen eine solche demokratiehistorische Weiß-Schwarz-Malerei gilt es, analytisch mehr Uneindeutigkeit zu wagen. Genau dieses Ziel verfolgt das vorliegende Buch: Gegen eine zunehmend verbreitete Demokratiemelancholie, in deren schummerigem Licht die euroatlantische Nachkriegszeit als das Höchste der demokratischen Gefühle glänzt, soll hier argumentiert werden, dass Demokratie ein zweischneidiges Schwert ist – und immer schon gewesen ist. Denn demokratisch verfasste politische Gemeinwesen ziehen dem sozialen Raum der Berechtigung grundsätzlich Grenzen. Der gesellschaftshistorischen Bewegung hin zu ›mehr Demokratie‹ ist zugleich eine Gegenbewegung eingelagert, eine gegenläufige Bewegung der Begrenzung und Beschränkung demokratischer Teilhabe. Diesen Sachverhalt bezeichne ich als Dialektik der Demokratie. Während Crouchs Parabel eine Generaltendenz zunächst der Zu-, sodann der Abnahme von Demokratie unterstellt, erscheint bei genauerem Hinsehen die Vorstellung einer Spiralform demokratischer Entwicklung realistischer: Das demokratische Berechtigungsniveau wird nach und nach höhergeschraubt – doch auf ihrem scheinbar kollektiven Weg nach oben lässt die Demokratie immer wieder auch ganze Kollektive zurück.
Wie kaum eine zweite ist die moderne Demokratiegeschichtsschreibung eine Erzählung der Sieger. Die Zukurzgekommenen der Demokratie, die auf der Berechtigungsstrecke Gebliebenen, sind ihr für gewöhnlich nicht der Rede wert. Die gängige Rekonstruktion von Deutschlands Weg nach Westen mag beispielhaft dafür stehen: Vom autoritären, aber doch auch protodemokratischen Kaiserreich über die erste, von Anbeginn unter einem schlechten Stern stehende Demokratie auf deutschem Boden zog der Treck, kurzfristig aufgehalten durch die Schergen des Naziregimes und zeitweilig begleitet durch den Unrechtsstaat der SED-Diktatur, über die kriegsgeläuterte und europapolitisch eingehegte Bonner hin zur wiedervereinigten, selbstbewussten Berliner Republik, in der die deutsche Demokratie endlich zu sich kommt. Wenn da nur nicht noch einige ewiggestrige DDR-Nostalgiker*innen im Osten verblieben wären. Wenn dieser Höhepunkt der Demokratiegeschichte nicht unseligerweise mit dem einsetzenden Siegeszug des Neoliberalismus zusammengefallen wäre. Und wenn die vom neuen Marktradikalismus Geschädigten sich nicht zunehmend als von der real existierenden Demokratie enttäuschte, wiedergestrige Rechtspopulist*innen entpuppen würden.
So könnte man es sehen. Zugegeben: So einseitig-holzschnittartig sehen es die wenigsten. Doch moderne Demokratiegeschichte als die Geschichte vom langen, unruhigen Fluss zu erzählen, der sich seit ungefähr den 1970er Jahren in einer weiten Schleife wieder in die Gegenrichtung zu bewegen scheint: Das ist doch durchaus und im wahrsten Sinne des Wortes narrativer Mainstream. Die hier zu präsentierende Gegenerzählung richtet ihren Blick hingegen auf diejenigen, die von diesem langen Strom schon vor dessen vermeintlicher Umkehr nicht erfasst wurden, die an den Stromschnellen demokratischer Entwicklung ans Ufer gespült wurden und dort zurückblieben. Die Hinterbliebenen des demokratischen Fortschritts: Das sind, wenn man in einer solch pathoslastigen Bilderwelt bleiben möchte, die Held*innen dieser Gegenerzählung.
Damit ist mehr angesprochen als die in der historischen Soziologie vielfach – und fraglos zu Recht – thematisierte »Ambivalenz der Moderne«, mehr als nur ihre Doppeldeutigkeit, mehr als die Koexistenz von Modernem und Vormodernem, als die Gleichzeitigkeit von Freiheit und Zwang. Vielmehr geht es um die innere Verbundenheit des Gegenteiligen, um die Gleichursprünglichkeit des Entgegengesetzten – um den strukturellen Zusammenhang zwischen Ausdehnung und Begrenzung der Demokratie, um das dynamische Zusammenspiel von Prozessen der Berechtigung und Nicht-Berechtigung oder gar Entrechtung. Es geht, genauer noch, um Freiheit und Zwang, Berechtigung und Entrechtung, Teilhabe und Ausschluss als soziale Verteilungsfragen: Es geht darum, dass in der Geschichte der modernen Demokratie die Freiheiten der einen regelmäßig die Zwänge der anderen waren, dass die Berechtigung der einen auf der Entrechtung anderer beruhte. Oder um es auf eine Kurzformel zu bringen: Die Geschichte der Demokratisierung ist eine Geschichte von Teilhabe durch Ausschluss. Und zwar bis auf den heutigen Tag.