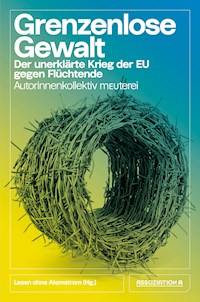
Grenzenlose Gewalt E-Book
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Assoziation A
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Die Europäische Union hat, zehn Jahre nachdem dem Staatenbund für den »erfolgreichen Kampf für Frieden und Menschenrechte« der Friedensnobelpreis verliehen wurde, mit seinem brutalen Vorgehen gegen schutzsuchende Menschen auf der Flucht die tödlichste Grenze der Welt geschaffen, das Mittelmeer zum Massengrab gemacht. Es ist die Aufkündigung der vielbeschworenen »europäischen Werte«, die zivilisatorische Kapitulation vor einer der zentralen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts, in dem so viele Menschen wie nie zuvor auf der Flucht sind – vor Krieg, Verfolgung, Hunger und Klimawandel. Das Buch des Autorinnenkollektivs »mEUterei« bilanziert minutiös die Systematik der tagtäglichen Verbrechen gegen die Menschlichkeit, orchestriert von Brüsseler Schreibtischen aus und exekutiert von hochgerüsteten Grenzwächtern. So gerät es zur Anklageschrift gegen die Friedensnobelpreisträgerin EU.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 516
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
GrenzenloseGewalt
Der unerklärte Krieg der EUgegen Flüchtende
Autorinnenkollektiv mEUterei
Herausgegeben von Lesen ohne Atomstrom
Dieses Buch wird gefördert im Rahmen des Stipendienprogramms der VG Wort in »Neustart Kultur« der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien.
© Berlin, Hamburg 2022
Assoziation A, Gneisenaustraße 2a, 10961 Berlin
www.assoziation-a.de, [email protected], [email protected]
Gestaltung: Andreas Homann
Foto Buchcover: iStockphoto/phanasitti
eISBN 978-3-86241-638-7
Danksagung
Unser Dank gilt allen Aktivist*innen und solidarischen Bewegungen, die Menschen auf der Flucht unterstützen und gegen das brutale Regime der Abschottung kämpfen, sowie allen Menschenrechtler*innen, Journalist*innen, Jurist*innen und Wissenschaftler*innen, die die Verbrechen entlang der europäischen Grenzen aufdecken und dokumentieren. Unsere Bewunderung und unser tiefster Respekt gebühren denen, die trotz aller Widerstände auf ihrem Recht auf Bewegungsfreiheit und auf ein sicheres Leben bestehen.
Zum Autorinnenkollektiv »mEUterei«
»Grenzenlose Gewalt« ist ein Gemeinschaftswerk der »mEUterei«, eines Kollektivs von Expertinnen, die sich seit Jahren gegen das europäische Grenzregime engagieren. Die mEUterei besteht aus Aktivistinnen, Fluchthelferinnen, Juristinnen, Migrations- und Politikwissenschaftlerinnen. Mitglieder des Teams sind u.a. Marlene Auer, Eliza Fröhlich, Natalie Gruber, Hela Kanakane, Lea Reisner und Julia Winkler. Sie sind in verschiedenen Organisationen und politischen Gruppen aktiv: Alarm Phone, borderline-europe, Border Violence Monitoring Network, Iuventa-Crew, Joosor und Safe Passage Foundation.
Das Kollektiv setzt sich aktuell überwiegend aus weißen cis Frauen zusammen. Diese Positionierung zu benennen, erscheint uns aus einer machtkritischen Perspektive relevant. Wir selbst sind Teil der Gesellschaften, die zur Errichtung der Festung Europa geführt haben und diese aufrechterhalten. Wir sind uns unserer Privilegien bewusst und können offen Kritik an den bestehenden kapitalistischen, rassistischen und (neo-)kolonialen Machtsystemen üben, ohne dafür nennenswerte Nachteile, Bedrohungen oder gar Schlimmeres befürchten zu müssen. Während des Entstehungsprozesses dieses Buches haben wir – auch mithilfe befreundeter Antirassismus-Aktivist*innen – versucht, diese Privilegien zu reflektieren und unsere Perspektiven sowie Sprache dafür zu sensibilisieren. Als elementare Konsequenz dieser Privilegien sehen wir uns in einer besonderen Verantwortung, die Festung Europa zu kritisieren und zu bekämpfen, wo immer möglich.
Inhalt
Vergogna — Schande:Gegen die Verschwörung des Schweigens!
Vorwort: Lesen ohne Atomstrom
Grenzenlose Gewalt
Einleitung
Wie man eine Festung baut
Mauern statt Brücken — von der Gründung der EU bis heute
Frontex — Türsteher der EU
Europas Außengrenzen — Systematische Abschottung und Gewalt
Zentrales Mittelmeer
Libyen
Tunesien
Frontex im zentralen Mittelmeer
»Ich überlasse euch dem Tod auf dem Wasser«
Westliches Mittelmeer und Kanaren
Westliche Mittelmeerroute
Jumping the fence — die Exklaven Ceuta und Melilla
(Alb-)Traumziel Kanaren
Frontex im westlichen Mittelmeer und im Atlantik
»›Da ist ein Baby im Boot!‹ — Sie haben nichts unternommen«
Östliches Mittelmeer
Zypern
Griechenland
Das EU-Türkei-Abkommen
Gewalt an den griechischen Grenzen
Willkommen in Europa – (administrative) Gewalt statt Rechte
»You have more money?«
Balkan und östliche EU
2015 und danach — Wellen europäischer Gewalt
Menschenrechtsverletzungen im Namen der »Grenzsicherung«
Frontex im Balkan
Kein Schutz, keine Zukunft — Gewalt durch menschenunwürdige Lebensbedingungen
Flucht nach und über Polen, Lettland und Litauen
Europäische Grenzen fernab der EU
Wo und wie Grenzen weiter wandern dürfen als Menschen
Niger — Europas tödliche Grenzziehungen in der Sahara
Kriminalisierung von Flüchtenden
Flucht als Verbrechen
Systematische Entrechtung und Unterdrückung
Kriminalisierung von Migration
Behinderung von Fluchthilfe
Das »Schleuser-Paket« — Rechtliche Grundlage für breitflächige Kriminalisierung
Diskreditierung im öffentlichen Diskurs
Bürokratische Schikanen und Blockaden
Einschüchterung durch Polizei und Sicherheitsbehörden
Strafverfolgung und Verurteilungen
Drastische Auswirkungen auf Grund- und Menschenrechte
Wo Unrecht zu Recht wird — Asylverfahren in der EU
Kein Zugang zu Asylverfahren
Kein Zugang zu Rechtsberatung und Information
Fehlerhafte Verfahren
Menschenunwürdige Aufnahmebedingungen
Willkürliche Schutzgewährung und Verfahrensgestaltung
Asyl als leere Hülle
Gute Aussichten? — Panorama der Gewalt
»Alles ist möglich! Auch sterben«
Wo soll die Reise hingehen? Und für wen?
Aus Verantwortung vor der Geschichte — Ein neuer Pakt für Europa
Epilog: Donatella Di Cesare
Anhang
Abkürzungsverzeichnis
Anmerkungen
Vergogna — Schande: Gegen die Verschwörung des Schweigens!
Vorwort: Lesen ohne AtomstromAndreas Blechschmidt, Oliver Neß, Frank Otto
Die Europäische Union feiert gern, gern auch sich selbst. Wie am 10. Dezember 2012, als der Staatenverbund in Oslo für seine Verdienste um »die Förderung von Frieden und Versöhnung, Demokratie und Menschenrechten« mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet wurde. In Brüssel beschwor man »Stolz« und »Ehre«, sah sich dekoriert als »größter Friedensstifter der Geschichte«. Beate Gminder, damals eineinhalb Jahrzehnte in EU-Diensten, wusste gar: »Ich habe den Friedensnobelpreis bekommen! Es hat verdammt gut getan, mal einen Abend lang gefeiert und nicht nur kritisiert zu werden.«
Ähnliches ist von der schwäbischen Karrierebeamtin auch am 18. September 2021 zu hören – dieses Mal am südöstlichsten Zipfel des Kontinents, auf der Agäis-Insel Samos. Feierlich hisst Beate Gminder an diesem sonnigen Spätsommertag die blau-gelbe EU-Fahne – vor ihrem Werk, das sie ein Jahr lang ersonnen hat. Im Auftrag von ganz oben, wie die eloquente Mittfünzigerin zuvor lässig berichtet hatte: »Direkt nach dem Feuer, das das Lager auf Lesbos zerstörte, hat die Frau Präsidentin von der Leyen gesagt ›Ich kann’s nicht mehr sehen. Warum kriegen wir diese Lager nicht unter Kontrolle?‹ Sie hat dann die Task Force ins Leben gerufen – und mich mit der Leitung betraut.« Seither ist Beate Gminder Deputy Director-General in Charge of the Task Force Migration Management, als solche Erfinderin des Closed Controlled Access Center of Samos – einer Siedlung Dutzender Container, in die Tausende Männer, Frauen und Kinder gepfercht werden. Umgeben von meterhohem Zaun, zweireihig, oben drauf blanker Draht mit Widerhaken, in regelmäßigen Abständen unterbrochen von Wachtürmen. Uniformierte patrouillieren rund um die Uhr, im Lager und drumrum.
Regelmäßig aufsteigende Drohnen überwachen das Camp bis in den hintersten Winkel, zur Perfektionierung der von »Frau Präsidentin« bestellten »Kontrolle«. Die fliegenden Kameras übertragen den deprimierenden Alltag der Insassen live in eine Kommandozentrale im fernen Athen: »Hier sind die Voraussetzungen für eine würdevolle Aufnahme von Migranten gegeben«, jubelt Beate Gminder am 18. September auf dem eigens planierten Felsplateau von Samos. Die nächsten Orte – das Dorf Chora, die historische Inselhauptstadt, und das heutige Zentrum Vathy – liegen eine Stunde Fußweg entfernt. Die dortigen Bewohner*innen sprechen von ihrer so charmanten Insel bereits als »Guantánamo«.
Der 10. Dezember 2012 war zweifelsohne eine historische Zäsur. Der 18. September 2021 ist es ebenso: Seither ist die Käfighaltung von flüchtenden Menschen offizielle Praxis der EU. Das Einsperren von Frauen, Kindern und Männern, die sich keines Vergehens strafbar gemacht haben. Einzig: Sie haben um Schutz nachgefragt. Bis dato hatte man es jahrelang mit systematischer Verelendung versucht, indem die Zigtausenden, die nach monatelanger Odyssee entkräftet auf den griechischen Inseln in Sichtweite der türkischen Küste anlandeten, weitgehend sich selbst überlassen waren, während man sie mit allen Mitteln an der Weiterfahrt aufs europäische Festland hinderte. Die Washington Post verortete so in der Ägäis »den Ground Zero der ungelösten Flüchtlingskrise Europas«. Künstler Ai Weiwei erkannte vor Ort »eine Art Verlängerung des Krieges«.
Es ist der Krieg einer Friedensnobelpreisträgerin. Orchestriert von »finsteren Brüsseler Bürokraten, die auf Abschreckung hoffen«, so UN-Diplomat Jean Ziegler. Dieses Ziel wird allerdings regelmäßig verfehlt: mit den vormaligen Elendsquartieren ebenso wie mit den neuen Käfigen aus deutscher Lagerexpertise. Die Menschen kommen weiter, auch nach Samos. Und es werden immer mehr, dies vorherzusehen braucht es keiner prophetischen Gabe. Schon jetzt sind so viele Kinder, Frauen und Männer auf der Flucht wie nie zuvor in der Menschheitsgeschichte. An die hundert Millionen. Von Krieg, Verfolgung, Armut oder Klimawandel dazu verdammt. Die – auch von EU-Staaten – in aller Welt finanzierten oder geführten Kriege wie zunehmend auch der aufgeheizte Planet machen immer weitere Landstriche unbewohnbar. Hunderttausende in Ostafrika flüchten vor Klimaverheerungen, die maßgeblich wir ihnen eingebrockt haben: mit unserem grotesken Lebensstandard, mit dem wir Europäer*innen jede*r neun Tonnen CO2 pro Jahr emittieren. Eine Einwohnerin Burundis kommt gerade mal auf 0,03 Tonnen. In Burundi allerdings kann der Homo Sapiens ob Hitze, Dürren und Sintfluten heute kaum mehr existieren. Ähnlich verhält es sich im Südsudan, Äthiopien, Mali, Teilen Kenias, auf Madagaskar, auch in Südostasien oder im Jemen. Überall dort bleibt kaum noch etwas anderes als zu fliehen. Und nicht nur von dort: Auch Enele Sopoaga, der ehemalige Präsident des Südseestaates Tuvalu, das in Folge des Meeresspiegelanstiegs dem Untergang, eher früher als später, geweiht ist, benennt die Verantwortlichkeiten: »Wir müssen unsere Heimat verlassen, weil man anderswo in der Welt nicht solidarisch mit uns ist.« Dies sind lediglich einige beispielhafte Schauplätze für eine der zentralen Herausforderungen für die Weltgemeinschaft des 21. Jahrhunderts: Migration.
Derzeit werden 90 Prozent der Flüchtenden in den Ländern des Globalen Südens aufgenommen, während sich die »Friedensnobelpreisträgerin« im Norden verschanzt, wozu auch das Closed Controlled Access Center of Samos dienen soll. Nach diesem Vorbild lässt Ursula von der Leyen ebenfalls auf den Nachbarinseln von Samos mit Hochdruck bauen, um Zehntausende internieren zu können. Dafür hat die EU-Chefin mehr als eine Viertelmilliarde Euro bereitgestellt, derweil sie unverdrossen behauptet, »keine Finanzierung von Stacheldraht und Mauern« zu ermöglichen. Ein weiterer eindrucksvoller Beleg für die Wertung des Economist, in Brüssel habe längst »Bullshit das Sagen«. Mit diesem Kraftausdruck zitierte das Blatt den US-Philosophen Harry G. Frankfurt, um die beharrliche Negation von Wirklichkeit zu beschreiben.
Wenn es darum geht, die Flüchtenden und Gehetzten zu misshandeln, ist offenkundig das australische Modell Vorbild für die EU: Down Under werden Flüchtende seit Jahren bereits nicht mehr aufs Festland gelassen. Stattdessen kommen sie direkt in Internierungslager auf weit abgelegenen Pazifikinseln. Der preisgekrönte kurdische Schriftsteller Behrouz Boochani wurde hier jahrelang gefangen gehalten, von einer »Gefängnisindustrie, die darauf abzielt, Menschen ihre Identität zu nehmen, ihre Moral zu brechen«, wie Boochani als Gast des Hamburger Literaturfestivals »Lesen ohne Atomstrom« sagte. Dies bestätigt der Kölner Pfarrer Hans Mörtter auch für Samos, nachdem er sich am Tag nach Beate Gminders Fahnenappell ins neue Closed Controlled Center geschmuggelt hatte. »Es ist der Wahnsinn«, bemerkte er beim Verlassen des Containergeheges konsterniert. »Die Menschen sollen die Botschaft nach Hause schicken: Hier ist die Hölle, kommt bloß nicht.« Was aber nicht funktioniere: »Denn zu Hause ist die Hölle noch größer«, weiß Mörtter. Eine Studie des konservativen Kieler Instituts für Weltwirtschaft bestätigt ihn: Ein liberaler, rechtskonformer Umgang mit Migrant*innen würde ausdrücklich nicht für die viel beschworenen »Pull-Effekte« sorgen.
Wie zum Beweis landen noch während Beate Gminder am 18. September 2021 ihr Geflüchtetencamp am Berg feierlich einweiht unten an der Küste von Samos wieder zwei Schlauchboote an, wie Einheimische berichten. Zwei Somalier und eine syrische Familie, alle am Ende ihrer Kräfte, so die Augenzeugen. In der Flüchtlingsstatistik tauchen die Gestrandeten später wie so viele andere nicht auf. EU-Grenzwächter verfrachten sie umgehend auf eine aufblasbare Insel – und schleppen diese wieder aufs Meer hinaus, wo man die Verzweifelten sich selbst überlässt. Derlei rechtswidrige Pushbacks sind längst Alltag, an allen EU-Außengrenzen. In Polen und Litauen, in Kroatien oder Spanien. Das Anti-Folter-Komitee des Europarats diagnostiziert »einen gut etablierten rechtswidrigen Modus Operandi im Umgang mit Migranten«.
Denn die Ankömmlinge auf Samos – und anderswo in der Ägäis – darf es seit 2016 gar nicht mehr geben. Dafür hat seinerzeit Gerald Knaus, sogenannter Politikberater, das EU-Türkei-Abkommen erdacht. Er folgte dabei einer simplen Logik, die in Brüssel und Berlin schnell zu überzeugen vermochte: Wenn die Türkei, bekannt für ihre polizeistaatlichen Fähigkeiten, viel Geld dafür bekommt, die Flüchtenden an den türkischen Ägäis-Stränden von der Überfahrt auf die nahen griechischen Inseln abzuhalten, gibt’s keine Flüchtenden mehr. Für die EU. Die deutsche »Wir schaffen das«-Kanzlerin und die EU-Regent*innen waren höchst angetan von Knaus’ profanem Konzept – und sechs Milliarden Euro überzeugten Türkeis Präsidenten Erdoğan rasch, als Türsteher für die EU anzuheuern. Der Knaus-Plan ist so einfach wie skrupellos, dass deutsche Medien seinen Erfinder seither auf allen Kanälen als »Migrationsexperten« feiern. Knaus firmiert dabei als »Leiter« oder »Chairman« einer Organisation mit dem hochtrabenden Namen »Europäische Stabilitätsinitiative«, was in Wahrheit ein kleiner, beim Amtsgericht Berlin-Charlottenburg eingetragener deutscher Verein ist. Für die Presse gilt er unhinterfragt als Thinktank. Dessen »Staff« – nach eigenen Angaben gut ein Dutzend »Analysten« – dürfte bei dem, ebenfalls nach eigenen Angaben, Jahresetat von gerade mal einer halben Million Euro kaum deutschen Mindestlohn erhalten. Was hingegen zählt, ist, dass Knaus mit seinem Kleinverein Zugang zum Kanzleramt hat. Das macht Kohle in Brüssel locker. Erdoğan hält seither die Hand auf – und will immer mehr davon, wenn er der EU weiter Flüchtende vom Hals halten soll, während man in Brüssel unablässig klagt, »erpresst« zu werden. Knaus’ brutales Konzept wurde derweil zur Blaupause für andere Außengrenzen: In Libyen finanziert die EU nun in Ermangelung eines schlagkräftigen Staatschefs der Einfachheit halber Warlords, die als sogenannte »Libysche Küstenwache« Jagd auf Flüchtende machen, sobald sie die waghalsige Überfahrt von Tripolis’ Küste gen Norden versuchen. Die Gräuel der von Brüssel alimentierten Paramilitärs sind zahlreich dokumentiert. Völkerrecht war gestern, Flüchtlingskonvention vorgestern.
Diese tagtäglichen Verbrechen gegen die Menschlichkeit haben dramatische Folgen: Dem Psychologen Jan Ilhan Kizilhan zufolge gilt jede*r dritte in Europa Asylsuchende als »klinisch traumatisiert«. Wenn sie das Zusammentreffen mit den EU-Grenzkriegern denn überleben. Mohamed Gulzar aus Pakistan hat den Versuch, mit seiner Frau in der EU Asyl zu beantragen, mit dem Leben bezahlt. Er wurde an der griechisch-türkischen Festlandsgrenze am 4. März 2020 erschossen, von hinten in den Rücken. Anlass für »die Frau Präsidentin«, umgehend an den Grenzabschnitt zu eilen, um die Täter zu belobigen: »Wir werden die Stellung halten.« Bejubelt von der Propaganda an der Heimatfront: Für den »Spiegel« sind »Zäune kein Widerspruch zu einer humanen Einwanderungspolitik, sie schaffen die Voraussetzungen dafür«. Die »Welt« weiß: »Grenzschutz ist hart – aber er muss sein.«
Demgegenüber hatten tatsächliche Migrationsexpert*innen das von Gerald Knaus den Berliner und Brüsseler Regent*innen eingeflüsterte »Outsourcing der EU-Asylpolitik« umgehend als »Ausverkauf humanitärer Werte« eingeordnet und eindringlich gewarnt. Die französische »Libération« erkannte sofort: »Für die Achtundzwanzig ist das Asylrecht tot.« Genau das bestätigen heute führende Repräsentant*innen ganz unverhohlen. Für Dänemarks Regierungschefin, die Sozialdemokratin Mette Frederiksen, ist das »Ziel, dass niemand mehr in Dänemark Asyl nachfragt«. Erfrischend ehrlich. Genau darum geht’s offenkundig auch Kommissionspräsidentin von der Leyen, die sich von den versammelten Rechtsradikalen im Europaparlament ins Amt hat wählen lassen – und für die nun liefert. Mit Hilfe ihrer dienstbaren Geister, den Gminders und Knaus. Letzterer hat weiter Konjunktur als vermeintlich seriöser Migrationserklärer: »Der Grundkonsens rund um die Menschenwürde ist nicht zusammengebrochen, der hat die Krise überlebt«, fabuliert der »Experte« weiter in alle Mikrofone, die ihm willig hingehalten werden. Auch dies ist »Bullshit«, schamloser Zynismus angesichts des Massengrabs Mittelmeer und der Verweigerung für inzwischen Hunderttausende, in der EU überhaupt einen Antrag auf Asyl stellen zu können. Und angesichts der neuen Internierungslager für jene, die es noch lebend an unsere Strände schaffen. Wenn Knaus und Gminder von »Abschiebungsrealismus«, einer »humanen Form der Kontrolle« und vom »neuen Kapitel im Migrationsmanagement« schwadronieren, offenbart sich darin ein neuer Typus des Schreibtischtätertums.
Gminder und Knaus sind furchtbare Technokrat*innen. Zwei von vielen, die Behrouz Boochani »Komplizen der systematischen Folter« nennt. Das unerbittliche Grenzregime der EU komplettieren schließlich Europas furchtbare Jurist*innen. Sie sorgen dafür, dass jene, die nicht umgehend wieder in Nacht- und Nebelaktionen zurückgepusht wurden, von der Friedensnobelpreisträgerin EU als Erstes ein Gefängnis von innen sehen: wie die zwei Afghanen Ayoubi Nadir und Hasan Eftekhari, die unmittelbar nach Ankunft im November 2020 auf Samos verhaftet wurden. Hasan hatte das Schlauchboot gesteuert, das am späten Abend vom türkischen Strand nach Samos abgelegt hatte. Als der Schlepper abgehauen war, musste einer die führerlose Nussschale mit 24 Flüchtenden an die Insel lenken. Hasan versuchte es so gut wie es eben ging: Als das Boot gegen die Klippen von Samos schlägt, gehen alle Insassen über Bord. Nadirs sechsjähriger Sohn ertrinkt. Für diese »Kindeswohlgefährdung« soll der junge Vater nun zehn Jahre, Hasan wegen »Beihilfe zur unerlaubten Einreise mit Todesfolge« lebenslänglich ins Gefängnis. Auch jene, die solch groteske Anklagen formal möglich machen, sitzen an Schreibtischen der EU-Administration. Von ihren bürokratischen Handreichungen machen die Staatsanwält*innen von Sizilien über Malta bis Samos reichlich Gebrauch. Und sie dehnen ihre Jagd auch auf andere aus: auf diejenigen, die Flüchtenden in ihrer Not Hilfe angedeihen lassen. So soll Seán Binder, der sein Studium in London unterbrochen hat, um als Rettungstaucher Schiffbrüchige in der Ägäis über Wasser zu halten, für viele Jahre in Griechenland ins Gefängnis. Genauso wie in Italien die Hamburger Kapitäne Dariush Beigui und Uli Tröder und ihre Einsatzleiter*innen Kathrin Schmidt und Sascha Girke, die mit dem Rettungsschiff »Iuventa« Tausende Ertrinkende aus dem Mittelmeer vor Libyen geborgen haben.
Doch »die Geschichtsbücher der Zukunft werden zeigen, wer kriminell ist«, prophezeit der weltbekannte Anti-Mafia-Kämpfer Leoluca Orlando. Der Bürgermeister Palermos hat das Urteil bereits gefällt. So sagte er beim Festival »Lesen ohne Atomstrom« 2021: »Die Kriminellen sind die Staaten, die heutigen Staatsführer.« Damit regte er ein internationales Tribunal an, für das diese Dokumentation die Vorlage zu liefern vermag: »Grenzenlose Gewalt« – verfasst vom Autorinnenkollektiv »mEUterei«, allesamt beeindruckende Aktivistinnen gegen das Grenzregime der EU. Die Juristinnen, Migrations- und Politikwissenschaftlerinnen sezieren so akribisch wie nüchtern den inzwischen von der »Friedensnobelpreisträgerin« aufgebahrten Leichnam des Humanismus. Die Suspendierung aller Werte, jedweder Moral.
Die »mEUterei«-Autorinnen zeigen erstmals das ganze Bild: von nahezu allen EU-Außengrenzen über die Fluchtrouten bis zur erbarmungslosen Kriminalisierung der Flüchtenden und der Europäer*innen, die Menschen auf der Flucht helfen. Ermöglicht wird all dies mit regelmäßigen Gesetzesverschärfungen, neuen Abkommen der Mitgliedstaaten, mit denen sie ihren Staatenverbund über Jahrzehnte gezielt zur Festung ausgebaut haben. In Deutschland wurde der Grundstein dafür bereits vor 30 Jahren gelegt, mit »einem der schandbarsten Kompromisse der bundesdeutschen Geschichte«, so Heribert Prantl. Für den Autor ist und bleibt die von einer ganz großen Koalition getragene Abschaffung des Grundrechts auf Asyl »eine Untat«. »Mauern statt Brücken« überschreibt die »mEUterei« diese Entwicklung der EU. Das Autorinnenkollektiv macht dabei ein differenziertes System minutiös ineinander greifender Mechanismen zur Bekämpfung völlig erschöpfter Menschen sichtbar, auf administrativer, juristischer und militärischer Ebene. Gegen jede*n, der*die es wagt, sich auf die Flucht gen Europa zu begeben.
So gerät dieses Buch zur Anklageschrift gegen die »Friedensnobelpreisträgerin«, deren führende Protagonist*innen längst Rousseau widerlegt haben, für den »die Menschen mit all ihrer Moral nie etwas anderes als Ungeheuer gewesen wären, wenn die Natur ihnen nicht das Mitleid zur Stütze der Vernunft gegeben hätte«. Was dem Schweizer Grenzkommandeur Paul Grüninger einst gegeben war, als er sich 1938 der ausdrücklichen Weisung widersetzte, jüdische Flüchtlinge an der Grenze abzuweisen. Grüninger ließ die Flüchtenden passieren, rettete so Tausenden das Leben – und verlor seinen Beruf. Über Jahrzehnte wurden er und seine Familie drangsaliert, erst posthum rehabilitiert.
In den Geschichtsbüchern zum 21. Jahrhundert wird »darzulegen sein, dass Europa – die Geburtsstätte der Menschenrechte – jenen die Gastfreundschaft verweigerte, die vor Kriegen, Verfolgung, Verwüstung und Hunger geflohen sind«, prognostiziert eine der führenden Intellektuellen Europas, Donatella Di Cesare. Im Epilog konstatiert die Philosophin »eine beunruhigende Kontinuität mit der dunklen Vergangenheit der Lager und der Vernichtung«.
Während die »Friedensnobelpreisträger*innen« um von der Leyen und Gminder noch glauben, mit ihrem aus zutiefst egoistischem Wohlstandschauvinismus gespeisten Krieg gegen Flüchtende ein weithin akzeptiertes, tatsächlich aber längst überkommenes Konzept verteidigen zu können: das der Nationalstaaten. Es folgt einer Logik von Abstammung und Boden, die sich vor dem Hintergrund der gerade in Europa »im Namen des Bodens entfesselten Kämpfe, der im Namen des Blutes verübten Verbrechen, der Asche von Auschwitz, auf der seine fragilen Demokratien errichtet sind«, verbieten sollte. Es ist eine Logik, die Migrierende als Bedrohung stilisiert, die dem Ansässigen dessen qua Abstammung zustehenden Platz streitig macht und die vermeintliche öffentliche Ordnung stört. So »stellt der Migrant mit seiner bloßen Existenz den Nationalstaat nachdrücklich in Frage. Auf Migration zu reflektieren heißt, den Staat neu zu denken«, folgert Di Cesare in ihrem Buch »Philosophie der Migration«. Was Friedensnobelpreisträger Elie Wiesel, der Auschwitz und Buchenwald überlebt hat, schon früh wusste: »Wenn die Menschenwürde in Gefahr ist, werden nationale Grenzen irrelevant.«
Bei dieser Geschichtsschreibung des 21. Jahrhunderts werden aber auch wir, die Zivilgesellschaft der EU, nicht gut wegkommen können: Wir, die wir das tagtägliche Sterben an unserer Haustür sehen – und es ganz überwiegend achselzuckend hinnehmen. Die wir das unermessliche Leiden von Millionen kühl ignorieren, die unmittelbar vor unseren Grenzwällen um Schutz nachsuchen, bevor viele von ihnen erfrieren oder ertrinken. Es ist jene todbringende Gleichgültigkeit, die Autor Ronen Steinke auf den Punkt bringt: »Es sind nicht nur Mörder, die einen Völkermord begehen. Es sind auch all jene, die nicht vom Sofa aufstehen, wenn sie es müssten.« Niemand von uns wohlstandsverwahrlosten, ganz überwiegend mit gleichgültiger Ignoranz gepeinigten Europäer*innen wird dereinst sagen können, er*sie hätte von diesen über Jahre in staatlichem Auftrag verübten Gräueln nichts gewusst. Spätestens mit dieser akribischen Dokumentation der »mEUterei«-Autorinnen kann es jeder wissen. Was aber gewiss noch nicht ausreicht, wie uns eine ganz besondere Freundin von »Lesen ohne Atomstrom« mahnt: »Es ist sehr schön, dass ihr sprecht. Aber Worte sind nicht genug. Taten wollen wir sehen«, sagt Margot Friedländer, jüdische Holocaust-Überlebende, die zum Jahresausklang 2021 hundert Jahre alt geworden ist.
Und nicht zuletzt deshalb stellt das Hamburger Literaturfestival jedem*r Abgeordneten des EU-Parlaments – das den Beate Gminders und Gerald Knaus, den Schergen der EU-Grenzwacht oder der »Libyschen Küstenwache« das Mandat für ihr skrupelloses Tun erteilt – die englische Version dieses Buchs persönlich zu. Verbunden mit dem Ausruf: »Vergogna!«
Das haben sie auf Lampedusa dem Vor-Vor-Gänger Ursula von der Leyens am 9. Oktober 2013 ins Gesicht geschrien: »Schande!« Als José Manuel Barroso die italienische Insel besuchte – und krokodil-tränte: »Den Anblick von Hunderten von Särgen werde ich nie mehr aus dem Kopf bekommen.« Es waren die Leichen jener, die – in Ermangelung legaler Einreiseoptionen – am libyschen Strand in See gestochen waren und ihr Ziel Europa nur tot erreichten. Die Insulaner*innen hatten die Leichen in den Vortagen eine nach der anderen aus dem Meer gezogen. Bis schließlich 280 Holzkisten den Flugzeughangar Lampedusas füllten, wie Barroso sich erinnert: »Särge mit Säuglingen, Särge mit Müttern und ihren gerade neu geborenen Kindern. Das hat mich tief geschockt.« Der »Herr Präsident« kam, nachdem er sorgsam Rosen auf jeden einzelnen Sarg gelegt hatte, zu der Erkenntnis: »Europa kann sich nicht umdrehen.« Um sich sodann umzudrehen.
Seither sind weit mehr als 20.000 Flüchtende – genau weiß das niemand – auf dem Boden des Mittelmeers zu liegen gekommen. Denn nach Barrosos Lampedusa-Visite haben sich dessen biedere Beamt*innen keineswegs »umgedreht«, vielmehr haben sie in den Brüsseler Bürotürmen immer neue, immer perfidere Schikanen und Hindernisse ersonnen, damit die Flüchtenden unsere Strände nicht erreichen. Die furchtbaren EU-Technokrat*innen sorgen seither dafür, dass Rettungsschiffe am Auslaufen gehindert werden, während gleichzeitig die staatlichen Notrufzentralen Europas die Hilferufe der Schiffbrüchigen ignorieren. Über Stunden. Tage. Bis der Fleck auf dem Radar verschwunden ist. Die einstige EU-Rettungsmission »Mare Nostrum« haben sie eingestellt, das Mittelmehr zum »Mare Mortuum« gemacht. Willentlich und wissentlich: Wenn sie schon nicht zu Hause verhungern oder dort von unseren Bomben, Minen und Drohnen zerfetzt werden, wenn sie es auf die Flucht geschafft haben und dabei in der Wüste nicht schon verdurstet sind, wenn sie auch in den von der EU alimentierten Folterlagern Libyens noch nicht zu Tode geprügelt oder vergewaltigt wurden – dann … Dann sollen sie spätestens vor unseren Stränden ersaufen. Hauptsache, es geschieht unbemerkt.
Für Donatella Di Cesare werden in Libyen »Frauen, Männer und Kinder im Namen und im Auftrag der europäischen Bürger*innen gefoltert«. Aber: »Wer die Auswirkungen seines Handelns nicht sieht, ist dadurch nicht unschuldig.« Derweil phantasieren »die Frau Präsidentin« und ihre Helfershelfer*innen immer wilder: vom »hybriden Krieg« der Flüchtenden gegen die hochgerüstete EU. Die einstigen »Asyltouristen« sind so nun zu »Kriegern« mutiert. Schon wieder Brüsseler Bullshit: Keine*r der Gehetzten, die sich an unsere Strände schleppen oder die immer höheren Zäune zu erklimmen versuchen, ist mit uns im Krieg. Von Krieg spricht einzig diejenige, die die Erlaubnis will für das, was Krieg unweigerlich immer ist: Menschen töten. Tote können keinen Asylantrag stellen. »Das Trauma der Einzelnen und der Gesellschaft endet so niemals«, merkt Psychologe Kizilhan an.
»Wer könnte jetzt noch antworten auf die entsetzliche Hartnäckigkeit des Verbrechens, wenn nicht die Hartnäckigkeit des Zeugnisses?«, hatte einst Albert Camus gefragt. Hier ist es, auf den folgenden Seiten. Das Zeugnis der inzwischen ganz selbstverständlichen systematischen Verbrechen gegen die Menschlichkeit, begangen von einer »Friedensnobelpreisträgerin«. Es ist nichts anderes als das, was die Einwohner*innen von Lampedusa in ihrer Verzweiflung EU-Präsident Barroso zugebrüllt haben: »Vergogna!«
Die grenzenlose Gewalt der EU ist die Schande Europas.
»Geflüchtet zu seinbedeutet, sprachlosgemacht zu werden,von der Teilhabe amLeben ausgeschlossenzu werden, nicht mehrMensch zu sein.«
Parwana Amiri
Einleitung
Grenzenlose Gewalt
Der unerklärte Krieg der EU gegen Flüchtende
Der 9. Mai ist Europatag – der Tag, an dem die Europäische Union (EU) sich selbst und ihre Errungenschaften unter dem Motto »In Vielfalt geeint« feiert. Im zehnten Jubiläumsjahr nach der Verleihung des Friedensnobelpreises an den Staatenverbund wagt »Grenzenlose Gewalt« einen Blick darauf, wen die EU mit dieser Vielfalt meint und wen explizit nicht; und darauf, wie sie ihre proklamierten Werte mit geltendem Recht in Einklang zu bringen meint. Nicht zuletzt erhielt die EU 2012 den Friedensnobelpreis wegen ihres »erfolgreichen Kampfs für Frieden und Versöhnung und für Demokratie sowie die Menschenrechte«.1 Die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte (AEMR) spricht einem jeden Menschen ein gleiches Maß an Würde und Rechten zu, die sich alle »im Geist der Solidarität begegnen« sollen. Dieser Geist der Solidarität findet u.a. in Artikel 14 eine Konkretisierung, der Menschen auf der Flucht gewidmet ist: »Jeder hat das Recht, in anderen Ländern vor Verfolgung Asyl zu suchen und zu genießen.«
Jede*r? Das scheint in Europa eher »ein paar von denen, die es trotz all unserer Bemühungen über die Grenze geschafft haben«, zu meinen. Geschichtsvergessen werden die Mauern der Festung Europa kontinuierlich höher gezogen, die Abschottung brutaler und die bürokratischen und physischen Hürden für Flüchtende, um ihr Recht auf Asyl in Anspruch nehmen zu können, nahezu unüberwindbar. Der Friedensnobelpreis wird als Persilschein missbraucht, um wider alle Realität humane Politik und Rechtsstaatlichkeit vorzugaukeln. Menschenrechtsverletzungen entlang der Binnen- und Außengrenzen der EU werden tagtäglich begangen, sind bekannt und gewollt. Die hehren Werte und erklärten Ziele der EU, wie z.B. die Unantastbarkeit der Menschenwürde, die Wahrung von Menschenrechten, Freiheit, Rechtsstaatlichkeit entpuppen sich mit Blick auf eine Abschottungspolitik, deren Ziel nicht der Schutz von Flüchtenden, sondern vor Flüchtenden ist, als reine Farce.
Dieses Buch zieht eine kritische Bilanz der europäischen Grenzgewalt und zeichnet die verschiedenen Facetten und Mechanismen der Abschottung nach. Dabei erhebt der Text keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Ebenso kann »Grenzenlose Gewalt« es nicht leisten, das ausgelöste Leid und die Auswirkungen der Abschottung für Menschen auf der Flucht im Einzelnen zu beleuchten. Das betrifft sowohl die Gründe ihrer Flucht als auch die Konsequenzen ihrer Abweisung in Europa. Betroffene sollten als Menschen mit eigener Stimme direkt gehört werden. Die Frage, was es für eine Gesellschaft bedeutet, sich in einem verkommenen Wertesystem zu bewegen, wird auf diesen Seiten unbeantwortet bleiben. Das Nachdenken darüber, ob man seine eigenen Rechte nicht auch verliert, wenn sie anderen verweigert werden, können und möchten wir unseren Leser*innen nicht abnehmen. Eine breite Debatte darüber, wer und wie für diese Menschenrechtsverbrechen – auch juristisch – zur Rechenschaft gezogen werden sollte, ist ebenso dringend nötig wie die deutliche Forderung nach einer anderen Grenzpolitik.
Wie man eine Festung baut
Flucht- und Wanderbewegungen sind in der Menschheitsgeschichte nichts Neues, sondern von jeher eine zivilisatorische Notwendigkeit. Um die Art der Bewegung zu klassifizieren und den Menschen dabei verschiedene Rechte zu- bzw. abzusprechen, werden offiziell verschiedene Begrifflichkeiten verwendet. Es wird zwischen Migrant*innen, Flüchtlingen und Asylsuchenden unterschieden:
»Migrant*in« ist ein Oberbegriff, der völkerrechtlich nicht eindeutig definiert ist und der Menschen beschreibt, die sich kurz- oder längerfristig von ihrem gewöhnlichen Aufenthaltsort entfernen, sei es innerhalb eines Landes oder über eine internationale Grenze – unabhängig von den Ursachen der Migration, ob freiwillig oder unfreiwillig, und unabhängig von der Art der Migration. Das schließt bspw. sowohl Arbeitsmigrant*innen mit ein, aber auch so betitelte »irreguläre Migrant*innen« (Menschen, die weder über ein reguläres Visum noch über einen legalen Aufenthaltsstatus verfügen, um in ein Land einzureisen bzw. dort zu bleiben). Dass Menschen des Globalen Nordens, die ihre Freiheit, zu leben und zu arbeiten, wo immer sie möchten in Anspruch nehmen, z.B. als »Expats« bezeichnet werden, während der Begriff »Migrant*in« Menschen aus dem Globalen Süden vorbehalten ist, ist nur ein kleiner Hinweis auf den strukturellen Rassismus dieser Zuschreibungen. Die im politischen Sprachgebrauch häufig vorgenommene Unterscheidung zwischen Flüchtlingen und Migrant*innen hat keine völkerrechtliche Grundlage. Man kann Flüchtlinge vielmehr als eine bestimmte Untergruppe von Migrant*innen bezeichnen.
Ein »Flüchtling« ist laut Genfer Flüchtlingskonvention (GFK) entweder eine Person, die sich aufgrund begründeter Angst vor Verfolgung wegen ihrer Abstammung, Religion, Nationalität, politischen Meinung oder Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe außerhalb des Landes, dessen Staatsangehörigkeit sie besitzt, aufhält und welche nicht in der Lage oder – aufgrund einer solchen begründeten Angst – nicht gewillt ist, vom in dem betreffenden Land angebotenen Schutz Gebrauch zu machen. Unter die Definition fallen auch Staatenlose, die sich aufgrund der genannten begründeten Angst außerhalb des Landes aufhalten, in dem sie sich zuvor üblicherweise aufgehalten haben, und die nicht in der Lage oder – aufgrund einer solchen begründeten Angst – nicht gewillt sind, dorthin zurückzukehren.
Ein*e »Asylsuchende*r« ist eine Person, die in einem anderen Land als ihrem Heimatland Sicherheit vor Verfolgung und ernsthafter Schädigung sucht und die eine Entscheidung über ihren Antrag auf Flüchtlingsstatus im Rahmen der geltenden internationalen und nationalen Gesetze und Regularien erwartet.2
Europäische Grenz- und Asylpolitik betrifft aber nicht nur offiziell anerkannte Flüchtlinge und Asylsuchende. Es sind gerade auch die Menschen, denen der völkerrechtliche Schutzstatus verwehrt wird, die Opfer eines Systems der Abweisung und Gewalt werden. Daher wird in diesem Buch der Begriff »Flüchtling« nur dann verwendet, wenn er sich auf anerkannte Schutzsuchende bezieht oder aus zitierten Publikationen, Statistiken usw. übernommen wird. Bei einer Betrachtung von Fluchtbewegungen und Grenzmechanismen, die sich auf die tatsächliche Lebenssituation von Menschen bezieht und nicht auf formelle behördliche Entscheidungen, schließt die Verwendung von Begriffen wie »Flüchtende«, »Schutzsuchende«, »Migrierende« und »Geflüchtete« alle betroffenen Menschen mit ein.
Des Weiteren sei darauf hingewiesen, dass auch wenn sich dieser Text häufig auf UN-Organisationen und ihre Beschlüsse wie z.B. die GFK bezieht, ausdrückliche und begründete Kritik an diesen bis heute überwiegend weißen Institutionen besteht, da sie die Interessen des Globalen Nordens weitaus deutlicher vertreten als jene des Globalen Südens. Seit ihrer Gründung sind UN-Organisationen an den kolonialen und postkolonialen Herrschaftsverhältnissen und deren Verbrechen beteiligt gewesen und bis heute haben sie keinen kritischen Umgang mit ihrer Geschichte gefunden.3 Der UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees; dt.: Hochkommissar der Vereinten Nationen für Flüchtlinge) und die Internationale Organisation für Migration (IOM) als UN-Partnerorganisation fallen in den letzten Jahrzehnten vor allem dadurch auf, dass sie insbesondere den europäischen Umgang mit der Abwehr von Flüchtenden unterstützen, anstatt sich auf die Seite der Schutzsuchenden zu stellen.
Angesichts ihrer Entstehung im Jahr 1951 im Kontext der Nachkriegszeit garantiert die GFK mit ihrer Definition eines Flüchtlings nur unvollständigen Schutz vor vielen heutigen Bedrohungslagen. Die GFK bildet dadurch ein verhängnisvolles Nadelöhr, wenn es zur »Qualifizierung« von Schutzbedürftigkeit kommt. Kritikwürdig ist zum einen, dass die gültigen Fluchtgründe zahlreiche Gefahren außer Acht lassen. Durch die strenge Kategorisierung von Anlässen begründeter Furcht, die allesamt eine individuelle Verfolgung aus bestimmten Ursachen voraussetzen (wie etwa aufgrund von Ethnie, Religion, politischen Überzeugungen, sexueller Orientierung oder Geschlechtsidentität), fallen Menschen, die Kriegen und Terror unterschiedslos zum Opfer fallen, nicht unter diese Gruppe – so auch nicht die Opfer von Giftgas, nuklearen Waffen oder anderen Massenvernichtungswaffen. Als Flüchtlinge gelten auch nicht solche Menschen, die ihre Lebensgrundlage durch ökologische Krisen wie z.B. Überschwemmungen, Dürreperioden und andere Auswirkungen der Klimakatastrophe verloren haben. Menschen, die durch Umweltzerstörung, Rohstoffhandel und Landraub verdrängt wurden, sind ebenso wenig Flüchtlinge im Sinne der GFK (es sei denn, sie werden bspw. als Umweltaktivist*innen verfolgt).
Zum anderen sind die Anforderungen an die Unterbeweisstellung einer Gefahrenlage oft eine schwer zu nehmende Hürde für schutzsuchende Menschen. Um den Status eines Flüchtlings zu erlangen, ist eine »begründete Angst vor Verfolgung« nachzuweisen. Die GFK bietet damit nur Schutz für Personen, die darlegen können, dass sie unmittelbar um Leib und Leben fürchten müssen, und nicht für solche, die ihr Herkunftsland bereits vor Erreichen einer solchen Gefahrenschwelle verlassen haben. Zwar müssen Asylsuchende in der Theorie nicht erst abwarten, bis sich eine befürchtete Gefahr realisiert hat, in der Praxis ist es aber oft schwierig bis unmöglich, die »begründete Angst« darzulegen.
Um zumindest die erste Lücke (das Erfordernis einer individualisierten Verfolgung) in der GFK zu schließen, wurde der »internationale Schutz« auf europäischer Ebene mit der Richtlinie 2011/95/EU durch den »subsidiären Schutz« erweitert. Subsidiärer Schutz wird Menschen zugesprochen, die zwar nicht die Voraussetzung für den Flüchtlingsstatus nach der GFK erfüllen, denen in ihrem Herkunftsland aber dennoch ein »ernsthafter Schaden« droht (bspw. Folter oder willkürliche Gewalt im Rahmen eines bewaffneten Konflikts) und die in ihrem Herkunftsland keinen Schutz in Anspruch nehmen können. Somit kommt der subsidiäre Schutz besonders für Menschen infrage, die vor Kriegsereignissen fliehen. Bei einem »Antrag auf internationalen Schutz« (ugs. unvollständig »Asylantrag« genannt) wird zunächst eine etwaige Flüchtlingsanerkennung (Asyl) und dann die mögliche Zuerkennung von subsidiärem Schutz geprüft. Der Grundgedanke der Richtlinie 2004/83/EG ist, Menschen, die subsidiären Schutz in Anspruch nehmen, denen, die unter den GFK-Schutz fallen, grundsätzlich gleichzustellen.4 Doch nicht nur in der öffentlichen Wahrnehmung wird der subsidiäre Schutzstatus oft als minderwertig betrachtet und die tatsächliche Schutzbedürftigkeit der Träger*innen dieses eingeschränkten Status angezweifelt, der subsidiäre Schutzstatus führt auch zu konkreter Schlechterstellung der Betroffenen. So sind etwa die Zeiträume zwischen den obligatorischen Überprüfungen zur Verlängerung bzw. zum Widerruf des Schutzstatus deutlich kürzer. Insbesondere aber ist das Recht auf Familienzusammenführung stark eingeschränkt (was im Zweifel die zurückgelassene Verwandtschaft wiederum auf gefährliche illegalisierte Fluchtrouten zwingt).
Es ist nicht zu übersehen, dass EU-Staaten den schwächeren subsidiären Schutz als ein Konzept zur Schutzverweigerung nutzen und seine Zuerkennung dem des vollen Flüchtlingsstatus vorziehen. So wurde etwa im Januar 2015 in Deutschland beinahe 99 Prozent aller Syrer*innen der volle Flüchtlingsstatus zugesprochen und bloß 1 Prozent der subsidiäre Schutzstatus. Im September des gleichen Jahres galten plötzlich nur noch 27 Prozent der syrischen Antragsteller*innen als Flüchtlinge und 71 Prozent der Menschen fielen unter den subsidiären Schutz.5 Das ohnehin beschnittene Recht auf Familienzusammenführung unter subsidiärem Schutz wurde im März 2016 in Deutschland im Zuge des Asylpakets II für zwei Jahre komplett ausgesetzt.
Diese einschränkenden Anerkennungskriterien sind angesichts der Zahl der weltweit Flüchtenden absolut realitätsfern. So waren laut offiziellem Bericht des UNHCR noch nie mehr Menschen auf der Flucht als heute.6 2020 wurde mit 82,4 Millionen Menschen (42 Prozent von ihnen Jugendliche und Kinder), die weltweit vor Krieg, Konflikten und Verfolgung fliehen mussten, erneut ein trauriger Rekord gebrochen. Dabei hat sich die Zahl der weltweit Flüchtenden allein in den letzten zehn Jahren verdoppelt. So sehr man in Europa von Flüchtlingskrisen, -schwemmen und -wellen unken mag, kommt der Großteil dieser Menschen jedoch mitnichten nach Europa. Mit einem Anteil von 48 Millionen sind die mit Abstand meisten dieser Flüchtenden Binnenvertriebene – Menschen also, die innerhalb ihres Landes auf der Flucht sind. 86 Prozent der Flüchtenden lebten Ende 2020 in Staaten des Globalen Südens mit niedrigen oder mittleren Einkommen. Die Länder, die die höchste Anzahl von Flüchtenden aufnahmen, waren die Türkei, Kolumbien und Pakistan. 22 Prozent der Menschen, die im Libanon leben, sind Geflüchtete (seit 2015 ist die offizielle Registrierung von Flüchtlingen im Libanon ausgesetzt), während der Anteil der Flüchtlinge in der EU bei sage und schreibe 0,6 Prozent der Gesamtbevölkerung liegt. Laut der Europäischen Kommission haben 2020 416.600 Menschen in der EU erstmalig einen Asylantrag gestellt und machten damit ca. 0,09 Prozent der EU-Gesamtbevölkerung aus.7
Mauern statt Brücken — von der Gründung der EU bis heute
Innerhalb Europas wurden Mauern und Zäune an Staatsgrenzen seit Ende der 1980er-Jahre abgebaut. Seit einigen Jahren erfreuen sie sich aber wieder zunehmender Popularität – an den EU-Außengrenzen. Diesem Aufbau der Festung Europa liegt eine jahrzehntelange Entwicklung zugrunde.
Seit den Römischen Verträgen von 1957, die u.a. die Errichtung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) sowie der Europäischen Atomgemeinschaft (Euratom) und Abkommen über gemeinsame institutionelle Strukturen in Europa beinhalteten, wurde auch die Asyl- und Grenzpolitik zunehmend als europäisches Thema diskutiert. Im April 1965 wurde beschlossen, die EWG, Euratom und die seit 1952 bestehende Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl (EGKS) zur Europäischen Gemeinschaft (EG) zu fusionieren. Das Schengener Übereinkommen von 1985 gilt als Ausgangspunkt der Etablierung eines mehrstaatlich orchestrierten Grenzregimes. Durch das Abkommen wurde eine gemeinsame europäische Außengrenze konstituiert und die Kontrolle an den Binnengrenzen im Gegenzug nach und nach gelockert, bis die Grenzkontrollen an diesen eingestellt wurden. Um das zu ermöglichen, sollten Einreisekontrollen bereits an den Außengrenzen durchgeführt werden. Heute sind sowohl EU-Mitgliedstaaten als auch Nicht-EU-Staaten wie Island, Norwegen oder die Schweiz Mitglieder des Schengenraums. Die europäische Freizügigkeit wurde damals wie heute auf Kosten der Bewegungsfreiheit aller »anderen« erlangt. Visaregelungen, die Bekämpfung von »grenzüberschreitender Kriminalität« sowie Maßnahmen zur Regulierung und zur Illegalisierung bestimmter Einreiseformen wurden EU-weit vereinheitlicht, um Mitgliedstaaten ohne Außengrenzen nicht abhängig von den migrationspolitischen und grenzsichernden Maßnahmen der Randstaaten zu machen. Auch wenn der Grenzschutz weiterhin Aufgabe der einzelnen Mitgliedstaaten blieb, war eine deutlich stärkere Zusammenarbeit das erklärte Ziel.
Mit der Europäischen Akte von 1986 wurde ein völkerrechtlicher Vertrag zwischen den Mitgliedstaaten über die europäische Zusammenarbeit in der Außenpolitik geschlossen und der Weg von der EG zur EU bereitet. 1992 folgte dann mit dem Maastrichter Vertrag die Gründung der EU als übergeordnetem Verbund für die Europäischen Gemeinschaften mit einer gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik und Zusammenarbeit in den Bereichen Justiz und Inneres. Asyl- und Grenzpolitik wurden hier erstmals als »Angelegenheiten von gemeinsamem Interesse« der EU gehandelt. Dadurch, dass Entscheidungen in diesen Belangen vorerst einstimmig getroffen werden mussten, blieb die Entscheidungshoheit aber weiterhin bei den Mitgliedstaaten.
Diese Entscheidungshoheit entfiel dann mit dem Amsterdamer Vertrag, der 1999 in Kraft trat. Seither sind Asyl- und Grenzpolitik supranational geregelt. Einzelnen Mitgliedstaaten wurde jedoch durch eine »stay-in/opt-out«-Regelung ermöglicht, die Änderungen nur teilweise (Irland, Großbritannien) oder überhaupt nicht (Dänemark) umzusetzen. Beim Treffen des Europäischen Rates beim Sondergipfel von Tampere in Finnland 1999 wurde ein Fünf-Jahres-Aktionsprogramm für die innen- und justizpolitische Zusammenarbeit der EU-Mitgliedstaaten verabschiedet. Das Programm bestimmte politische Leitlinien sowie konkrete Vorgaben für den Aufbau eines europaweiten »Raums der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts« mit Asyl- und Migrationspolitik als Kardinalpunkten.8 Sowohl im Amsterdamer Vertrag als auch im Tampere-Programm wurde die GFK mit dem darin enthaltenen Grundsatz der Nichtzurückweisung (Refoulement-Verbot) als wichtiger Pfeiler der EU-Asylpolitik benannt. Das Refoulement-Verbot verbietet die Auslieferung, Ausweisung oder Rückschiebung einer Person in ein anderes Land, falls ihr dort Folter, unmenschliche und erniedrigende Behandlung oder andere Menschenrechtsverletzungen drohen. Dieser Grundsatz ist aus unterschiedlichen völkerrechtlichen Quellen ableitbar, bspw. aus der GFK, der UN-Antifolterkonvention und dem Völkergewohnheitsrecht. Die zunächst lobende Zustimmung vieler Menschenrechts- und Flüchtlingsorganisationen zum Tampere-Programm kippte in den folgenden Jahren in harsche Kritik an den letztlich verabschiedeten Richtlinien.
Fluchtbewegungen wurden zunehmend mit Kriminalität und Terrorismus gleichgesetzt. Eine Entwicklung, die durch die Anschläge vom 11. September 2001 in New York und die Anschläge in Madrid (2004) und London (2005) verstärkt wurde. Spätestens als die Europäische Kommission 2004 mit dem nachfolgenden Haager Programm eine Bilanz des Tampere-Abkommens zog und die Richtung für die Jahre 2005–2010 vorgab, zeigte sich, dass der Schutz von Flüchtenden nicht der Schwerpunkt europäischer Grenzpolitik war. Mit den Schlagworten »Rückkehr«, »Abschreckung« und »Bekämpfung« auf der einen Seite und Maßnahmen wie der Vorratsdatenspeicherung, dem Verknüpfen von Datenbanken, der Schaffung von Frontex (s.u.) und erweiterten Kompetenzen der EU-eigenen Strafverfolgungsbehörde Europol andererseits, wurden die Außengrenzen weiter gestärkt und abgeriegelt. Die »Bekämpfung des Asylmissbrauchs« wurde als zentrale Leitlinie für ein gemeinsames europäisches Asylsystem formuliert.9 Mit dem Mehrjahresprogramm des Stockholmer Programms von 2010 wurde diese polizeiliche, militärische und geheimdienstliche Zusammenarbeit weiter vorangetrieben. Die Bekämpfung und Illegalisierung von Flucht und Migration blieben als Leitlinien erhalten. Dafür wurden polizeiliche EU-Agenturen erweitert und neue technische Überwachungsmaßnahmen implementiert. Diesem zunehmend militarisierten System aus Strafverfolgung, Sicherheitsbehörden, Datenbanken, Informationssystemen und paramilitärischen Organisationen mangelte es von Anbeginn an Kontrollmechanismen und Rechenschaftspflicht.10 Vielmehr hat die EU mit dem Programm ihre Bereitschaft zu Menschenrechtsverletzungen an ihren Innen- und Außengrenzen weiter festgeschrieben und die Rechte Flüchtender erheblich eingeschränkt.
Als Reaktion auf verstärkte Fluchtbewegungen nach Europa legte die Europäische Kommission 2015 die Europäische Migrationsagenda vor, durch die der strategische Kanon der Migrationspolitik zwischen 2015 und 2020 ausformuliert wurde.11 Auch in dieser Agenda bestand man darauf, Migration als Bedrohung darzustellen und Flüchtenden mit Abschottung, Abschreckung, Ab- und Ausweisung zu begegnen.
Im Jahr 2020 legte die Europäische Kommission einen Reformvorschlag vor: Das »Neue Asyl- und Migrations-Paket« beinhaltet eine überarbeitete Neufassung des Gemeinsamen Europäischen Asylsystems (GEAS), die allerdings keine Verbesserungen für Schutzbedürftige mit sich bringt. Die im Paket enthaltenen »Verbesserungsvorschläge« sind eingebettet in erhebliche Verschärfungen von Abschottungsmechanismen, wie etwa ein »Vorsortieren« von Schutzsuchenden an den europäischen Außengrenzen in den sog. Screening-Verfahren (die mitunter von europäischen Geheimdiensten durchgeführt werden), beschleunigte Grenzverfahren und die Idee von »Abschiebepatenschaften«, die mit pervertierter Sprache verstärkte Abschiebungen durch zur Aufnahme unwillige Staaten als Akt der Solidarität verkaufen will.
Das Gemeinsame Europäische Asylsystem (GEAS), an dem seit 1999 gearbeitet wird, soll für Mindeststandards bei der Durchführung von Asylverfahren und bei der Unterbringung und Versorgung von Asylsuchenden in den EU-Mitgliedstaaten sorgen. GEAS beruht auf drei Richtlinien (Qualifikations-, Aufnahme-, Asylverfahrensrichtlinie) und zwei Verordnungen (Eurodac-Verordnung zum Abgleich der Fingerabdruckdaten von Asylbewerber*innen und Dublin-Verordnung). Um die Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten zu intensivieren und eine kohärente Umsetzung des GEAS zu gewährleisten, wurde mit der EU-Verordnung Nr. 439/2010 im Jahr 2010 das Europäische Unterstützungsbüro für Asylfragen (European Asylum Support Office; EASO) errichtet. Zusätzlich veröffentlicht das EASO Berichte über häufige Herkunftsländer von Flüchtenden für Asylbehörden (Country of Origin Information Reports; COI-Berichte).
Bis heute verläuft die Umsetzung des GEAS uneinheitlich mit teils enormen Unterschieden zwischen den Mitgliedstaaten. Es gibt gravierende Differenzen, nicht nur bei der Behandlung von Asylsuchenden, sondern auch bei den Anerkennungsquoten. Die Anerkennungspraxis innerhalb der EU gleicht einer Lotterie, die über Leben entscheidet. 2015 etwa lag der Anerkennungsdurchschnitt irakischer Asylsuchender EU-weit bei 54 Prozent. Während in Griechenland nur 3 Prozent anerkannt wurden, waren es 93 Prozent in Italien.12 2020 sprach Belgien 23 Prozent der venezolanischen Asylsuchenden den Schutzstatus zu, während es in Spanien 98 Prozent waren.13 Während EASO laut Mandat die einheitliche Umsetzung des GEAS unterstützen soll, sieht die Realität ganz anders aus, wie die folgenden Kapitel zeigen werden.
1997 trat das Dubliner Übereinkommen in Kraft. Dieser völkerrechtliche Vertrag regelt, welcher EU-Mitgliedstaat für die Durchführung eines Asylverfahrens zuständig ist, und gilt neben der EU auch in Island, Norwegen, Liechtenstein und der Schweiz. Formell ist das Abkommen noch in Kraft, wurde jedoch 2003 durch die Dublin-II-Verordnung ersetzt. Seit 2014 gilt die derzeit angewandte Dublin-III-Verordnung. Eine von der EU-Kommission vorgelegte Neufassung passierte 2017 als Dublin-IV-Verordnung das Europäische Parlament, blieb aber bislang ohne Zustimmung des Ministerrats.
Die Grundidee des Dubliner Übereinkommens ist, dass derjenige EU-Staat, der von einem*r Asylsuchende*n zuerst betreten wird, für ihn*sie verantwortlich ist. Durch klare Zuständigkeitsregelungen sollte vermieden werden, dass Schutzsuchende von einem europäischen Mitgliedstaat in den anderen reisen und Mitgliedstaaten die Verantwortung auf jeweils andere Mitgliedstaaten abschieben können (und damit für sog. refugees in orbit zu sorgen). Zentraler Bestandteil der migrationsfeindlichen Argumentation war, durch Dublin »Asyl-Shopping« (sic!) zu vermeiden.14 Mit diesem Unwort wird Asylbewerber*innen unterstellt, in mehreren Staaten um Asyl nachzusuchen, um bessere Asylbedingungen und/oder höhere Sozialleistungen zu erhalten. Tatsächlich bewirken die Regularien der Dublin-Verordnung durch das grundsätzliche Zuständigkeitskriterium der Ersteinreise, dass Staaten mit einer europäischen Außengrenze für den Großteil der Asylanträge zuständig sind. Dadurch wird die Verantwortung für den Flüchtlingsschutz an die EU-Randstaaten geschoben. Die daraus resultierende extrem ungleiche Verteilung von Asylverfahren innerhalb der EU in Kombination mit einem vorsätzlich dysfunktional gestalteten Aufnahmeprozedere (bzgl. etwa der Unterbringung oder des Arbeitsverbots während der ersten neun Monate des Asylverfahrens) hat zur Konsequenz, dass Randstaaten versuchen, Asylsuchende möglichst erst gar nicht über ihre Landesgrenzen kommen zu lassen. Schaffen Flüchtende es doch in einen EU-Randstaat, droht ihnen oft eine so schlechte Behandlung, dass sie in andere EU-Staaten weiterfliehen. Dort wird dann versucht, sie so schnell wie möglich zurückzuschieben. Dieser Mechanismus führt zu elenden und mitunter lebensbedrohlichen Lebensbedingungen für die Menschen auf der Suche nach Zuflucht.
Durch die Bestimmung der Zuständigkeit für das Asylverfahren ergibt sich auf nationaler Ebene im Normalfall auch, dass Asylsuchende jenen ersten EU-Staat, den sie betreten, nicht mehr verlassen dürfen, bis ihr Asylverfahren abgeschlossen ist, da ihnen nötige Reisedokumente fehlen. Eine mögliche Konsequenz der Ausreise ist, dass laufende Asylverfahren einfach eingestellt werden. Ein Asylantrag in einem anderen EU-Staat wird automatisch als unzulässig abgelehnt und den Schutzsuchenden droht Haft zur »Sicherung« ihrer »zwangsweisen Überstellung« (Abschiebung) in den zuständigen Ersteinreisestaat.
Auf dem Papier gibt es in der Dublin-Verordnung Vorschriften, die die Familienzusammengehörigkeit schützen sollen. Durch administrative Hürden, wie etwa den sehr eng gefassten Begriff von Familie, kurze Antragsfristen und oft unmöglich zu erbringende Nachweise von familiären Bindungen, wird der Schutz von Familie jedoch allzu oft ausgehebelt.
Diese Mechanismen, gepaart mit einer völlig unzureichenden Umsetzung des Regelwerks durch die Mitgliedstaaten, hat zur Folge, dass Asylsuchenden der Zugang zu ihren Familienangehörigen und sozialen Netzwerken in anderen europäischen Ländern oder auch zu solchen EU-Staaten, deren Sprache sie sprechen, verwehrt bleibt. Das hat nicht nur folgenschwere Auswirkungen auf das Leben Betroffener, sondern steht auch einem Schutz- und Partizipationsgedanken diametral entgegen. Während sich also die meisten europäischen Bürger*innen der Freiheiten und Erleichterungen durch das Schengener Abkommen erfreuen, verhindert die Dublin-Verordnung, dass Asylsuchende einen Asylantrag in einem EU-Staat ihrer Wahl stellen können, und schränkt somit ihre Bewegungsfreiheit erheblich ein. Das führt nicht zufällig dazu, dass Flüchtende gegebenenfalls in einem EU-Staat festsitzen, der besonders niedrige Anerkennungsquoten hat, während sie andere Mitgliedstaaten, in denen ihnen sehr wohl internationaler Schutz zugesprochen würde, nicht betreten dürfen.
Die Möglichkeiten für Flüchtende, ihr Recht auf Asyl wahrzunehmen, sind in der EU mehr als begrenzt. Zunächst müssen sie sich innerhalb der EU befinden, um einen Antrag stellen zu können. Es ist nicht möglich, in z.B. europäischen Botschaften Asyl zu beantragen. Auch spezielle humanitäre Visa wie Asyl-Visa, die in solchen Botschaften ausgestellt werden könnten, gibt es nicht. Visa für Tourist*innen sind für Schutzsuchende aus den meisten Herkunftsstaaten faktisch unerreichbar, sei es, weil es keine Termine bei den Botschaften bzw. in Kriegsgebieten oftmals gar keine Botschaften gibt, die Gebühren zu hoch und die Verfahren zu langwierig sind oder weil der Einreise-Zweck »Tourismus« als unglaubwürdig eingestuft wird. Das heißt, die Visa-Anträge scheitern entweder an formellen oder finanziellen Voraussetzungen oder spätestens daran, dass die Personen langfristig in Europa bleiben und Asyl beantragen wollen.
In der Theorie können Menschen Europa entweder auf dem Luftweg, dem Landweg oder dem Seeweg erreichen. In der Praxis sorgt die EU-Richtlinie 2001/51/EG dafür, dass Fluggesellschaften (bzw. jedwedes »Beförderungsunternehmen«) schon außerhalb der EU die Grenzkontrollen übernehmen. Bei einer Beförderung von Fluggäst*innen ohne gültige Papiere muss die Fluggesellschaft die Kosten der Rückführung übernehmen und mit hohen Strafen (im Wiederholungsfall bis zu 500.000 Euro) rechnen. So lehnen die Mitarbeiter*innen von Fluggesellschaften alle Personen ohne gültige Dokumente ab, ohne Berücksichtigung potenzieller Fälle von Menschen, denen nach internationalem Recht sehr wohl der Schutz als Flüchtling zustünde. Daraus ergibt sich, dass konventionelle Flugreisen, um in die EU zu gelangen, Flüchtenden nahezu gänzlich verwehrt sind.
Dabei wären Flugtickets nicht nur günstiger und schneller, sondern v.a. sicherer als die Einreise über den Land- oder Seeweg. Oftmals sind Menschen jahrelang auf der Flucht (z.B. interkontinental in Afrika), bevor sie es überhaupt an die Außengrenzen der EU schaffen, nur um dort festzustellen, dass ihnen die Einreise verwehrt wird.
Das internationale Resettlement-Programm des UNHCR will dieser Problematik Abhilfe verschaffen, indem »besonders schutzbedürftige Flüchtlinge aus ihrem [nicht-europäischen] Erstaufnahmeland in ein sicheres Land« verbracht werden sollen.15 Dabei wählt der UNHCR die Flüchtlinge nach ihren »besonderen Schutzbedürfnissen« aus und überlässt die endgültige Entscheidung über die Aufnahme den jeweiligen Zielländern. Es besteht keine Verpflichtung von Staaten zur Teilnahme an diesem Programm und auch die Anzahl der angebotenen Plätze obliegt der Entscheidung der Aufnahmeländer. Der weltweite Bedarf an Resettlement-Plätzen ist mitnichten gedeckt. 2019 stellten weltweit 29 Länder Aufnahmeplätze zur Verfügung.16 Laut UNHCR waren im gleichen Zeitraum 1,4 Millionen Flüchtlinge auf ein Resettlement angewiesen, einen solchen Platz erhalten haben lediglich 63.696 Personen – weniger als fünf Prozent des angegebenen Bedarfs (zumindest auf dem Papier, denn nicht alle versprochenen Plätze werden am Ende auch zur Verfügung gestellt). Rechnet man die Plätze auf alle 26 Millionen offiziellen Flüchtlinge um, die sich 2019 in Drittstaaten aufhielten, standen für 0,24 Prozent von ihnen Plätze zur Verfügung.17 Im Corona-Jahr 2020 stellten nur noch 20 Staaten Aufnahmeplätze bereit und die Zahl der Resettlement-Plätze sank auf den niedrigsten Stand seit 20 Jahren. Nicht einmal 1,6 Prozent des vom UNHCR angegebenen Bedarfs wurde gedeckt. Das entspricht 0,09 Prozent der offiziellen Flüchtlinge in Drittstaaten und 0,03 Prozent der gewaltsam vertriebenen Menschen weltweit.18
Die Anzahl der tatsächlichen »Umsiedlungen« ist derart gering, dass das Resettlement-Programm vor allem als Feigenblatt einer restriktiven Migrationspolitik anzusehen ist. Während die Chancen auf einen Platz im Programm verschwindend gering sind, bietet es Staaten die Legitimation, Menschen in Drittstaaten festzuhalten und sich dennoch als »großzügig« präsentieren zu können. Neben dem eklatanten Mangel an Plätzen erweist sich auch die Qualifizierung als »besonders schutzbedürftiger Flüchtling« als sehr selektiv und schließt die meisten Flüchtenden kategorisch aus. Das Recht auf Asyl ist aber kein Gnadenakt, der nur »besonders schutzbedürftigen« Personen gilt, sondern ein für alle geltendes Menschenrecht. Doch der Kampf um einen Resettlement-Platz gleicht einem Wettbewerb des größten Leidens, bei dem Flüchtende sich ihr Menschenrecht auf einen Asylantrag erst verdienen müssen. Eine transparente und flächendeckende Prüfung der Vergabeverfahren in den Drittstaaten bleibt derweil aus. Stattdessen sieht sich der UNHCR mit schweren Korruptionsvorwürfen gegen Mitarbeiter*innen konfrontiert, die sich die Vergabe von Plätzen teuer bezahlen lassen.19
Dabei darf Resettlement nicht mit Relocation verwechselt werden. Bei Relocation-Programmen geht es um die Umsiedlung von schutzbedürftigen Personen innerhalb der EU zur Entlastung von Mitgliedstaaten an den EU-Außengrenzen. Diese Programme haben unterschiedliche Anwendungsbereiche, Voraussetzungen und Laufzeiten. Ihnen ist jedoch gemein, dass sie nur für Personen zugänglich sind, die sich bereits in der EU befinden. Relocation-Programme zeichnen sich vor allem durch Intransparenz, fehlenden Zugang zu Rechtsberatung, fehlendes Mitspracherecht der Betroffenen sowie fehlende Übersetzer*innen aus, ebenso wie durch Willkür, sog. Pre-Screenings zum »Vorsortieren« von Flüchtenden und die Beteiligung von Geheimdiensten bei der Auswahl der Programmteilnehmer*innen. Recherchen legen nahe, dass etwa in Deutschland gezielt Asylsuchende ausgewählt werden, die dort keinen Asylgrund geltend machen können und somit in der Abschiebungssystematik landen. So wahrt Berlin den Schein, an der Entlastung der Mitgliedstaaten an den Außengrenzen und am Wohl der Schutzsuchenden interessiert zu sein, ohne eines von beiden zu erfüllen.20
Die 1951 gegründete Internationale Organisation für Migration (IOM) rühmt sich, »die führende zwischenstaatliche Organisation im Bereich Migration« zu sein. Mit etwa 9.000 Mitarbeiter*innen in 470 Büros weltweit und einem Jahresbudget von etwa 1,3 Milliarden Euro betreut die IOM sog. Migrationsprojekte.21 2016 wurde die IOM zwar offiziell zu einer »verwandten Organisation« der Vereinten Nationen – also einer mit der UN assoziierten zwischenstaatlichen Organisation, die aber weiterhin unabhängig agiert und an eigene Statuten gebunden ist (anders als etwa der UNHCR) –, sie ist aber mitnichten als eine Menschenrechtsorganisation, sondern eher als internationaler Dienstleister für Staaten im Bereich der »Migrationskontrolle« zu verstehen. Die 174 (demokratischen und auch undemokratischen) Mitgliedstaaten der IOM entscheiden über die Ausgaben der projektgebundenen Gelder und damit über den Löwenanteil des Budgets. Gefördert werden vorrangig Projekte mit dem Ziel von Rückführungen Flüchtender (z.B. nach Afghanistan oder Irak). In Deutschland stellt die IOM im Zuge von »Rückkehrberatungen« Formulare bereit, in denen Schutzsuchende die »Freiwilligkeit« ihrer Rückkehr und den Verzicht auf alle aufenthaltsrechtlichen Ansprüche erklären sollen. »Freiwillig« bedeutet in der Regel nichts anderes, als dass finanziell sanktioniert, inhaftiert und abgeschoben wird, wer sich nicht bereit erklärt, ohne Widerstand zu gehen. Hierbei greift weder ein interner noch externer Mechanismus, der bewertet, ob Entscheidungen über die Rückkehr von den betroffenen Menschen freiwillig und im Sinne des Völkerrechts getroffen werden. Die IOM untersucht nicht, ob Asylbewerber*innen ein vollständiges und faires Asylverfahren durchlaufen haben, und öffnet somit Tür und Tor für illegale Abschiebungen. Auch eine systematische Nachbetreuung von Menschen nach ihrer Rückkehr sieht die IOM nicht in ihrem Aufgabenbereich.
Andere Arbeitsschwerpunkte sind Projekte, die den Zugang zu Asyl verhindern und zu illegalen Refoulements führen. In Jordanien bspw. wurden Menschen aus Somalia und dem Sudan binnen 72 Stunden nach ihrer Ankunft durch ein Programm der IOM rückgeführt, ohne Prüfung, ob ihnen Verfolgung in ihrem Herkunftsland drohte.22 Des Weiteren betreibt die IOM Internierungslager, wie das berüchtigte australische Nauru Detention Centre auf der gleichnamigen Pazifikinsel. Die IOM ist ein Organ der Kontrolle und Bekämpfung von Fluchtbewegungen, das nach wirtschaftlichen und nicht nach humanitären Grundsätzen handelt.
Weder auf globaler noch auf europäischer Ebene finden sich Lösungsansätze, die den Bedürfnissen oder Rechten von Menschen, die gezwungen sind, ihre Heimat zu verlassen, gerecht werden. Die Nicht-Existenz sicherer und legaler Einreisewege zwingt Menschen auf gefährliche und allzu oft tödliche Überlandrouten und Seewege, auf denen sie zunehmend auf Fluchthilfe angewiesen sind und damit auch Gefahr laufen, in die Hände von skrupellosen Schleusernetzwerken zu geraten. Das Recht auf Asyl verkommt zu einer Worthülse vermeintlicher moralischer Überlegenheit, weil Schutzsuchende in einem fort davon abgehalten werden, jemals einen Asylantrag stellen zu können.
Frontex — Türsteher der EU
Das Thema Migration wurde seit den 1980er- und 1990er-Jahren zunehmend als Sicherheitsproblem wahrgenommen und weniger unter dem Aspekt der Einwanderungspolitik betrachtet, geschweige denn unter der Prämisse, Flüchtenden Schutz zu bieten. Diese Entwicklungen führten zu einer immer enger verwobenen polizeilichen Zusammenarbeit zwischen den europäischen Staaten und gingen mit der Entstehung verschiedener EU-Institutionen und Informationssysteme einher: Zu nennen sind hier u.a. die Europäische Strafverfolgungsbehörde Europol (European Police Office) (1999), das Schengener Informationssystem SIS (2001), das Informations-, Reflexions- und Austauschzentrum für Fragen im Zusammenhang mit dem Überschreiten der Außengrenzen und der Einwanderung (Center for Information, Discussion and Exchange on the Crossing of Frontiers and Immigration; CIREFI) (1992) und die Gemeinsame Fachinstanz Außengrenzen (2003). Im Zuge dieser Vereinheitlichung und Stärkung des Grenzregimes wurde schließlich 2004 die Europäische Agentur für die Grenz- und Küstenwache Frontex (Akronym für französisch frontières extérieures, dt.: Außengrenzen) durch die Verordnung Nr. 2007/2004 des Europäischen Rates geschaffen. Ziel war eine »Verbesserung der Koordinierung der operativen Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten im Bereich des Schutzes der Außengrenzen«.
Die Agentur begann ihre Operationen 2005 mit 70 Mitarbeitern und einem Budget von etwa sechs Millionen Euro. Seither stiegen nicht nur die finanziellen und personellen Ressourcen der Grenzschutzbehörde in einem schwindelerregenden Ausmaß, sondern auch das anfangs noch begrenzte Mandat, Befugnisse und Aufgaben der Agentur wurden substanziell erweitert.23 Die zu Beginn angedachte koordinierende und unterstützende Funktion, mit der Frontex EU-Mitgliedstaaten beim Schutz ihrer Grenzen beglücken sollte, entwickelte sich schnell zu einem operativen Einsatzschwerpunkt bei der Überwachung der Grenzen, der Rückführung illegalisierter Migrierender und der Bekämpfung krimineller Aktivitäten.
Schon 2007 wurden mit der EU-Richtlinie 863/2007 die ersten Änderungen des Frontex-Mandats vorgenommen und die Agentur dazu ermächtigt, Soforteinsatzteams für Grenzsicherungszwecke (Rapid Border Intervention Team; RABIT) in EU-Mitgliedstaaten zu entsenden, die mit einer hohen Anzahl von illegalisierten Grenzübertritten aus Drittstaaten konfrontiert waren. Die Einführung der EBGTs (European Border Guard Teams) im Jahr 2011, in denen der Agentur Grenzschutzbeamte direkt unterstellt wurden, stellten einen weiteren Schritt zu operativen Exekutivfunktionen dar. Denn von den EU-Mitgliedstaaten wird nun erwartet, dass sie ein kurzfristig einsatzbereites »ständiges Korps« von mindestens 1.500 Beamt*innen für die EBGTs bereitstellen. Die Teams können für eine Reihe von Aktivitäten eingesetzt werden: gemeinsame Operationen von Frontex, Soforteinsätze sowie Rückführungseinsätze – auch zur sofortigen Rückführung.
Frontex-Operationen stützten sich ursprünglich auf Mittel, die auf Anfrage von europäischen Ländern, EU- und Nicht-EU-Ländern, bereitgestellt wurden. 2011 erhielt Frontex die Befugnis, eigenständig Mittel von privaten Unternehmen für ihre Operationen zu leasen und zu chartern.24 Das Hauptziel bestand darin, Frontex in die Lage zu versetzen, Lücken zu schließen, die durch unzureichende Beiträge der EU-Länder entstehen und zu unerwünschten Grenzübertritten in Europa führen könnten. So erweiterte Frontex nicht nur seine Kontroll- und Überwachungsfunktion an den Grenzen, sondern entzog sich gleichzeitig der Kontrolle und Überwachung durch die EU und ihre Mitgliedstaaten.
Mit der Einrichtung des Europäischen Grenzüberwachungssystems Eurosur (European Border Surveillance System) im Jahr 2013 erhielt Frontex ein neues Instrument für Grenzkontrollen. Das Überwachungs- und Datensammelsystem setzt Drohnen, Aufklärungsgeräte, Offshore-Sensoren, hochauflösende Kameras und Satellitensuchsysteme ein, um die illegalisierte Einwanderung in die EU-Mitgliedsländer zu überwachen und das »Situationsbewusstsein [der EU-Mitgliedstaaten] und ihre Reaktionsfähigkeit an den Außengrenzen zu verbessern«. Auch die Aufgabe von Eurosur ist also weder der Schutz noch die Rettung von Leben, sondern lediglich die Überwachung. Die Agentur sammelt hierbei Daten in einem Gebiet, das weit über die Grenzen der EU hinausreicht.25
Der zunehmend repressive Charakter von Frontex zeigt sich auch in der Zusammenarbeit mit der europäischen Polizeibehörde Europol. Nach den ersten Vereinbarungen zwischen den Agenturen im Jahr 2008 wurde 2015 ein überarbeiteter Deal unterzeichnet. Entgegen allen Einwänden von Datenschützer*innen sollten von nun an die von Frontex gesammelten Informationen und Daten Europol für die Verbrechensbekämpfung zur Verfügung gestellt werden.
2016 wurde die Agentur in European Border and Coast Guard Agency umbenannt, wobei der Name Frontex weiterhin gebräuchlich bleiben sollte. In der EU-Verordnung 2016/1624 wurde die Bekämpfung und Prävention von »Kriminalität mit grenzüberschreitender Dimension« erstmals explizit unter den Zielen des überarbeiteten Mandats erwähnt und das Überwachungsportfolio ergänzt. Auch die Kompetenzen und Exekutivfunktionen der Agentur in Bezug auf Rückführungen sowie Such- und Rettungsaktionen auf dem Meer wurden im Rahmen der neuen Verordnung deutlich erweitert. Die zunehmend regulierende, überwachende und operative Rolle ermächtigte die europäische Grenzschutzagentur als repressives Organ, während sich gleichzeitig das zur Verfügung stehende Budget kontinuierlich vergrößerte. 2018 arbeiteten etwa 700 Personen bei Frontex und die finanziellen Mittel waren auf 320 Millionen Euro angestiegen. Die Mandatsänderung im Jahr 2019 führten diese Entwicklung fort. So wurden die Kompetenzen und Aufgaben der Agentur u.a. bei der Durchführung von Rückführungsmaßnahmen nochmals erweitert und die personellen und finanziellen Mittel aufgestockt.26 Ferner war die Agentur nun durch EU-Verordnung 2019/1896 in der Lage, nicht nur verschiedenste Gerätschaften und Fahrzeuge zu leasen, sondern selbst zu erwerben.
Eine der bemerkenswertesten Neuerungen betraf die territoriale Ausweitung der Operationen. Von nun an hatte die europäische Grenzschutzagentur das Mandat, operative Tätigkeiten einschließlich Exekutivmissionen in Drittstaaten ohne direkte Grenze mit einem Mitgliedstaat auszuführen und sog. Antenna Offices in Nicht-EU-Staaten zu eröffnen. Damit erweitern sich nachrichtendienstliche und Strafverfolgungsmaßnahmen durch Frontex auf einen ausgerufenen »Grenzvorbereich« von immenser Größe. Diese Expansion wird ungeachtet dessen vollzogen, dass weder die EU noch Frontex auf Territorien außerhalb der EU staatliche Hoheitsrechte ausüben dürfen. Dadurch wird eine rechtliche Einordnung von Operationen und im gegebenen Fall die Strafverfolgung europäischer Grenzbeamt*innen nahezu unmöglich gemacht. Teil dieser geopolitischen Ausweitung der europäischen Grenzüberwachung sind auch die Analyse und der Austausch von Daten mit Nicht-EU-Staaten. So ist Frontex Kooperationsvereinbarungen mit den Behörden von 18 Ländern außerhalb der EU eingegangen: Albanien, Armenien, Aserbaidschan, Belarus, Bosnien und Herzegowina, Kanada, Kap Verde, Nordmazedonien, Georgien, Kosovo, Moldawien, Montenegro, Nigeria, Russland, Serbien, Türkei, Ukraine und USA.27
Zählte das ursprüngliche Mandat von Frontex nur sechs Aufgaben, sind es mittlerweile mehr als 30. Das Budget wurde auf 1,3 Milliarden Euro pro Jahr (2021–2027) angehoben und damit die fortschreitende Militarisierung der europäischen Grenzen für die Zukunft festgelegt. Zudem soll bis 2027 ein ständiges Korps von 10.000 Grenzschutzbeamt*innen im Einsatz sein, von denen die Agentur etwa ein Drittel selbst rekrutieren kann. Damit Frontex nicht mehr auf die Bereitstellung von Material durch die Mitgliedstaaten angewiesen ist, soll die Agentur mit entsprechenden Mitteln ausgestattet werden, um ihre Ausrüstung selbst anschaffen zu können.28
Frontex steht im Zentrum der Grenzkontrolloperationen in Europa, doch trotz des drastischen Machtzuwachses besteht faktisch kaum eine Rechenschaftspflicht für die EU-Agentur. Das ist vor allem deswegen ein untragbarer Zustand, da der Einsatzbereich in vorwiegend menschenrechtlich sensiblen Bereichen liegt, in denen die Agentur nicht mit Kriminellen, sondern mit Schutzbedürftigen zu tun hat. Die EU-Agentur agiert dabei ohne unabhängige Kontrollinstanz. Die derzeitigen EU-parlamentarischen Kontrollmechanismen können getrost als zahnlose Tiger bezeichnet werden. Zuständige Ombudspersonen können z.B. keine rechtlich bindenden Urteile oder gar Sanktionen erlassen, sondern lediglich unverbindliche Empfehlungen aussprechen. Während sich die Vorwürfe in Bezug auf Menschenrechtsverletzungen durch Frontex mehren und eine erdrückende Beweislast für etwa die Beteiligung an illegalen Pushbacks* vorliegt, kann die Behörde auch juristisch kaum zur Verantwortung gezogen werden. Da die Rechtsbrüche inmitten eines Verantwortungswirrwarrs zwischen nationalen und europäischen Ebenen begangen werden, ist der Weg zu Gerichtsverfahren deutlich erschwert. Klagen vor nationalen Gerichten gestalten sich schwierig, weil sich nationale Grenzbeamt*innen hinter der Aufsichtsposition und den Anweisungen der EU-Agentur verstecken. Rechtswidrige Handlungen von EU-Agenturen wiederum können nicht vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) verhandelt werden, da die EU, anders als die einzelnen Mitgliedstaaten, die Europäische Menschenrechtskonvention (EMRK) nicht unterzeichnet hat. Vor dem Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH) sind keine sog. Individualbeschwerden zulässig, d.h., betroffene Einzelpersonen können nicht selbst vor dem EuGH klagen. Dieses rechtliche Vakuum ist kein Versehen, sondern ein wichtiger Bestandteil europäischer Abschottungspolitik und Migrationsabwehr, durch das Frontex ein menschenrechtlicher Freifahrtschein erteilt wird.
So überrascht es nicht, dass sich Frontex-Chef Leggeri unantastbar fühlt und sich vor dem EU-Parlament mit Falschaussagen begnügt, wenn es zu Anschuldigungen gegen Frontex kommt.29 Als der damaligen Frontex-Grundrechtsbeauftragten Inmaculada Arnáez im Jahr 2019 40 weitere Mitarbeiter*innen zur Seite gestellt werden sollten, entließ Leggeri Arnáez kurzerhand (ohne rechtlich dazu befugt zu sein).30 Erst im Juni 2021 stellte Frontex einen neuen Grundrechtsbeauftragten ein und besetzte die Hälfte der vorgeschriebenen 40 Stellen der Grundrechtsbeobachter*innen.31 Leggeri gab dabei offen zu, dass die Besetzung dieser Posten »keine Priorität« für ihn habe.32





























