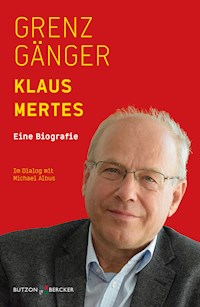
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Butzon & Bercker
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Klaus Mertes - mutig und unbequem Ein Brief löst eine Lawine aus: Als sich der Direktor des renommierten Canisius-Kollegs im Januar 2010 an mögliche Opfer von Missbrauch wandte und für seinen Orden die Verantwortung übernahm, wurde er mit einem Schlag zu einer der bekanntesten Persönlichkeiten der deutschen Kirche. Wer ist dieser Mann? Als Sohn eines hochrangigen Diplomaten kommt er schon in seiner Kindheit intensiv mit anderen Kulturen in Berührung. Der eher "konservative" Jesuitenpater verändert sich entscheidend durch den Dialog mit seinen eigenen Mitbrüdern und durch seine Arbeit als Pädagoge. Im Gespräch mit Michael Albus schildert er, was sein Leben geprägt hat und sein Handeln motiviert.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 186
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Klaus Mertes Grenzgänger
Klaus Mertes
Grenzgänger
Eine Biografie Im Dialog mit Michael Albus
Butzon & Bercker
„Orientierung durch Diskurs“ Die Sachbuchsparte bei Butzon & Bercker, in der dieser Band erscheint, wird beratend begleitet von Michael Albus, Christine Hober, Bruno Kern, Tobias Licht, Cornelia Möres, Susanne Sandherr und Marc Witzenbacher.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
ISBN 978-3-7666-2352-2
E-Book (Mobi): ISBN 978-3-7666-4314-8
E-Book (PDF): ISBN 978-3-7666-4315-5
E-Pub: ISBN 3-978-3-7666-4313-1
© 2017 Butzon & Bercker GmbH, Hoogeweg 100, 47623 Kevelaer, Deutschland, www.bube.de
Alle Rechte vorbehalten.
Umschlagabbildung: © Christliches Medienmagazin pro / Norbert Schäfer
Umschlaggestaltung: Christoph Kemkes, Geldern
Satz: Schröder Media GbR, Dernbach
Printed in Germany
Inhalt
Vorwort
Singend durch Europa gefahren
Nomadische Kindheit
Die Eliten des Evangeliums sind gefährlich
Armut, Keuschheit, Gehorsam
Ein Gespräch über drei unmögliche Dinge
Keuschheit hat etwas Kompromissloses
Herz und Verstand
Grundsätzliche Überlegungen
Der Weg ist schwierig und anspruchsvoll
Ein Gespräch zur Gottesfrage und zur Gewalt
Auf dem Teppich bleiben kann man nur, wenn man einen hat
Michael Albus
Macht ist etwas Ähnliches wie Luft: Es gibt sie eben
Sie brennen uns auf den Nägeln, weil wir sie sterben sehen
Flüchtlinge, Migration, Abschiebung
Herz und Verstand: Russland
Mitbrüder haben mir eine Brücke gebaut
Befreiungstheologie
Auf welcher Seite stehe ich?
Anatomie einer Gewalt
Überall, wo ich lebe, lebe ich in dem Bewusstsein, dass dort nicht mein endgültiger Ort sein wird
Versuch eines Fazits
Michael Albus
Biografische Notiz
Personen und Begriffe
Textnachweise
Vorwort
Im Januar 2010 hat der Jesuit Klaus Mertes einen Brief an die ehemaligen Schülerinnen und Schüler der potenziell durch sexuellen Missbrauch betroffenen Jahrgänge in den 1970er- und 80er-Jahren am Canisius-Kolleg der Jesuiten in Berlin geschrieben. Er war zu jener Zeit der amtierende Direktor des Kollegs.
Der Brief hat eine Lawine mit Fernwirkung ausgelöst und für Aufruhr inner- und außerhalb der katholischen Kirche gesorgt. Viel Vertrauen ging verloren, das bis heute nicht zurückgewonnen werden konnte. Es wurden tiefe Wunden sichtbar, die vor allem Kindern und Jugendlichen zugefügt worden waren.
Mir war Klaus Mertes schon vorher bekannt, und ich habe auf verschiedenen Feldern seine vielfältige Arbeit mitverfolgt. Ich kannte auch seinen Vater, den Diplomaten Alois Mertes, aus vielen persönlichen Gesprächen. Er war eine beeindruckende Persönlichkeit.
Ich wollte wissen, was hinter Klaus Mertes steckt, was ihn antreibt, wo er seine Wurzeln hat. Beeindruckt hatte mich immer seine durchdachte Klarheit, gerade bei schwierigen, komplexen Themen. Aber auch seine Spiritualität als Christ und Mitglied des Jesuitenordens.
Wir trafen uns an einem Sonntag in St. Blasien im Schwarzwald. Dort arbeitet Klaus Mertes seit einigen Jahren – wieder als Direktor – am Jesuitenkolleg. Einen Tag lang sprachen wir miteinander. Unser Gespräch zeichneten wir auf. Mir war es wichtig, dass der Gesprächscharakter bei der Erarbeitung dieses Buches nicht verlorengeht. Er bringt etwas von Klaus Mertes’ Persönlichkeit zum Vorschein.
Erklärungen für Personen und Begriffe – sie sind im Text jeweils mit Asteriskus (*) versehen –, eine biografische Notiz und Textnachweise befinden sich, alphabetisch geordnet, am Ende des Buches. Texteinschübe, die von mir stammen, sind entweder mit meinem Namen als solche kenntlich gemacht oder kursiv gesetzt. Alle anderen Texte stammen von Klaus Mertes.
Das Gespräch mit Klaus Mertes hat mich ermutigt. Ich traf einen Menschen, der nicht „fertig“ ist, bei dem noch alles im Fluss ist, der seine Wunden hat, aber dennoch Mut und Optimismus ausstrahlt.
Michael Albus
Singend durch Europa gefahren
Nomadische Kindheit
„Das Leben wird vorwärts gelebt und rückwärts verstanden.“ Klaus Mertes hat den Satz von Søren Kierkegaard* mehrmals während unserer Begegnung zitiert. Ich hatte den Eindruck, er passt genau zu seinem Leben, das auch – und zuweilen schnell – vorwärts gelebt wird.
Unter dem Vorzeichen einer einmal getroffenen Lebensentscheidung, Priester und Jesuit zu werden, war und ist sein Weg von vielen Wenden durchzogen. Stille Wenden waren es meist, unspektakuläre. Die aber dann urplötzlich in Entscheidungen von großer Tragweite sichtbar und wirksam wurden.
Lebenswenden, wirkliche, tief innere, zeichnen sich dadurch aus, dass wir etwas tun müssen. Sie tragen den Charakter der Unabweisbarkeit und Unausweichlichkeit. Wir können uns verweigern. Die Freiheit haben wir. Wenn wir uns verweigern, uns für Stillstand und Ruhe entscheiden, hat sich auch etwas gewendet. Verweigerungen sind kleine Tode – vor der Zeit.
Klaus Mertes hat mitten in einem reichen Land, mitten in einer wohlhabenden Kirche die Armen gesehen. Das hat ihn verändert. Unbedingt.
Darin könnte er für uns wegweisend sein. Vorausgesetzt, wir öffnen die Augen, bleiben nicht sitzen und achten auf unser unruhiges Herz.
Hören wir ihm zu. Er hat etwas zu sagen. Er zeigt etwas.
Meine frühesten Erinnerungen an die Kindheit sind verbunden mit meiner Familie, mit meinen Eltern und den Geschwistern. Vielleicht auch mit dem Meer in Marseille. Denn ich habe die ersten anderthalb Lebensjahre in Marseille verbracht. Mich überkommt heute noch ein Gefühl von Vertrautheit, wenn ich das Mittelmeer sehe und sein Geruch zu mir dringt.
Mein Vater, Alois Mertes*, war Diplomat, und deswegen habe ich die ersten sechseinhalb Jahre in Frankreich verbracht. Die ersten beiden eben in Marseille und weitere fünf Jahre in Paris. Anschließend kam Moskau.
Das war eine bewegte Kindheit. Ich war viel unterwegs. Und ich bin nachträglich sehr dankbar dafür, dass wir viele Geschwister waren. In Frankreich waren wir vier Geschwister. Mein jüngster Bruder Johannes kam in Deutschland zur Welt.
Ich erinnere mich daran, dass wir lange Autofahrten gemacht und dabei viele Lieder gesungen haben. Wir sind singend durch Europa gefahren. Später dann im Auto von Moskau nach Gerolstein in der Eifel. Hinten die Kinder, vorne meine Mutter und mein Vater. Tausende von Kilometern über die Rollbahn, die unendlich langen Strecken von Moskau über Smolensk und Minsk. Bis wir dann über die deutsch-polnische Grenze kamen und es mitteleuropäisch, ja westlich wurde. Spitze Kirchtürme statt Zwiebeltürmen.
Das Singen ist eine Grunderfahrung meiner Kindheit. Die Eltern legten darauf wert, dass wir zu Hause Deutsch sprachen und auch die deutschen Kirchenlieder kennenlernten. Morgens vor dem Frühstück haben wir oft aus dem Trierer Kirchengesangbuch gesungen. Deswegen kann ich heute noch alle Lieder des alten Trierer Gesangbuches auswendig. Manchmal flehte meine Mutter meinen Vater an: „Alois, hör doch auf! Die Kinder müssen gleich in die Schule!“ Wir haben dann blitzschnell gefrühstückt, der Vater hat uns ins Auto gepackt – das war damals in Frankreich – und hat uns zur deutschen Schule in Saint Cloud, einem Vorort von Paris, gefahren. Während dieser Fahrt haben wir dann weiter gesungen. Und wenn es im Berufsverkehr vor der Ampel einen langen Stau gab, dann hat mein Vater die ganze Autoschlange singend überholt und sich wieder vorne eingeordnet, sodass wir gerade noch pünktlich in die Schule kamen.
Also Singen! – Das hat sich bis heute durchgehalten. Für mich ist Singen ganz wichtig. Singen ist ein entscheidendes Moment des Gebetes für mich. Ich bin später Musiker geworden, war eine Zeit lang Orchestermusiker, spielte Geige und wahlweise auch Bratsche. Aber singen bedeutet mir noch mehr. Singen ist einfach eine Erfahrung von Einheit und Ganzheit. Sie ist für meine Frömmigkeit zentral. Singen ist eine große Gemeinschaftserfahrung.
Singen war auch eine meiner Urerfahrungen, als ich zum ersten Mal als kleiner Junge, im Alter von neun Jahren, eine orthodoxe Kirche betrat. Da wird ja auch nur gesungen. Nach drei, vier Minuten habe ich schon mitsummen können und dabei Laute imitiert, die ich noch gar nicht verstand: ,gospodipomiluj-gospodipomiluj-gospodipomiiiiiiiluu uuujjj‘.
Das mehrstimmige Singen ist für mich auch ein wunderbares Bild für die Einheit in der Verschiedenheit. Wenn man mehrstimmig singt, ist das eine Einheitserfahrung – trotz der unterschiedlichen Stimmen. Im Singen kann ich mich hingeben, im Singen kann ich eins werden mit den anderen. Und zugleich unterschieden bleiben. Ich empfinde eine große Dankbarkeit gegenüber meinen Eltern, dass sie mir das Singen ermöglicht haben.
Unterwegssein ist mein Wesen geworden
Das viele Unterwegssein in der Kindheit hatte etwas Nomadisches an sich. Es hat sich wieder erneuert, als ich in den Jesuitenorden eingetreten bin. Als ich zuletzt wieder vom Canisius-Kolleg hierher nach St. Blasien im Schwarzwald versetzt worden bin, fiel mir der Satz zu: „Wir Jesuiten leben in Zelten, nicht in Klöstern.“ Das ist auch so. Überall, wo ich lebe, lebe ich in dem Bewusstsein, dass dort nicht mein endgültiger Ort sein wird. Zwischendurch habe ich mich immer wieder sehr nach Heimat gesehnt.
Eine tiefe Heimaterfahrung ist für mich verbunden mit der Eifel, mit Gerolstein. Mein Vater stammt von dort. Die Ferienfahrten in der Kindheit hatten immer Gerolstein zum Ziel, die Heimatstadt meines Vaters.
Die Gerolsteiner Welt erlebte ich als eine „heile Welt“ – das meine ich gar nicht abschätzig –, und ich glaube, dass sie das in gewisser Weise auch für meinen Vater war und blieb, obwohl er sich von dieser Welt löste und sicherlich auch manche ihrer Schattenseiten sah. Es war eine Welt von Bauern, Handwerkern und Kommunalbeamten, die in vergleichsweise einfachen Verhältnissen lebten, aber ein ausgeprägtes Selbstwertgefühl hatten. Es war auch eine kultivierte Welt, wobei neben der Schule die Kirche eine wesentliche Rolle als Kulturträgerin und -vermittlerin spielte. Eifeler sind Grenzlandbewohner. Man blickt nach Westen, nach Luxemburg, nach Belgien, nach Frankreich. Hier gibt es übrigens eine wichtige Gemeinsamkeit zur Herkunft meiner Mutter. Sie stammt aus dem Saarland, also ebenfalls aus einer Grenzregion. Ihre Familie gehörte einem anderen, einem urbanen und kaufmännischen Milieu an. Ihr Vater war Internist und Chefarzt. Er hatte als Katholik in einer Zeit studiert, als in den Fakultäten die Ansicht verbreitet war, dass katholischer Glaube und modernes Weltbild miteinander unvereinbar seien. Mit diesen Fragen hatte er sich intensiv beschäftigt. Meine Mutter ist davon geprägt worden, und ich erinnere mich, dass mein Vater mir ein paarmal gesagt hat, dass sie ihm dadurch neue Horizonte eröffnet habe.
Als ich 1966 als Elfjähriger wieder zurück nach Deutschland kam und wir uns in Bonn ansiedelten, war dann Bonn wieder eine Heimat für mich. So kann ich heute sagen: Ich bin ein Rheinländer.
Noch einmal zurück zum Nomadischen. Es besteht ein entscheidender Unterschied zwischen Zelten und Wohnen. Zwischen Nomadentum und Sesshaftigkeit. Unsere Religion hat nomadische Ursprünge. Sie kommt aus der Wüste, wo Hirtenstämme von Weidegrund zu Weidegrund und von Wasserstelle zu Wasserstelle ziehen, wo kein Raum ist für große Hierarchien, dafür aber die tägliche Erfahrung des Angewiesenseins auf den eigenen Clan in einer oft lebensfeindlichen Umgebung gemacht wird.
Mich hat auch an der Person Jesu immer fasziniert, dass er auf der Straße gelebt hat. Den Satz von ihm: „Die Füchse haben ihre Höhlen und die Vögel ihre Nester; der Menschensohn aber hat keinen Ort, wo er sein Haupt hinlegen kann“ (Lukas 9) habe ich nicht einfach als einen Klagesatz verstanden, sondern als eine Selbstbeschreibung seines Lebensstils. Er ist eben gewandert. Und die ersten Jesuiten haben ihr Ideal auch über das Wanderapostolat verwirklicht. Das Weitergehen, das Leben in Zelten ist mir wichtig geworden. Ich bin selbst viel gewandert. Durch Frankreich bis nach Santiago de Compostela. Diese Wanderung habe ich im Zeitraum von vier Jahren mit Freunden zusammen unternommen.
Zelten, Unterwegssein, das ist jesuitischer Lebensstil. Ich habe mich daran gewöhnt. Es ist mein Wesen geworden. Deswegen was es auch 2011 okay für mich, Berlin zu verlassen und nach St. Blasien zu gehen.
Über die Prägungen, die ich im Elternhaus erfahren habe, gäbe es viel zu sagen. Es ist schwer zu sagen, wie viel Anteil daran mein Vater hatte, wie viel Anteil meine Mutter. Beide waren sehr unterschiedlich, beide ergänzten einander auch. Mein Vater war in der Öffentlichkeit sichtbar, meine Mutter nicht. Das verleitete manche dazu zu glauben, der Einfluss meines Vaters sei größer gewesen. Aber so ist das nicht. Der Glaube war eine starke gemeinsame Basis. Beide hatten ein sehr reflektiertes Verhältnis zum eigenen Glauben. Bei meinem Vater war es eher geprägt durch den Blickwinkel klassischer Philosophie und Theologie, wobei er sich eine urtümliche Lust am Glauben bewahrte. Bei meiner Mutter war es eine sehr große Feinfühligkeit, psychologische Reflexion und Sinn für moderne Kunst und Naturwissenschaft.
Der Vater – eine starke, charismatische Persönlichkeit
Mein Vater stammte, wie gesagt, aus der Eifel. Er war der Jüngste von fünf Kindern. Eine Schwester von ihm ist ganz früh gestorben. Er war tief geprägt durch den Eifeler, den Gerolsteiner Katholizismus, durch die Begegnung mit den Pfarrern, durch die Bildungswelten, die ihm im Regino-Gymnasium in Prüm eröffnet wurden.
Dann kam der Zweite Weltkrieg. Die Immunisierung gegen den Nationalsozialismus hat er – wie er immer wieder erzählte – besonders durch die Kirche erfahren. Die Verbundenheit mit der Diözese Trier blieb erhalten, auch dadurch, dass sein älterer Bruder Johannes, mein Patenonkel, Priester der Diözese Trier war. Auf Wunsch der Familie hielt 1985 der damalige Bischof von Trier, Hermann Josef Spital*, das Requiem, die Totenmesse, für meinen Vater im Bonner Münster.
Nach dem Krieg kam mein Vater nach Bonn. Dort war die Erfahrung der katholischen Studentengemeinde ein wichtiger Punkt.
Fasziniert war er auch von der europäischen Frage, vor allem durch die deutsch-französische Aussöhnungsbewegung. Er ging mehrfach mit bei den Studentenwallfahrten nach Chartres. In Frankreich hat er auch meine Mutter kennengelernt, die aus dem Saarland stammte.
Für mich als Sohn war er eine starke, ja charismatische Persönlichkeit. Er war intellektuell unglaublich beweglich und präzise. Wir haben zu Hause schon sehr früh, bei Tisch, über theologische und philosophische Fragen gesprochen. Aber seine Intellektualität war zugleich geprägt von einer ganz starken religiösen Bindung. Wenn wir unter dem Weihnachtsbaum saßen, hat er uns eine halbe Stunde lang aus den Werken Romano Guardinis* vorgelesen. Romano Guardini war einer der großen Namen für ihn. Ebenso Josef Pieper*, ein bedeutender katholischer Philosoph zu jener Zeit.
Er ist dann in den diplomatischen Dienst eingetreten. Seine Leidenschaft wurde das Thema der Europäischen Vereinigung.
Studiert hat er Romanistik und Geschichte. Später war man oft der Auffassung, er sei Jurist, weil er immer stark völkerrechtlich argumentiert hat. Aber er war eben Romanist und Historiker.
Das andere große Thema, das ihn früh schon gepackt hat, war die deutsch-israelische Aussöhnung.
Die Erneuerung des Zweiten Vatikanischen Konzils* hat er innerlich mitvollzogen, selbst wenn ihm der Abschied von geliebten, gewohnten Formen auch manchmal weht tat. Das Konzil spielte bei uns zu Hause eine große Rolle.
Dann auch das Mitgehen mit der Ökumenischen Bewegung. Martin Luther* war bei uns ein positiv besetzter Name. Luthers Gnadentheologie hat ihn sehr beeindruckt. Als es möglich wurde, dass wir in Russland zur Kommunion in der russisch-orthodoxen Kirche gehen konnten, hat ihn das tief bewegt. Vorher hat er bei einem orthodoxen Priester gebeichtet. Das war für ihn eine wichtige ökumenische Erfahrung.
In Russland war für ihn noch einmal ganz tief und wichtig die Auseinandersetzung um die europäische Einigung. Vor allem die Überwindung der Spaltung Deutschlands. Da war er ganz auf der Seite Konrad Adenauers. Auch in der Frage der Westbindung. In der Frage der Wiederbewaffnung der Bundesrepublik hat er die Position Adenauers übernommen. Das führte zu einem inneren Bruch mit dem später so genannten Linkskatholizismus, der vor allem durch Walter Dirks* verkörpert wurde. Das Gespräch über diese Themen blieb uns in der Familie auch Jahre später erhalten, insbesondere in den Zeiten der Friedensbewegung der 1970er- und 80er-Jahre: Wie kann ein wohlverstandener christlicher Pazifismus, und damit das Gebot der Feindesliebe und der Gewaltlosigkeit, verbunden und versöhnt werden mit einer Politik, die einen politischen Gebrauch der Waffen, wie es das Abschreckungsszenario der Siebziger-, Achtziger- und Neunzigerjahre des letzten Jahrhunderts vor Augen führte, mit einschloss? Oder ist das unvereinbar? Wie ist das ethisch zu rechtfertigen? – Das war für uns ein ganz großes und wichtiges Thema.
1966 ist er von Moskau nach Deutschland zurückgekehrt. 1969 kam Willy Brandt* an die Regierung. Das war aus seiner Sicht eine Wende. Er wurde dann von Helmut Kohl* als Fachmann für Ost-West-Beziehungen „entdeckt“ und zum Bevollmächtigten von Rheinland-Pfalz beim Bund ernannt, um vonseiten der CDU-Länder im Bundesrat Einfluss zu nehmen auf die Debatte um die Ratifizierung des Moskauer und des Warschauer Vertrages. Die Auseinandersetzung um die Ostpolitik war für ihn eine sehr bewegte Zeit. Sie schlug auch bei uns in der Familie hohe Wellen. Ich erinnere mich an einen Abend, an dem das Dokument des Viermächteabkommens über Berlin von 1971 auf dem Tisch lag. Den englischen Text des Abkommens hatte er meinem Bruder Michael gegeben. Mir gab er die offizielle Übersetzung der Bundesregierung. Er selbst saß vor dem Text im „Neuen Deutschland“, der SED-Parteizeitung der DDR. Ich musste den offiziellen Text vorlesen. Und immer, wenn in der Übersetzung im „Neuen Deutschland“ ein anderer Begriff auftauchte, wurde das vermerkt und diskutiert, wie er in den jeweils anderen Übersetzungen gebraucht und angewandt wurde. Zum Beispiel der Begriff ,ties‘, Bindung. West-Berlin ist eine Stadt mit ,ties‘ zur Bundesrepublik Deutschland. In der bundesrepublikanischen Übersetzung stand ,Bindungen‘, und in der DDR-Übersetzung stand, dass West-Berlin eine Stadt mit ,Verbindungen‘ sei. Das war natürlich eine andere Gewichtung. Sprache war für meinen Vater von zentraler Bedeutung. Er war der Auffassung, dass sich Politik an Sprache entscheidet. Deswegen war er auch ein Gegner von Formelkompromissen. Aber letztlich musste er auch einsehen, dass Formelkompromisse unumgänglich waren, wenn man politisch weiterkommen wollte.
In dieser Zeit hat er sich auch entschieden, in die praktische Politik zu gehen. Er hat zum ersten Mal 1972 im Eifeler Wahlkreis 153 kandidiert. Von da ab hieß er im politischen Sprachgebrauch nur noch „Mertes (Gerolstein)“. Dann wurde er außenpolitischer Fachmann der CDU/CSU-Bundestagsfraktion. Als dann 1982/83 die Wende von Helmut Schmidt* zu Kohl kam, wurde er Staatsminister im Auswärtigen Amt bei Hans-Dietrich Genscher*, dem Außenminister.
Harmonie war wichtig
Mein Vater hat meine Mutter, wie schon erwähnt, in Paris kennengelernt. Das war bei einer Diskussion in der katholischen Studentengemeinde von Paris über die Frage, ob das Saargebiet wieder unter deutsche Hoheit kommen sollte. Mein Vater war dafür, meine Mutter auch. In dieser Hinsicht gab es also kein Problem mit der Familie meiner Mutter. Aber meine Mutter erzählt gerne die Geschichte, dass mein Vater von ihrer Familie zunächst ein bisschen skeptisch betrachtet wurde; die Eifel galt im vergleichsweise weltläufigen Saarbrücken als ziemlich rückständig. Doch als mein Vater sich dann ans Klavier setzte und Schubert-Lieder sang, war das Eis gebrochen.
Mein Vater war ein herzlicher Mensch. Die Familie war sein Refugium, sein Zufluchtsort. Deswegen war ihm auch Harmonie in der Familie wichtig. Das konnte dazu führen, dass Konflikte in der Familie, die nicht ausbleiben, von ihm eher als emotionale Belastung empfunden wurden. Da war eine seiner Grenzen. Meine Mutter war da stärker. Sie konnte emotionale Konflikte auf ihren sachlichen Kern zurückführen und so entschärfen.
Eine oft wiederkehrende Meinungsverschiedenheit meiner Eltern bezog sich darauf, dass mein Vater durch seinen Beruf oft außer Haus und für die eigene Familie kaum da war. Viel später habe ich das, obwohl ich sehr stolz auf meinen Vater war, auch als einen Mangel empfunden. Ich erinnere mich, dass er mich zwei, drei Wochen nach meinem mündlichen Abitur fragte, wann ich denn eigentlich mein Abitur mache. Das hat mich nicht verletzt, sondern es hat mich eher belustigt. Wenn ich heute die narzisstischen Festspiele rund um das Abitur sehe, muss ich sagen: Das ist ja auch nicht mehr normal. – Die Ferne des Vaters war sicher ein wichtiger Punkt. Andererseits war er, wenn er dann einmal da war, so stark präsent, dass es vielleicht auch gut war, dass er nicht zu oft im Hause war.
Mein Vater und meine Mutter haben sich geliebt, ganz sicher. Das war für uns in der Familie ohne Zweifel. Aber: Es war diskret.
Die Mutter – Im entscheidenden Augenblick Leben retten
Meine Mutter – sie ist jetzt 88 Jahre alt – stammte aus einer katholischen Saarbrücker Familie. Ihr Vater war, wie gesagt, Arzt. Meine Großmutter mütterlicherseits war eine gute Pianistin. Eine Erfahrung mit meiner Mutter war prägend: Einmal spazierten wir, in der Pariser Zeit, durch den Bois de Boulogne. Da fiel meine Schwester in den See. Meine Mutter ist, ohne zu zögern, in ihren Kleidern ins Wasser gesprungen und hat sie gerettet. Das ist ein unauslöschliches Bild der Erinnerung: dass sie im entscheidenden Augenblick Leben rettet.
Meine Mutter ist eine Frau, die sich nicht gerne in der Öffentlichkeit zeigt. Positiv gesagt: Sie ist nicht eitel. Sie ist zurückhaltend. Sie hat immer Wert darauf gelegt, dass wir Kinder „normal“ bleiben, dass wir uns nicht als die scheinbar tolle Familie inszenieren, nicht protzig auftreten. Darauf achtete sie. Es war ihr eher unangenehm, wenn mein Vater voller Stolz seine Kinder in jeder Kirche, in die wir reinkamen, präsentierte, und sagte: „Wir können auch gerne gregorianische Choräle während des Gottesdienstes singen.“ Da war sie zurückhaltend, ja scheu.
Sie brachte die Themen in die Familie ein, die meinem Vater fremd waren. Nachdem mein Vater in die Politik gegangen war, machte sie eine Ausbildung in der Telefonseelsorge und hat dann dort auch praktisch gearbeitet. Dabei ist sie natürlich auf Lebensthemen gekommen, die in unserer Familie zuvor gar nicht groß debattiert wurden. Zuvor ging es um Außenpolitik, Philosophie, Thomas von Aquin*, Guardini, Luther und „renouveau catholique“*. Für Fragen wie Sexualität, Homosexualität, voreheliche Beziehungen, zerbrochene Ehen hatte meine Mutter ein Ohr. Deswegen wurde sie für mich über Jahre hinweg eine sehr wichtige Gesprächspartnerin. Ich konnte mit ihr Fragen besprechen, die meinen Vater – so sehe ich es im Nachhinein – überfordert hätten.
Wenn mein Vater einmal eine Illustrierte, eine „Quick“ oder einen „Stern“ kaufen musste, weil dort ein wichtiger politischer Artikel stand, dann hat er diesen Artikel ausgeschnitten und den Rest wegen der Bikini- und Nacktbilder gleich in den Müll geworfen. Manchmal lagen wir Geschwister abends vor dem Fernseher und guckten uns irgendeinen Film an. Dummerweise kam mein Vater immer bei den Stellen rein, wo sich Mann und Frau knutschten, und sagte: „Müsst ihr euch so etwas angucken?“ Er lebte in den Diskretions- und Schamgrenzen seiner Zeit, die immer mehr zu schwinden begannen.
1985 ist mein Vater ganz plötzlich, drei Tage nach einem Schlaganfall, gestorben. Selbstverständlich war das für uns alle ein Einschnitt. Was der Tod eines Vaters bedeutet, begreift man erst langsam, im Laufe von Jahren. Direkt danach beschäftigten uns viele Fragen. Die ganze Ernte dieses Lebens wurde für uns angesichts seines Todes auf einmal sichtbar: Die vielen Kondolenzschreiben, die Besuche, das Bemühen, das Erbe meines Vaters zu sichern. Wir haben das Requiem gemeinsam vorbereitet. Die Sprache des Glaubens der katholischen Kirche hat uns dabei die Vorlage gegeben.
Meine Mutter ist dann relativ bald aus dem großen Familienhaus in Wachtberg-Pech bei Bonn ausgezogen in eine Wohnung in Bad Godesberg. Das empfand ich immer als einen starken Ausdruck für ihre Auffassung, dass das Leben weitergeht. Sie trauerte, aber sie haderte nicht. Sie konnte mit Dankbarkeit auf alles Gute zurückblicken, das sie im gemeinsamen Leben mit meinem Vater erfahren hatte.
Die Religiosität meiner Mutter ist, wie die des es Vaters war, ganz tief. Sie ist aber zugleich angefochtener. Und darin ist sie mir dann auch wieder näher.





























