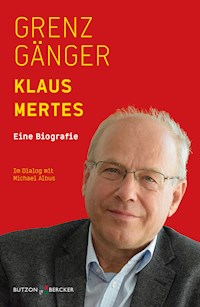Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verlag Herder
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Im Januar 2010 thematisierte Rektor Klaus Mertes in einem Brief an frühere Berliner Jesuitenschüler Kindesmissbrauch und Vertuschung. Damit löste er eine Auseinandersetzung der Öffentlichkeit mit Machtmissbrauch gegenüber Schutzbefohlenen aus, die weltweite Kreise zog. Ein schmerzhafter Prozess hat die Kirche erschüttert und verändert. Auch in der Gesellschaft ist die Wahrnehmung des Problems gewachsen und begannen Schritte der Versöhnung und der Prävention. Pater Mertes erzählt und reflektiert den Gang der Ereignisse, analysiert Gründe und Hintergründe der beispiellosen Vertrauenskrise und zeigt Perspektiven für heilsame Reformen der Kirche auf.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 273
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Klaus Mertes
Verlorenes Vertrauen
Katholisch sein in der Krise
Impressum
© Verlag Herder GmbH, Freiburg im Breisgau 2013
Alle Rechte vorbehalten
www.herder.de
Umschlaggestaltung: Guter Punkt, München
Umschlagmotiv: © dpa/picture-alliance
ISBN (E-Book) 978-3-451-80016-0
ISBN (Buch) 978-3-451-34172-4
Inhalt
Zu diesem Buch
TEIL IDie Vertrauenskrise
I. Vorbemerkung
II. Mein Weg
1. Vorerfahrungen
2. Die Veröffentlichung des Briefes
2.1 Lob und Tadel
2.2 Ausweichmanöver
2.3 Wir
3. Begegnungen mit Opfern
4. Kirche
4.1 Der katholische Geschmack
4.2 Kirche der Opfer
4.3 Neuentdeckung der Kirche
5. Mitwissen und Verantwortung
TEIL IIDas Problem mit der Macht
I. Krisensymptome
1. Thematische Erweiterung
2. Gesamtkirchliche Dimension
3. Hasssprache
4. Denunziation
5. Taubheit
II. Machtstrukturen
1. Vorbemerkung: Mithörende Opferperspektive
2. Macht in der Kirche
3. Anmerkungen zum katholischen Zentralismus
4. Priestertum
4.1 Die besondere Fallhöhe
4.2 Priesterliche Vollmacht
5. Eliten und Sekten
5.1 Elitebewusstsein und das selbstverständlich Christliche
5.2 Exkurs: Die Eliten des Evangeliums
6. Gehorsam
6.1 Der Begriff „Glaubensgehorsam“
6.2 Notwendige Asymmetrien
6.3 Willens- und Verstandesgehorsam
6.4 Ultimative Gehorsamsforderungen
7. Zentralismus abbauen
8. Subsidiäre Strukturen stärken
III. Macht und Sexualität
1. Herzlosigkeit
2. Unkeuschheit
2.1 Exkurs 1: „Reinheit“
2.2 Exkurs 2: Sexualität und Nächstenliebe
3. Frauenfeindlichkeit
4. Homophobie
5. Sprachlosigkeit
TEIL IIIVertrauensressourcen
I. Theologische Vergewisserung
1. Was ist katholisch?
1.1 Der Begriff „katholisch“
1.2 „Katholisch“ als Konfessionsbegriff
1.3 Kirchliches Lehramt
2. Kirche und Inkarnation
2.1 Illibration und Inkarnation
2.2 Exkurs: Geist und Text, Altes und Neues
3. Reich Gottes
3.1 Die Armen und die Sünder
3.2 Frauen und Kinder
3.3 Überwindung der Gewalt
II. Persönliche Vergewisserung
1. Dankbarkeit
2. Sehnsucht
3. Glauben
4. Eucharistie
III. Neue Bewegungen
1. Reformbewegungen
2. Stolpersteine
3. Überraschungen aus Rom
Anhang
Der Brief vom 20. Januar 2010
Anmerkungen
Zum Autor
Zu diesem Buch
Dieses Buch ist in den drei Jahren nach dem Januar 2010 entstanden, als der Missbrauchsskandal in der katholischen Kirche in Deutschland aufbrach und eine schon vorhandene Vertrauenskrise in der Kirche um eine zusätzliche Dimension steigerte. Mit dem Rücktritt von Papst Benedikt XVI. und der Wahl von Papst Franziskus eröffnen sich seit dem Frühjahr 2013 neue Perspektiven. Vor diesem Hintergrund merke ich mit Dankbarkeit, dass manches von dem, was ich in diesem Buch über das verlorene Vertrauen in der Kirche geschrieben habe, zwar nicht falsch, aber doch – erfreulicherweise – unvollständig ist, weil Vertrauen neu zu wachsen beginnt. So hoffe ich auch, dass einiges, was in diesem Buch noch im Präsens steht, bald zur Vergangenheit gehören wird; und dass die Kritik am „theologischen Narzissmus“, die Kardinal Bergoglio vor seiner Wahl zum Papst formulierte, tatsächlich zu einer Umkehr zu den Armen, auch zu den Armen in der Kirche führt.
Die Sorge der Kirche um sich selbst, um ihren guten Ruf, um ihr Erscheinungsbild, um ihre „Reinheit“ und um ihren eigenen Fortbestand entfremdet die Kirche schließlich auch von sich selbst. Wenn die Kirche diesen Institutions-Narzissmus nur überwinden wollen würde, um sich selbst aus der gegenwärtigen Glaubwürdigkeitskrise zu retten, würde sie scheitern. Kein Münchhausen kann sich am eigenen Schopf aus dem Sumpf ziehen. Deswegen ist der Hinweis des neuen Papstes auf Franziskus von Assisi – der übrigens auch mit am Anfang des Bekehrungsweges von Ignatius von Loyola stand – wegweisend. Papst Franziskus deutet damit letztlich auf Jesus hin, dessen Begegnung mit den Armen und Sündern den Ursprung der Kirche ausmacht und der der Kirche seine Gegenwart zunächst und zuerst in der Begegnung mit den Armen und Sündern verheißen hat.
Ich danke den vielen Menschen, die sich seit 2010 bei mir gemeldet haben, um mir ihre Geschichten in der Kirche und mit der Kirche zu erzählen – angefangen bei den drei ehemaligen Schülern des Canisius-Kollegs, die mich im Januar 2010 aufsuchten. Ich danke den vielen Gesprächspartnern, die mir insbesondere in den letzten drei Jahren geholfen haben, mit den gehörten Geschichten zu leben, sie zu reflektieren und aus ihnen neue Erkenntnisse zu schöpfen. Ich danke Bernd Ulrich und Rüdiger Merz für die kritische Gegenlektüre des Manuskripts und weiterführende Anregungen. Schließlich bin ich dankbar für die vielen Geschenke von Freundschaft und Ermutigung, die ich in den letzten drei Jahren empfangen habe. Das, wofür ich noch nicht dankbar sein kann, vertraue ich getrost – entsprechend dem schönen Wort von Søren Kierkegaard – einem späteren geistlichen Rückblick an: „Das Leben wird vorwärts gelebt und rückwärts verstanden.“
Ostern 2013
P. Klaus Mertes SJ
TEIL IDie Vertrauenskrise
I. Vorbemerkung
Das Vertrauen ist weg. Das ist bis in innerste Kreise hinein die Lage in der katholischen Kirche. Bei einigen ist es ganz weg, andere ringen darum, es nicht endgültig zu verlieren. Mit dem überraschenden Rücktritt von Papst Benedikt und der ebenso überraschenden Wahl eines neuen Papstes, der sich nach Franziskus von Assisi nennt, keimt zwar auch neue Hoffnung auf. Doch umso mehr wird die Dimension der Aufgabe deutlich, um die es in der Kirche geht: Es geht um den Aufbau von neuem Vertrauen. Der Weg dahin wird aller Wahrscheinlichkeit nach lang und sicherlich nicht konfliktfrei sein.
Vertrauenskrise – damit meine ich nicht nur, dass Menschen außerhalb der Kirche der Kirche nicht mehr trauen, ihr nichts oder doch immer weniger zutrauen. Diesen Aspekt des Vertrauensverlustes gibt es natürlich auch.1 Es geht mir aber genauso um das Vertrauen innerhalb der Kirche, der Katholiken untereinander. Der Vertrauensverlust innerhalb der Kirche und die Vertrauens- oder auch Glaubwürdigkeitskrise der Kirche für Außenstehende hängen zusammen. Zerstrittene Parteien sind nicht attraktiv. Genauso wenig ist eine Kirche attraktiv, in der die Gläubigen einander nicht mehr vertrauen, sondern zerstritten sind. „Seht, wie sie einander lieben“ – das war in den Anfangszeiten das Erscheinungsbild der Christenheit vor den Augen der Welt, mit dem sie für sich werben konnte.2 In der katholischen Kirche geschieht seit längerer Zeit das Gegenteil – ganz zu schweigen von der Zerstrittenheit der christlichen Konfessionen untereinander.
Indiz für die Vertrauenskrise in der Kirche ist die Zunahme von Misstrauen untereinander, das Lagerdenken, die Reduzierungen strittiger Fragen auf Machtfragen. Die Leitung der Kirche ist von dieser Vertrauenskrise nicht ausgenommen, im Gegenteil: Je deutlicher die Vertrauenskrise wird, desto mehr entpuppt sie sich auch als eine Leitungskrise. Die Vatileaks-Enthüllungen sowie die offen ausgetragenen Gegensätze im Kardinalskollegium nach dem Rücktritt von Papst Benedikt haben vor den Augen der Welt sichtbar gemacht, dass die Kirchenleitung in Rom von der Vertrauenskrise nicht ausgenommen ist: statt Vertrauen Intrigen und Machtkämpfe nach innen und verzweifelte Imagepflege nach außen.3
Vertrauen ist keine Einbahnstraße. Auch im Verhältnis von Kirchenvolk und Kirchenleitung fließt Vertrauen nicht nur von unten nach oben, sondern auch von oben nach unten. Vertrauenskrise der Leitung bedeutet daher nicht nur, dass die Herde den Hirten zu wenig vertraut, sondern auch umgekehrt, dass die Hirten der Herde mit Misstrauen begegnen. Erfahrungen dieser Art haben viele Katholiken und Ortskirchen in den letzten Jahren gemacht, nicht zuletzt auch im Zusammenhang mit Bischofsernennungen.4 Vertrauen der Leitung zum Kirchenvolk ist aber unverzichtbar für die Möglichkeit vertrauensvoller Beziehungen innerhalb des gesamten Systems Kirche. Gerade von der christlichen Lehre her müsste dies einsichtig sein, die man ja auch in den Satz übersetzen kann: Gott schenkt Vertrauen – und zwar als Erster. Leitung muss mit Vertrauen beginnen. Deswegen beeindruckt die Geste von Papst Franziskus zu Beginn seines Pontifikates, wenn er sich vor dem Kirchenvolk verneigt und um dessen Segensgebet bittet, bevor er selbst es segnet. In der Logik dieser Geste liegt die Hoffnung auf eine Kirchenleitung, die sich selbst neu mit Vertrauen riskiert, statt sich oben zu verschanzen, sich Informationen über die Basis aus informellen Kanälen zu besorgen und Leitungspositionen untereinander nach Loyalitäts- statt nach Qualifikationskriterien zu verteilen.
Durch den Missbrauchsskandal ist das Vertrauen in der Kirche nachhaltig um eine weitere Dimension erschüttert worden. Alois Glück, der Vorsitzende des Zentralkomitees der deutschen Katholiken, formulierte im November 2010: „Ausgehend von der Aufdeckung zahlreicher Fälle sexuellen Missbrauchs aus den vergangenen Jahrzehnten hat die Kirche einen beispiellosen Vertrauensverlust erlitten, der bis in ihre Mitte reicht.“5 Der Blick über den deutschen Tellerrand nach Irland, Holland, Österreich, Belgien und in die USA zeigt, dass es hier um ein flächendeckendes Thema geht, das noch weitere Länder betreffen wird, in denen die kirchliche und gesellschaftliche Schweigemauer noch nicht durchbrochen ist. Was entscheidend zum Vertrauensverlust in der Kirche beigetragen hat, ist das Versagen von Vertretern kirchlicher Institutionen gegenüber den Opfern – indem sie ihnen seinerzeit den Schutz versagten, den sie brauchten, und stattdessen die Täter schützten, insbesondere dann, wenn diese zum Klerus gehörten. Durch das Aufdecken der Missbräuche wurde auch dieses Versagen aufgedeckt, nicht nur die Taten der Täter. Seitdem stehen beträchtliche Teile der Kirchenleitung vor den Augen der Welt und vor den Augen der eigenen Leute nackt und unansehnlich da.
Die Scham in der Kirche über die eigene Leitung gehört zum Vertrauensverlust, der „bis in ihre Mitte reicht“. Der innere Kern der Gläubigen ist durch das Vertuschen und Verdecken der Missbräuche getroffen: treue Kirchenbesucher, einfache Leute, engagierte Gläubige, die das gebrochene Verhältnis von Bischöfen und Personalverantwortlichen zur Wahrheit nicht fassen können, wie es im Zusammenhang mit den Missbrauchsskandalen sichtbar wurde. Sie fühlen sich belogen, und zwar rückblickend manchmal über Jahrzehnte hinweg. Die ganze eigene Geschichte mit der Kirche und mit der kirchlichen Hierarchie erscheint plötzlich in einem anderen Licht. Was soll man auch sagen, wenn man sich selbst bereitwillig in die kirchliche Disziplin gefügt hat – im Vertrauen auf die Autoritäten, die diese Disziplin festlegen und nötigenfalls auch disziplinarisch einfordern –, und dann entdeckt, dass die Autoritäten sich selbst Ermessensspielräume gestatten, die weit über das Erlaubte hinausgehen, und dies im Interesse des eigenen Ansehens beziehungsweise des Ansehens der Institution? Papst Benedikt XVI. räumte bei seinem Deutschlandbesuch im September 2011 ein, dass solche Erfahrungen zu tiefen Entfremdungen gegenüber der eigenen Kirche führen: „Ich kann verstehen, dass jemand im Licht solcher Informationen – vor allem wenn sie einen nahestehenden Menschen betreffen – sagt: Das ist nicht mehr meine Kirche.“6 Kein Wunder, dass das Aufdecken der Missbräuche bei fast allen Gläubigen tiefes Nachdenken über die eigene Geschichte mit der Kirche auslöste, mit einer neuen und größeren inneren Freiheit gegenüber den Autoritäten.
Der Umgang der Kirchenleitung mit der seit 2010 aufgedeckten Wahrheit ist ein aktuell weiter wirkender Faktor, der Vertrauen in der Kirche beschädigt. Sichtbar wurde dies erneut im Januar 2013, als die Deutsche Bischofskonferenz den Vertrag mit dem Kriminologischen Forschungsinstitut Niedersachsen aufkündigte, ihrerseits mit dem Hinweis auf das zerbrochene Vertrauensverhältnis zu dessen Leiter. Was immer die Gründe für das Zerwürfnis gewesen sein mögen, es zeigt sich jedenfalls, dass auch gut gemeinte Projekte zur Wiedergewinnung von Vertrauen das Gegenteil von dem bewirken können, was sie beabsichtigen.
Glaubwürdigkeit entscheidet sich am Verhältnis zur Wahrheit, gerade auch dann, wenn sie bitter schmeckt. Der Feind der Wahrheit ist das Imagedenken. Schon im Evangelium beklagt Jesus die Heuchelei, das Festhalten am Schein und das Verstecken des Seins. Je mehr sich die Leitung in der Vertrauenskrise damit befasst, die Fassade zu reparieren, desto tiefer manövriert sie sich in die Entfremdung gegenüber den eigenen Leuten hinein. Ich sehe drei destruktive Weisen, mit der Differenz von Sein und Schein umzugehen: Die jämmerliche Weise ist die, die Differenz zwar wahrzunehmen und über sie zu klagen, aber nicht die Kraft zur Konsequenz aus dieser Einsicht aufzubringen. Die zynische Variante besteht darin, die Differenz wahrzunehmen und sie zu bejahen, also am Vorrang des Images vor der Wahrheit festzuhalten. Die sektiererische Weise schließlich besteht darin, die Differenz nicht mehr wahrzunehmen, sondern den Schein tatsächlich für das Sein zu halten. Das ist das Gefühl der kleinen Gruppe, die sich als verfolgte Minderheit begreift, obwohl sie gar nicht verfolgt wird. Es besteht durchaus die geistliche Gefahr, den Vertrauensverlust der Kirche bei vielen Menschen als Angriff auf die Kirche zu erleben, wenn man den Schein für das Sein hält. Wenn sich Gruppierungen, die so empfinden, auf der Leitungsebene durchsetzen würden, dann wäre verstärkt damit zu rechnen, dass Bischöfe ernannt würden, die in einer Sonderwelt fernab von der Lebenswirklichkeit der „Herde“ leben und ihr mit Misstrauen begegnen.
Durch die Vertrauenskrise gerät für viele Katholiken ihr Katholisch-sein in die Krise. Ich schlage vor, den Spieß umzudrehen und zu fragen: Was bedeutet Katholisch-sein in der Krise? Anders gefragt: Wie hilft gerade in der Vertrauenskrise das Katholisch-sein – das katholische Kirchenverständnis, die katholisch geprägte Frömmigkeit, das in der Kirche immer neu auszulegende Evangelium –, den Vertrauensverlust auszuhalten, Schritte nach vorne zu machen, die Mitchristen in der katholischen Kirche und darüber hinaus in der ökumenischen Christenheit neu zu entdecken und mit ihnen in das größere Gottvertrauen einzutreten? Den Jammerern, Zynikern oder Sektierern soll die Kirche jedenfalls nicht überlassen werden. Vielleicht verhält es sich ja sogar folgendermaßen: Dass die Kirche mit ihrer Vertrauenskrise vor den Augen der Welt derzeit so unattraktiv dasteht, könnte ein Auftrag Gottes an die Kirche sein – ein „Zeichen der Zeit“, eine Gelegenheit, der Welt zu zeigen, wie Vertrauen neu werden kann. Diese Orientierung braucht die Welt tatsächlich auch für ihre eigenen Probleme, die sie belasten und zerreißen.
II. Mein Weg
Als ich am 20. Januar 2010 einen Brief an circa 600 Personen schrieb (vgl. den Anhang dieses Buches), von denen ich annehmen musste, dass sie als Jugendliche in den 70er- und 80er-Jahren potenziell Opfer von sexualisierter Gewalt am Berliner Canisius-Kolleg geworden waren, ahnte ich nicht, was für eine Lawine dieser Brief auslösen würde. Meine Perspektive beschränkte sich auf den Verantwortungsbereich meines Rektorates am Canisius-Kolleg in Berlin. Durch den Brief wollte ich, veranlasst durch ein Gespräch am 14. Januar 2010 mit drei ehemaligen Schülern, die mir die Augen für die Dimension der Missbräuche eröffnet hatten, Ansprechbarkeit signalisieren.
1. Vorerfahrungen
Vor meinem Eintritt in den Jesuitenorden hatte ich Gelegenheiten zu sehen, welche Macht über das Denken und Fühlen von Menschen durch Manipulation von religiöser Sehnsucht und jugendlicher Großherzigkeit ausgeübt werden kann. In den 70er-Jahren agierten sektiererische Gruppen auf dem religiösen Markt („Children of God“, „Vereinigungskirche Mun“ u. a.), die junge Menschen einer Gehirnwäsche unterzogen, an deren Ende sie bereit waren, sich sexuell und finanziell ausbeuten zu lassen. Dass das die eigene unmittelbare Umgebung treffen kann und wie das konkret funktioniert, erlebte ich, als ein Bruder eines Schulfreundes in eine solche Gruppe hineingezogen wurde. Nach seiner Befreiung schrieb er einen aufschlussreichen Bericht, der die Mechanismen des Vertrauens- und Machtmissbrauches in der Sekte reflektierte.7 Später entdeckte ich, dass es vergleichbare Manipulationsmuster auch in kirchlichen Gruppen gibt. Ich verdanke dieser Zeit ein Grundmisstrauen gegenüber autoritären Formen von Religion und ein Unverständnis für die Blindheit gegenüber Missbrauch von geistlicher Macht in den eigenen Reihen, vor allem dann, wenn die Symptome dafür deutlich bis überdeutlich geworden sind. So konnte ich jedenfalls den Bericht der Missbrauchsopfer aus den 70er- und 80er-Jahren am Canisius-Kolleg besser nachvollziehen – den sektiererischen Charakter des Schweigens in einer Gruppe sowie den Missbrauch in seinem zweiten Aspekt, dem Wegschauen des familiären, sozialen und institutionellen Umfelds einschließlich der Verantwortlichen. Im Falle des Missbrauchs am Canisius-Kolleg war dieses Weghören nachweisbar: Schüler hatten 1980 in einem Protestbrief versucht, sich bei den Autoritäten zu beschweren. Der Brief wurde nie beantwortet. Später wurden die Täter an andere Schulen versetzt. Die Opfer blieben zurück und wurden vergessen. Für die Betroffenen gehört Wegschauen und Weghören des Umfelds zum bleibenden Schmerz der Missbrauchserfahrung. Das machte sie einsam und schutzlos.
Eine Erfahrung mit familiärem Missbrauch stammt aus meiner Referendarszeit Ende der 80er-Jahre in Frankfurt. Ich wurde damals Zeuge, als ein Junge aus seiner Großfamilie verstoßen wurde, da er begonnen hatte, sich gegen die Gewalt in seiner Familie zu wehren. Damals verfügte ich noch nicht über das Wort „sexueller Missbrauch“. Ich empfand nur ein Entsetzen über das, was ich hörte, als der junge Mensch sich mir anvertraute. Ich erlebte, wie es mitten in einer kirchlich und bürgerlich geordneten Welt geschehen kann, dass ein Jugendlicher in den Abgrund gestürzt wird. Alle schauen zu, alle finden es in Ordnung oder sind so gelähmt, dass sie selbst nichts dagegen tun.
Warum erfährt ein Jugendlicher oder auch ein Kind, das sich gegen die Gewalt wehrt, so viel Gewalt? Die Antwort lautet: aus Angst vor dem Opfer. Das Opfer hat eine Geschichte zu erzählen, die das Selbstverständnis von Gruppen, von Familien, Schulen und Gesellschaften erschüttert. Einem Opfer zuzuhören – nicht aus der beobachtenden, begleitenden oder therapeutischen Perspektive, sondern aus der beteiligten, sich selbst dem System zurechnenden Perspektive – bedeutet, sich einem anderen Blick auf sich selbst zu öffnen, Mythen des Selbstverständnisses loszulassen, den Stolz aufgrund von Zugehörigkeit zurückzustellen. Das tut weh. Um den Schmerz zu vermeiden, bietet sich als Alternative an, das Opfer zum Schweigen zu bringen.
Im Canisius-Kolleg begegnete ich auch einem Mythos. Da ich von außen in das Kolleg kam, hatte ich den Vorteil, nicht aus der Identifikation mit diesem Mythos zu leben: „Eliteschule“, „große Familie“, das besondere „Wir-Gefühl“, „letzte freie Schule vor Wladiwostok“. Auch im Orden begegnete ich einem Mythos: „Eliteorden“, „schlaue Jungs“ und so weiter. Mythen werden nicht von Einzelpersonen erfunden, sondern entstehen aus mehreren Komponenten. Sie werden auch von außen angetragen. Alle sind der Ansicht, dass das Kolleg eine Eliteschule ist – egal, ob sie das positiv oder negativ finden – und dass der Jesuitenorden nur die Besten der Besten in sich versammelt. Am Ende glauben die Jesuiten selbst, was andere über sie denken, und im Kolleg beginnt man stolz darauf zu sein, einer Elite zuzugehören. Je mehr man diesen Mythos ausstrahlt, desto mehr zieht man Menschen an, die genau von diesem Mythos fasziniert sind. Wenn man drinsteckt, merkt man es nicht. Die Chance, dies zu merken, besteht, wenn das Opfer beginnt zu sprechen – nicht irgendein Opfer, sondern das Opfer, das in der mythisch überhöhten Schule oder Familie Missbrauch erleben musste von einem Repräsentanten ebendieses Systems.
Einen Mythos zu brechen hat politische Aspekte. Ich lernte diese in zwei weiteren Auseinandersetzungen kennen, die ich rückblickend auch mit dem Thema Machtmissbrauch in Zusammenhang bringe. Die eine Auseinandersetzung betrifft die homosexuellen Mitbrüder im katholischen Klerus. Auch sie sind Opfer eines ihnen auferlegten Schweigens, weil sie nicht ohne Selbstgefährdung in der Ich-Form über ihre Sexualität sprechen können. Dahinter steckt ein kirchenpolitisches Thema. Wer das anspricht, muss mit Diffamierung, Wut und Druck rechnen. Das habe ich bei betroffenen Mitbrüdern erlebt.
Die andere Auseinandersetzung stammt aus der Begegnung mit Flüchtlingen. Familien, Menschen ohne Papiere oder mit prekärem Aufenthaltsstatus sind in einen täglichen Überlebenskampf gestellt. Sie sind angewiesen darauf, dass man ihnen glaubt. In vielen Fällen erlebte ich, wie die Asylgerichte gegenüber den Asyl Beantragenden eher vom Verdacht ausgingen, belogen zu werden, als vertrauensvoll hinzuhören. Vertrauen galt und gilt als naiv. Damit nahmen die Gerichte aber zugleich das Risiko in Kauf, dass ein Mensch, der kein Verbrechen begangen hat, trotzdem wie ein Schwerverbrecher in der Abschiebehaft eingekerkert oder gar in eine lebensgefährliche Situation in seiner Heimat zurückgeschoben wurde. Nicht zu vertrauen ist auch eine Entscheidung.
Die Gesellschaft begegnet Flüchtlingen jedenfalls mit Misstrauen. Hier ist die Parallele zur Erfahrung von Missbrauchsopfern: Die Institution begegnete ihnen mit Misstrauen. „Woher soll ich wissen, dass das stimmt, was du mir sagst?“ Deswegen war ich auch nicht sonderlich überrascht, als mir sehr bald nach der Veröffentlichung meines Briefes vom 20. Januar 2010 der Vorwurf gemacht wurde, ich würde, indem ich den Opfern glaube, die Unschuldsvermutung aussetzen und damit ein rechtsstaatliches Prinzip über Bord werfen. Das war und ist natürlich nicht der Fall. Der Hinweis auf die Unschuldsvermutung konnte nur nicht dafür herhalten, mich von der Verantwortung für die Entscheidung zu dispensieren, ob ich in diesem oder jenem Falle einem Menschen vertraue und glaube, der sich mir als Pädagogen oder Seelsorger, als Schulleiter oder Vertreter des Ordens anvertraut. Ich kann mich auch entscheiden, nicht zu vertrauen. Das habe ich später in einigen Fällen auch getan, wenn ich zum Beispiel den Eindruck hatte, es mit einem Trittbrettfahrer zu tun zu haben. Es gibt aber auch Opfermeldungen, die ich bis heute für wahr halte, obwohl die entsprechenden Anzeigen von der Staatsanwaltschaft wegen Mangel an Beweisen aufgrund der Unschuldsvermutung zurückgewiesen wurden. Andere Opfer, deren Berichte ich für glaubwürdig halte, wurden durch erfolgreiche Verleumdungsklagen erneut zum Schweigen gebracht. Juristisch lassen sich alle diese (für den Juristen „mutmaßlichen“) Täter nicht mehr belangen. Doch das Leiden der Opfer bleibt. Das ist ja gerade die Erkenntnis, die den Rechtsstaat ausmacht: dass der Staat keine vollkommene Gerechtigkeit schaffen kann. Es bleibt eine Dimension der Begegnung zwischen Opfern und Vertretern der Institution, die tiefer geht als das, was mit den Mitteln des Rechtsstaates geklärt werden kann. Diese Dimension schwingt von Anfang an mit, wenn sich Opfer und Institution begegnen.
Missbrauchsopfer berichteten der Presse schon bald nach der Veröffentlichung meines Briefes am 28. Januar 2010,8 durch welche die Aufklärungs-Lawine losgetreten wurde, dass der damalige Schulleiter am Canisius-Kolleg sie aus seinem Büro hinausgeworfen hatte, als sie versuchten, ihre Geschichte zu erzählen: „Du lügst“, rief er dabei. Er hatte ihnen nicht geglaubt. Ich erinnere mich an diesen Mitbruder, der in den 70erund 80er-Jahren Direktor war und inzwischen verstorben ist. Ich habe ihn sehr geschätzt. Er war ein beliebter Schulleiter, ein anständiger, gebildeter und frommer Mann. Vermutlich befanden sich die Übergriffe, von denen die Opfer zu berichten versuchten, jenseits seiner Vorstellungskraft. Vielleicht dachte er: „So etwas tut ein Mitbruder von mir oder ein Lehrer an meiner Schule nicht.“ Er konnte es einfach nicht glauben. Es zu glauben hätte sein Grundvertrauen in die Mitbrüder und Kollegen zu tief erschüttert; also ließ er die Information erst gar nicht an sich heran – vielleicht sogar so sehr nicht, dass er sich heute, wenn er leben würde, nicht mehr an die Szene erinnern würde, wenn man ihn darauf anspräche. Oder vielleicht war er, als er es dann doch wahrhaben musste, so entsetzt, dass er in der Abwehr steckenblieb und sich darauf beschränkte, den Täter möglichst schnell aus dem eigenen Verantwortungsbereich zu entfernen, um dann wieder zum business as usual zurückzukehren.
Ich zögere sehr, das Problem des Weghörens oder Nichthörens bloß als moralisches Problem zu begreifen. Jemandem seine Geschichte zu glauben ist ein Akt geschenkten Vertrauens. Es ist schwer, so etwas in hochmoralischem Ton zu fordern. „Glauben“ ist ein vieldeutiges Wort. Der Akt des Glaubens, von dem das Evangelium spricht, ist (nicht nur, aber auch) Glaube an etwas Unglaubliches. Nicht alles Unglaubliche ist glaubwürdig, aber es gibt Unglaubliches, das ich glauben kann, ja vielleicht sogar muss, wenn ich dem Charakter einer Beziehung gerecht werden will. Zur Offenheit für Glauben als Grundhaltung gehört wohl auch dies: darauf gefasst zu sein, dass etwas Unglaubliches vielleicht doch wahr sein könnte. Jedenfalls kann keiner, der eine Opfermeldung hört, die Entscheidung vermeiden: Entweder ich glaube der Person oder ich glaube ihr nicht. Für den Fall, dass ich nicht glaube, bleibt immer noch die Möglichkeit der wohlwollenden Vermutung, dass das Kind oder der Jugendliche einen Grund für seine Behauptung hat, um mich auf die Suche nach diesem Grund zu begeben, anstatt dem ersten Impuls zu folgen, die Behauptung entrüstet abzuwehren. Kinder und Jugendliche haben dieses Grundvertrauen seitens ihrer Eltern und ihrer Pädagogen nötig.
Vertrauen, jemandem seine Geschichte glauben, ist kein bloß irrationaler Akt. Es war für mich nicht schwer, den Missbrauchsopfern, die sich im Januar bei mir meldeten, zu glauben, denn es gab Gründe, ihnen zu glauben. Zum einen halfen mir die Hartnäckigkeit der Gerüchte, die ich in den Jahren zuvor schon gehört hatte, sowie zwei einzelne Wortmeldungen, die mich 2006 und 2008 schon erreicht hatten und die von den Meldungen im Januar 2010 unabhängig waren. Aus den Übereinstimmungen mit den Aussagen der drei Männer im Gespräch am 14. Januar 2010 ergaben sich Argumente für die Entscheidung, den Betroffenen zu glauben. Damit war aber das andere, für mich Neue klar: Aus dem, was ich am 14. Januar 2010 hörte, ergab sich, dass die Übergriffe nicht nur Einzelfälle gewesen waren, sondern dass mit mehr als 100 Opfern zu rechnen sei, die in den 70er- und 80er-Jahren von den Tätern seinerzeit systematisch in Fallen gelockt worden waren. Diese Zahlen bestätigten sich später.
2. Die Veröffentlichung des Briefes
Nach dem Abschicken des Briefes am 20. Januar 2010 informierte ich das Kollegium über den Brief und bot ein Gespräch dazu an. Es kamen drei Kollegen. Ich erzähle das nicht, um das Kollegium nachträglich bloßzustellen – es hat in den Monaten nach Januar 2010 Großartiges geleistet –, sondern um deutlich zu machen, wie tief das Schweigen zum Thema Missbrauch im Regelfall über einer Institution liegt. Am 28. Januar 2010 erschien dann mein Brief in der Berliner Morgenpost. Er war von einem der Adressaten, den ich bis heute nicht kenne, an die Redaktion weitergereicht worden.9 Der Journalist, der mich am Vorabend anrief, um sich bestätigen zu lassen, dass der Brief tatsächlich von mir war, beendete das Gespräch mit dem Satz: „Ziehen Sie sich morgen warm an.“
Als ich am Morgen des 28. Januar 2010 – es war ein Donnerstag – mein Büro betrat, standen schon die ersten Journalisten dort. Von den auf mich gerichteten Mikrofonen riss mich die Schulleiterin Gabriele Hüdepohl weg, indem sie in mein Büro kam und sagte: „Du musst jetzt nicht mit Journalisten sprechen, du musst mit den Schülern und mit den Lehrern sprechen.“ Erst da begriff ich, dass die Lehrer und Schüler morgens früh bereits durch die Stadt gefahren waren und jetzt unter dem Schock der Schlagzeilen über ihre Schule standen, die ihnen aus den Läden und Kiosken entgegenschlugen. Ich selbst wohnte zusammen mit der Kommunität der Jesuiten auf dem Gelände der Schule und hatte deswegen keinen morgendlichen Schulweg hinter mir. Wir versammelten also alle Schüler und Schülerinnen in der Turnhalle und sprachen mit ihnen. Anschließend protokollierte ich, was ich den Schülern gesagt hatte, um es den Eltern per Mail zuzusenden. Inzwischen hatte sich die Tiergartenstraße vor dem Eingang der Schule mit wartenden Journalisten und Übertragungswagen gefüllt. Das Berliner erzbischöfliche Ordinariat rief an, um mich zu einer Pressekonferenz zu bitten, weil es selbst den Andrang der Öffentlichkeit und der Fragen nicht mehr bewältigen konnte. Es fügte sich, dass ich um 13.30 Uhr in das Taxi stieg, um zur Pressekonferenz zu fahren. Der Pressetross fuhr hinter mir her, so dass die Schülerinnen und Schüler relativ unbehelligt um 14.00 Uhr das Gelände der Schule verlassen und nach Hause gehen konnten. Als ich den Presseandrang im Saal des erzbischöflichen Ordinariates erblickte, wurde mir endgültig klar, dass mein Brief mehr ausgelöst hatte, als ich mir vorher jemals hätte vorstellen können.
Oft bin ich gefragt worden, warum gerade mein Brief dieses Erdbeben ausgelöst hat. Als zehn Jahre zuvor ein Missbrauchsbericht über die Odenwaldschule in der Frankfurter Rundschau erschien, gab es keine nennenswerten Reaktionen in der Öffentlichkeit. Ich habe keine Antwort auf diese Frage, sondern kann höchstens spekulieren: Das Canisius-Kolleg liegt im Zentrum der Hauptstadt und wird dort zumal als katholisches Gymnasium besonders aufmerksam beobachtet. Der Missbrauch in einer kirchlichen Institution erschreckt die Öffentlichkeit mehr als zum Beispiel der Missbrauch im Berliner Freizeitzentrum Wuhlheide,10 der sogar in Berlin nur ein lokales Ereignis bleibt – weil die Kirche eben im Unterschied zum Freizeitzentrum Wuhlheide weltweit hohe moralische Grundsätze formuliert. Mir scheint aber auch, dass es einen entscheidenden, allerdings unberechenbaren Faktor gibt: Eine Gesellschaft braucht als Ganze ihre Zeit, um das Thema „Missbrauch“ überhaupt anzunehmen. In Deutschland war es eben 2010 so weit. In Polen zum Beispiel sind bereits einige Missbrauchsfälle in kirchlichen und anderen Institutionen bekannt geworden. Dennoch reagiert die Öffentlichkeit noch nicht. Wann eine Zeit reif ist, lässt sich nicht planen.
2.1 Lob und Tadel
In den ersten Tagen nach der Veröffentlichung meines Briefes erlebte ich ein verwirrendes Neben- und Gegeneinander von Lob und Vorwurf. Zunächst zum Lob: Ich erhielt eine Fülle von ermutigenden, unterstützenden und hochachtungsvollen Zuschriften, die mich sehr berührten und manchmal auch beschämten, für die ich vor allem aber dankbar bin. Manchmal nahm ich mir in schweren Stunden solche Mails und Briefe wieder vor, um mich an ihnen aufzurichten. Die Zustimmung kam aus allen Ecken der Gesellschaft, sie verlief nicht entlang der üblichen Linien von konservativ und progressiv, links oder rechts. Offensichtlich erreicht das Missbrauchsthema viele Menschen in einer Tiefe, die das Lagerdenken in Kirche und Gesellschaft hinter sich lässt.
Anerkennung kam auch von Missbrauchsopfern aus Kirche und Gesellschaft über den Kreis der Betroffenen am Kolleg hinaus. Es gab Tage, an denen es schien, als seien im ganzen Land Stumme zum Reden gebracht worden, ohne dass ich jemals die strategische Absicht dazu gehabt hätte. In der Presse meldeten sich Opfer aus anderen Schulen und Institutionen zu Wort, die nach dem Motto „Wenn nicht jetzt, wann dann?“ zu sprechen begannen. Schulleiter anderer Schulen schrieben mir, dass sie nun ermutigt seien, auch ihrerseits Übergriffe an ihrer Schule anzusprechen. Aus Vereinen und Initiativen gegen Gewalt und sexuellen Missbrauch an Kindern und Jugendlichen, an Jungen und Mädchen erhielt ich ebenfalls Zuspruch.
Immer wieder kam in den positiven Rückmeldungen die Bemerkung vor, ich hätte einen „mutigen“ Schritt gemacht und sei ein „mutiger“ Mann. Das befremdete mich, da ich zum Zeitpunkt der Entscheidung wenig Angst vor den Folgen des Schreibens gespürt hatte. Ich hielt meinen Schritt für eine Selbstverständlichkeit – und halte ihn auch heute noch dafür. Aber die Folgen bekam ich nun zu spüren, auch die schmerzlichen. Da war zunächst der Ansturm der Presse. Es folgten die anstrengenden Begleiterscheinungen, die Prominenz mit sich bringt – eine Prominenz, die man sich nur wünschen kann, wenn man sie selbst nicht erlebt hat. Prominenz kann auch dazu führen, dass man abhebt. Aber der begrenzte, konkrete Bereich, in dem ich Verantwortung trug, musste im Blick bleiben. Schließlich stand nicht nur ich, sondern die ganze Schule im Zentrum der Aufmerksamkeit. Der Vorgang hatte für die aktuellen Schüler, Eltern und Lehrer ebenfalls gravierende Folgen. Als am 29. Januar 2010 die ersten Presseartikel mit Titeln wie „Schule des Grauens“ erschienen, begann ich die Furcht in der Schule vor Stigmatisierung zu verstehen. Die ganze Institution war von den Missbräuchen aktuell betroffen, obwohl diese 30 Jahre zurücklagen. Umso dankbarer bin ich bis heute für die Unterstützung aus Schülerschaft, Elternschaft und Kollegium. Keine einzige Stimme vernahm ich, die ernsthaft der Meinung war, dass der Ruf der Schule und die Vermeidung der Stigmatisierung Vorrang hätte haben sollen vor dem Interesse an der Aufdeckung und Aufarbeitung zurückliegender Missbräuche. Solche Solidarität ist umso mehr wert, als sie einen Preis kostet, nämlich den, sich mit in den Schatten zu stellen, der nun von der Vergangenheit her auf der ganzen Institution lag.
So viel zum „Lob“. Schwerer ist es, von den Vorwürfen zu sprechen, an denen tiefe Spaltungen sichtbar wurden, sowohl in der Schule wie in Orden und Kirche. Vorwürfe wurden in der Anfangsphase meist nicht laut geäußert – was die Sache nicht weniger schmerzlich macht. Man erfährt sie ja meistens hintenherum. Da niemand ernstlich behaupten wollte, die Institutionsperspektive solle doch besser Vorrang vor der Aufklärung haben, äußerte sich die Missbilligung über den Brief vom 20. Januar 2010 verdeckt. Gespräche verstummten, bisher heiße Drähte wurden merklich kühler. Anfeindungen wurden mir von wohlmeinenden Zuträgern berichtet, denen ich dann oft erwiderte: „Musstest du mir das erzählen?“ Gelegentlich kam die Wut auf mich auch in offener Anfeindung und in Verleumdungen zum Ausdruck. Der inhaltliche Kern der Vorwürfe lässt sich leicht reduzieren auf: Nestbeschmutzung, Eitelkeit, Illoyalität. Es gab auch „Fachleute“, die versuchten, mich als Unkundigen darzustellen, der besser die Finger von der komplizierten Materie Missbrauch lassen sollte.
Immerhin bezeichnete mich ein Leitartikler einer überregionalen Zeitung schon sehr früh ganz offen als Verräter an der Sache der Kirche. Heute wird der Vorwurf auch schamfrei in anderen Blättern erhoben. Was mir half und hilft, mit dieser Art von Vorwürfen umzugehen, ist ihre hermetische Struktur. Der Instrumentalisierungsvorwurf zum Beispiel funktioniert wie ein Totschlagargument: Man kann es beliebig anwenden. Die einen sagen: Er instrumentalisiert die Opferperspektive für eine kirchenkritische Agenda, die anderen sagen genau das Gegenteil: Er verteidigt die Kirche, indem er aus Image-Gründen die Opferperspektive vor die Image-Interessen der Institution stellt. Es reicht, wenn man weiß, dass beides falsch ist.
2.2 Ausweichmanöver
Ich bleibe noch etwas bei den ersten Wochen nach dem 28. Januar 2010: Ein befreundeter Priester berichtete mir, dass er längere Zeit brauchte, um aus dem Ärger in ein tieferes Verstehen darüber hineinzukommen, dass es da doch offensichtlich ein ernstes Problem gibt. Sein Bericht passt zu Erfahrungen, die ich selbst gemacht habe. Zum einem ist da das Gefühl, dass man „die Sache“ diskreter hätte handhaben können, um die Institution Schule, Orden oder Kirche weniger zu beschädigen. Zum anderen fühlt man sich selbst als Opfer und verliert so den Blick auf die Opfer. Selbstmitleid stellt sich ein: „Wir sind Opfer einer Pressekampagne, einer Hetzkampagne der Kirchenfeinde.“ So kam und kommt es zu verunglückten Wortmeldungen. Es taten sich da in den ersten Monaten auch einige Bischöfe hervor und stürzten damit Katholiken in Schamgefühle über ihre Kirche. Sie kosteten die Hierarchie viel innerkirchliches Vertrauen. Manche öffentlichen Äußerungen in den ersten Wochen nach dem 28. Januar 2010 folgten dem Schema: Interview geben, nachdenken, sich entschuldigen. Auch drei Jahre später sind manche aus dem falschen Opfergefühl und dem Selbstmitleid immer noch nicht herausgekommen, sondern haben sich darin eher sogar eingemauert.
Man kann sich die Opferperspektive auch vom Leibe halten, indem man auf den zeitlichen Abstand hinweist, nach dem Motto: „Das war doch vor 30 Jahren. Was habe ich heute damit zu tun?“ Schüler haben ein Anrecht auf Schulalltag. Aber