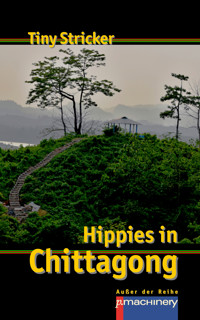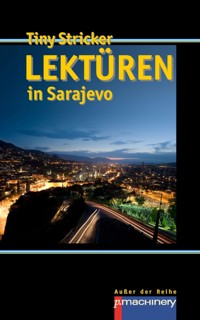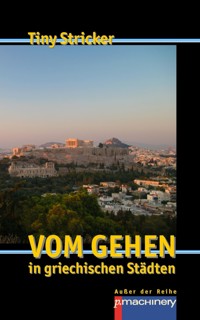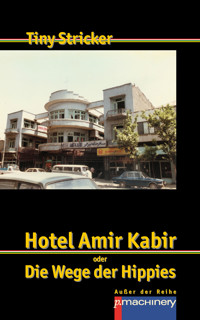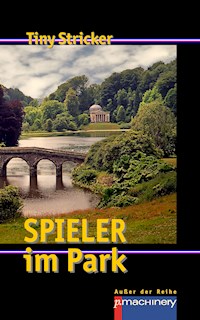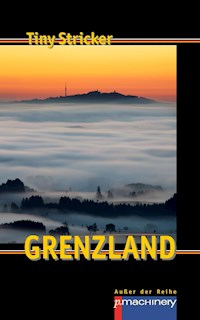
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: p.machinery
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
In ein "Grenzland" gerät die Hauptperson dieses Buchs, ein Junglehrer, in mehrfacher Hinsicht: in ein Gebiet an der deutsch-deutschen Grenze, in das er geschickt wird, vor allem aber an eine innere Grenze, der zwischen Jugend und der Welt der Erwachsenen. Auf einmal sitzt er zwischen allen Stühlen. Und seiner Freundin am anderen Ende des Landes ergeht es ebenso. Nur die Autobahn und ein alter, roter Passat, den er "hauptsächlich wegen seiner Farbe und seines schönen Namens kaufte", führen sie zusammen. Wie schon in den Romanen "Soultime" und "Unterwegs nach Essaouira" zeichnet Tiny Stricker Personen in einer Übergangsphase, genauer gesagt: in einem Zwischenstadium, in dem man voraus- und zurückschauen kann. Gleichzeitig ist dieses Buch eine Art "Heimatroman", zeigt eine Gesellschaft im Übergang, ein Deutschland zwischen zwei Systemen, aber auch zwischen einer schwer abzuschüttelnden Vergangenheit und einer vage erträumten Zukunft.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 100
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Tiny Stricker
GRENZLAND
Werkausgabe Tiny Stricker
Band 8
Außer der Reihe 30
Tiny Stricker
GRENZLAND
Werkausgabe Tiny Stricker
Band 8
Außer der Reihe 30
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
© dieser Ausgabe: September 2018
p.machinery Michael Haitel
Deutsche Erstveröffentlichung
Titelabbildung: Stefan Gerzoskovitz, www.gipfellicht.de
Layout & Umschlaggestaltung: global:epropaganda, Xlendi
Lektorat: Michael Haitel
Herstellung: global:epropaganda, Xlendi
Verlag: p.machinery Michael Haitel
Ammergauer Str. 11, 82418 Murnau am Staffelsee
www.pmachinery.de
ISBN der Printausgaben:
978 3 95765 146 4 (Paperback)
978 3 95765 147 1 (Hardcover)
1
Der Beginn der Referendarzeit war wie ein seltsames Déjà-vu, wie das Einrücken bei der Bundeswehr oder etwas ähnlich Schreckliches (schon nach drei Tagen erhielten wir einen Erste-Hilfe-Kurs, als ob wir ihn dringend nötig hätten). Es war dieses Gefühl, wieder in die Schule zurückzukehren, der man vor nicht allzu langer Zeit entronnen war, jetzt aber auf der Gegenseite, als ihr Apologet. Die Schüler erwarteten uns, standen rauchend und höhnisch neben dem Kriegerdenkmal vor dem Eingang, alles überklar gezeichnet in der Morgenkälte.
In einem Gewölbe unter dem wilhelminischen Schulbau, der einer spärlich verzierten Festung glich, empfingen uns unsere Betreuer: Braunert und Dr. Möller, Letzterer bereits unruhig auf und ab laufend. Braunert war ein harter Mann, auch hart mit sich selbst. Sogar das Weiche an ihm, zum Beispiel seine hellblonden, feinen Haare, war einer starren Ordnung unterworfen. Seine Notizen waren in gestochener Schrift in ganzen Sätzen auf graues Papier geschrieben. Es gab nichts Durchgestrichenes oder zufällig Hingekritzeltes. Bei Abschweifungen, die er nicht schätzte, legte er gut sichtbar und mahnend den Finger auf die Stelle, an der wir gerade waren. Einmal hörte ich im Lehrerzimmer, wie er zu einem anderen ähnlichen Mann im schwarzen Anzug sagte, dass er vor Kurzem »wieder einmal« seine alten Abituraufgaben in Mathematik durchgerechnet und sie gerade noch geschafft hätte, was ihn zu schlimmen Befürchtungen veranlasste.
Möller hingegen, der Abschweifungen liebte, ja, darin den eigentlichen Glanz unserer Sitzungen sah, gab sich feinsinnig-ästhetisch, ungreifbar und flüchtig waren seine Ausführungen, viel »Wissen um« und »Gespür für«, aber keine genauen Festlegungen. In den Protokollen, die bald unsere Hauptlebensaufgabe wurden und mit denen unsere neue Lebensform unaufhörlich bestätigt wurde, strich er »Dr. Möller erklärte« durch und verbesserte »Dr. Möller skizzierte«. Er hatte sich Elemente der Bühnensprache angeeignet oder vielmehr im strengen Sinne anerzogen, zum Beispiel das stimmhafte »S« in »Sonne«, das er überdeutlich aussprach. Dies gab ihm etwas Verstiegenes wie bei einer fortwährenden Rezitation, bewirkte stellenweise ein verklärtes Säuseln, dann wieder ein jähes Innehalten vor bestimmten Wörtern, die dadurch irgendwie wichtig und großartig wurden. Vielleicht war dies seine Rettung, sein künstlich erzeugter Status in den provinziellen Niederungen, der ihm etwas wie Respekt einbringen sollte.
Einmal beobachtete ich ihn, wie er in einer höheren Klasse mit großem Mut den »Zauberberg« durchnahm. »Wie also finden Sie diesen – Settembrini?«, fragte er mit Kunstpause und im gleichen Moment hervorquellendem Lächeln. »Gekackt«, antwortete ein aufgeschossener Schüler mit stechendem, norddeutschem Akzent, mit brutaler Hässlichkeit seine norddeutsche Überlegenheit ausspielend. Doch Möller zog nur die Nase hoch wie einen Flieger und tat, als hätte er im weiten Raum nichts vernommen.
Nachts lief ich durch die Gassen der Stadt mit der Absicht, mich zu verlaufen. Der Punkt, wo die Städte sich ganz ähnlich wurden. Ich erreichte eine Telefonzelle, die weit weg zu sein schien. Dann rief ich meine Freundin an, legte mich hinein in ihre vertraute Stimme, die wie eine andere Art von Heimat klang.
Sie lebte jetzt in Nürnberg, zu dieser Zeit eine dunkle Großstadt, fast vergessen am Rande der Welt, und ich sehe, wie sie im Regen auf der Suche nach Unterkunft durch die Neubausiedlungen hastet. »Was, Sie sind Lehrerin?«, fragen die Leute erstaunt, die sich längst ihr Bild gemacht haben und sich drohend vor ihre Wohnzimmer stellen.
»Oh je«, sagte sie, als ich ihr alles erzählte, und die Nähe von Schlaf und Traum drang durch, ein Hinüberseufzen, das schon die Erdenschwere abstreifte.
Und doch fand ich später keinen Schlaf. Das düstere Zimmer, das ich gemietet hatte, mit den lieblos aus alten Schlafzimmern zusammengetragenen Möbeln, in denen die dunklen Seiten des Zusammenlebens aufbewahrt zu sein schienen, das hohe Bett vor allem, das wie eine schwere Tür den Weg in den Schlummer versperrte … Erst gegen Morgen fiel ich in leichten Schlaf. Ich träumte, dass ich als Indianer auf einem schlanken Pferd durch hohes, feines Rispengras ritt, das uns wolkengleich umwallte und bis an meine Knie ging – ein wunderbar leichtes, befreiendes Gefühl.
Am Nachmittag zog Manfred ein. Frau Butterfeld, die Vermieterin, mit blonder, festgesprayter Frisur, kam wie eine Königin die Treppe herab. Manfred unten im alten Trenchcoat mit einem Köfferchen in der Hand, die Bescheidenheit selbst. Frau Butterfeld betrachtete ihn misstrauisch. Er hatte vermutlich zu wenig Haare, trat altmodisch und unsicher auf. Ich wurde als eine Art Musteruntermieter eingeführt, obwohl ich erst drei Tage hier wohnte. Wir standen immer noch im Gang, und Manfred sah sich etwas verzweifelt nach einem Zimmer um. »Sagen Sie mal«, brach es plötzlich aus Frau Butterfeld hervor, »haben Sie – irgendwelche Bedürfnisse?« »Wie meinen Sie?«, stammelte Manfred, der krebsrot wurde. »Ich meine, feiern Sie Orgien?« Das letzte Wort stieß sie geradezu triumphal, wie einen Durchbruch zur absoluten Direktheit aus. Manfred zuckte zusammen, was ihr nicht entging. Sie litt schwer unter dem Vermietersyndrom, ständig das Übelste befürchtend, ja, bereits wahrnehmend. Mit dem Bewusstsein, dass sie ihn scharf getroffen und gehörig verwarnt hatte, zeigte sie ihm endlich das Zimmer, das er zerknirscht und reumütig betrat.
Er war Kunsterzieher, Referendar wie ich, aber schon etwas älter, weil er sich lange in seiner Nürnberger Dachstube verkrochen und mit Hingabe Renaissancemeister kopiert hatte, mit denen er sich zunehmend identifizierte. Später traf ich ihn in der Küche, wo er weltfremd in die Schränke hineinstarrte. Er sprach gedehnt und gezwungen lehrerhaft, als bereite er sich innerlich schon auf seinen ersten Auftritt vor einer seltsamen Öffentlichkeit vor.
Abends wieder ziellos durch die Stadt. Ich ging die Richard-Wagner-Straße entlang und suchte minutenlang unterbewusst ein Geschäft, das an einer Ecke von Oxford Street liegt. London, in das ich mich kurz zuvor eingegraben hatte, ohne dass mir die Flucht viel genützt hätte, aber das Labyrinth seiner Straßen war unterschwellig immer noch da, vielleicht, weil es so traumhaft gewesen war. Plötzlich stand ich vor dem »London Pub« und ging hinein.
Jetzt, da ich einen richtigen Beruf hatte, bezog ich den Platz an der Theke anders. Mit einer Rechtmäßigkeit, die ich selbst nicht mochte, saß ich am Tresen. Eine erwachsene Scheinwelt umgab mich: die Musik, die fiebrige Disco vortäuschte, die roten Tapeten wie Dessous. Die Bedienung, norddeutsch und unterkühlt, eine harte Erotik ausstrahlend, wippte mit einem Tablett voller Pils (for men only) durch den Raum. »Telefon für Sie! Die Kleine aus Nürnberg«, sagte der Chef zu einem Gast, nicht unabsichtlich seinem Etablissement einen Hauch von intimen Abenteuern gebend.
Drei Barhocker weiter von mir Herr Meininger, Abteilungsleiter, in Begleitung von einem Kollegen mit Krawatte und zwei mitgebrachten Verkäuferinnen. »Wir vom Hause H. sind doch alle eine große Familie«, verkündete Meininger, was ihm Gelegenheit gab, die Arme um beide Verkäuferinnen zu legen. Der Kollege verlegte sich auf die Diskussion (leicht als Ersatz erkennbar): »Die Emanzipation muss kommen, sonst gibt’s böses Blut.« »Ja, da kommt noch was«, sagte die eine Verkäuferin selbstvergessen im Arm von Herrn Meininger. »Ich meine«, entschied Letzterer, »eine Frau kann einem Mann a Hos’ anstecken, aber ein Mann einer Frau kein Kleid!«
»Das soll er mal probieren«, lachte die andere Verkäuferin. Meininger, begehrt, aber bereits nach der Bedienung schielend: »Eine Frau ist doch was Schönes, so ein zauberhaftes Figürchen …« »Na, ich kenn andere Reize«, entgegnete die Bedienung, ihren harten Arbeitsrhythmus betonend.
Später … der Kollege, jetzt betrunken und mit böser Ironie: »Natürlich sind wir alle Spitze, sonst passen wir doch gar nicht rein in den Betrieb!« »Das ist doch jetzt völlig egal«, übertönte ihn Meininger. »Was hatten Sie, zwei Bier?«, sagte die Bedienung kaltschnäuzig zu mir.
Auch in dieser Nacht fand ich lange keinen Schlaf. War es, dass mein Nacht- und Tagwesen miteinander im Streit lagen und das Erste sich beharrlich weigerte, dem anderen den absoluten Vorrang einzuräumen? Der Zwischenzustand jedenfalls begann, eine heimliche Faszination auf mich auszuüben. So lag ich lange in den Vorhöfen des Traums, konnte zwar nicht eintreten, aber doch schon hineinspähen. Ein Gefühl wie Fliegen war das, über Schauplätze gleitend, dabei tauchten Dinge aus den letzten Tagen wieder auf, Details, die ich am Rande wahrgenommen hatte, ausgeschnittene Randfiguren, die plötzlich bedeutsam wurden …
7.50 Uhr: What is ›to meet‹? Wir hospitierten bei Braunert, der in einer unteren Klasse modernen Unterricht vorführen wollte. »What is ›to meet‹?«, fragte er in die Klasse hinein, die verwirrt aufhorchte. »Pittner, come here, please!« Pittner lief mit eingezogenen Schultern und Sündermiene wie zur Abholung eines Verweises nach vorne, Braunert jedoch, der ein seltenes und dadurch besonders trügerisches Lächeln aufgesetzt hatte, schritt ihm entgegen, sodass Pittner unschlüssig abbremste. Für einen Moment standen sie sich wie zwei ungleiche Kontrahenten gegenüber. Da fasste Braunert mit einer schnellen Bewegung den zurückzuckenden Pittner bei der Hand und rief: »Hello!«
»This is ›to meet‹«, erklärte er, befriedigt grinsend wie nach einem gelungenen Physik-Experiment, dann beschied er »Sit down, Pittner«, warf das Lächeln ruckartig von sich und fuhr fort.
Warum er Englisch unterrichtete, blieb unklar. Es stellte sich heraus, dass er einmal vier Wochen in London gewesen war, offenbar als Teilnehmer an einem mysteriösen Kongress. In der Klasse bezeichnete er sich als »Mr. Brown«, wie die Hauptfigur im Lehrbuch, was die kleinen Schüler stark verunsicherte. Und doch hatte er eine gewisse Ähnlichkeit mit diesem »Mr. Brown«, der immer Anzug und Krawatte trug, einen zutiefst ordentlichen Lebenswandel führte, Familie hatte und sonst nichts von seiner Identität preisgab.
Nachmittags Seminar im Lehrerzimmer, unerbittlich lief das Programm ab. »Wir kommen jetzt zu Geschenken an Staatspersonen«, schnarrte der alte Siegler, der allgemeine Schulordnung gab (bei dem Wort »Staatspersonen« richteten sich einige Referendare in der ersten Reihe auf). Ich saß hinten neben Manfred, der ein kulturhistorisches Werk mit dem Titel »Der Mensch ohne Hand. Ein Symposium« las. Er schaute auch bei Sieglers gefälligen Witzchen nicht auf, sondern machte fleißig Randnotizen in enger Schrift, in seine Arbeit vertieft wie ein Mönch. Siegler dagegen hatte etwas von einem Priester, der augenzwinkernd und anspielungsreich ständig das Weltliche durchscheinen ließ. »Da könnte ja einer auf die Idee kommen«, ereiferte er sich, »sagen wir, der Vater hat ein Mercedes-Geschäft, alles schon mal da gewesen …« Er steigerte sich richtig hinein. »Oder er hat Immobilien und lässt mietfrei wohnen, auch nicht schlecht!« Ich lieh mir Manfreds Buch und entdeckte, dass er die Seiten am Rande lateinisch kommentiert hatte, Zitate von Augustinus, dazu mit jugendlicher Prätention »(sic!)« hingeschrieben. Es war wie ein Zeichen. »Was anderes is«, dröhnte Siegler, sich wieder mäßigend und in amtliche Bescheidenheit zurückverfallend, »wenn jemand fünfundzwanzigjähriges Betriebsjubiläum hat und er bekommt ein Fass Bier oder ein kaltes Büffet …« Die beiden Referendare vorne blickten andächtig zu ihm auf.
Am Samstagmittag war ich am Bahnhof und nahm den ersehnten Zug. Gastarbeiter im Wagen, die die südliche Richtung verstärkten. »Du Deutschland?«, fragte mich ein Türke.
In Nürnberg stieg ich um und lief durch den langen Zug, der nach München ging. Im allerletzten Abteil fand ich endlich meine Freundin. Die Vorhänge waren zugezogen, und sie lag da, mit lose umgeworfenem, dünnem Reiseschal wie in einer Kutsche oder Sänfte. Mir war nicht klar, dass sie die Wirklichkeit einfach ausblenden wollte. Während ich sie ungestüm umarmte und am liebsten gleichzeitig geredet und sie geküsst hätte, blieb sie still und sagte nur manchmal »Nicht nennen!«, als wollte sie etwas von sich bannen. Erst später verstand ich, dass sie in einer reinen Illusion leben konnte und diese mit weiblicher Kraft beschützte. Sie wohnte weiterhin in ihrem Zimmer in München, das sie sich mühsam erkämpft hatte, und weigerte sich standhaft, die neuen Lebensumstände anzuerkennen.
2
Sonntagnacht trennten wir uns schweren Herzens am Bahnhof von Nürnberg, und ich nahm den letzten Zug nach B. Es ging auf Mitternacht zu, und der Zug schien bereits in ein Zwischenreich einzufahren. Ich saß mit zwei älteren Herren zusammen, die beide Jägerhüte trugen und sich vermutlich deswegen ins gleiche Abteil gesetzt hatten. Andererseits verwirrte sie offenbar die Gleichartigkeit, und sie schienen auf eine Gelegenheit zu lauern, diese definitiv zu bestätigen. Auf dem Gang erschienen plötzlich wie in einem Traum zwei schöne, dunkelhäutige Mädchen mit pechschwarzen Haaren in weißen Spitzenblusen und kurzen Röcken und schauten lächelnd zu uns herein. »Mischlinge«, bemerkte der eine Herr wie ein Kenner. »Ja, Mischlinge sind oft sehr schön«, versetzte der andere. »Und schlau«, ergänzte der Erste. Sie lösten einander ab auf diese knappe, fast mechanische Art, als wären sie zwei Wachposten in der Nacht. Als Nächstes lief ein Bundeswehrsoldat vorüber. »Bei der Wehrmacht war’s strenger«, kommentierte der Erste, offensichtlich dankbar über den harten Kontrast, und versuchte, den Blick des anderen aufzufangen. »Auf jeden Fall«, beeilte sich dieser hinzuzufügen. »Aber schön war’s doch«, sagte der Erste. »Ja, schön war’s«, sagte der andere in einem bestimmten, das Thema abschließenden Ton, sodass sie wieder in Schweigen und Misstrauen versanken.