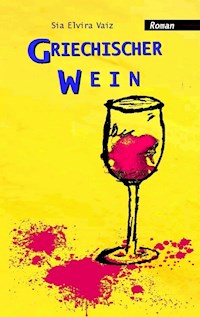
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Von der Zerissenheit zwischen Abscheu und Vergötterung des Selbst. Von Misstrauen und Angst vor nichts als dem Ich. Mein Kopf ist mein Gefängnis, und ich büße lebenslänglich. Griechischer Wein erzählt von einem Leben zwischen Realitäten, aufgebaut auf Bewältigungsstrategien, und dem Kampf mit der eigenen Psyche beim Versuch zu sich zu finden.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 190
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Sia Elvira Vaiz ist am 28.03.1993 in Korneuburg geboren und lebt in Wien, Österreich. Seit ihrem 12ten Lebensjahr schreibt sie englische Lyrik. Ab ihrem 16ten Lebensjahr präsentierte die Autodidaktin sich öffentlich als Solo-Musikerin und trug auf vielen Bühnen fast ausschließlich selbst geschriebene musikalische Werke vor. Wechselhaft spielte sie in diversen Musikprojekten.
Durch ihre Spanisch-Amerikanischen Wurzeln schreibt Sia ihre Musiktexte zum Großteil in ihrer Muttersprache, Englisch. Wenn es um andere Formen von Texten geht, liegt ihre Leidenschaft jedoch im spielerischen Umgang mit der deutschen Sprache. Sie ist weiterhin als Singer/Songwriter unter dem Namen "Sia Vaiz", sowie als Frontfrau der Wiener Rockband "SeralOx" aktiv.
Danke an Michi und Dagmar Frick, Ty , Georg Hochecker, Alex Winter, Stephan Sperlich, Floh und Nina für die Mithilfe bei allem rund um das Buch.
Natürlich vielen Dank an jeden der an mich glaubt und das hier liest.
Die eigentliche Widmung gilt den einflussreichsten Menschen in meinem ersten Vierteljahrhundert:
Amadeo Bahr (RIP) und Johannes Erlinger
Nun auf in neue Gewässer!
Jede Ähnlichkeit mit realen Personen oder Orten ist weder beabsichtigt noch zufällig, sondern unvermeidlich.
Enthaltene Liedzitate sind von realen Künstler*innen und werden in der Quellenangabe am Ende des Buches vermerkt.
Inhaltsverzeichnis
Weder Anfang noch Ende
Funktion. Meine Funktionen.
Versteckte Friedhöfe, wohin man blickt
Ein Hauch Leben
Die vage Erinnerung an Freiheit
Elke
Schnaps und Sentimentalität
Griechischer Wein
Der Papagei
Der Moment des Rausches
Wasser
Meine Nummer ist
Erinnerungen an den Kreisverkehr
Der Tag, an dem mein Mentor starb
Impulsdurchbruch
Liebe, eine Qual.
Leere.
Nun kannst du lernen zu verstehen
Keine Reaktion
Die Geburt Annas
Domenic
Wie ich uns das Leben nahm
Der Tanz mit dem Teufel
Der surreale Herbst
Ich werde du sein
Die Trophäe
Freier Fall
Lämmchen
Tiefe Gewässer
Näheste Gegenwart
Süßer Schlaf
Sündenböcke
Die Innere Freiheit
Zugedröhnt & Pflegeleicht
Der Doktor
Ein klarer Augenblick
Unbezwingbar
Die Überstellung
Vertrauen
Mein Kunstwerk
Realität
Die Schuld
Mundtot
Eisiges Blau
Trenne das
Virus
Die Heilung
Der finale Schuss
Liederverzeichnis
1. Weder Anfang noch Ende
Mit einem Schlag war alles weg. Weder war ich der Ritter, der ich gerne sein möchte, noch das skrupellose Biest, welches weiß, was es tun muss, um das zu kriegen, wonach es verlangt. Ich war immer noch dieselbe langweilige deprimierte Person wie eh und je, liegend auf dem durchgeschwitzten Sofa zu den Tönen von nächtlicher Telefonsex-Werbung. Der widerliche Nachgeschmack von Bier haftete an meiner Zunge, am Tisch die dazu gehörenden Dosen sowie der überfüllte Aschenbecher, der wohl für meinen brennenden Hals verantwortlich war. Entschlossen griff ich zum Tabak, um mir eine weitere Zigarette zu drehen. Lust darauf verspürte ich keine, es war eher die Gewohnheit, die mich daran erinnerte, mir mal wieder etwas Schlechtes zu tun. Die Frage, ob ich denn diesmal passen sollte, stellte sich mir nicht. Ich kenne dieses Spiel zu gut: zwei Minuten darauf gebe ich klein bei, da mein Hirn mich immer wieder an meine Sucht erinnert. Noch benommen suchten meine Hände nach einem funktionierenden Feuerzeug. Natürlich war es irgendwo in der Sofaritze versteckt. Der Rauch brannte sich noch stärker in meiner Kehle ein und stieg in die warme stickige Luft meines Zimmers. Automatisiert griff ich nach einer halbvollen Dose mit abgestandenem warmen Bier und nahm einen großen Schluck. Mein Gesicht verzog sich sofort. "Notgeile Hausfrauen warten auf dich!" Das glaube ich auch. Es scheint mir wie eine Ewigkeit, die ich liegen bleibe und doch viel zu kurz, als der erste Weckton meines Mobiltelefons sich bemerkbar macht. Ein zufälliger Song aus meiner Playlist. Eine ruhige akustische Nummer, schmerzgeladen, ausdrucksvoll untermalt sie eine brüchig raue weibliche Stimme. Bei der Nummer wäre ich niemals wach geworden.
"Are you trying to tell me something with your eyes..."
Mit aller Kraft hieve ich meinen Körper vom Sofa, um auf wackeligen Beinen zu landen. Jetzt langsam. Ganz langsam. Benommenen Schrittes taumle ich auf das Badezimmer zu, um, mühsam angekommen, erst einmal vor meinem Spiegelbild zu erschrecken. Diese fahle Haut, so Eine würdest du nie in einem Magazin sehen. Die trockenen rissigen Lippen, das Muttermal über der Oberlippe, welches mir anscheinend noch nie aufgefallen war. Die Nase, zu breit, zu präsent im Gesicht...ach was, Nasen sind immer hässlich. So verweile ich nun länger vor meinem vermeintlichen Spiegelbild und starre in befremdliche Augen. Blaue stählerne Augen, die vorsichtig übergehen zu einem grünlichen Rand um die Iris, umkleidet von eingefallenen dunklen Augenhöhlen, die durch die Blässe des restlichen Gesichts umso erschreckender auffallen. Die Augen sind die Fenster zur Seele, wurde mir einst gesagt. Der Spruch entspricht für mich der Wahrheit, ungeachtet dessen wie man eine Seele definieren will. Ich verliebe mich in die Augen eines Lebewesens. Der erste Blick soll mich an das Leben ziehen. Unbemerkt wallen Erinnerungen in mir auf, unaufhaltsam und bestimmt. Erinnerungen an ein pures Wesen, welches mich entkräftete, doch zeitgleich mit solch einer Lebensfreude füllte, wie ich sie noch nie gepürt hatte. Sanft schlug es seine Augen auf und sofort wurde ich in fremde Welten getragen, um in süßer Zweisamkeit in den Sälen der Götter zu tanzen. Wieso ging es fort, wie kam es nur dazu… war ich nicht stets bemüht zu gefallen? Sowieso jedem Menschen, dem ich je begegnet war, wollte ich gefallen. Ich hatte mich verbogen, hatte mich gequält und war stets ein guter Mensch, immer im Bemühen den anderen zu helfen. Warum konnten nicht alle Menschen so sein? Gedankenverloren stelle ich mich in die Dusche, um bald von brennend heißem Wasser ummantelt zu werden. Ein kläglicher Versuch, mich aufzuwärmen, doch kommt die Kälte von innen und bleibt stets präsent. Es ist bloß eine Frage der Zeit bis die Hitze die Kälte verdrängt. Heute ziehst du nicht zurück. Du hast die Kontrolle. Dieser Schmerz ist nicht real. Du bestimmst das hier. Du hast die Kontrolle, Alex…
Alex... „ANNA!" "Hmm…" "Du hast die Infusion schon wieder entfernt durch dein Gezappel. Wenn das so weiter geht, müssen wir dir Fesseln anlegen." "Ich weiß, was mit mir nicht stimmt…" "Du redest wirr. Das sind die Medikamente" "Nein, bitte, ich kenne das Problem.." "Alles wird gut."
2. Funktion. Meine Funktionen.
Funktionieren. Funktionieren.
Ich dachte immer, ich wollte jemand anderer sein. Ich bin mir sicher, viele Menschen träumen davon, am nächsten Morgen aufzustehen und im Spiegel ein fremdes Gesicht zu erblicken. Doch ich träume davon, eines Morgens aufzustehen und endlich in ein vertrautes Gesicht zu blicken. Vergeblich suche ich jeden Tag nach dem bekannten und scheitere. Mit jedem ersten Augenaufschlag an jedem Morgen, den ich erlebe, treibt es mir die Zweifel in den Kopf. Zweifel bei jeder Muskelbewegung, die meinen Kopf mit Fragezeichen füllt, ob sie der Anstrengung wert ist. Jeder Morgen, der sich so leer anfühlt, als wäre er der erste überhaupt. Als hätte es keine Vorigen gegeben. Ich möchte leben, woanders. Als wer anderer. Ich möchte ich sein. Doch würde ich mich kennenlernen, würde ich dies noch wollen? Ich möchte ich sein, als jemand anderer. Wer weiß ich jedoch nicht. Irgendwo muss es doch irgendwie eine Lösung geben! Hier komme ich zu keiner. Auf dieser Ebene nicht. Der Radiowecker schreit auf und erzählt von immer gleichen Staus an immer gleichen Orten mit den immer gleichen Menschen zu immer gleichen Zeiten. Mein Tagespensum für gewalttätige Handlungen erfülle ich meist zu diesem Zeitpunkt, wenn ich den Wecker für seinen undankbaren zuverlässigen Dienst mit der Handfläche bestrafe. Auch heute muss er meine Unzufriedenheit erfahren. Ich wäre so gerne liegen geblieben. Ich hätte so gerne noch ein paar Stunden gelebt.Mich schmerzt jeder Muskel und meine Knochen krachen wie der veraltete Holzboden, über den ich schreite. Die Sonne ist noch lange nicht aufgegangen, denn es ist erst vier Uhr früh an einem kalten grausigen Neujahrstag. An meinen Fenstern sammelt sich Tauwasser. Wieder einmal stellt sich mir die Frage, wozu ich diese verfluchten Dinger eigentlich benötige, da sie die kalte Luft hineinwinken wie offene Gewässer die Mücken. Ich taumle frierend und noch teils erblindet in die Küche, erschrecke wie jeden Morgen wegen ihres scheußlichen Anblicks und stelle mir, angewidert vom Geruch des kalten Kaffees, trotz allem eine Tasse voll in die Mikrowelle. Jetzt darf ich noch alleine sein. Ich versuche dies mit aller Kraft zu genießen und auszukosten. Diese Minuten gehören mir. Fast, denn nun bin ich hier an diesem unerwünschten Ort. Vorhin noch im süßen Schlaf, falls es denn so einer ist, der viel zu selten kommt. Doch wenn er kommt, egal ob mit schönen Botschaften oder doch realistisch mit neutralen Szenarien bis hin zu den schlimmsten Grausamkeiten, zu denen die Menschheit fähig ist, in diesen Stunden darf ich leben. Wie gerne würde ich leben. Mit der kalten Luft strömt auch der Geruch von Schwarzpulver durch meine ramponierten Fenster. Ab und an hört man ein einzelnes Knallen eines Böllers. Ich setze mich mit meiner Kaffeetasse in der Hand auf mein Single-Bett mit Holzumrahmung, welches eines der wenigen Möbelstücke in meiner Altbau-Einzimmerwohnung darstellt. Abgesehen vom Bett wird der alte Boden mit dunklem Holzton noch von einem rechteckigen vollgeräumten Couchtisch, einem kleinen Kleiderschrank, quasi ein Bed and Breakfast für Motten, belagert, sowie einem Fernseher, welcher auf leeren Bierpfandkisten stehend gegenüber vom Bett platziert ist. Umrahmt wird all dies von vergilbten Wänden, die versprechen, einst garantiert weiß gewesen zu sein. Am Couchtisch steht ein voller Aschenbecher, der in aller Dringlichkeit bittet, ihn zu leeren. Automatisiert zünde ich mir mittlerweile die zweite Zigarette heute Morgen an und überschreite rücksichtslos die Grenzen des dreckigen Glasbehälters, während ich so vor mich hinstarre und versuche, mich mental auf diesen Tag vorzubereiten. Die erste Zigarette hatte ich bereits im Halbschlaf beim ersten Weckton angezündet, bin währenddessen jedoch wieder eingeschlafen und wie jeden Morgen mit Asche auf der Brust aufgewacht. Dieses Mal keine Brandflecken auf meiner blassen Haut. Doch selbst wenn, wäre es mir egal. Es ist an der Zeit. Der Tag muss jetzt nun einmal starten… Mit einem lustlosen Kraftaufwand hieve ich mich vom Bett und ziehe mir die Kleidung an, die am nähesten zu mir liegt. Es ist alles so schwierig, doch notwendig… Nach einem kurzen Aufenthalt im Badezimmer bin ich physisch bereit, die Wohnung zu verlassen. Die Uhr zeigt 04:30 in der Früh an. Mein Dienst beginnt um 5 Uhr. Ich trete aus der Tür des Gebäudes und fühle mich naturgemäß alarmiert, als die Eiseskälte mir wie ein Fausthieb ins Gesicht schlägt und mir die Tränen in die Augen treibt. Es hängen dichte Nebelschwaden in der Luft und der Boden ist gepflastert mit entzündeten sowie halb angezündeten Böllern. Leider keine dazugehörigen Hände, denke ich mir. Der Geruch des Schwarzpulvers ist unausweichlich da und an jeder Oberfläche begegnet einem Frost. In der Ferne knallen immer noch vereinzelt Böller, doch die Straßen sind menschenleer. Ich gehe die Straße entlang mit der U-Bahn als Ziel, denn um diese Uhrzeit fährt noch kein Bus in meinem Stadtteil. 15 Minuten Fußmarsch durch eisige Kälte versuche ich möglichst an mir vorübergehen zu lassen und spanne jeden Muskel meines Körpers an, um die Kälte auszuschließen. Meine Haube verdeckt zum Teil meine Augen und meine Brille beschlägt soweit, dass mir die Sicht genommen ist. Mit jedem Atemzug in meinen dicken Schal, der meinen Mund verhüllt, werde ich blinder und ich erfreue mich ein Stück weit daran, diese grausigen Böller am Boden nicht mehr sehen zu müssen. Auf jeder meiner Seiten schießen alte und neue Bauten empor, die die Sicht auf graue Landschaft und die vereiste Donau versperren. Der Schnee, der vor kurzem noch weiß war, ist nur mehr dunkler Matsch, der langsam und eiskalt in mein einziges Paar zerfledderter Sneakers dringt und sich ansonsten wie Sand an jeder möglichen Stelle hartnäckig anheftet. Wenigstens hat er es nicht nur auf mich abgesehen. Überall stehen Autos, doch kein einziges ist als solches erkennbar, da der Dreck jedes ummantelt und zu einer grauen Katastrophe werden lässt. Unterm Dreckmantel sind alle Autos gleich... Während ich mit einem spontanen Lächeln im Kopf weiterspinne, wie dies auf Menschen übetragbar wäre und was für einen wahnsinnigen Effekt es auf das soziale Miteinander haben könnte, gehe ich unter einer Unterführung durch, die mir verspricht, gleich am Ziel zu sein. Während ich mich frage, wie die typische Sorte Mensch es bewerkstelligen könnte, sich anhand dieser Drecksregel, gleicher zu fühlen als andere, erreiche ich die Treppen, die aus dieser Unterführung herausführen und fixiere einen kurzen Moment den Ort, an dem sonst immer eine alte Bettlerin sitzt. Ich bin froh, dass sie nicht da ist. Ich schäme mich das zu fühlen, jedoch kennt sie mich schon und ich kann nicht einfach vorbeigehen. Wenn sie mich sieht, muss ich stehen bleiben und mit ihr reden, was ja in Ordnung ist, aber wenn ich nichts habe, was ich ihr geben kann, fühle ich mich schlecht. Doch ich habe nicht genug, um ihr immer etwas zu geben. Mir wäre es lieber, sie wäre einfach nicht mehr da. Ihr vermutlich auch. Generell sehe ich, wie es ihr geht und fühle mich schlecht, auch wenn ich ihr etwas gebe. Dann verabschiede ich mich nach ein paar Minuten, in denen ich mir ihr Leid anhöre, gehe weiter Richtung heimwärts oder Arbeit und fühle mich schlecht. So eine komische Art von Schlecht-Fühlen. So eine richtig ungemütliche soziale Art des Schlecht-Fühlens. Das gefällt mir nicht. Ich fühle mich lieber gewohnt schlecht, für mich alleine. So habe ich begonnen mit dem Bus zu fahren oder große Umwege zu nehmen. Das ist furchtbar von mir. Aus der Dunkelheit heraus trete ich in die hell beleuchteten Räume der U-Bahn Station und muss sofort einen Sprint hinlegen, da die verdammte U-Bahn zu früh dran ist. Mit einem Sprung schaffe ich es knapp in den Waggon, als die Türen hinter mir kreischend zuschnappen. Der Boden sowie einige Sitze erzählen von nächtlicher Dienstbereitschaft im Dienste der Stadt, und sind dementsprechend bedeckt mit fettigem Imbissbuden-Essen. Einzelne Salatfetzen heben sich farblich ab und verleiten mich fast zu lobenden Tönen gegenüber den Alkoholleichen, die vor Stunden hier ihr Unwesen getrieben haben. Hätten sie sich doch daheim etwas Gesundes einpacken lassen sollen… Ich betrachte eine Stelle am Boden eines Viersitzers, der von herzhaft gekochter Nahrung eines liebenden Elternteils erzählt und frage mich, ob besagtes Elternteil denn ahnen könnte, wo seine Liebe denn nun hingekommen sei. Lieber doch Imbissfraß. Bierdosen und Schnapsflaschen kullern fröhlich herum und leeren ihren Inhalt auf den Boden, wo sich Rinnsale alkoholischer Getränke bilden, die um die Wette laufen, hin zu einer Frau, die angewidert die Beine einzieht. Wohl auch so ein Kind des Glücks welches zu Neujahr Frühdienst hat. Es sind nicht viele Fahrgäste hier. Einige Viersitzer werden von einzelnen Personen besetzt und auf zwei Vierern sitzen fünf sichtlich angetrunkene Jugendliche, die lautstark lallend von ihrem hammergeilen Abend erzählen, der morgen nur mehr peinlich in Erinnerung bleiben wird. Falls Erinnerungen zurück bleiben. Von besagtem Abend gehen sie Fotos auf ihren Smartphones durch, Erinnerungsfotos sozusagen, knipsen noch einige weitere, die sie, wenn man ihren lauten Ankündigungen glauben darf, sofort weiterschicken an die Jenny, die Augen machen wird. Du Glückspilz, Jenny. Ich darf nicht unfair sein. Nur vier Jugendliche lassen ihrer Kreativität freien Lauf, während der fünfte bleich gegen die dreckige Fensterscheibe gelehnt in das Wünschen nach dem Koma versinkt. Es muss ihm wirklich dreckig gehen. Der Zug fährt in die Station ein und die Jugendlichen hetzen nach draußen, nur der Koma-Patient bleibt bleich zurück. Einer der Jugendlichen merkt dies scheinbar erst draußen und klopft auf der Scheibe gegen das weiße Gesicht mit den dunklen Augenringen. "Alter, was machst du für ´n Scheiß! Elias, he! Steig aus… Alter!" Die Türen krachen zu und der Zug kommt langsam ins Rollen, fährt der Gruppe schließlich davon und hinterlässt den einzigen Jungen, den es interessiert hat, mit ratlosem Gesicht, während die restlichen drei in der Gruppe sich bereits Richtung Ausgang machen. Ich überlege kurz, ob ich etwas tun sollte, doch entscheide mich dagegen. Eine unsympathische Stimme kündigt die nächste Station an und ich sammle alle Kraft, um meinen Körper in die Höhe zu hieven. Der Zug kommt langsam zum stehen und ich schlage die Tür auf, um gleich darauf, wie für diese Station üblich, einer Wand von Menschen zu begegnen, die einsteigen wollen. Es sind nicht viele, und üblicherweise sind sie auch nicht alle betrunken, doch dass sie sich, egal in welcher Anzahl, vor den Türen auftürmen und in ihrer Panik, es nicht mehr rechtzeitig hineinzuschaffen, das Aussteigen enorm erschweren, ist scheinbar so eine Art Tradition am Westbahnhof, und die Menschen hier nehmen diese sehr ernst. Ich kämpfe mich durch diese übelriechende, mit Jacken gepolsterte Wand und eile auf die Rolltreppen zu, ohne einen weiteren Blick auf die zugemüllte Station zu wagen. Die Rolltreppen, die mir großzügigerweise das Steigen abnehmen, und trotz allem so viele Menschen dazu verleiten sich sportlich zu betätigen, enden an der kalten Luft einer Einkaufsmeile, die bei weitem mehr unter feierwütigen Wahnsinnigen gelitten hat als mein Stadtteil. Der Platz wirkt ohne Menschen so groß. Vereinzelt schießen Quotenbäume säuberlich aus ihren Betonrahmen und in zentimetergenauen Abständen zueinander aus dem Boden hervor. Sie wirken wie sehr disziplinierte Bäume, die es niemals wagen würden, in einer falschen Krümmung oder mit einem asymmetrischen Ast zu wachsen. Richtige Stadtbäume. Ich komme an meinem unfreiwilligen Ziel an und zwinge mich wie jeden Tag, das Hotel zu betreten. In der modernen, sauberen Hotellobby liegen zwei Männer schnarchend auf den Sofas im Wartebereich vor der Rezeption. Der junge Rezeptionist, dessen Namen ich mir einfach nicht merken kann, begrüßt mich müde. Der Arme hatte wohl Nachtdienst zu Silvester. Ich überlege mir, wie die Diskussionen rund um den Dienstplan wohl ausgesehen hatten und ob es Tränen gegeben hatte. Vielleicht hatte er etwas Unentschuldbares getan, wie zum Beispiel in Krankenstand zu gehen, und die Diskussion kam somit nicht einmal zustande. Der arme Trottel. Ich gehe bei den Gäste-WCs die Stufen hinab und lasse mich mit einem Surren, erzeugt vom Türschalter, in den unterkellerten Personalbereich. Der graue beleuchtete Gang, in dem ich mich nun befinde, endet in einem großen Kellerareal, das dem Personal mehrere Wege zur Auswahl bietet und sich unterschwellig über die Zukunftsperspektiven der Selben lustig macht. Das Surren der Geräte ist sehr präsent und es riecht nach Industriewaschmittel, während die Glühbirnen in ihrem widerlichen trüben Licht flackern, doch irgendwann habe ich all dies zu einem einzigen Wort zusammengefügt, welches mein Gefühl, wenn ich diese Räume betrete, am besten beschreibt: Hoffnungslos. Mein Weg führt mich an der mürrischen Wäschelady vorbei in Richtung der Garderoben. Ihr Menschenhass ist beachtenswert, doch nachvollziehbar, wenn man bedenkt, welchen Beruf sie ausübt. Gekonnt schleiche ich an ihr vorbei, bevor sie mir ihren kurzen feuerroten Haarschopf zuwenden kann. Dieser Moment ist der gefährlichste des Tages. Hat sie erst ein Opfer gefunden, ergießt sich ihr Unmut über die ganze Welt über Einen wie fließende Lava, dem man hilflos ausgeliefert ist. In den Garderoben angekommen lege ich meine Uniform in Rekordgeschwindigkeit an, um noch Zeit für eine Zigarette vor dem Dienst zu haben. Meine Arbeitsschuhe sind unbequem, doch wenigstens muss ich die widerlichen durchnässten Sneakers nicht mehr tragen. Mit zerknitterter dreckig-gelber Uniform, die sehr an ein Senf-Missgeschick erinnert, lasse ich mich auf einen Sessel im Raucherzimmer fallen. Es ist mit vollem Engagement ein Raucherkammerl, denn der Luftanteil ist gering genug, um nach wenigen Minuten Schwindelgefühle zu erzeugen. In diesem Kammerl ist das furchtbare Surren der Geräte noch lauter und noch präsenter. An der Decke verlaufen metallene Rohre und die Wände sind löchrig und schmutzig, bedeckt mit vereinzelten Postern als verzweifelter Versuch, die Atmosphäre aufzuhellen. Es wird jedoch eher der gegenteilige Effekt erzielt. Ich inhaliere den widerlichen Rauch und nehme voller Genuss das Brennen tief in meine Lungen auf, im Versuch dieses Gefühl möglichst lange zu halten. Los geht´s… Stufe für Stufe nähere ich mich dem Lieferantenbereich, gehe durch die dunkle Küche in den Service Bereich, sperre das Büro auf, mache überall Licht und starte meine Kontrollgänge durch die Räume des Hotelrestaurants. Im Barbereich sitzt noch eine kleine Gruppe von Menschen, die lallend miteinander philosophieren und scheinbar von meinem Kollegen mit einem kleinen Frühstück versorgt worden sind. Das Geld hierfür hat er sich garantiert in die eigene Tasche gesteckt, und ich weiß, dass ich es auch tun würde. Den besagten Kollegen finde ich schlafend unter einem Tisch mit einer Frau im Arm vor. In einem anderen Eck liegt der Hoteldirektor fern von Bewusstsein und ohne seine Frau auf einer Bank. Ich entschließe mich dazu, all dies zu ignorieren und mich auf meinen Bereich zu konzentrieren, wo sich auch ein paar Menschen zum Schlafen eingenistet haben. Ich wecke sie der Reihe nach auf und schicke sie in die Hotelbar, wo sie ruhig tun können, was sie wollen. Sie wanken alle brav und benommen in die angezeigte Richtung, um kurz darauf die Barbänke zu umarmen. Ich beginne, in leiser Vorahnung, dass dieser Tag keine produktiven Arbeitskräfte verspricht, mit dem Aufbau des Frühstückbuffets, wozu es noch keines Koches in der Küche bedarf. Dazu hat das Hotel zu wenig Sterne, und ich freue mich insgeheim darüber. Um 05:50 wankt der erste arme Lehrling in Richtung des Kücheneingangs, um zu den unterkellerten Garderoben zu gelangen. Aus hygienischen Gründen eigentlich streng verboten, doch mir ist das egal… Auf seinem Weg gibt er einen Laut von sich, der wohl eine Begrüßung darstellen sollte. Ich rufe eine Beschimpfung in seine Richtung und mache mich über seinen Zustand lustig. So läuft es bei uns, so überstehen wir den Alltag. Nachdem ich sowieso bereits vorgearbeitet habe, folge ich meinem Lehrling nach fünf Minuten in den Keller, um an einer weiteren Zigarette zu nuckeln. Oder zwei. Gäste gibt es erst ab 06:30 und dann ist es vorbei mit der freien Zeiteinteilung. So sitzen wir zu zweit im Raucherkämmerchen und lästern über den zweiten Lehrling, der noch nicht erschienen ist. Ich erkläre diesen hier zu meinem Liebling. In dieser Arbeit muss man sich solcher Perversitäten bedienen, sich Lehrlinge als Haustier zu nehmen und sie so zu behandeln, um sich wenigstens eine Stufe über





























