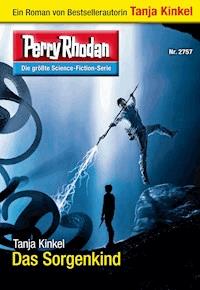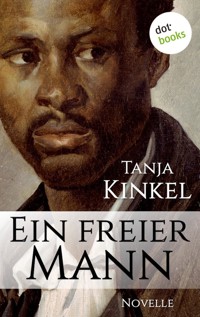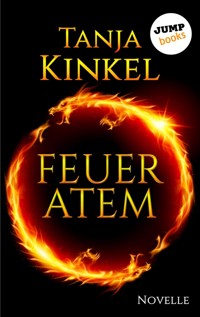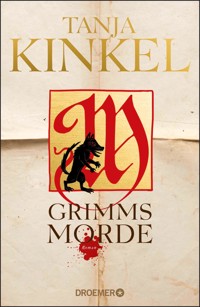
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Droemer eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der neue historische Roman der Spiegel-Bestsellerautorin Tanja Kinkel führt zurück in das neunzehnte Jahrhundert und verbindet märchenhaftes Setting und historische Spannung mit einer grausamen Mordserie. Rot wie Blut… Kassel, 1821: Die ehemalige Mätresse des Landesfürsten wird nach Märchenart bestialisch ermordet. Die einzigen Indizien weisen ausgerechnet auf die Gebrüder Grimm. Weil die Polizei nicht in Adelskreisen ermitteln kann, die sich lieber Bericht erstatten lassen, anstatt Fragen zu beantworten, kommen den Grimms Jenny und Annette von Droste-Hülshoff zur Hilfe. Ein Zitat aus einer der Geschichten, welche die Schwestern zur Märchensammlung der Grimms beigetragen hatten, war bei der Leiche gefunden worden. Bei ihrer Suche müssen sich die vier aber auch ihrer Vergangenheit stellen: Vorurteilen, Zuneigung, Liebe – und Hass, und diese Aufgabe ist nicht weniger schwierig. In einer Zeit, wo am Theater in Kassel ein Beifallsverbot erteilt wird, damit Stücke nicht politisch missbraucht werden können, Zensur und Überwachung in deutschen Fürstentümern wieder Einzug halten und von Frauen nur Unterordnung erwartet wird, sind Herz und Verstand gefragt. Geschickt verwebt Tanja Kinkel die privaten Verwicklungen von zwei der berühmtesten Geschwisterpaare der deutschen Literaturgeschichte in ein unglaubliches Verbrechen. Ein Mordsbuch.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 612
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Tanja Kinkel
Grimms Morde
Roman
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Aus Grimms Märchen werden Grimms Morde. Die langjährige Mätresse des hessischen Kurfürsten wird bestialisch ermordet. Kurz danach gibt es einen weiteren Toten. Die einzigen von der Polizei vorgefundenen Hinweise führen zu den Brüdern Grimm und zu den Schwestern von Droste zu Hülshoff. Die Grimms sind Verdächtige. Nur die Zusammenarbeit der ungleichen Geschwisterpaare kann die Wahrheit über Morde und Märchen an den Tag bringen. In einer Zeit, wo die Errungenschaften der Freiheitskriege verloren gehen, Zensur und Überwachung in deutschen Fürstentümern wieder Einzug halten, müssen die vier sich dafür Verwicklungen aus der Vergangenheit stellen, um die Rätsel der Gegenwart zu lösen.
Inhaltsübersicht
Dramatis Personae
I.
Prolog: Ende März 1821
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
II.
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
III.
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
IV.
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Epilog
Nachwort
Bibliographie
Dramatis Personae
Jacob – Hofbibliothekar, Germanistik-Begründer und scharfzüngiges Oberhaupt der Familie
Wilhelm – Bibliothekssekretär, Märchensammler und (meist) Friedensstifter
Lotte – die einzige Schwester, führt Jacob und Wilhelm den Haushalt; verlobt
Ludwig Emil »Louis« – der Malerbruder, jüngstes Familienmitglied
Carl – arbeitsloser Weinvertreter im Schatten seiner Geschwister
Annette – Dichterin, in mehr als einer Hinsicht zu früh geboren
Jenny – Annettes ältere Schwester, verliebt in Wilhelm Grimm
Therese (geborene von Haxthausen) – die Mutter der beiden, Matriarchin zweier Familien
August – Thereses viel jüngerer Stiefbruder, Literaturförderer und Annettes Feind
Anna – Annettes Stieftante, jünger als sie selbst, und ihre Feindin
Christian von Kern – Hofmarschall von Hessen-Kassel
Baronin von Kern – seine Mutter, Gastgeberin der Drostes in Kassel
Anne-Marie Mouet, Freiin von Bachros – ehemalige Mätresse des alten Kurfürsten
Eugen von Bachros – ihr Sohn, wegen seiner Ehe mit einer Bonaparte-Cousine in Ungnade
Auguste von Preußen – die neue Kurfürstin, Förderin von Wilhelm Grimm, mit ihrem Mann verfehdet
Kurprinz Friedrich Wilhelm – ihr Sohn, Wilhelms Schüler
Staatsbeamte und Mitglieder des hessischen Hofs:
Karoline von Schlotheim, Gräfin Hessenstein – die langjährige und wichtigste Mätresse des alten Kurfürsten
Emilie Ortlöpp, Gräfin Reichenbach – die Mätresse des neuen Kurfürsten
Caspar von Dörnberg – Volksheld, derzeit Gesandter in St. Petersburg
Oberwachtmeister Blauberg – der zweite Mann der Kassler Polizei
Hofbibliothekar Völkel – Jacobs Vorgesetzter
Fritz Wegner – gekränkter Autor eines von der Zensur abgelehnten Romans
Hilfsprediger Dupont – leidenschaftlicher Leser von Räuberromanen
Paul Schreck – dichtender Zimmermann
Siegfried Müller – Verwaltungsbeamter und alter Bekannter von Jacob
I.
»Die Sachen haben sich gar nicht gut gekehrt, und man wird vor sich selbst bestürzt, wenn man sich die Möglichkeit gestehen muss, dass unsere Regierungen (…) in ein System von Furcht und Ängsten, Misstrauen, Beschuldigungen und allen den kleinlichen und schändlichen Handgriffen der Polizei (…) verfallen können.«
Jacob Grimm, Kassel, 3.11.1819
Prolog: Ende März 1821
Die Kleidung der Frau war teuer, das sah Oberwachtmeister Blauberg sofort, und er hielt sich keineswegs für einen Experten für weibliche Mode. All die Spitzen und Volants, die den Ausschnitt und die winzigen Ärmel zierten, hätte sich seine Gattin niemals leisten können, und er gehörte zu den bessergestellten Beamten Kassels. Der Turban, den die Tote um den Kopf trug, bestand sogar aus grüner Seide. Seit dem Abzug der Franzosen hatte Blauberg keine Damen mehr gesehen, die Turbane statt Hüte trugen. Für ihn unterstrich diese Kopfbedeckung das Groteske des Anblicks der Leiche, des Gesichtes der Toten oder was davon noch übrig war. Dafür musste eine dicke Wachsschicht erst entfernt werden, und dabei hatten sich Teile ihrer Gesichtshaut und sogar Fleisch aus den Wangen gelöst. Jemand hatte dieser Frau offensichtlich kochend heißes Wachs über das Gesicht gegossen, als sie noch lebte, denn der Mund erschien immer noch schmerzverzerrt. Ihre Hand- und Fußgelenke trugen Fesselspuren, aber was auch immer benutzt worden war, um sie während dieser Qual daran zu hindern, sich zu wehren, war später entfernt worden.
Ein Diener hatte sie sorgfältig aufgebahrt vorgefunden, unter der Überdachung der Brücke, die den Hauptteil des Schlosses Wilhelmshöhe mit dem Weißensteinflügel verband. Der alte Kurfürst war noch keinen Monat tot; der neue, sein Sohn, dem Vater entfremdet, war erst noch dabei, seinen Haushalt in die kurfürstlichen Residenzen zu verlegen, und an diesem Tag nicht in Kassel. Blauberg freute sich nicht darauf, dem neuen Herrscher zu diesem Vorfall Bericht erstatten zu müssen, machte es aber lieber später, wenn er mehr wusste. Um wen es sich auch immer bei der Toten handelte: Eine Leiche im Wohnbereich der kurfürstlichen Familie, das war eine unerhörte Brüskierung und schrie nach einer Verletzung der Sicherheit des Herrschers. Blauberg war todunglücklich, dass ausgerechnet ihn das Schicksal getroffen hatte, die Untersuchungen zu leiten.
Im Ausschnitt der Frau hatte sich ein Blatt Papier befunden, teures Papier, wie es für jemanden aus dem Volk viel zu kostspielig gewesen wäre, und die Schrift, mit der etwas darauf geschrieben stand, war regelmäßig und verriet Übung. Nur ein Umstand gab Blauberg Hoffnung, dass es sich bei dem Mörder vielleicht doch um einen Verbrecher niederen Ranges statt eines Mannes von Stand handelte. Der auf dem Papier geschriebene Satz war schauderhaft buchstabiert und klang überdies nach allem Möglichen, nur nicht nach Deutsch, wie es in Hessen gesprochen wurde: »Usse Bloet soll örfer die Rache schreien, nun is kin Mensk up de Welt geboren, un wird geboren, de uns erlösen kann.«
Seit im letzten Jahr der Burschenschaftler Sand hingerichtet worden war, weil er den Schriftsteller August von Kotzebue umgebracht hatte, seit die Polizei in Hessen, genau wie in allen anderen Ländern des Deutschen Bundes, die wegen dieses einen Mordes in aller Eile erlassenen Karlsbader Beschlüsse durchsetzte, welche es ermöglichten, die Presse, die Universitäten und die Vereine wieder unter staatliche Kontrolle zu bringen, hatte Blauberg befürchtet, dass auch in Kassel die Seuche des politischen Mordes einziehen würde. Aber Sand hatte bei seiner Tat »Verräter des Vaterlands« gerufen, und ähnliche Parolen waren doch gewiss bei einer Nachahmungstat zu erwarten, nicht ein in irgendeinem Dialekt geschriebener Satz.
»Unser Blut soll über dich Rache schreien«, sagte Blauberg zögernd, um für sich den Satz durch eine laute Aussprache verständlich zu machen. »Nun ist kein Mensch auf der Welt geboren, und es wird auch keiner geboren, der uns erlösen kann!«
»Ein Gottesleugner vielleicht?«, mutmaßte einer seiner Polizeidiener. Der Hausmeier, dem ein Lakai die Leiche gemeldet hatte und der daraufhin Blauberg hatte benachrichtigen lassen, dessen Blicke nun ständig von der Toten zu Blauberg und zurück wanderten, zuckte zusammen und beeilte sich, zu versichern, dass es am kurfürstlichen Hof keine Gottesleugner gebe. Schließlich lebe man nicht mehr unter den Franzosen. Es war ein kühler Märzmorgen, aber der Mann schwitzte sichtlich unter seiner Perücke. Dafür zumindest hegte Blauberg eine gewisse Sympathie. Als hessischer Patriot hatte er die Rückkehr des alten Kurfürsten begrüßt, aber dass dieser umgehend darauf bestanden hatte, bei allen Staatsbeamten und bei seinem Hofstaat die Perücken der vorrevolutionären Zeit wieder einzuführen, sorgte selbst in den übrigen deutschen Fürstentümern für Spott. Wenigstens stand zu hoffen, dass sein Sohn, der neue Kurfürst, endlich das Perückengebot zurücknahm.
»Kann Er sich inzwischen darauf besinnen, um wen es sich bei der Dame handelt?«, fragte Blauberg, absichtlich die altmodische Anredeform wählend, um seinerseits seine Autorität wie seine treudeutsche Gesinnung und mangelnde Sympathie mit neuen, noch nicht vom Kurfürsten erlaubten Ideen zu demonstrieren. Dass es sich bei der Toten um eine Dame handelte, bezweifelte er nicht. Dienstmädchen trugen keine Turbane französischen Stils aus grüner Seide. Selbst Hofdamen taten das nicht, wenn sie wussten, was gut für sie war; sowohl der alte als auch der neue Kurfürst verabscheuten jede Erinnerung an die unrühmlichen Jahre, in denen die Wilhelmshöhe Napoleons Höhe geheißen und in Kassel Napoleons jüngster Bruder Jérôme regiert hatte. Eine Frau von Adel, die wollte, dass ihre Familie sich gut mit dem Herrscher stand, würde also nie einen solchen modischen Fauxpas begehen, es sei denn, sie hätte Grund zu wissen, dass der Herrscher ihr dergleichen verzeihen würde.
Blauberg fühlte sich ob seiner Aufgabe denkbar unwohl. Genau wie sein Vater hatte der neue Kurfürst eine Mätresse, die er gerade vom Bürgertum in den Adel erhoben hatte und für die er in Kassel das Palais Gohr umbauen ließ.
»Es kann doch wohl nicht die Gräfin Reichenbach …?«
Der Hausmeier schüttelte heftig den Kopf, noch ehe Blauberg seinen Satz beendet hatte. Wie er sich bei dem Zustand des Gesichtes so sicher sein wollte, wusste Blauberg allerdings nicht.
»Die Gräfin Reichenbach befindet sich noch auf Schloss Philippsruh in Hanau«, erläuterte sein Gegenüber. »Außerdem dürfte es da einen erheblichen Altersunterschied geben. Mit Verlaub.«
Er wies auf die Hände der Toten, die gepflegt waren, sichtlich nicht an Arbeit gewohnt, und großzügig beringt, was bewies, dass es dem Mörder nicht um den Diebstahl des Schmuckes gegangen war. Diese Hände waren bei aller Pflege nicht mehr die einer jungen Frau, doch Blauberg, dem Hände von dreißigjährigen Frauen vertraut waren, die rissig, voller Altersflecken und zerfurcht waren, hatte sie nicht gleich als einen Hinweis auf ein höheres Alter angesehen.
»Diese Dame war gewiss über fünfzig Jahre alt«, schloss der Hausmeier. »Wenn nicht sogar an die sechzig.« Mit einem Mal stockte er.
»Es wird doch nicht … nun, sie war wegen der Beerdigung seiner Hoheit wieder in Kassel, zum ersten Mal seit Jahren, und ich habe nicht gehört, dass sie abgereist wäre …«
»Ein Name wäre von Nutzen«, sagte Blauberg trocken.
»Die Freiin von Bachros,« entgegnete der Hausmeier unbehaglich, »die sich früher des … Wohlwollens seiner verstorbenen Hoheit erfreute. Sie hat den gleichen dunklen Teint wie diese Dame, wie so viele der Hugenottenfamilien, die aus dem Süden Frankreichs zu uns gekommen sind. «
Blauberg war durchaus bekannt, dass der alte Kurfürst mehrere Mätressen gehabt hatte, neben der berühmtesten, Karoline von Schlotheim, Gräfin Hessenstein, aber deren Namen waren ihm mit dem Ende ihres Einflusses auf den Fürsten entfallen. Gerade wollte er sich weitere Auskünfte erteilen lassen, als einer seiner Polizeidiener, der mit seinen Kameraden eigentlich die Aufgabe hatte, neugieriges Gesinde, aber auch Hofleute fernzuhalten, ihm meldete, der zweite Hofbibliothekar bestehe darauf, zur Bibliothek durchgelassen zu werden; er habe dort für seine Arbeit unentbehrliche Bücher zu konsultieren.
Blauberg konnte sich nicht vorstellen, was ein Hofbibliothekar je an Arbeit tun konnte, um die Worte »unentbehrlich« oder »dringend« zu rechtfertigen, und sagte das auch laut.
»Oh, Sie kennen Herrn Grimm nicht, Herr Oberwachtmeister«, kommentierte der Hausmeier.
»Damit kann ich leben. Sprech Er mir nun von der Freifrau.«
Der Hausmeier runzelte die Stirn. »Herr Grimm ist, ähem, wirklich immer sehr entschlossen. Sie sollten ihn einfach passieren lassen, Herr Oberwachtmeister. Vielleicht kann er sogar aushelfen, was jenes Schreiben am Körper der bedauernswerten Toten betrifft. Mit üblen Pamphleten aller Arten muss er sich auskennen. Er ist Mitglied der Zensurkommission.«
Die Zensurkommission war nach dem Abzug der Franzosen und der Rückkehr des alten Kurfürsten auf dessen Drängen umgehend wieder eingerichtet worden, um ein Aufkommen revolutionären Ungeistes in Hessen von Anfang an zu unterbinden. Sie bestand aus vier Männern. Inzwischen gab es sie fünf Jahre, aber Blauberg konnte sich nicht erinnern, von ihr jemals nützliche Hinweise erhalten zu haben, die Verhaftungen ermöglichten. Das bestätigte seine lebenslang gewachsene Meinung über Bücherwürmer. Andererseits fanden auch blinde Würmer gelegentlich Körner, und wenn er bereits einen Verdächtigen hatte, ehe er dem neuen Kurfürsten Bericht über diesen Mord erstatten musste, dann würde das sein Leben erheblich erleichtern. Also bedeutete er dem Polizeidiener, Herr Grimm möge durchgelassen und zu ihm gebracht werden.
Das Erste, was Blauberg an dem Bibliothekssekretär Grimm ins Auge fiel, war, dass der Mann offenbar sehr sicher über die Abschaffung der Perückenvorschrift für Staatsbeamte unter dem neuen Kurfürsten oder sehr selbstbewusst hinsichtlich seines Status war; sein braunes, lockiges Haar war kurz geschnitten und unbedeckt, und er trug keine Livree, sondern einen dunklen, zweireihig geknöpften Frack, dazu eine helle Hose, wie es nahezu jeder nicht in Staatsdiensten beschäftigte Hesse heutzutage tat. Die kurze Krawatte um seinen Hals war hastig gebunden, als habe er heute Morgen nicht in den Spiegel geschaut. Zu Blaubergs leichter Überraschung trug er keine Brille, noch war sein Rücken gekrümmt, beides Dinge, die Blauberg mit Bücherwürmern assoziierte. Stattdessen war er groß und gut genug gewachsen, um jeden vernünftigen Beruf ausüben zu können. Der Hausmeier stellte ihn mit Namen und Titel als den Leiter der Ermittlungen vor, als wäre der Bibliothekar die Respektsperson, was Blauberg insgeheim ärgerte. Immerhin war er, Blauberg, der hochrangigste Polizeibeamte von Kassel gleich nach dem Leiter der Polizei selbst.
»Ich bitte um Verzeihung«, sagte der Ankömmling dann auch mit einer ganz und gar nicht demütigen Stimme und in einer Tonlage, der man anmerkte, dass er keine Ursache dafür sah, sich bescheiden zu geben, »aber es ist wirklich wichtig, dass man mich in die Bibliothek lässt.«
Sein Blick fiel auf die Leiche, und er erstarrte. Die Polizeidiener mussten ihn bereits von der Existenz einer Toten unterrichtet haben, also war es nicht die Tatsache an sich, die ihn überraschte.
»Erkennen Sie die Dame?«, fragte Blauberg interessiert.
Herr Grimm schüttelte den Kopf. »Was, um alles in der Welt, hat man ihr angetan?«, fragte er. Die Ungeduld und Arroganz war völlig aus seiner Stimme geschwunden. Blauberg war sich nicht sicher, ob er Grimm die so plötzlich entstandene Bestürzung glaubte; in seinem Alter und bei seiner körperlichen Verfassung musste er doch gedient und daher auch schon früher Tote gesehen haben.
»Jemand hat ihr heißes Kerzenwachs über das Gesicht gegossen«, entgegnete er langsam und ließ den Bibliothekar nicht aus den Augen. »Wir mussten es entfernen.«
»Wachs?«, wiederholte Grimm verstört, und fügte hinzu: »Weißes Kirchenwachs?«
Blauberg spürte die Spannung in sich, die ihn erfüllte, wenn sich unversehens eine Spur auftat. Natürlich konnte Grimm Wachsreste auf dem Boden erspäht haben, aber leicht waren diese nicht auszumachen, und nachdem mehrere Lakaien und Polizeidiener darübergetrampelt waren, konnte man auch ihrer Farbe nicht sicher sein. »Kirchenwachs« statt »Kerzenwachs« war ebenfalls keine selbstverständliche Substitution. Immerhin befand man sich auf einem Schloss mit einer Menge an Leuchtern. Warum sollte das Wachs nicht von diesen Kerzen rühren?
»Dieses Papier lag bei der Toten«, sagte Blauberg, ohne auf die Frage einzugehen, und hielt Grimm das Blatt mit dem merkwürdigen Satz unter die Nase. Für den Fall, dass der Mann trotz nicht vorhandener Brille wie so viele Menschen, die mit Akten und Büchern zu tun hatten, kurzsichtig sein sollte, wiederholte Blauberg den Satz noch einmal laut:
»Usse Bloet soll örfer die Rache schreien, nun is kin Mensk up de Welt geboren, un wird geboren, de uns erlösen kann.«
Nun verlor das Gesicht des Bibliothekars gänzlich jegliche Farbe, und seine Lippen pressten sich zusammen.
»Kennen Sie diese Worte?«, fragte Blauberg streng. Bei einer derartigen Miene musste man sofort nachhaken. Grimm machte sich auch nicht die Mühe, zu leugnen, sondern nickte.
»Durch Ihre Arbeit in der Zensurkommission, nehme ich an«, sagte Blauberg. »Von welchem unserer schreibenden Unruhestifter stammen sie?«
Mit einem Schlag wich die Verstörtheit in Grimms Miene einer ausdruckslosen Glätte.
»Vom Volksmund, Herr Oberwachtmeister.«
»Herr Grimm«, warf der Hausmeier begütigend ein, »das ist nun wirklich nicht der Moment, um irgendwelche Jakobiner zu schützen!«
Mittlerweile schaute Grimm wieder arrogant an seiner langen Nase entlang, als er erklärte: »Ich verabscheue Jakobiner. Aber der Satz, der dort auf diesem Blatt steht, hat wirklich keinen einzelnen Autor. Er stammt aus der mündlichen Überlieferung zahlloser Generationen, ergo, aus dem Volksmund.«
Blauberg war nicht in der Stimmung, sich von Bücherwürmern belehren zu lassen, die ganz offensichtlich etwas zu verbergen hatten. Obwohl Grimm als Hofbibliothekar und Beamter dem Rang nach wohl über ihm stand oder ihm zumindest gleichgestellt war, verfiel er nun ebenfalls in die alte, herabsetzende Anrede an Untergebene.
»Aber Er hat diesen Satz offensichtlich wiedererkannt, also muss Er ihn aus einem bestimmten Mund gehört haben, nicht aus zahllosen. Von wem?«
Bei dem Wort »Er« wurde Grimms ohnehin gerader Rücken stocksteif. Seine graublauen Augen verengten sich.
»Sie finden diesen Satz in den von mir und meinem Bruder Wilhelm veröffentlichten Kinder- und Hausmärchen«, entgegnete er schmallippig. »Er entstammt dem auf Plattdeutsch erzählten Märchen ›De drei schwatten Prinzessinnen‹, das hundertsiebenunddreißigste Märchen unserer Sammlung. Zweiter Band. Ist diese Quellenangabe präzise genug für Sie?«
Soweit es Blauberg betraf, waren Märchen etwas, mit dem ihm seine Gattin die drei Kinder vom Leib hielt und verhinderte, dass diese ihn durch neugierige Fragen plagten, wenn er rechtschaffen müde nach Hause zurückkehrte und seine Ruhe wollte. Warum man sich als erwachsener Mann damit abgeben sollte, sie zu sammeln und zu veröffentlichen, entzog sich seinem Verständnis. Aber er erkannte einen Ablenkungsversuch sofort, wenn er ihn hörte.
»Nein«, gab er genauso kühl zurück. »In diesem Land schwatzt man nämlich immer noch Hessisch, also bezweifle ich, dass Er so ein plattdeutsches Märchen aus seiner eigenen Kindheit kennt. Also, wer genau hat es Ihm erzählt?«
Grimm musterte ihn voller Abscheu.
»Die von uns gesammelten Märchen haben viele unterschiedliche Quellen. Die Arbeit an der Sammlung hat sich über Jahre hingezogen. Sie können nicht von mir erwarten, dass ich auf Anhieb weiß, welche der guten, alten Frauen in den Dörfern …«
»Wenn es plattdeutsch sprechende alte Frauen in hessischen Dörfern sind, dann schon«, unterbrach Blauberg. »Mir würde so eine alte Frau nämlich im Gedächtnis bleiben.«
»Weil es Ihre Aufgabe ist, sich an Menschen zu erinnern«, entgegnete Grimm scharf. »Meine ist es, auf Anhieb eine Verbindung zwischen Dornröschen und Brünhild in der Edda herstellen zu können. Und die Bibliothek des Kurfürsten zu verwalten, wofür ich bezahlt werde, also schlage ich vor, Herr Oberwachtmeister, dass Sie mich dieser Aufgabe jetzt nachgehen lassen und Ihrerseits tun, wofür Sie bezahlt werden: festzustellen, wer diese arme Frau umgebracht hat. Falls Sie mehr über das Märchen von den drei schwarzen Prinzessinnen wissen wollen, so erwerben Sie den zweiten Band in der hiesigen Buchhandlung.«
Damit wandte er sich ab und verschwand mit ungeduldigen, raschen Schritten in Richtung der im ersten Stock befindlichen Hofbibliothek, ohne sich noch einmal umzuschauen. Die Polizeidiener blickten verblüfft zu Blauberg, unsicher, was sie tun sollten. Blauberg überlegte. Von einem Adligen hätte ihn ein solches Verhalten nicht überrascht, und einen Adligen hätte er von Anfang an anders behandelt. Einen einfachen Bürger hätte er zurückhalten lassen, desgleichen einen ungebärdigen Studenten. Ein verdächtiges Subjekt, das gleichzeitig ein hoher Staatsbeamter war, nicht einer von Blaubergs Untergebenen, so jemand war ihm in dieser ausgebildeten Arroganz allerdings noch nicht begegnet, und das hieß was, nach über zwanzig Dienstjahren.
Er entschied, Grimm vorerst gehen zu lassen. Aber er würde ihn bald wieder befragen. Nachdem er sich über alles unterrichtet hatte, was es über den Mann zu wissen gab.
Einschließlich seiner verwünschten Märchen.
Kapitel 1
Die Wohnung im zweiten Stock des nördlichen Torwachgebäudes am Wilhelmshöher Platz zu erhalten war seinerzeit ein Glücksfall für die Geschwister Grimm gewesen. Vom Wilhelmshöher Platz aus nahm die Allee ihren Anfang, die vom alten Kern Kassels bis zum Schloss Wilhelmshöhe führte. Jacob Grimm ging gern und viel, ermüdete dadurch schnell die meisten seiner Bekannten, die sich mit ihm auf Spaziergänge wagten, und ging daher meist allein, in seine Gedanken vertieft, auch den Weg zum Schloss in die Hofbibliothek, obwohl er seine drei täglichen Pflichtstunden auch in der Landesbibliothek, die im Museum Fridericianum untergebracht war, ableisten konnte. Eine gute Möglichkeit, um seiner Vorliebe zu frönen, in seiner jeweils von ihm geschaffenen Welt herumzustöbern, ohne dabei Zeit für die Arbeit zu verlieren, die ihm wirklich am Herzen lag.
An dem Tag, als er mit dem Bild einer auf grauenhafte Weise ermordeten Frau vor Augen zum Torwachgebäude zurückkehrte, schien dagegen jeder Schritt so mühsam zu sein, als bewege er sich durch dickflüssige Melasse. Als er endlich angekommen war, machte er sich nicht einmal die Mühe, nach allen Geboten der Höflichkeit seine Schwester Lotte zu begrüßen.
»Ist Wilhelm schon hier?«
»Guten Tag, Lottchen«, sagte Lotte trocken. »Es tut mir leid, dass ich heute früher zurückkehre, obwohl ich versprochen habe, den ganzen Tag fortzubleiben, damit meine vielgeplagte Schwester das Großreinemachen der Wohnung vollenden kann. Wie geht es dir?«
»Lass die Narreteien«, gab er ungeduldig zurück und wiederholte: »Ist Wilhelm schon hier?«
»Nein, aber Carl hält sich genauso wenig an das, was ich sage, und …«
»Carl kümmert mich nicht«, schnitt Jacob ihr das Wort ab und wollte auf dem Absatz kehrtmachen, als er Lotte sagen hörte: »Genauso wenig wie der Rest von uns.«
So sehr er in Gedanken noch in Schloss Wilhelmshöhe war und bei allem, was das dort Geschehene bedeuten mochte, diese Worte seiner Schwester drangen dennoch in sein Bewusstsein. Jacob hielt inne und sah sie an. Lotte war acht Jahre jünger als er und mit achtundzwanzig kein junges Mädchen mehr. Es hatten sich bereits einige feine Linien in ihr Gesicht gegraben. Im Gegensatz zu denen der Brüder waren ihre braunen Haare von Natur aus glatt, zu ihrem Kummer, denn wenn sie sich in Gesellschaft bewegte, brannte sie sich deswegen einige Korkenzieherlocken, der herrschenden Mode folgend. Aber heute waren sie nur einfach gescheitelt und zurückgebunden. Sie trug eine Schürze über ihrem Hauskleid, und die Art, wie sie sich gegen die Wand des Vorzimmers lehnte, signalisierte weniger Erschöpfung als ernsthaften Überdruss und Ärger über ihren Bruder.
»Das ist nicht wahr, Lottchen«, sagte Jacob.
»Doch, das ist es. Für dich gibt es nur Wilhelm und eure Bücher. Carl und Ferdinand sind Enttäuschungen und bedeuten lediglich Ausgaben, Louis nimmt mit seinen Bildern Raum für Bücherregale weg, und ich erspare dir wenigstens eine Haushälterin. Aber wenn heute hier ein Feuer ausbräche, wie im Stadtschloss vor zehn Jahren, weißt du, was du tätest? Du würdest Wilhelm retten und dann so viele Bücher wie möglich. Der Rest von uns könnte sehen, wie er sich bei dem Feuer zurechtfände.«
Ehe er sich zurückhalten konnte, erwiderte er: »Ihr habt alle zwei Beine, um selbst vor dem Feuer fortzulaufen, Lotte, aber ich habe hier eine der wenigen Abschriften der älteren Edda, die es in deutschen Landen gibt und die ich in jahrelanger Arbeit …«
Sie schlug mit der linken Hand gegen die Wand hinter sich, und Jacob verstummte. Eine Weile musterten sie sich schweigend. Er hatte seine Mutter vergöttert und nie verstanden, warum Lotte so ganz anders war; manchmal grüblerisch, manchmal streitlustig, statt sanft und verständnisvoll, wie es die Mutter als Inbegriff von Weiblichkeit doch vorgelebt hatte. Gegen seinen Willen sah er wieder die tote Frau vor sich. »Tropf ihr heißes Wachs ins Gesicht«, das schrieb und edierte sich so leicht. Er hatte es als Symbol für rituelle Reinigung verstanden, möglicherweise auch als Hinweis auf keltische Jenseitsvorstellungen, und die mögliche Verbindung zu Wolfram von Eschenbachs »Parzival« hatte ihn interessiert. Was es bedeutete, wenn etwas Derartiges real einem Gesicht angetan wurde, das hatte Jacob nie bedacht, nicht bis zum heutigen Morgen.
»Lotte«, sagte er schließlich, »wenn es für mich nur den Wilhelm gäbe, dann wären wir von Kassel weggegangen, als die Franzosen kamen. Dann hätte ich nie meinen Stolz hinuntergeschluckt und um eine Anstellung bei dem jungen Bonaparte gebeten. Das habe ich getan, weil ich für euch alle verantwortlich bin. Ihr seid doch meine Geschwister.«
Er würde sich nicht dafür entschuldigen, Präferenzen zu haben. Carl hatte seine Stelle als Weinhändler verloren, sein gesamtes Erspartes verspekuliert und beeilte sich derzeit ganz und gar nicht, seinen Brüdern nicht länger auf der Tasche zu liegen. Ferdinand hatte endlich bei einem Verlag in Berlin Arbeit gefunden, und Louis war aufrichtig begabt, war es wert, dass man ihn unterstützte. Keiner von ihnen war jedoch wie Wilhelm, und Lottchen war eine Frau.
»Manchmal frage ich mich, was der Vater wohl getan hätte«, sagte Lotte. Sie war erst drei Jahre alt gewesen, als der Vater starb, und besaß keinerlei Erinnerung an ihn. Jacob hütete seine eigenen Erinnerungen wie sorgfältig aufpolierte Gemmen, doch manchmal fürchtete er, dass sie auch nicht mehr Leben enthielten, als Gemmen es taten. Er hatte den Geschwistern den Vater immer als alles geschildert, was gut und edel an einem Mann war, doch wenn er versuchte, sich auf eine so einfache Kleinigkeit zu besinnen wie die Frage, ob der Vater des Morgens Kaffee oder doch lieber Tee getrunken hatte, dann vermochte er es nicht. Es war, als seien die Züge des Vaters zu einem Porträt erstarrt, das zwar Wahrheit spiegelte, aber eben kein Leben mehr. Was der Amtmann Grimm getan hätte, hätte er die französische Besatzungszeit noch erlebt, das wusste Jacob nicht, doch das Porträt von ihm in seinem Herzen hatte ihn bei seinen einsamen Entscheidungen immer missbilligend und mahnend zugleich gemustert, ohne dass ihm dies weiterhalf.
»Er hätte uns gemahnt, treu zueinanderzustehen«, entgegnete Jacob, was die Art von vorbildhafter Antwort war, wie er sie gab, seit er elf Jahre alt war, wenn er versuchte, ein gutes Familienoberhaupt zu sein. Zu streiten fiel ihm wesentlich leichter, weil es wenigstens seine verbale Kreativität herausforderte.
Lotte verzog den Mund, doch ihre eigene Streitlust schien verflogen. »Was musst du denn so dringend mit dem Wilhelm besprechen?«, fragte sie. »Ist euer Gehalt doch noch erhöht worden?«
Der neue Kurfürst hatte bei fast allen Staatsbeamten das Gehalt erhöht, wie es bei einer Regierungsübernahme üblich war. Bei allen, außer jenen, die er entweder für nicht genügend gesinnungsgetreu oder für Parteigänger seiner ihm entfremdeten Gemahlin hielt.
Weder Jacob noch Wilhelm hatten Gehaltserhöhungen erhalten. Ihr Vorgesetzter, der erste Hofbibliothekar Völkel, dagegen schon.
»Nein«, gab Jacob kurz angebunden zurück. Er dachte nicht gern daran, was die Haltung des neuen Kurfürsten bedeuten konnte. Immer noch war er auf sein Bibliothekarsgehalt angewiesen. Die Stelle in der Zensurkommission bedeutete nur eine weitere Nebeneinkunft, was der einzige Grund dafür war, warum er sie angenommen hatte. Von ihren Buchveröffentlichungen konnten weder er noch Wilhelm leben. Der Leserkreis für Aufsätze über den altdeutschen Meistergesang oder altdänische Heldenlieder war begrenzt, und wenn die Märchen sich auch im Vergleich dazu wesentlich besser verkauften, so behauptete doch ihr Verleger, dass bisher noch nicht einmal die Unkosten des Verlags gedeckt seien.
Ganz zu schweigen davon, dass es offenbar einen Leser gab, der ein plattdeutsches Märchen für eine Gebrauchsanweisung zum Mord an einer ehemaligen Fürstenmätresse hielt. Jacob hatte die Leiche sofort erkannt, aber keinen Anlass gesehen, dies dem Oberwachtmeister mitzuteilen. Er verachtete Polizisten. Doch die Freifrau von Bachros hatte ihn seinerzeit sehr schnell zu sich rufen lassen, als er aus Paris zurück war, weswegen er sich noch genau an sie erinnern konnte.
»Er hat die Aufgabe gehabt, die unseren Schlössern geraubten Bilder und anderes Kunstwerk aufzuspüren und zurückzubringen, richtig?«
Jacob hatte die altmodische Anredeform verabscheut, seit sein erster Lehrer sie gebraucht hatte, um ihn vor den reicheren Mitschülern herabzusetzen, die gesiezt wurden. Von verflossenen Mätressen des Kurfürsten, die ihren eigenen Titel nur ihren Fertigkeiten im Bett verdankten, als Lakai behandelt zu werden, war sogar noch demütigender.
»Ja, Euer Gnaden.«
»Hier ist eine Liste der Gemälde, die seine Hoheit mir persönlich geschenkt hat. Les Er sie durch und sag Er mir, was Er davon bei den Franzosen gefunden hat.«
Nein, er hatte sie wegen ihrer Arroganz und ihres Egoismus nicht gemocht. Unter allen anderen Umständen wäre es ihm gleichgültig gewesen, dass sie tot war. Aber niemand verdiente es, ermordet zu werden. Dass der Mörder dabei noch auf ein Märchen anspielte, dessen Kenntnis hier in Hessen eigentlich nur seinen »Kinder- und Hausmärchen« entstammen konnte, machte die Angelegenheit nicht nur widerlich, sondern überdies auch noch gefährlich. Seit den Karlsbader Beschlüssen sahen die Behörden potenzielle Mörder und Verschwörer überall, und Jacob glaubte nicht, dass der neue Kurfürst ihn und Wilhelm bei dem Verdacht einer Verbindung schützen würde, als geschätzte Mitarbeiter, die außerhalb jeden Zweifels standen.
»Hat Wilhelm gesagt, wann genau er zurückkehrt?«
Lotte zuckte die Achseln. Wilhelm war dabei, sich einen neuen Arzt zu suchen, nachdem sein vorheriger Kassel bald verlassen würde. Im Gegensatz zu Jacob, der als Kind die Pocken überlebt hatte und sich seither eiserner Gesundheit erfreute, wurde Wilhelm regelmäßig von Krankheiten heimgesucht, von seinen Herzattacken und Angstzuständen ganz zu schweigen. Dafür hatte er fast jede neue Behandlungsmethode erprobt, die auch nur einigermaßen erschwinglich war, einschließlich der durch elektrischen Strom, vor ein paar Jahren, als er zur Kur war, die er Jacob sehr ausführlich in einem Brief beschrieben hatte. Billig war nichts davon und ein weiterer Grund, warum sie sich bemühen mussten, bei einem Fürsten, den Jacob persönlich für ein ausgesprochen unterdurchschnittliches Exemplar seiner Spezies hielt, beschäftigt zu bleiben.
»Dann schick ihn sofort zu mir, wenn er kommt«, sagte Jacob, und machte Anstalten, in das Arbeitszimmer zu gehen, das er sich mit Wilhelm teilte. Es war sein Refugium; der blau gepolsterte Lehnstuhl stellte sicher, dass er beliebig lange an seinem Schreibtisch sitzen konnte, die wichtigsten Nachschlagwerke, die er regelmäßig konsultierte, waren in Handreichweite, auch wenn die Bücher mittlerweile in allen Regalen in zweiter Reihe standen. Lotte hielt ihn zurück.
»Ich weiß, dass du nie zuhörst, wenn ich dir etwas sage, auch, wenn es erst zehn Minuten her ist, aber da kannst du trotzdem noch nicht hineingehen. Wir sind immer noch nicht mit dem Aufräumen und dem Abstauben dort fertig.«
»Aufräumen?«, wiederholte Jacob entsetzt, mit einem Schlag aus seinem Grübeln gerissen. »Wenn du meine Manuskripte durcheinandergebracht hast …«
Am Ende beschloss Jacob, in einem nahe gelegenen Kaffeehaus auf Wilhelms Rückkehr zu warten, und sagte das seiner Schwester, um weiteren Streitereien mit Lotte aus dem Weg zu gehen. Der Besuch dort erwies sich dann leider als ein verhängnisvoller Fehler, denn kaum hatte er sich gesetzt, da erspähte ihn der junge Fritz Wegner, den Jacob mittlerweile für einen der zudringlichsten Menschen der Stadt hielt.
»Was für ein Glück, Sie hier anzutreffen, Herr Grimm. Ist die Zensurkommission schon dazu gekommen, meinen Roman zu prüfen?«
Es war die gleiche Frage, die er jedes Mal stellte, wenn Jacob das Unglück hatte, ihm zu begegnen. An jedem anderen Tag hätte Jacob vielleicht noch die Selbstbeherrschung aufgebracht, diplomatisch zu bleiben, aber nicht an diesem.
»Leider ja, Herr Wegner.«
Der junge Wegner wurde blass.
»Leider? Dann wird er nicht … Aber er enthält doch gar keine Politik!«
»Wenn Sie das wirklich glauben, dann sind Sie nicht nur ein miserabler Schriftsteller, sondern obendrein noch dumm«, sagte Jacob ungerührt. »Wenn man heute einen Roman schreibt, in dem der Schurke ein Fürst ist und sich Mätressen hält, dann ist das Politik.«
»Aber es handelt sich doch bei dem Schurken ganz eindeutig um einen französischen Fürsten! Einen Usurpator, nicht um den wahren, deutschen Landgrafen, der sich bei den edlen Räubern in den Höhlen verstecken muss, bis ihm zu seinem Recht verholfen wird! Der Roman zielt doch eindeutig auf die gottlosen Welschen, nicht auf – was meinen Sie, warum ich den Fürsten Geronimo genannt habe?«
»Weil Sie zu allem Überfluss auch noch mangelnde Erzählerlogik an den Tag legen«, erwiderte Jacob. »Französische Fürsten tragen keine spanischen Namen. Was den früheren König von Westphalen betrifft, so lautete die ursprüngliche Form seines Namens Girolamo Buonaparte, da es sich bei ihm um einen Korsen handelt und die Korsen eine Abart des Italienischen sprechen. ›Hieronimo‹ wäre als Anspielung in diesem Fall sprachlich korrekt gewesen. Aber welchen Namen auch immer Sie verwendet hätten, es hätte nichts an Ihrem gotterbärmlichen Schreibstil geändert. Ich muss im Rahmen meines Berufs die Inhalte sämtlicher hessischer Leihbibliotheken kennen, also glauben Sie mir bitte, wenn ich Ihnen versichere, dass sich Ihre Räuberpistole selbst im Vergleich zu den sentimentalen Ergüssen eines Herrn Clauren als unterdurchschnittlich ausnimmt.«
»Sie … Sie … wissen Sie, was Sie sind? Ein feiger Franzosenknecht, das sind Sie! Während andere Leute fürs Vaterland gekämpft haben, da haben Sie sich bei den hiesigen Handlangern des korsischen Ungeheuers angebiedert! Ich weiß nicht, warum man Sie nicht längst aus Hessen rausgeworfen hat!«
Wenn Jacob den Fritz Wegner ernst genommen hätte, dann hätte er darauf hingewiesen, dass seine Brüder Louis und Carl an den Befreiungskriegen teilgenommen hatten, und nicht auf französischer Seite. Aber der junge Mann war ihm einfach nur lästig. Also entgegnete er trocken: »Es muss wohl an der Trägheit bei den Behörden liegen, Herr Wegner. Wenn es nach mir ginge, dann würde Ihr Roman sogar zugelassen werden. Ganz offen, ein Aufrührer, der sich von einer Prosa wie der Ihren inspirieren lässt, kann gar keine erfolgreiche Revolution durchführen, und es ist nicht die Aufgabe der Kommission, literarische Leistungen zu bewerten, sonst dürfte in Hessen nämlich so gut wie überhaupt nichts mehr veröffentlicht werden. Aber wenn Sie wirklich einen Roman unter die Leute bringen wollen, in dem der Schurke ein Fürst ist, der mit seiner Mätressenwirtschaft den Staat zugrunde richtet, dann nicht in einem Land, dessen verstorbener und gegenwärtiger Herrscher offen mit ihren jeweiligen Mätressen zusammenleben. Ziehen Sie dafür am besten in die Schweiz.«
Wegners volle Lippen zitterten. Zu Jacobs Unbehagen brach der junge Mann in Tränen aus. Wilhelm, dachte Jacob mit einem Hauch schlechten Gewissens, hätte Fritz Wegner die gleiche Nachricht wohl freundlicher, wohlwollender beigebracht und am Ende sogar sein Taschentuch angeboten. Deswegen war Wilhelm auch jemand, der, im Gegensatz zu ihm, zu Gesellschaften nicht nur aus Pflichtgefühl eingeladen wurde. Aber Wilhelm war nicht hier, und Jacob hatte nie verstanden, warum er lügen sollte, wenn es nicht darum ging, seine Familie oder sich selbst zu schützen.
»Sie sind ein Ungeheuer, Herr Grimm!«, schluchzte Wegner. »Wie Sie damit fertig würden, wenn man Ihre Schriften verböte, das möchte ich mal erleben!«
»Dann bewerben Sie sich doch um ein Zensoramt, Herr Wegner, und es mag wohl dazu kommen. Mein nächstes Buch handelt nämlich von der deutschen Grammatik, und mit dieser stehen Sie, Ihrem Roman nach zu urteilen, ebenfalls auf Kriegsfuß.«
Der junge Wegner schniefte ein letztes Mal. Dann verkündete er mit überraschend gefestigter Stimme: »Das werden Sie noch bereuen!« Damit verließ er das Kaffeehaus, und die übrigen Gäste, die so taten, als hätten sie nicht gelauscht, vertieften sich wieder in ihre Gespräche. Jacob nahm sein Exemplar des Westöstlichen Diwans auf. Obwohl er Goethes erst im letzten Jahr veröffentlichten Gedichtband sehr schätzte, fiel es ihm heute schwer, sich darauf zu konzentrieren.
Die Freifrau von Bachros war als Anne-Marie Mouet in Rosbach als Sprössling einer der vielen Hugenottenfamilien geboren worden, die sich vor mehr als einem Jahrhundert, aus Frankreich vertrieben, in den deutschen Fürstentümern angesiedelt hatten. Sie war bei weitem nicht so lange wie die Gräfin von Hessenstein Mätresse des verstorbenen Kurfürsten gewesen. Anders als die Gräfin hatte sie ihm nur zwei, nicht dreizehn Kinder geboren. Aber da der verstorbene Wilhelm I. ganze Regimenter nach Nordamerika verkauft hatte, um seine Mätressen und Bastarde angemessen auszustatten, war keine der betreffenden Damen beim Volk beliebt gewesen. Trotzdem, wer konnte sie so sehr gehasst haben, dass er sie auf eine solche Weise umbrachte? Sie hatte doch keinerlei Einfluss mehr. Hätte der Anschlag der derzeitigen Mätresse des neuen Kurfürsten gegolten, dann hätte das noch einen Sinn ergeben. Oder selbst auf die Gräfin von Hessenstein, angesichts dessen, dass die Zeit ihres Einflusses erst wenige Wochen zurücklag, und daher Wunden, die sie geschlagen haben konnte, noch offen sein mochten. Aber eine Mätresse, deren Glanzzeit schon zwanzig Jahre zurücklag?
Um so viel Wachs zum Kochen zu bringen, das für diesen Mord nötig war, brauchte man doch gewiss nicht nur eine entsprechende Feuerstelle und Gefäße, sondern auch Hilfe. Um eine Frau zu fesseln, damit man ihr Gesicht mit Wachs übergießen und sie auf diese Weise nicht nur foltern, sondern auch ersticken konnte, war ebenfalls mehr als ein Mann nötig. Es mussten also mehrere Menschen sein, deren Hass gegen die Verstorbene groß genug gewesen war. Entweder das, oder ein Mann mit Geld oder Macht genug, um anderen zu befehlen.
Nun, es war Sache der Polizei, Näheres herauszufinden. Damit machten sie sich auf alle Fälle nützlicher als mit dem Überprüfen unvorsichtiger Worte von Professoren gegenüber ihren Studenten, die wegen der Karlsbader Beschlüsse häufig überwacht wurden. Aber was war, wenn der Oberwachtmeister von heute sich stattdessen darauf versteifen sollte, Jacob weiter nach den Quellen für das Märchen von den drei schwarzen Prinzessinnen zu befragen? Jacob hatte seine Gründe dafür gehabt, der Frage auszuweichen, und von dem Mann herabsetzend angeredet worden zu sein, war dabei noch das Geringste gewesen.
Als Wilhelm endlich kam, wanderten Jacobs Gedanken immer noch durch das gleiche Heckenlabyrinth, aus dem es keinen klaren Ausweg zu geben schien.
»Lotte hat mir gesagt, dass ich dich hier finde«, sagte Wilhelm fröhlich. »Auch, dass du in einer fürchterlichen Laune bist und ich es nicht wagen soll, dich zurückzubringen, ehe ich dich nicht wieder zu einem Menschen mit mehr Geduld gemacht habe.«
Seit der Gerichtsassessor Hassenpflug Lotte den Hof machte und ihr damit eine Zukunft vor Augen stellte, in der sie nicht für den Rest ihres Lebens die Haushälterin ihrer Brüder sein musste, neigte sie dazu, sich nicht einmal mehr den Schein weiblicher Bescheidenheit zu geben, dachte Jacob.
»Meine Laune wird bald die deine sein«, erwiderte er und schilderte seinem Bruder das Unglück des Vormittags. Jeder Übermut wich schnell aus Wilhelms Miene. Wilhelm mochte so umgänglich wie Jacob schroff sein, doch er war nie fähig gewesen, seine Gedanken und Gefühle daran zu hindern, sich durch seine Augen so deutlich wie eine flammende Schrift an einer Wand Bahn zu brechen, und nun schaute er genauso verstört, elend und aufgebracht drein, wie Jacob sich immer noch fühlte. Es erleichterte Jacob. Wilhelm konnte ungehemmt Gefühle ausdrücken, was es Jacob gestattete, der Logische, Vernünftige von ihnen beiden zu sein, ohne sich deshalb wie ein Wesen ohne Empfindungen vorzukommen. Er brauchte Wilhelm, um er selbst zu sein; so war es schon immer gewesen.
»Die Geschichte von den drei schwarzen Prinzessinnen haben die Fräulein von Droste mir geschickt«, sagte Wilhelm langsam.
»Ich weiß.« Jacob hatte es sofort gewusst, als er die Worte auf dem Papier und die Todesart erkannte; sein Gedächtnis war schließlich das eines geübten Bibliothekars, eines Gelehrten, der sein Quellenstudium mit Leidenschaft betrieb.
»Wir können die Damen unmöglich bei der hessischen Polizei kompromittieren«, sagte Wilhelm heftig. Mit Mühe unterdrückte Jacob ein Seufzen. Wilhelms Reaktion bewies, was Jacob bereits vermutet hatte; sein Bruder hatte sich das westfälische Fräulein keineswegs aus dem Kopf geschlagen. Wilhelm mochte »die Damen« sagen, doch in Wahrheit kam es ihm nur auf eine der beiden Schwestern an, die zu ihren Quellen für den zweiten Märchenband gehört hatte, und es war die, mit der er seither traulich Briefe wechselte.
»Es besteht kein Anlass, sich Sorgen um die Fräulein von Droste zu machen«, entgegnete Jacob sachlich. »So weit reicht der Arbeitseifer eines hessischen Polizeioberwachtmeisters nicht, dass er bis nach Münster reist, um zwei adlige Fräulein wegen eines Mordes in Kassel zu befragen. Das war nicht der Grund, warum ich ihm die Namen nicht genannt habe.«
Wilhelm hatte einen raschen Geist, der dem von Jacob nicht hinterherjagte, sondern gewöhnlich Seite an Seite mit ihm lief, ja, ihn hin und wieder überholte. Auch darum bedeutete Jacob die Gesellschaft seines Bruders mehr als die jedes anderen Menschen. Daher war es ungewöhnlich, dass Wilhelm nicht sofort begriff, worauf er hinauswollte. Es musste wohl an dem Fräulein von Droste liegen, und das war beunruhigend. Mit diesem Fräulein konnte es keine Zukunft geben. Sie war Katholikin, hatte trotz ihres Standes keine Mitgift, und vor allem anderen war sie adlig.
»Die einzige unserer Quellen, die wir je öffentlich gemacht haben, war die Viehmännin«, sagte Jacob ungeduldig. »Weil die Viehmännin die einzige Frau war, die tatsächlich nicht mehr jung ist und aus dem Volk stammt. Wir haben unsere Märchen jedoch als Geschichten aus dem Volk beschrieben, Wilhelm, überliefert von Großmüttern aus dem Bauernstand. Nicht als Erzählungen von gutbürgerlichen oder gar adligen jungen Damen zwischen fünfzehn und fünfundzwanzig Jahren. Wenn das an die Öffentlichkeit dringt, wird es unserer Reputation als Wissenschaftler schaden.«
Wilhelm schüttelte den Kopf. »Ich glaube nicht, dass so etwas die Herren von der Polizei überhaupt interessieren wird.«
»Die Herren von der Polizei interessiert alles«, sagte Jacob düster. »Deswegen muss die Zensurkommission ihnen ja regelmäßig Berichte schicken. Und sie legen alles andere als Sorgfalt an den Tag, wenn es darum geht, Dinge für sich zu behalten. Ich vertraue keinem Polizisten meinen Ruf an, meinen nicht und deinen auch nicht.«
»Ich vertraue gewiss keinem Polizisten, was den ausreichenden Respekt bezüglich des guten Rufes einer Dame betrifft, die mir nichts als Freundlichkeit erwiesen hat«, entgegnete Wilhelm steif, was für Wilhelms Verhältnisse ein deutlicher Tadel war. Ohne dass er es aussprechen musste, konnte Jacob den Vorwurf in seinen Augen lesen: Wilhelm hielt ihn für selbstsüchtig.
»Enge Verbindungen zwischen Adligen und Bürgerlichen«, sagte Jacob und schaute dabei auf den Gedichtband, der immer noch vor ihm auf dem Tisch lag, um Wilhelm die Gelegenheit zu geben, seine Gefühle zu ordnen, »sind lange nicht so glücklich wie die zwischen Menschen aus gleichem Stand. In gewissen Lagen muss der Adlige den Bürger im Stich lassen, und der Bürger kann ihm nicht folgen. In manchen Fällen ist das umgekehrt. Eigentliche Schuld hat keiner dabei. Bürgerstolz hat etwas Rauhes, Polterndes, aber mehr Bewusstsein wirklicher Werte. Er ist bei den besseren Bürgerlichen größer, der Adelsstolz bei den besseren Adligen kleiner, aber treffen, wirklich treffen, können die beiden sich nie.«
»Du hast Freunde von Adel«, sagte Wilhelm. »Einen von ihnen sogar seit deiner Schulzeit, Jacob!«
»Ja. Und ich kann keine Minute lang vergessen, dass Otto von der Malsburg das Stipendium bekommen hat, das ich eigentlich verdient hatte, nur weil er der Sohn eines Adligen war.«
»Manchmal bist du noch ganz wie ein Kind«, sagte Wilhelm, zu Jacobs Überraschung mit offensichtlicher Erheiterung. Jacob schaute auf, und tatsächlich, sein Bruder, dem er nur ein einziges Jahr voraus hatte, schien keineswegs verärgert, sondern lächelte ihn an.
»Ich bin mir sehr wohl bewusst, dass ein Fräulein von Droste niemals etwas anderes als Freundschaft für einen Kassler Gelehrten empfinden wird noch soll«, sagte Wilhelm. »Auch ich hege keinerlei Gefühle für sie, die rein freundschaftliche Sympathie überschreiten. Du brauchst dir also in dieser Hinsicht keine Sorgen zu machen.«
Am liebsten hätte Jacob protestiert, er mache sich keine Sorgen, die nicht begründet waren, aber das hätte den Vorwurf, wie ein Kind zu reagieren, nur bestätigt. Er entschloss sich stattdessen, seinen Bruder ein wenig zu necken.
»Immerhin hast du mir einmal geschrieben, sie sei dir im Traum erschienen, ganz in dunkle Purpurflammen gekleidet, hätte sich einzelne Haare ausgerissen und sie als brennende Pfeile durch die Luft nach dir geworfen. Das klingt mir durchaus besorgniserregend.«
Ein Schatten legte sich auf Wilhelms Gesicht. Er glaubte an die Bedeutung von Träumen, hatte es immer getan, schon, als sie in ihrer Kindheit im gleichen Bett geschlafen hatten, Wilhelm schreiend aufgewacht war und nicht wieder einschlief, bis er Jacob in allen Einzelheiten geschildert hatte, welche Nachtmahr ihn gerade plagte.
»Nicht von ihr«, sagte Wilhelm. »Das habe ich nicht von Fräulein Jenny geträumt. Sondern von ihrer Schwester. Von Annette.«
Kapitel 2
Solange sich ihr Wachsein noch dem Schlaf entwirrte, war alles wie früher: Ein neuer Tag, dachte Annette schlaftrunken, nach der Messe und dem Frühstück wird wohl Zeit sein, um spazieren zu gehen, doch Jenny wird bei den Blumen arbeiten wollen, dazu hat ihr der Vater das Glashäuschen eingerichtet. Sie reckte sich und stieß mit den Zehen gegen ein Bein. Natürlich, sie lag nicht in ihrem eigenen Bett auf dem Schloss, sondern in der Stadtwohnung am Alten Steinweg, im Haus des Postmeisters, wo sie es mit Jenny teilen musste, wenn sich die Familie in Münster befand, schon weil die beiden jüngeren Brüder darauf bestanden, alle Einzelräume für sich und ihre Freunde in Beschlag zu nehmen, und obendrein noch August zu Besuch war.
August. Annette wurde ein wenig wacher, und die Gegenwart legte sich wie kalte, klamme Feuchtigkeit um sie. Nichts war mehr wie früher. Ihre Gedanken über das, was erst vor wenigen Monaten geschehen war, ließen sie keine Minute allein. Die seit Monaten währende Scham in ihr machte sie endgültig wach, und auch der Hass, den sie nicht hegen durfte. Deine Schuld, sagte sie sich, es ist alles deine Schuld, vergiss das nicht, aber es half nichts, genauso wenig, wie all das Flehen zu Gott ihr bisher geholfen hatte.
»Bist du wach, Nette?«, fragte Jenny leicht benommen. »Ist es schon Zeit für die Messe?«
»Es ist gewiss halb sieben«, antwortete Annette und zwang sich, die warme Decke zurückzuschlagen und aufzustehen. Wie um ihr recht zu geben, konnten Jenny und sie nun die Glocken hören. Jenny setzte sich rasch auf. Auf dem Land mochte es angehen, hin und wieder auf den Besuch der Frühmesse zu verzichten, doch in der Stadt war das undenkbar, zumindest wenn man ein Mitglied der Familie Droste zu Hülshoff war.
Annette hatte das vergangene halbe Jahr damit verbracht, sich vorzustellen, wie jeder einzelne Kirchgänger bis ins kleinste Detail über ihre Schande Bescheid wusste und mit diesem Wissen auf sie starrte, jedes Mal, wenn sie an einem Gottesdienst in der Stadt teilnahm. Umsonst sagte sie sich, dass die Leute anderes kümmerte; anderer Klatsch, andere Sorgen, und, so war zu hoffen, wenigstens für einige tatsächlich das Bedürfnis nach Gott. Sie konnte sich davon überzeugen, bis sie über die Schwelle der Kirche trat, aber dann war alle Sicherheit dahin.
Das Fräulein Nette, meinte sie zu vernehmen, als schrie es jeder missbilligend abgewandte Kopf in die Weite, haben Sie es auch schon gehört? Trug die Nase immer so hoch, bildete sich ein, mit den Männern debattieren zu können, und dann benimmt sie sich wie …
»Nette, träumst du? Wir müssen uns beeilen!«, sagte Jenny ungeduldig und zupfte sie am Arm. Jenny war schon fast mit dem Ankleiden fertig, gerade so weit, dass Annette ihr mit dem Zurechtlegen der Haare helfen musste. Wenn sie Jenny von ihren Ängsten erzählte, dann würde Jenny lachen – nein, nicht lachen, denn Jenny wusste sehr wohl, dass sie nicht völlig unbegründet waren. Aber Jenny würde auf ihre Große-Schwester-Manier zurückfallen und sagen: »Die Leute haben noch anderes im Kopf, Nette. Musst du denn selbst im Schämen eingebildet sein und meinen, dass du für alle im Mittelpunkt stehst?«
Nein, das würde sie auch nicht sagen. Zu unfreundlich wäre das für ihre Schwester Jenny dieser Tage. Jenny behandelte sie jetzt schon über Wochen manchmal wie eine Invalide, dachte Annette, und das war weit schlimmer, als ein offener Vorwurf es gewesen wäre. Sie hatten nie über das gesprochen, was in Bökendorf geschehen war, nur dass Jenny nicht ein einziges Mal nach Straube gefragt hatte, während sie früher Nette wegen jedes Verehrers geneckt hatte. Nein, Jenny musste wenigstens in groben Zügen Bescheid wissen. Ob Anna ihr geschrieben oder August es ihr erzählt hatte, spielte keine Rolle.
Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern, aber das konnte sie nicht beten, nicht aufrichtigen Herzens. August, als er in Münster eintraf, hatte nichts Besseres zu tun gehabt, als festzustellen: »Wie erfrischend, zu Besuch bei euch zu sein und zu Wort zu kommen. Nette, so ein wenig Zurückhaltung steht dir ungemein. Bökendorfer Lehren greifen tief, wie?«
Er war eingeweiht. Nicht erst hinterher, sondern schon vorher, davon war sie mittlerweile überzeugt und hasste ihren Halbonkel, während sie sich gleichzeitig sagte, dass sie kein Recht dazu hatte. Schuld, Schuld, übergroße Schuld.
Vorher und nachher. Vor Bökendorf hatte Annette Pläne gehabt. Sie machen Verse, Fräulein von Droste, wie reizend, wie apart, nein, mein Herr, nicht apart, nicht für einen Damenzirkel, nein, ich will mehr, und warum nicht? Warum nicht? Ich habe es in mir, ich weiß es. In die Welt hinaus damit!
Aber nicht mehr nachher. Nie mehr. Nicht nach Bökendorf. Schuld, Schuld, und die Enttäuschung in den Augen ihrer Mutter. Annette hatte die letzten Monate damit verbracht, zu versuchen, sich reinzuschreiben, Gedichte für ein geistliches Jahr geschrieben, Flehen zu Gott, siehst du, Mama, daran kann doch niemand Anstoß nehmen, hörst du mich bitten?
Annette hatte ihrer Mutter die Gedichte zu Weihnachten verehrt. Ihre Mutter hatte sie ungelesen in ihren Sekretär gesperrt und nicht wieder herausgenommen.
Maßlosigkeit ist in keiner Angelegenheit wünschenswert, Nette. Wir wollen nicht mehr davon sprechen.
»Komm, Nette«, sagte Jenny, und sie liefen die Treppe hinunter, die Fräulein von Droste, Haare gebändigt und gebunden, nichts Maßloses, Mama, gewiss nicht, kleine, kleine Schritte zur Kirche.
Nachbarin, Euer Fläschchen, dachte Annette und musste sich zurückhalten, um in der frühen Morgenstunde nicht zu lachen. Manchmal schlug all das Elend in ihr um, wie Most zu Essig wurde, und passend-unpassende Zitate aus dem »Faust« waren da noch das Geringste, was ihr in den Sinn kam. Oh, Gretchen zu sein, ohne vorher wenigstens einen Faust gefunden zu haben, wie absurd das doch war. Oder besser noch, Faust sein. Wenn schon Schande, warum dann nicht gleich ein Pakt mit dem Teufel, um herauszufinden, was die Welt im Innersten zusammenhält.
Wär ich ein Mann im mindesten nur, ein Stückchen von einem Soldaten, was war das? Ein Fragment von einem Satz, ein Vers? Nicht für ein weiteres geistliches Jahr, nein, das war ein Satz, der in eine andere Art von Gedicht gehörte, ein unbotmäßiges, weltliches.
Ein Ellbogen stieß ihr in die Seite. »Wo bist du nur wieder mit deinen Gedanken, Nette? Willst du denn heute gar nicht zur Kommunion gehen?«
Wär ich. Wär ich. Aber ich bin nicht. Und ich werde nie sein.
Annette sank vor dem Altar auf die Knie.
Nach der Messe nahm die Familie gemeinsam das Frühstück ein, und da August bald wieder abreisen wollte, zog sich das Plaudern am Kaffeetisch über mehrere Stunden hin. August war der Stiefbruder von Annettes Mutter, die eine geborene Haxthausen aus Bökendorf war. Zwanzig Jahre jünger als sie, stand er jedoch vom Alter her näher an Jenny und ihren Geschwistern, weswegen er von ihnen stets eher wie ein geliebter Vetter denn wie eine Autoritätsperson behandelt worden war. Von Annettes Brüdern machte es ihm nichts aus. Nur Annette, die fünf Jahre jünger als er war, hatte er es übelgenommen, nicht von ihr bewundert zu werden. Dass sie ihn ausgelacht hatte, als er zum ersten Mal in einem mittelalterlichen Kostüm auf Hülshoff erschienen war, hatte er ihr, da war sie ganz sicher, nie verziehen.
»Das bildest du dir ein«, meinte Jenny, als Annette einmal etwas in der Richtung äußerte, aber Jenny neigte dazu, in Menschen prinzipiell das Gute zu sehen. Man musste sich nur vor Augen halten, wie sie hingebungsvoll für Wilhelm Grimm Märchen aufgeschrieben hatte, für nichts als ein paar freundliche Worte. Noch nicht einmal eine Erwähnung im Vorwort war es den Grimms wert gewesen.
»Aber Nette, es ist doch eine Ehre, dass wir dazu beitragen konnten, den Wissensschatz unseres Volkes zukünftigen Generationen zu erhalten. Wir wissen das. Wer ist denn so ruhmsüchtig, seinen Namen unbedingt gedruckt sehen zu wollen?«
»Ich bin es«, hatte Annette mit der Selbstsicherheit ihrer noch nicht von Bökendorf erschütterten Existenz erklärt, »aber längst nicht so sehr wie die Herren Grimm. Den Tag möchte ich nämlich erleben, an dem die beiden nicht ihren Namen unter etwas setzen, das sie als ihre Arbeit betrachten.«
»Wir sind doch nicht die Einzigen, die Märchen beigetragen haben. Anna, Ludowine, Malchen Hassenpflug, das sind nur diejenigen, die wir persönlich kennen, und keiner von ihnen war so unbescheiden, eine Erwähnung zu fordern. Weißt du, Nette, manchmal kann ich schon verstehen, warum Haxthausens meinen, dass du dich immer und überall in den Vordergrund spielen musst.«
»Im Hintergrund sieht man mich nicht«, hatte Annette erwidert, mit einem Lächeln, denn in jenen Tagen war sie durch Kritik nicht zu kränken gewesen. »Ich bin zu klein.«
Aber sie hatte das Thema gewechselt, weil sie sehr wohl verstand, dass Jenny nicht für zukünftige Generationen gewissenhaft alle Märchen hatte aufschreiben wollen, an die Annette und sie sich erinnern konnten. Sie hatte es für ihren hessischen Gelehrten getan, der, soweit es Annette betraf, dergleichen nicht verdiente. Leider würde sie es nicht über sich bringen, Jenny je von dem tieferen Grund für ihre Abneigung gegen Wilhelm Grimm zu erzählen.
Als gegen elf Uhr Briefe von der Postkutsche gebracht wurden, waren auch welche aus Kassel darunter, und Annette war froh, sich inzwischen genug unter Kontrolle zu haben, um kein Interesse dafür zu zeigen. Straube würde ihr nie vergeben, würde nie wieder schreiben; das war inzwischen mehr als deutlich geworden. Und selbst wenn er es täte; es gab keine Zukunft für ein Fräulein von Droste und einen bürgerlichen Anwalt, dessen Vater den Bankrott hatte erklären müssen, das hatte die Mutter bereits vor dem ganzen Unglück deutlich gemacht.
Straube hatte an sie geglaubt, an ihr Talent. Bis zu dem Tag, an dem sie ihm ihre Wertlosigkeit offenbart hatte. »Du weißt hoffentlich, was du angerichtet hast«, hatte August ihr genüsslich erklärt, August, der Straubes letzten Brief überbracht hatte, im September des Vorjahres. Seither war ihr die Kehle eng, wenn sie nur in die Nähe ihres Onkels kam, und sie wusste nicht, ob dabei Ekel, Scham oder Zorn in ihr überwogen.
Annette setzte sich an das Klavier, um August nicht länger im Gesichtsfeld zu haben. Sich in Musik zu verlieren, war ihr immer noch möglich.
»Ich vergesse stets, dass du auch am Flügel brillierst, Nette«, sagte er, und mit einem Mal ritt sie der Teufel. Sie spielte die Champagner-Arie aus »Don Giovanni«. Befriedigenderweise fiel August daraufhin keine hämische Bemerkung mehr ein; jedenfalls blieb er still, während sie Mozarts Wüstling auf dem Klavier nachspürte und froh war, die Partitur ausgiebig studiert zu haben.
»Das Stück kommt mir bekannt vor, Nette«, sagte ihr Vater milde, und ihr innerer Aufruhr legte sich ein wenig. Papa war wie Jenny, immer bereit, das Beste von den Menschen zu glauben, und am glücklichsten, wenn er seine Sammlung versteinerter Schnecken ordnete. Wenn sie glauben müsste, er wüsste über Bökendorf Bescheid, dann wollte sie sterben. Glücklicherweise konnte man sich darauf verlassen, dass Mama dergleichen, wie alles andere Ernsthafte im Leben, von ihm fernhielt. »Ein Volkslied?«
»Mozart, Papa«, sagte sie leise.
»Mein talentiertes Mädchen«, murmelte er und lächelte ihr zu. August räusperte sich, doch was immer er sagen wollte, blieb ungesagt. Jenny, die offenbar einen an sie gerichteten Brief erhalten hatte, faltete ihn sorgsam wieder zusammen und legte ihn in ihr Pompadour, während sie zu Annette sagte:
»Es gibt Neuigkeiten von Malchen Hassenpflug, Nette. Sie hat ein ganz eigenes neues Stickmuster entworfen.«
Annettes Brüder schauten sofort gelangweilt drein. »Nun, wenn die Damen über Stickereien sprechen wollen …«, begann August, und Annette, die nicht einen Moment lang glaubte, dass der Brief von Stickereien handelte, sagte hastig: »Wir werden uns zurückziehen. Die Postkutsche verlässt Münster ja nicht vor dem morgigen Tag, also bleibt noch genügend Zeit, um sich von dir zu verabschieden … lieber Onkel.«
Außerhalb der Hörweite der Familie, auf der Treppe, sprach Jenny immer noch nicht, sondern bedeutete Annette nun durch einen Finger auf dem Mund, dass sie schweigen musste; offenbar wollte sie auch keinen Dienstboten oder den neugierigen Postmeister vom Erdgeschoss als Zuhörer. Vor wenigen Jahren noch hatte die Familie ein eigenes Stadthaus besessen, aber seit das Münsterland nach dem Ende Napoleons an Preußen gefallen war, mussten neue Steuern entrichtet werden, und Papa hatte das Haus verkauft, um stattdessen eine Wohnung für gelegentliche Besuche in Münster zu mieten.
Jenny und Annette holten sich wärmende Umhänge, denn die Märzluft war noch immer zu kühl, um nur im Kleid das Haus zu verlassen, und ließen den Alten Steinweg, die Straße, in der ihre Wohnung sich befand, bald hinter sich.
»Nun bin ich wirklich neugierig«, sagte Annette, als Jenny endlich stehen blieb. »Was steht in dem Brief?«
Sie versuchte, so gelassen wie möglich zu klingen. Straube hat geheiratet, dachte sie; er verkehrte bei den Hassenpflugs, also würde Malchen darüber Bescheid wissen. Straube hat geheiratet, und Jenny will es mir schonend beibringen.
Jenny legte eine Hand auf Annettes Arm, und nun war Annette ihrer Sache gewiss. Gut, dachte sie und versuchte, den salzigen Geschmack von Tränen auf ihren Lippen zu ignorieren. Manchmal hat man eben eine Erinnerung, die einem ganz leise die Wange herunterläuft. Es ist gut, dass er geheiratet hat. Er hat es verdient, glücklich zu sein.
»Jemand hat vor ein paar Tagen in Kassel eine der Mätressen des alten Kurfürsten ermordet«, sagte Jenny. »Indem er sie gefesselt und ihr heißes weißes Wachs von Kirchenkerzen über das Gesicht gegossen hat.«
Die plötzliche Erleichterung in ihrem Herzen war schändlich; die sofortige Neugier angesichts eines so grausamen, bizarren Umstandes nicht minder.
»Aber das klingt doch …«, begann Annette, und Jenny nickte.
»Ja. Es klingt nach den drei schwarzen Prinzessinnen. Und es kommt noch schlimmer. Auf der Leiche der armen Frau wurde ein Blatt mit einem Zitat aus unserem Märchen gefunden. In Plattdeutsch.«
Jetzt meldete sich endlich das Entsetzen, von dem Annette wusste, dass sie es von Anfang an hätte empfinden sollen, aber die unchristliche, weibliche Neugier in ihr, sie wurde nur noch größer.
»Hat dir das wirklich Malchen Hassenpflug geschrieben«, fragte Annette, »oder Wilhelm Grimm?«
Jenny errötete. Daran, dass sie noch immer mit Wilhelm Grimm korrespondierte, obwohl es längst keine Märchen mehr als Erklärung gab, war nichts Geheimes; da ihr Onkel August häufig Wilhelm Grimm in Bökendorf zu Gast hatte, konnte Annettes Mutter nichts gegen den Umgang an sich einwenden, obwohl sie sich in regelmäßigen Abständen die Briefe zeigen ließ, in denen bisher nie ein verfängliches Wort gestanden hatte. Aber Annette wusste, dass Jenny jeden von Wilhelm Grimms seltenen Briefen viele Male las, und Jenny wusste, dass sie es wusste, und dass Briefe zu schreiben häufig Einsamkeit mit Geselligkeit verband.
»Es war Lotte Grimm«, sagte Jenny. Das kam unerwartet. Vor zwei Jahren hatte der Vater mit ihnen eine Rheinreise gemacht und sich zu einem Abstecher nach Hessen beschwatzen lassen, sogar nach Kassel. Bei dieser Gelegenheit hatten sie auch die Schwester der Grimms kennengelernt, während sich der älteste Bruder, Jacob, in seine Bibliothek verkrochen hatte. Danach hatte es noch ein paar höfliche Dankesbriefe aller Drostes an Lotte als Gastgeberin gegeben, doch genau wie vor dem Besuch in Kassel fand nur zwischen Jenny und Wilhelm Grimm eine regelmäßige Korrespondenz statt.
»Sie macht sich große Sorgen«, fuhr Jenny bekümmert fort. »Es scheint nämlich, dass die Kasseler Polizei meint, dass ihre Brüder etwas mit dem Mord zu tun haben könnten, schon weil sie sich weigern, zu verraten, wo sie das Märchen herhaben.« In der kalten Märzluft waren ihre Wangen rosig gefärbt, obwohl sie kein Rouge aufgelegt hatte. »Annette, die Vorstellung, dass ich Unglück über einen Freund …«
Zum ersten Mal seit Monaten gab es etwas außer ihrer eigenen Misere, auf das Annette sich konzentrieren konnte. Selbst das Schreiben hatte ihr diese Möglichkeit nicht geboten; jeder Brief, jedes Gedicht war ein Flehen um Vergebung gewesen. Die Vorgänge in Kassel dagegen boten ein Rätsel, das nichts mit Bökendorf zu tun hatte, und ihr Verstand, der sich früher immer gerade an Schwierigkeiten entzückt hatte, schärfte sich sofort daran wie ein Schwert an einem lang nicht mehr benutzten Schleifstein. Es war ein beinahe berauschendes Gefühl. In ihrem Körper begann es zu kribbeln, und es schien ihr, als hätte ihr jemand eine Tür aus einem dunklen, lange verschlossenen Raum geöffnet.
»Unsinn«, unterbrach sie ihre Schwester fest, »der Mörder ist der Unglücksbringer, über sein Opfer, nicht über Herrn Grimm. Du kannst ihm ja schreiben, dass er jederzeit unsere Namen nennen darf.« Noch während sie sprach, kam ihr ein weiterer Gedanke, und es erinnerte sie daran, wie sie früher an der Handlung für das Drama gefeilt hatte, das sie nun nie beenden würde, Bertha, wie ein Einfall den nächsten gejagt und Purzelbäume geschlagen hatte.
»Besser noch«, fügte sie hinzu, »besser noch, wir erproben ein weiteres Mal die neuen Straßen, die uns die Preußen gebaut haben, und reisen selbst nach Kassel. Bis Bökendorf sind es jetzt nur noch drei Tage und von dort nach Kassel weitere zwei.«
Jenny starrte sie an. »Aber – wir können doch nicht einfach – Mama würde uns nie nach dort gehen lassen, nicht nach Kassel. Und wenn wir das Wort ›Polizei‹ erwähnen, ganz zu schweigen von ›Untersuchung‹, dann ist ihr nächstes Wort ›Skandal‹. Nein, das ist unmöglich.«
»Nicht ohne Begleitung«, gab ihr Annette recht. »Aber wir können es als eine Ehrenschuld hinstellen. Adel verpflichtet, das sagt sie immer. Es ist unser Märchen. Außerdem wird sie davon beeindruckt sein, dass dein Grimm bisher unsere Namen nicht genannt hat.«
»Er ist nicht mein Grimm!«
»Gewiss nicht. Aber er ist mit August befreundet. August wird unser Begleitschutz, schließlich will er ohnehin weiter ins Hessische reisen. Und August wird Mama versichern, dass er sich als die wahre Quelle des Märchens ausgeben wird. Schließlich haben seine Bökendorfer ebenfalls Märchen beigetragen. Mama wird sich nicht vorstellen können, dass die Kasseler Polizei angesichts eines Herrn von Haxthausen etwas anderes tun wird, als sich dafür zu entschuldigen, ihn belästigt zu haben.«
»Annette«, sagte Jenny misstrauisch, und da sie so gut wie nie den vollen Namen ihrer Schwester gebrauchte, sprach es für ihren Ernst, »du hasst August seit dem letzten Sommer, und er scheint, nun, wie soll ich sagen, zumindest nicht sehr warm für dich zu empfinden. Warum sollte er uns helfen?«
Weil er mir etwas schuldet,