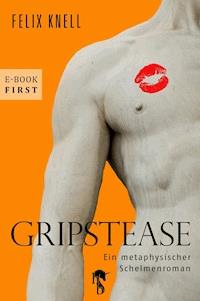
7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: hockebooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Konstantin Freundel führt ein Doppelleben der besonderen Art. Im offiziellen Leben auf einer Vertretungsdozentur in Frankfurt Philosophie lehrend, verdingt er sich nebenberuflich als bezahlter Hausfreund und Reisebegleiter einsamer Damen der Bildungsschicht. Bei seinen unerschrockenen Einsätzen in fremden Betten bietet er aristokratischen Witwen, verträumten Hausfrauen und anderen hoffnungsvollen Kundinnen nicht allein körperliche Befriedigung. Ebenso geschickt weiß er ihren Geist durch intellektuelle Gespräche zu fesseln, um sie dadurch auf Dauer an sich zu binden. Dabei kommt ihm sein Talent zugute, verblüffende philosophische Gedanken zu entwickeln – für Freundel eine gern vollbrachte Fingerübung, für seine Kundinnen hingegen eine perfekte Symbiose von Sexappeal und Intellekt. Als er zum aussichtsreichen Anwärter auf eine Professorenstelle wird, droht ihm das zweigleisige Leben allerdings zum Verhängnis zu werden – zumal er auch noch in erhebliche Geldnöte gerät. Denn die Frankfurter Unterwelt ist von Freundels schutzgeldfrei geführten Geschäften nicht gerade begeistert. Für den Protagonisten steht unvermittelt alles auf dem Spiel, denn selbst seine neu erwachte Liebe zu einer eigensinnigen Schriftstellerin schafft Komplikationen. Bis zu guter Letzt die Dinge eine überraschende Wendung nehmen… Ein Buch über die Sogkraft des metaphysischen Denkens, die wunderliche Welt der Geisteswissenschaften und die skurrilen Nöte brotloser Intellektueller: tiefgründig, frech, poetisch und spannend.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 463
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Felix Knell
Gripstease
Ein metaphysischer Schelmenroman
Kapitel 1: Die Schleuse
Zwei Dinge standen für Dr. phil. habil. Konstantin Freundel außer Zweifel: Die Existenz der Welt war erstaunlich, und er hatte einen geilen Arsch. Letzteres war ihm von seinen zahlreichen Kundinnen im Lauf der Jahre wiederholt bestätigt worden, und obwohl sein vierzigster Geburtstag bereits hinter ihm lag, hatte das Alter auf dem gepriesenen Körperteil noch keine sichtbaren Spuren hinterlassen. Was die Existenz der Welt betraf, so bestand immerhin die naheliegende Alternative in der Existenz von überhaupt nichts. Während das Wasser auf seine Schultern niederprasselte und von dort gegen die Wände der Duschkabine spritzte, versuchte Freundel, das Problem genauer zu fassen. Insbesondere erschien es rätselhaft, dass eine so ungeheure Vielzahl verschiedenartiger Dinge existierte. Nicht allein gab es die endlose Anhäufung von Sternen und Galaxien, die in den stummen Weiten des Universums ihre namenlosen Formationen bildeten. Auch seine Wohnung enthielt zum Beispiel etliche tausend unterschiedlich geformte und gefärbte Gegenstände. Hinzu kam noch der Klang der Kirchturmglocken im Hintergrund, der ätherische Geruch des Kastanienshampoos, das aus seinem Haar tropfte, und das Brennen des immer heißer werdenden Wasserstrahls auf seiner Haut.
Die Existenz der Welt war nur eines der Probleme, die Freundel beschäftigten. Ein anderes war die prekäre Frage, ob er nicht gerade Gefahr lief, die unerwarteten Zukunftsaussichten, die sich ihm an der Universität eröffneten, in fatalem Leichtsinn zu verspielen. Während er sich bemühte, die Temperatur des Wasserstrahls zu regulieren, senkte sich diese Befürchtung in seine Magengrube wie ein zu Boden gelassener Boxersack. Er dachte an die fremde Frau, die am Telefon ihre Wünsche angegeben hatte. Warum nur musste er ausgerechnet zum jetzigen Zeitpunkt ein so enormes Risiko eingehen? Ohnehin würde sein Doppelleben ab dem heutigen Tag eine radikalere, kompromisslosere Form annehmen als in all den Jahren zuvor. All dies würde ihm weitaus mehr Disziplin und Organisationsfähigkeit, aber auch wesentlich mehr Achtsamkeit abverlangen als in der Vergangenheit. Da wäre es schon vernünftiger gewesen, Zurückhaltung zu üben. Und erst einmal abzuwarten, wie die Dinge sich entwickeln.
„Wären Sie imstande, mich mit dem Mund zu verlustieren?“, hatte sich die Frau am Telefon erkundigt, deren Stimme anfangs ein wenig nervös klang und auf ein mittleres Alter hindeutete. „An meinem Schatzkästchen, meine ich. Sind Sie darin versiert?“
Konnte man das so sagen? Jemanden verlustieren? Es hieß doch: Sich verlustieren. Ein reflexives Verb.
„Selbstverständlich“, hatte er routiniert geantwortet. „Das gehört zu meinem Programm. Oder auch eine schöne manuelle Massage. Was immer Sie scharf macht.“
„Ich meine eine richtige Symphonie. Nicht nur ein bisschen mit der Zunge trällern.“
„Ich verstehe, was Sie meinen.“
„Und das Foto ist ein Originalfoto?“
„Klar.“
„Sieht ja O.K. aus. Mir gefällt nur nicht, dass man die Augen nicht sieht.“
„Meine Augen sind grün. Aber ich lege Wert auf Diskretion. Deshalb zeige ich nicht alles. Sollte Ihnen jedoch mein Gesicht nicht gefallen, brauchen Sie mir lediglich die Anfahrtskosten zu begleichen. Das handhabe ich beim ersten Treffen immer so.“
Freundel reckte Renés Gesicht nach oben, kniff die Augen zusammen und ließ das warme Wasser durch seinen Mund laufen. Er fühlte sich wankelmütig und schwach. Gemessen an dem eher bescheidenen Zusatzverdienst, der ihm winkte, stand eigentlich zu viel auf dem Spiel. Mit Macht presste er den Rest des qualligen Duschgels aus der Flasche, um sich die Achselhöhlen einzuseifen. Eines war klar: Unter keinen Umständen durfte er zum gegenwärtigen Zeitpunkt von dem Prinzip abrücken, seinen beiden Professionen an geographisch getrennten Orten nachzugehen. Allerdings hatte seine Gesprächspartnerin zu Beginn des Telefonats erwähnt, sie wohne in einem Taunus-Vorort. Der liege ein erhebliches Stück vom Stadtkern entfernt. Aus diesem Grund suche sie jemanden, der auch Hausbesuche anbiete. Dadurch war ihm das Risiko, trotz anfänglicher Bedenken, einigermaßen kalkulierbar vorgekommen.
Natürlich hatte sie ihm bereits nach wenigen Sätzen die unvermeidliche Frage gestellt, was es mit der philosophischen Bildung auf sich habe, mit der er in seinem Inserat warb. Auch hier hatte Freundel seine Standardantwort parat.
„Es ist so: Ich sehe meine Dienstleistung nicht ausschließlich als sexuelles Angebot. Ich betrachte sie eher – wie soll ich sagen – als eine Form der ganzheitlichen Zuwendung. Und ich finde, das schließt eine interessante Unterhaltung unbedingt mit ein.“
„Und wieso gerade Philosophie?“
„Das ist eine Art Steckenpferd von mir. Ich spreche gerne über philosophische Themen.“
„Und damit kennen Sie sich aus?“
„Ich habe das studiert.“
„Aha … Und was soll ich davon haben?“
Unerwartet schwere See. An die 6 Beaufort.
„Na, ja. … Das Verlangen nach Klarheit. Kennen Sie das nicht? Dieses unbedingte Verlangen nach Klarheit.“
„Das kommt darauf an.“
„Zweifellos.“
Es entstand eine Pause. Derweil war in der Leitung ein gedämpftes Rattern zu vernehmen. Es klang, als mache sich ein Specht an einem Lederkoffer zu schaffen.
„Also“, unterbrach er das Schweigen. „Ich würde sagen: Wenn Sie ebenfalls Wert auf gute Gespräche legen und ab und zu die Neigung verspüren, den Geheimnissen des Lebens auf den Grund zu gehen, dürften Sie bei mir an der richtigen Adresse sein.“
„Ich muss zugeben, dass das Angebot seinen Reiz hat.“ Die Frau ließ ein verhaltenes Lachen erklingen, wirkte nun entspannter als zu Beginn des Gesprächs. „Aber das kostet sicher extra.“
„Nein. Der Preis für den gewöhnlichen Service liegt bei 100 Euro pro Stunde. Bei speziellen Sonderwünschen müssten wir eventuell über einen Aufschlag reden. Aber Gespräche kommen selbstverständlich gratis dazu.“
„Wirklich?“
„Wenn es Ihnen Vergnügen bereitet, mit mir zu plaudern und wir beide ausreichend Zeit zur Verfügung haben, bleibe ich auch gerne länger bei Ihnen. Ohne dafür mehr zu berechnen.“
„Das klingt nett. Ich kann nicht behaupten, dass alle in Ihrem Gewerbe so kulant sind.“
„Mir sind Niveau und ein gutes persönliches Verhältnis wichtiger als exakte Buchführung. Und besonders beim ersten Kennenlernen achte ich darauf, dass kein störender Zeitdruck entsteht.“
„Sie hören sich wirklich sympathisch an. Ich würde Sie gerne treffen. Ich müsste mich nur ebenfalls auf Ihre Diskretion verlassen können.“
„Keine Sorge. Da können Sie mir vertrauen.“
„Was ist denn mit heute Abend? Hätten Sie da Zeit?“
Wie er im Lauf der Jahre gelernt hatte, kam es gerade bei der ersten Kontaktaufnahme darauf an, zeitlich möglichst flexibel zu erscheinen. Daher hatte er ohne längere Überlegung eingewilligt.
„Das ginge im Prinzip gut. Allerdings erst nach 20 Uhr. Das heißt, falls Sie nicht zu weit von der Innenstadt entfernt wohnen.“
„Können Sie raus zu mir nach Kronberg kommen?“
Die Frau klang nun zielstrebig. Allerdings war dies nicht weiter verwunderlich. Frauen, die so weit gingen, bei ihm anzurufen, besaßen in der Regel recht genaue Vorstellungen von dem, was sie wollten.
Freundel verließ die Dusche und trocknete sich ab. Durch das angelehnte Küchenfenster fiel das Licht der Abendsonne auf seine Beine. Die Kirchturmglocken hatten inzwischen zu läuten aufgehört. Dafür waren jetzt vom Hof her Kinderstimmen zu hören. Aus einer der Nachbarwohnungen stieg der Geruch von gekochtem Kohlrabi.
Die Duschkabine hatte der Vermieter damals neu in die Küche eingesetzt. Ein richtiges Bad gab es in der heruntergekommenen Altbauwohnung nicht. Lediglich eine schmale, mit einem gusseisernen Waschbecken ausgestattete Toilette. Er dachte daran, wie Susanne und er bei der Besichtigung der Wohnung feierlich durch die leeren Räume gewandert waren. Sie hatte sich als Erstes davon überzeugen müssen, dass nicht irgendwer aus dem gegenüberliegenden Haus durch das Küchenfenster in die Dusche spähen konnte. Susanne wohnte jetzt in einem anderen Viertel. Nur der Garfield-Aufkleber, der ihm auch heute wieder einen leichten Stich versetzte, prangte noch an der halbdurchsichtigen Schiebetür. An deren Innenseite rannen jetzt perlende Wassertropfen herab. Noten an endlos gedehnten Hälsen gleichend, die unaufhaltsam in den Abgrund einer tiefer und tiefer reichenden Basstonskala glitten.
Die Nasszelle mit ihren schmutzigblauen Kunststoffwänden hatte sich im Lauf der Jahre zu einer Art Schleuse seiner Doppelexistenz entwickelt. Er betrat sie jedes Mal, um sich für einen bevorstehenden Einsatz herzurichten, und kehrte nach getaner Arbeit in sie zurück, um sich von den Spuren seiner Tätigkeit reinzuwaschen. Manchmal kam es ihm so vor, als habe die Kabine zwei Ausgänge, von denen einer auf die Nord- und der andere auf die Südhemisphäre der Erde führte. Er machte sich nichts vor. Er hatte bereits einen handfesten Duschzwang entwickelt. Er benutzte die Dusche auch dann, wenn dies unter hygienischen Gesichtspunkten überhaupt nicht erforderlich war. Sie half ihm einfach, die beiden Hälften seines Lebens voneinander zu unterscheiden.
Während er versuchte, sich auf den Text zu konzentrieren, den er in einer halben Stunde würde aufsagen müssen, musterte er sein Gesicht in dem halb erblindeten Oval des Spiegels, der an dem monströsen Dübel über der Küchenspüle hing. Sein bereits ergrautes, noch feuchtes Haar haftete an beiden Seiten des Schädels. Auf der Vorderseite der Halbglatze, die dazwischen bleckte, entdeckte er einen Mitesser. Er würde ihn später mit etwas Creme kaschieren. Ansonsten wirkte seine Haut für sein Alter noch tadellos. Der südländische Olivton entlockte Jutta Trierweiler regelmäßig unbeholfene poetische Worte. Auch seine Figur ließ nichts zu wünschen übrig. Und dies, obwohl er bisher darauf verzichtet hatte, ein Fitnessstudio zu besuchen, und obgleich er morgens gerne lesend und Kaffee schlürfend im Bett liegen blieb, während seine Fachkollegen im Laufschritt durch den Grüneburgpark trabten. Er musste an Dr. Keltberlet denken, dem er dort einmal kurz nach Sonnenaufgang bei der Rückkehr von einem nächtlichen Einsatz begegnet war. Dr. Keltberlet arbeitete als Oberassistent am Institut und ließ bei jeder Gelegenheit seinen Stolz darüber aufblitzen, bei Randmüller promoviert zu haben. Keuchend hatte er ihm erklärt, allein das morgendliche Joggen versetze ihn in die Lage, sein tägliches Arbeitspensum von bis zu zehn Stunden Lektüre- und Schreibarbeit ohne Effizienzverlust durchzuhalten. Freundel, der seinerseits ein mehrstündiges Arbeitspensum absolviert hatte, das ihm einen ordentlichen Batzen Geld bescherte, war froh, die sportliche Ertüchtigung in seine Tätigkeit integrieren zu können. Er fand, dass Dr. Keltberlet, aus dessen bambushellen Haarsträhnen schwerer, uranhaltiger Schweiß zu tropfen schien, in seinem leukoplastfarbenen Jogging-Anzug ähnlich irreal aussah wie eine Figur aus einem Zeichentrickfilm.
Bereits seit Tagen hatten die Blätter in den hohen Wipfeln der Westendalleen die Klimax ihrer zitrusgelben und granatapfelroten Leuchtkraft erreicht. Einige von ihnen zeigten sich gar in goldfischfarbener Pracht. Umflutet vom Champagnerglanz der verblassenden Herbstsonne, lösten sie sich von den Ästen, um lautlos auf die Torpfosten, Mülltonnen und Trottoirs des Quartiers hernieder zu schweben. Freundel schritt durch den lauwarmen Oktoberabend und wählte eine mnemotechnisch günstige Route. Sie führte ihn in einem großräumigen Viereck um die jüdische Synagoge herum, vor deren Front die aus Beton gefertigten Schutzsperren wie Wellenbrecher aus der Straße aufragten. Aus Erfahrung wusste er, dass er sich seinen wöchentlichen Einleitungsvortrag besonders gut einprägen konnte, wenn er ihn kurz vor Beginn der Veranstaltung noch einmal memorierte und dabei einen Weg beschritt, der ihm nicht vertraut war.
An der Ecke zur Friedrichstrasse tat sich linkerhand eine neue Umgebung auf. Ins Auge stach dort ein fünfgeschossiger Neubau. Seine Fassadenverkleidung bestand aus graubraunem Granulat. Es handelte sich um eine grobkörnige Beschichtung, die aussah, als habe jemand überdimensionales Vogelfutter zu einem speziellen Belag zusammengepresst. Das Anwesen war zwischen zwei stuckverzierte Gründerzeitbauten geklemmt und schien auf verschiedenen Etagen gleich mehrere Zahnarztpraxen zu beherbergen. Die charakteristischen Beleuchtungsgeräte mit ihren großen, beweglichen Schwenkarmen ließen sich von der Straße aus deutlich erkennen.
Freundel riss sich zusammen. Meine Damen und Herren, liebe Studierenden! Ich möchte Sie herzlich zu dem diessemestrigen Hauptseminar begrüßen. Wir werden uns in den kommenden Monaten mit einem ganz und gar elementaren Problem beschäftigen. Mit der Frage nämlich, warum überhaupt eine Welt existiert und nicht vielmehr nichts. Diese Frage wird häufig auch als die Grundfrage der Metaphysik bezeichnet.
Am Rand der gegenüberliegenden Straßenseite war, in einiger Entfernung, die Rückseite eines Möbelwagens zu erkennen. Eine der beiden Hecktüren stand offen. Auf dem Gehsteig zeichneten sich Umrisse eines senkrecht aufgerichteten Bettgestells sowie etlicher kleinerer Einrichtungsgegenstände ab.
In dieser Form wurde die Frage als erstes von Leibniz formuliert. Im 20. Jahrhundert war es dann vor allem Martin Heidegger, der sie wieder aufgegriffen hat.
Inzwischen hatte er sich dem Wagen ein Stück weiter genähert. Für einen Augenblick wurde er von der Melancholie des Umbruchs erfasst, die den aufgetürmten, ihrem alltäglichen Lebenszusammenhang entrissenen Möbelstücken anhaftete. Zu ihnen gehörten neben dem Bettgestell auch mehrere zusammengerollte Teppiche, zwei Stehlampen, ein Schubladenschrank sowie ein großer Cordsessel. Was ihm jedoch vor allem zusetzte, war der Anblick des gefräßigen Laderaums des Umzugswagens. Mit einem ähnlichen Kleintransporter der Marke Mercedes-Sprinter war auch Susanne damals, mit ihrem kompletten Hab und Gut, unwiederbringlich von dannen gezogen.
Wir werden im Lauf des Semesters nicht nur verschiedene mögliche Antworten auf die Frage kennenlernen, warum überhaupt Dinge existieren, sondern wir wollen auch den Sinn dieser Frage untersuchen. Entgegen dem ersten Anschein steht nämlich gar nicht fest, dass es sich bei ihr überhaupt um eine verständliche Frage handelt.
Die imposante Fassade des Poelzig-Baus mit ihrer Plattenverkleidung aus beigem Travertin wurde jetzt sichtbar. Insgesamt vier Fakultäten waren vor einigen Jahren in das herrschaftliche Gebäude übergesiedelt. Damals hatte eine öffentliche Debatte darüber stattgefunden, ob die Universität eine Immobilie nutzen dürfe, von deren Räumlichkeiten aus die IG Farben während der NS-Zeit die Zyklon-B-Lieferungen in die Konzentrationslager organisiert hatte. Am Ende der Debatte stand der Beschluss, auf dem Universitätsgelände eine Erinnerungsstätte einzurichten und ein spezielles Forschungsinstitut unterzubringen, das sich mit der Aufarbeitung der Nazizeit beschäftigen sollte. Für das philosophische Institut bedeutete der Umzug auf jeden Fall einen Gewinn. Es hatte zuvor in einer unsäglichen Betonschachtel in der Nähe der Senckenberganlage seinen Sitz gehabt, deren abgetakeltes Erscheinungsbild in krassem Gegensatz zu seiner ruhmreichen Tradition stand.
Auf der gegenüberliegenden Straßenseite näherte sich eine hagere Gestalt, die ihm freundlich zuwinkte. Sie trug einen langen, zweireihig geknöpften Mantel, dessen Farbe an erkalteten Vanillepudding denken ließ. Als Freundel Professor Weesenberg erkannte, überquerte er die Straße. An der Bushaltestelle Grüneburgweg begrüßten sie einander per Handschlag. Wie üblich, hafteten die rotbraunen Haarsträhnen seines Gegenübers in eigenwillig schräg nach oben zulaufender Manier an dessen Schläfen. Die gesamte Frisur ähnelte dadurch dem windschiefen Reisigdach der Behausung eines Waldschrats.
„Ich grüße Sie, Herr Collega“, eröffnete der Professor das Gespräch. „Hatten Sie einen guten Start in das Semester?“
Sein Lächeln erinnerte an das Grinsen eines Erwachsenen, der einem artigen Kind ein Eis überreicht. Der gönnerhafte Habitus entsprach genau der Situation. Während Manfred Weesenberg als langjähriger Ordinarius und aktueller Dekan des Fachbereichs in jeder Hinsicht überlegen im institutionellen Sattel thronte, war Freundel von der ortsansässigen Professorenriege die gnädige Chance erteilt worden, sein Können im Rahmen einer zweisemestrigen Lehrstuhlvertretung unter Beweis zu stellen.
„Ich beginne erst heute Abend“, antwortete Freundel und stellte seine schmale, aus kirschrotem Segeltuchstoff gefertigte Aktentasche zwischen den Beinen ab. „Ich bin gerade auf dem Weg zu meinem Seminar.“
„Bei mir ging es schon am Montagmorgen los. Erschrecken Sie nicht, wenn es rappelvoll wird. In den Veranstaltungen treiben sich wieder ärgerlich viele Studienanfänger herum.“
„Ach ja.“
„Es ist jedes Mal dasselbe zu Semesterbeginn. Lauter orientierungslose Leute. Die meisten der neuen Gesichter verschwinden nach einigen Wochen wieder von der Bildfläche.“
„Das läuft in Mainz nicht anders.“
„Übrigens hat das Thema Ihrer Vorlesung meine Neugierde geweckt“, sagte Weesenberg und machte einen halben Schritt auf ihn zu. „Ich teile Ihre These, dass die Möglichkeit einer zeitgenössischen Metaphysik viel zu wenig diskutiert wird. Hätten Sie etwas dagegen, wenn ich mich gelegentlich unter Ihr Publikum mische, sobald das Semester in die Gänge gekommen ist?“
Die Vorstellung machte Freundel nervös.
„Im Gegenteil. Das würde mich sehr freuen. Es ist allerdings so, dass ich in der Vorlesung Gedanken ausprobiere, die einen sehr vorläufigen Charakter haben. Manches von dem, was ich ausführe, ist noch ziemlich unausgegoren.“
„Da kommt gerade mein Bus“, rief Weesenberg und reichte ihm erneut die Hand. „Ich schaue im Lauf der Woche mal in Ihrem Büro vorbei.“
Das Seminar würde bereits in fünf Minuten beginnen, und Freundel musste sich sputen. Als er das repräsentative Eingangsportal des Gebäudes passiert hatte und die mächtigen Stufen der geschwungenen Marmortreppe emporeilte, keimte Stolz in ihm auf. Den Rest seines Einleitungsvortrags würde er ohne Schwierigkeiten frei improvisieren.
Kapitel 2: René
Es war kurz vor 21 Uhr, als er sich der zweistöckigen Villa näherte. In einen der beiden Torpfosten war ein Briefkasten aus Edelstahl in der Größe einer Babyklappe eingelassen. Über dem Briefkasten befand sich ein ovales, ebenfalls aus Metall gefertigtes Schild. Trotz der schummrigen Straßenbeleuchtung ließ sich die eingravierte Hausnummer erkennen, die Frau von Stein ihm genannt hatte. Dank eines der detaillierten Stadtpläne, die er vom gesamten Rhein-Main-Gebiet besaß, war es ihm nicht schwergefallen, von der S-Bahn-Station aus den Weg zu finden. Die erste Seminarsitzung hatte, wie üblich, kaum mehr als eine halbe Stunde in Anspruch genommen. Dadurch war ihm genügend Zeit geblieben, um daheim noch rasch eine tiefgekühlte Lasagne in die Backröhre zu schubsen sowie ein weiteres Mal die Duschkabine zu besteigen.
Das Anwesen schien von einem parkartig angelegten Garten umgeben, dessen furiose Baumbestände sich in der Finsternis nur schemenhaft erahnen ließen. Vom Eingangstor aus führte ein zirka 30 Meter langer Kiesweg, flankiert von zwei Buchsbaumhecken, zu der überdachten Haustür. Durch deren halbkreisförmiges, in Lamellen unterteiltes Oberfenster schimmerte ein gedämpftes Licht. In topasfarbener Noblesse ließ es die spitzwinkligen Glassegmente aus der Dunkelheit hervortreten. Schritt für Schritt näherte Freundel sich der Tür. Während der Kies unter seinen Schuhen knirschte, stellte sich die gewohnte Empfindung ein. Ihm war, als spanne sich durch seine Eingeweide eine schwere, vom Wind in immer heftigere Schwingungen versetzte Hängebrücke. Mit dem ersten Besuch bei einer neuen Kundin verband sich, auch nach Jahren der Routine, noch immer ein erheblicher Nervenkitzel. Vor allem kam es beim ersten Blickkontakt darauf an, sich eine eventuelle Enttäuschung unter keinen Umständen anmerken zu lassen. Nach wie vor neigte er dazu, sich seine unerschrockenen Anruferinnen in der Phantasie als aparte, verruchte oder laszive Wesen vorzustellen. Zwar behielt er in einigen wenigen Fällen damit sogar Recht. Doch in den übrigen Fällen konnte der hoffnungsvollen Erwartung leicht ein hinderliches Störfeuer erwachsen.
Als Frau von Stein ihm die Tür öffnete, realisierte er augenblicklich, dass das Schicksal es ein weiteres Mal gut mit ihm meinte. Sie trug ein dunkles, eng anliegendes Kostüm, das ihre propere Figur betonte. Ihr schwarzes, leicht gewelltes Haar hatte sie mit einer Klammer nach hinten gesteckt. Ihre Hände wirkten gepflegt, die sorgsam zurechtgefeilten Fingernägel zierte ein zurückhaltender Silberton. Auf den ersten Blick schätzte er ihr Alter auf Ende vierzig.
„Haben Sie den Weg gut gefunden?“, erkundigte sie sich. Ihre Augen funkelten wie polierte Murmeln im Lichtschein des Hauseingangs.
„Das war kein Problem. Die Wegbeschreibung war perfekt“.
„Bitte. Treten Sie ein.“
Er folgte ihr in eine geräumige Eingangshalle. Von dort führte auf beiden Seiten ein geschwungener Treppenaufgang ins Obergeschoss. Seine Gastgeberin geleitete ihn durch einen engen, nach rechts abzweigenden Korridor. Nach wenigen Metern betraten sie einen hell erleuchteten Salon. Er maß schätzungsweise 60 Quadratmeter, wobei der Zuschnitt nicht ganz dem Ideal des rechten Winkels zu entsprechen schien. Die gesamte Einrichtung bestand aus antikem Mobiliar. An den hohen, in altbierbrauner Farbe tapezierten Wänden hingen in entspiegelten Glasrahmen abstrakte Zeichnungen. Das umgebende Passepartout umfasste weitaus mehr Fläche als die Zeichnungen selbst. Ein üblicher dramaturgischer Kniff, um den künstlerischen Wert der dargebotenen Werke zu unterstreichen. Eine der beiden hinteren Ecken des Raums füllte ein massiver, mit Terracottaplatten verkleideter Kamin. Vor dem Kamin stand ein schmales Sofa, mit Polstern aus camembertfarbenem Samt. Darauf saß eine schlanke rothaarige Frau, die ihm interessiert entgegenblickte. Freundel war darüber nicht sonderlich überrascht. Er hatte es bereits des Öfteren erlebt, dass bei einem Antrittsbesuch in der Wohnung einer neuen Kundin deren beste Freundin anwesend war. Vor allem dann, wenn die Kundin keinen Hund besaß, der sie im Zweifelsfall vor unerwünschten Übergriffen schützen konnte.
„Das ist Lydia, eine Bekannte von mir“, sagte Frau von Stein. „Sie war ebenfalls neugierig darauf, Sie kennen zu lernen. Ich hoffe, das macht Ihnen nichts aus.“
„Ganz im Gegenteil. Ich bin mehr als erfreut. Zwei so ungewöhnlich hübschen Evastöchtern auf einmal zu begegnen, ist ein echter Glücksfall.“
Einen Augenblick lang befiel ihn die Sorge, die beiden könnten es auf eine ménage à trois abgesehen haben. Seine Kräfte würden dafür womöglich nicht mehr ganz ausreichen. Immerhin hatte er am frühen Nachmittag bereits eine schweißtreibende Sitzung mit einer Stammkundin hinter sich gebracht. Ort des Geschehens war eine Hochhauswohnung in der Nähe von Offenbach gewesen, deren Parkettböden sich stets ein wenig klebrig anfühlten und in der es bei fast jedem seiner Besuche penetrant nach Siedfleisch mit Meerrettich roch. Unauffällig tastete er nach der Tablettenpackung in seiner Jackettasche. Was ihn jedoch andererseits beruhigte, war die Tatsache, dass zumindest Frau von Stein am Telefon ein vorrangiges Interesse an Praktiken bekundet hatte, bei denen in erster Linie seine Zungenfertigkeit gefragt war.
„Machen Sie es sich bequem“, sagte diese zu ihm und wies mit ihrer Handfläche in Richtung der im Raum herumstehenden Sitzmöbel. „Darf ich Ihnen etwas zu trinken anbieten?“
„Gerne.“ Er ließ sich in einem Sessel aus wallnussfarbenem Holz mit ochsenblutrotem Lederbezug nieder und blickte sich um. Das Zimmer mit seinen ungewöhnlich düster gefärbten Wänden wirkte, der Verspieltheit der Einrichtungsgegenstände zum Trotz, ein wenig bedrückend. Es hätte gut und gerne einem von Polanski inszenierten Kammerspiel als Kulisse dienen können. Für einen flüchtigen Moment kam es ihm sogar so vor, als habe sich in dem Anwesen in der Vergangenheit etwas Grauenvolles zugetragen. Sogleich jedoch verscheuchte er den Gedanken wieder, indem er im Geiste Ausschau nach einem Kompliment hielt, mit dem er die Herrin des Hauses umschmeicheln konnte.
„Nehmen Sie einen Schluck Sekt?“, erkundigte sich diese.
„Da wäre ich nicht abgeneigt. Ich muss sagen, Sie leben hier ja in einem wahren Palazzo. Und Sie haben sich äußerst geschmackvoll eingerichtet.“
„Das verdanke ich Lydia. Sie ist meine Stilberaterin.“
Frau von Stein ging zu einer uralten Wandkommode, deren aschfahles Holz wie Pappmaché aussah. Von dort nahm sie eine offene Flasche Cremant d’Alsace. Anschließend füllte sie drei Gläser, die auf einem Silbertablett bereitstanden. Sie reichte ihm und ihrer Freundin je ein Glas. Danach nahm sie, direkt ihm gegenüber, auf einem Stuhl Platz, dessen auf Hochglanz polierte Lehne ein Exempel überbordender Schnitzkunst bot.
„Ich bin Tamara. Zum Wohl!“ Sie musterte ihn genauer und setzte dann ein vorsichtiges Lächeln auf. „Und Sie sind also René?“
Freundel lächelte zurück. Tamara gefiel ihm. Sie gestaltete diese Kennenlernszene mit einer bemerkenswerten Abgeklärtheit. Zugleich lag in ihren Gesichtszügen etwas Zartes, Filigranes. Auch ließ ihr Mienenspiel Aufgeschlossenheit und Feinsinn erkennen. Ihre großen dunklen Augen bildeten einen ansprechenden Kontrast zu ihrem blassen Teint. Am Hals zeigten sich ein paar Falten, aber insgesamt schien sich ihre Haut noch in einem recht passablen Zustand zu befinden. Er wusste, dass er diese Frau ohne Verstellung begehren konnte. Dennoch musste er sich darauf konzentrieren, nicht zu häufig zu der anderen Frau hinüber zu linsen, die zu seiner Rechten saß und die Beine übereinandergeschlagen hatte. Mit ihrem fülligen tizianroten Haar, den hohen Wangenknochen und ihrem breit lächelnden Mund war sie eine echte Schönheit. Sie schien etliche Jahre jünger zu sein als Tamara. Freundel schätzte sie auf Anfang vierzig.
„Tamara ist ein eleganter Name“, sagte er zu seiner Gastgeberin. „Er klingt, als hätten Sie einen russischen Familienhintergrund.“
„Ich finde nicht, dass ich Ihnen bei unserem ersten Treffen gleich so persönliche Auskünfte erteilen sollte.“ Frau von Stein blickte nun streng. „Da könnte ich Sie ja auch gleich fragen, ob René vielleicht bloß Ihr – wie soll ich das nennen – Ihr Künstlername ist, und mich erkundigen, wie Sie in Wirklichkeit heißen.“
Er wurde verlegen. „Pardon. Ich wollte nicht indiskret sein. Wenn mir jemand gefällt, werde ich manchmal ziemlich rasch vertraulich. Ist eine Schwäche von mir.“
„Für einen Philosophen ist jedenfalls René ein gediegenes Etikett“, rief Lydia dazwischen. Ihre Stimme besaß einen rauen, leicht öligen Klang. In Freundels Phantasie beschwor er das Bild einer bleiern getönten Glasvitrine herauf.
„Finden Sie?“, erwiderte er.
„Na, kommen Sie!“, antwortete sie. „Schließlich zählt Descartes zu Ihren geistigen Ahnherren.“
Er wurde unsicher. Noch nie war es vorgekommen, dass eine seiner Kundinnen den Entstehungshintergrund seines Pseudonyms erraten hatte. Tatsächlich war ihm bei der Suche nach einem tauglichen Künstlernamen schon bald René Descartes in den Sinn gekommen. Die Idee, den Vornamen eines bekannten Philosophen zu verwenden, lag in seinem Fall ohnehin auf der Hand. Auf der anderen Seite sollte das Pseudonym einigermaßen halbseiden und verführerisch klingen. Er hatte einschlägige Broschüren mit Inseraten studiert, in denen Callboys ihre Dienste anboten. Die hießen beispielsweise Sascha, oder Nico oder Pierre. René fügte sich hervorragend in diese Reihe ein. Als Alternative zu Descartes hatte Freundel anfangs auch Wittgenstein als möglichen Namenspatron in Erwägung gezogen. Dessen Vorname Ludwig passte nämlich in eine andere Reihe eher derb klingender Callboynamen, wie Georg, Heinz oder Rudolf, die ebenfalls häufiger vorkamen. Allerdings schienen diese Namen eher auf schwule Kunden gemünzt zu sein. Da er für diese Klientel kein Angebot bereithielt, wollte er deren Interesse lieber erst gar nicht auf sich lenken. Daher erschien ihm René am Ende als die geeignetere Wahl.
Was zusätzlich für Descartes sprach, war die Tatsache, dass der berühmte Rationalist und Metaphysiker des 17. Jahrhunderts seinerseits enge Beziehungen zu diversen adeligen Gönnerinnen unterhalten hatte, in die sich, mit ein wenig Einfallsreichtum, eine Art Callboy-Existenz hineinphantasieren ließ. Zumindest lösten die überlieferten Berichte von der engen Freundschaft des Philosophen mit Elisabeth von der Pfalz und von dessen Privatquartier am Hof der schwedischen Königin bei Freundel entsprechende Assoziationen aus. Einen weiteren Anlass für die Wahl des Pseudonyms bot zudem eine rätselhafte Notiz, die Descartes der Nachwelt hinterlassen hatte. Sie kam Freundel vor, als handele es sich um eine versteckte Regieanweisung für sein eigenes geheimes Doppelleben:
Wie die Schauspieler eine Maske aufsetzen, damit auf ihrer Stirn nicht die Scham erscheine, so betrete ich das Theater der Welt – maskiert.
Alles in allem verlieh ihm der philosophiehistorische Hintersinn von „René“ bei seinen forschen Einsätzen an den mitunter tückischen Kletterwänden weiblichen Verlangens eine willkommene Souveränität. Als Maskottchen aus einer anderen Welt bot er ihm jenes Gefühl der Überlegenheit, das er benötigte, um seine erotischen Dienstleistungen mit der erforderlichen Selbstsicherheit ausführen zu können.
Es war jedoch nicht in erster Linie diese Sicherheit, die er durch Lydias Bemerkung bedroht sah. Eine ganz andere Befürchtung keimte in Freundel auf. Wenn diese Frau über Philosophiekenntnisse verfügte: Hatte sie dann womöglich Kontakte zum Frankfurter Institut? Eine fatalere Koinzidenz wäre in seiner derzeitigen Lage kaum vorstellbar. Warum zum Teufel war er nicht vorsichtiger gewesen? Er gab sich Mühe, die Nachfrage so beiläufig wie möglich vorzubringen:
„Wie es aussieht, haben Sie ebenfalls einen Bezug zur Philosophie.“
„Bingo! Das ist aber kein Grund, gleich nervös zu werden“, antwortete Tamaras Freundin, der offenkundig nichts entging. „Ihnen werde ich schon nicht das Wasser reichen können. Als Studentin habe ich nebenher ein paar Philosophievorlesungen besucht. Das ist alles.“
Freundel bemühte sich, seine Erleichterung zu verbergen. Dann konzentrierte er sich wieder auf seine eigentliche Gastgeberin, die ihn jetzt ungeniert anlächelte. Er ließ sich noch ein Glas Sekt nachschenken und erzählte daraufhin die Geschichte von Descartes und seiner gönnerhaften Fürstin. Die beiden Frauen lachten, und die Stimmung war jetzt gelöst.
Nach einer Weile warf ihm Tamara einen durchdringenden Blick zu. „Wie wäre es“, sagte sie, „wenn wir den Rest der Flasche mit nach oben nehmen?“
Durch den zarten Stoff ihrer Bluse ließ sich erkennen, dass ihre Brustwarzen zum Leben erwacht waren. Sogleich verspürte er seinerseits einen Anflug der Erregung und beglückwünschte sich einmal mehr zu seiner erquicklichen Nebentätigkeit. Eine Tablette würde er heute voraussichtlich nicht mehr benötigen.
Lydia erhob sich und schlenderte leise summend in die gegenüberliegende Ecke des Salons. Dort ließ sie sich in einem Schaukelstuhl mit hoher, pilzförmiger Lehne nieder. Dieser geriet durch ihr Gewicht so wenig in Bewegung, dass man meinen konnte, die Kufen seien auf dem Parkett festgenagelt. Flüchtig strich sie ihren Rock über den Knien zurecht. Dann beugte sie sich zur Seite, um aus einem Bastkorb neben dem Stuhl ein grellbuntes Magazin zu angeln.
„Sie wird hier unten bleiben und uns nicht stören“, sagte Tamara, während Freundel ihr, die Sektflasche und sein Glas in den Händen, in Richtung Treppenhaus folgte. Am Treppenabsatz streifte sie die Schuhe von den schmalen, mit metallicschwarzen Nylonstrümpfen bekleideten Füßen. Anschließend lief sie in mädchenhaften Schritten über die polierten Stufen nach oben.
Im Obergeschoss angelangt, führte sie ihn in ein geräumiges Zimmer. Es wurde von einem überkandidelt gestylten Messingkronleuchter illuminiert, der wie ein vergessener Weihnachtsschmuck von der Decke hing. Einen Teil der Fensterfront verhüllte ein schwerer, acrylblauer Vorhang. Durch das freie Fenster sah man den Lichthof einer Laterne, die offenbar die hinter dem Haus gelegene Seite des Gartens beleuchtete. An der linken Wand des Zimmers stand ein Doppelbett mit Bezügen aus grün-weiß gemustertem Quiltstoff. Vom Kopfende des Betts aus fiel der Blick auf einen bombastischen Flachbildschirm, der an der gegenüberliegenden Wand prangte, einem attrappenhaften Requisit aus einem Science-Fiction-Streifen gleichend. Den Boden des Schlafgemachs bedeckte ein heller, ziemlich zerzaust wirkender Kamelhaarteppich. Tamara setzte sich auf den Rand des Betts und hielt ihm ihr Glas entgegen. Er nahm an ihrer Seite Platz und schenkte ihr Sekt nach. Dann stieß er sein noch zur Hälfte gefülltes Glas gegen ihres.
„Darf ich dich eigentlich küssen, du schöner Kerl?“, fragte sie ihn, während sie ihn halb verlegen, halb besitzergreifend musterte. Er stellte die Sektflasche auf dem Nachtisch ab. Derweil betrachtete er die kosmetisch verstärkten Linien ihrer dezent geschwungenen Lippen.
„Das mache ich eigentlich nur in Ausnahmefällen“, log er. „Wenn mir jemand besonders sympathisch ist. Aber bei dir könnte das so eine Ausnahme sein“.
Kaum hatte er den Satz beendet, presste sie bereits ihr Gesicht auf seines. Sie fuhr mit der Hand durch sein Nackenhaar, während sie ihm rasant ihre Zunge entgegenschob. Ihr Mund schmeckte nach Sekt. Die Zunge, die sich ungestüm auf und ab bewegte, fühlte sich weich und flach an, als handele es sich um das Blütenblatt einer nicht mehr ganz knackfrischen Tulpe. Er erwiderte den Kuss. Dabei rutschte er vom Bettrand hinab auf den Fußboden, bis er schließlich vor ihr auf dem Teppich kniete. Während der Kuss andauerte und seine Hose sich zu spannen begann, tastete er nach ihren Brustwarzen, die hart wie Trüffelpilze unter ihrer Bluse standen. Ihr entfuhr ein raubeiniger Seufzer, als seine Hand die rechte Brust umschloss, während er die andere Hand in Höhe der Hüfte unter ihre Bluse schob. Er tastete sich weiter hinab unter den Rocksaum und fühlte die Kühle ihrer Pobacke.
Sie unterbrach den Kuss und begann damit, sich die Bluse aufzuknöpfen, unter der die nackten Brüste zum Vorschein kamen. Deren Flecken und Unebenheiten erinnerten an leicht verwitterten und zugleich von Niederschlägen glatt gewaschenen Marmor. An jenes verwunschene Gestein, auf das er während der verträumten Streifzüge seiner Kindheit inmitten endloser Kolonien knorpeliger Macchiabüsche gelegentlich gestoßen war. Entschlossen fing er an, eine der beiden Brustwarzen mit dem Mund zu bearbeiten. Gleichzeitig nahm er beide Brüste in die Hände, während er die Daumen von unten, in synkopischen Gegenbewegungen zum Rhythmus seiner Lippen, in Richtung der Brustwarzen schob. Irgendwo in der Ferne schlug eine Kirchturmuhr. Er zählte zehn Schläge.
„Warte mal. Ich habe dir ja noch gar nicht dein Geld gegeben.“ Sie schob seinen Kopf von ihrem Oberkörper weg.
„Das hat doch Zeit bis nachher.“
„Also hundert Euro, abgemacht? Und dafür möchte ich, dass du mich später ausgiebig mit dem Mund da unten verwöhnst.“
„Ich weiß. Sollen wir uns nicht noch ein bisschen mehr ausziehen?“
Wenig später lag Tamara, vollständig entkleidet, rücklings auf dem watteweichen Quiltbezug des Doppelbetts. Durch das angelehnte Fenster war seit einiger Zeit ein heftiger Regenguss zu vernehmen. Unablässig rauschten die Tropfen auf die Blätter der im Garten befindlichen Laubbäume nieder, sanft und beruhigend, wie eine behutsam raschelnde Großmutter im Nebenzimmer. Freundel schob die Hände unter Tamaras nur halbherzig gespreizte Schenkel. Langsam ging er auf Tauchgang, um sich behutsam weiter vor zu wagen, bis das behaarte Geschlecht in Übergröße vor ihm aufragte. Es ähnelte einem seit Jahrzehnten in Vergessenheit geratenen, von sperrigem Unkraut überwucherten Grabhügel. Jetzt kam es darauf an, rasch die richtige Orientierung zu gewinnen. Jede Frau war in ihren Proportionen ein wenig anders gebaut, und aus unmittelbarer Nähe blieb das Gesichtsfeld zu verschwommen, um die günstigsten Ansatzpunkte für den Cunnilingus sicher identifizieren zu können. Hinzu kam, dass bei üppigerem Haarwuchs bestimmte Abstände, die sich als Orientierungsmaßstäbe eigneten, verzerrt erscheinen konnten. Dass es ihm gelang, die richtigen Stellen ohne Umschweife aufzuspüren, durften seine Kundinnen jedoch von ihm erwarten. Schließlich zählte diesbezügliche Effizienz zu jenen Fähigkeiten, durch die er sich in seiner Eigenschaft als bezahlter Profi von einem gewöhnlichen Liebhaber zu unterscheiden hatte.
Freundel wählte das Verfahren, dadurch einen distanzierten Blick auf das Gelände zu gewinnen, dass er mit der Zungenspitze zunächst an der Innenseite der Oberschenkel auf- und niederglitt. Bei gekonnter Ausführung bot diese Verzögerungstechnik den Vorteil, die Erregung der Frau im Vorfeld zu steigern, sofern diese an den entscheidenden Stellen nicht zu kitzelig war. In Tamaras Fall klappte diese Methode problemlos, und als Freundel von seiner Exkursion zurückkehrte, war er genau darüber im Bilde, in welche Regionen die geforderte Attacke zu zielen hatte.
Etwa zwanzig Minuten später hatte Tamara mehrere Höhepunkte erreicht. Erschöpft drehte sie sich auf die Seite. Freundel, dessen Gesicht fast vollständig von ihrem Saft benetzt war, wartete ab, ob sie noch einen anschließenden Genitalverkehr wünschte. Nach einer Weile hob sie den Kopf und schaute gelöst.
„Boy, oh boy! Das habe ich gebraucht. Das habe ich wirklich gebraucht! Ich danke dir.“
Während ihres gemeinsamen Schweigens hatte er begonnen, sich die Grobstruktur der Vorlesung zu vergegenwärtigen, die er am nächsten Tag zu halten hatte. Plötzlich befiel ihn eine starke Nervosität. Er musste sich unbedingt noch ein paar einleitende Worte zu Kants Metaphysikbegriff zurechtlegen. Als Tamara Anstalten machte, ihr Höschen überzustreifen, war er erleichtert. Sie warf einen Blick auf ihre Armbanduhr.
„Ich würde dich gerne noch in mir spüren. Aber ich möchte Lydia nicht noch länger unten warten lassen. Vielleicht das nächste Mal?“
Er grinste ihr zu. „Es wäre mir ein Vergnügen“.
Während seine Gastgeberin damit beschäftigt war, sich ein wenig lethargisch, mit noch immer stark geröteten Wangen, anzukleiden, begann er sich zu fragen, wie Frau von Stein ihren Alltag verbrachte. Übte sie einen Beruf aus, oder verdiente ein Ehemann das Geld, um die exorbitante Villa zu finanzieren? Früher oder später würde sie ihm davon erzählen. Wie alle seine Kundinnen. Sobald er mehr über ihr Leben, ihre Sorgen und ihre Sehnsüchte in Erfahrung gebracht hatte, würde es ihm auch nicht schwer fallen, einen geeigneten Anknüpfungspunkt für eine seiner Geschichten zu finden.
Als sie wenig später die Treppe herunterkamen, war das Biedermeierwohnzimmer leer.
„Sie ist wahrscheinlich eine Runde drehen gegangen“, sagte Tamara und geleitete ihn zur Tür.
Als er die abschüssige Straße zurück in Richtung S-Bahn-Station marschierte, fuhr ein unruhiger Wind durch die mächtigen Baumwipfel jenseits der Grundstücksmauern. Die Nachtluft war kühl und erfüllt vom Geruch des Herbstlaubs, das den frischen Regen in sich aufgesogen hatte. Die feuchten Blätter auf dem geteerten Untergrund glänzten matt im Schein der Straßenlaternen. Unter seinen Schuhsohlen fühlten sie sich glitschig an. In den Laubduft mischte sich von ferne ein Holzkohlegeruch. Vielleicht handelte es sich auch um den Aufguss einer Sauna, die zu einer der prunkvollen Villen der Umgebung gehörte. Hinter ihm näherte sich ein Auto, das ihn im Schritttempo überholte. Aus dem Innenraum des bulligen Coupés, dessen Reifen leise über das Laub knisterten, erklang „I get a kick out of you“ von Frank Sinatra.
Im Weitergehen ließ Freundel den Blick über die erleuchteten Fenster der mehrstöckigen Häuser schweifen, die sich im unteren Abschnitt der Straße befanden. An einer Zimmerdecke bemerkte er einen amöbenhaft geformten, beweglichen Schatten. Er musste von einer Person stammen, die in dem Raum auf und ab ging. Er versuchte, sich die Menschen vorzustellen, die in den verschiedenen Zimmern hinter den Fenstern lebten. Jeder der Bewohner hielt sich zu diesem Zeitpunkt an einem exakt bestimmbaren Ort innerhalb seiner Räumlichkeiten auf. Und jeder von ihnen würde die Stelle seines momentanen Aufenthalts mit dem Wort „hier“ bezeichnen. In jedem dieser Fälle markierte dieser Ort einen Nullpunkt, von dem aus sich die räumlichen Koordinaten der gesamten Welt erstreckten.
Eine solche, mit „hier“ bezeichnete Stelle mochte sich beispielsweise gerade in einer Küche im vierten Stock des Neubaus befinden, dessen leicht nach hinten fliehende Fassade dort drüben jäh in den Nachthimmel ragte. Während ein anderes „hier“ in diesem Moment vielleicht genau zwei Meter vor dem Fernsehgerät lokalisiert war, dessen bläulicher Schimmer die komplette Erdgeschosswohnung auf der gegenüberliegenden Straßenseite in ein seifiges Licht tauchte. Und dann gab es da noch sein eigenes „hier“, das jenes Koordinatenzentrum bezeichnete, von dem aus er soeben diese Betrachtung anstellte. Die diversen Nullpunkte existierten also zeitgleich an verschiedenen Orten. Das war sonderbar. Ja, es war sogar zutiefst verwirrend. Denn jeder dieser Orte bildete nicht weniger als das Zentrum des Universums. Vom logischen Standpunkt aus betrachtet schien dies ein klarer Widerspruch zu sein. Dieser Widerspruch bot Anlass, die Struktur der Wirklichkeit für paradox zu halten.
Er versuchte den Gedanken weiterzuspinnen. Doch das ungelöste Problem der fehlenden Einleitung zu seiner morgigen Vorlesung drängte mit Macht erneut in sein Bewusstsein. Auch aus diesem Grund war es behämmert gewesen, ausgerechnet am heutigen Abend noch einen Hausbesuch einzuschieben. Er musste sich abermals eingestehen, dass er nicht anders konnte. Er war ein Maniac.
In der S-Bahn glitten die Leuchtschriften der Industriegebäude von Eschborn an den verschmutzten Fensterscheiben vorüber. Wieder hatte ein kräftiger Regen eingesetzt. An der letzten Haltestelle war ein durchnässtes Obdachlosenpärchen zugestiegen. Sein strenger Körpergeruch hatte Freundel und mehrere andere Fahrgäste dazu veranlasst, einige Sitzbänke weiter in Fahrtrichtung umzuziehen. Hier war der Boden mit zerrissenen Pappschachteln der Junk-Food-Kette Kentucky Fried Chicken sowie mit zugehörigen Essensresten übersät. Unbeholfen suchte er inmitten des Chaos Platz für seine Schuhe. Dabei musste er Acht geben, mit den Knien nicht die Beine der älteren Dame mit der blondierten Kranichfrisur zu berühren, die ihm aus demselben Grund in ähnlich verrenkter Haltung gegenübersaß. Abwesend beobachtete er, wie ihr bläulich angelaufener Mittelfinger in kurzen Abständen auf die Oberfläche der Handtasche niederzuckte, die sie auf ihrem Schoß hielt. Derweil registrierte er, wie in seinem Unterkiefer allmählich das taube Gefühl nachließ, das dort wie eine riesige Plombe festsaß, seit Frau von Stein eine halbe Stunde zuvor mit archaischer Wucht ihren Unterleib an seinem Gesicht herauf- und heruntergedrückt hatte.
Erneut überkam ihn ein Anflug von Panik. Es war lediglich eine Frage der Zeit, bis sein ausgeflipptes Treiben in ein Desaster münden würde. Was den Grad des Leichtsinns anging, so glich seine heutige Aktion schon fast der Eselei eines US-Industriellen, den es juckte, einen privaten Picknickausflug ins sunnitische Dreieck zu unternehmen. Schließlich hätte er von vornherein damit rechnen können, dass seine Gastgeberin ihn womöglich nicht alleine empfangen würde. Und wer weiß, in welchen Kreisen diese Lydia wiederum verkehrte. Er schloss die Augen, bemüht, seine innere Gelassenheit mit Hilfe einer speziellen Atemübung wiederzuerlangen. Deren Technik hatte ihm sein Onkel Spiros vor Jahrzehnten beigebracht, um die Übelkeit auf hoher See zu bekämpfen: Jene fatale Agonie, die über sie hereinzubrechen pflegte, wenn vor Sonnenaufgang der gefürchtete Walpurgisritt der Borreas-Winde einsetzte, während ihnen der Gasgeruch der Bordbeleuchtung, vermengt mit dem Leichenduft der Köderfische, in die Nasen stieg. Mit voller Konzentration, ließ er die Luft aus seinen Lungen entweichen. Doch es nützte wenig. Die Unruhe, die über ihn gekommen war, blieb in diesem Moment so hartnäckig an ihm haften wie ehemals der scheußliche Bootsteer an seinen knabenhaften Fersen.
Dabei hatte noch vor wenigen Jahren in Mainz alles so herrlich einfach begonnen. Die Entscheidung, sich als Anbieter erotischer Dienstleistungen zu verdingen, bot ihm damals einen bestechend eleganten Ausweg aus der bedrückenden Finanznot. Einen Ausweg, der sich in jeder Hinsicht als ertragreich erwies. Die Idee dazu war ihm in einer plötzlichen Eingebung in den Sinn gekommen, nachdem er vorübergehend an einem privaten Arbeitskreis mitgewirkt hatte, dessen übrige Teilnehmer der Ehrgeiz trieb, mit einer philosophisch aufgemotzten Unternehmensberatung Gewinne zu scheffeln.
„Freundel, seien Sie nicht blauäugig!“, hatte Meyer-Myrtenrain ihm in den Jahren zuvor gebetsmühlenhaft geraten. „Sie müssen für die Zeit nach Ihrer Habilitation vorsorgen.“
Bei diesen Ermahnungen hatte der bekennende Schöngeist ihn jedes Mal mit der hohlwangigen Miene eines gestrengen Beichtvaters angeblickt. Meyer-Myrtenrain, auf den die Initiative für das Unternehmensberatungsprojekt zurückging, leitete damals die philosophische Abteilung der geisteswissenschaftlichen Fakultät in Mainz. Dort beschäftigte er Freundel auf einer zeitlich befristeten Stelle als persönlichen Institutsassistenten. Der weißhaarige Hüne, der ausnahmslos maßgeschneiderte Anzugswesten trug, besaß eine bemerkenswerte Doppelpersönlichkeit. Einerseits widmete er sich mit glühender Hingabe der Philosophie des deutschen Idealismus, wobei seine mit Anekdoten und Bonmots gespickten Vorlesungen zu Fichte, Hölderlin und Novalis stets ein begeistertes Fach- und Laienpublikum anzogen. Auf der anderen Seite unterhielt er freundschaftliche Beziehungen zu Banker- und Unternehmerkreisen, pflegte eine Mitgliedschaft im städtischen Rotary Club und fuhr einen gleißend lackierten Porsche Carrera. Verheiratet war er mit einer überaus eleganten, zwanzig Jahre jüngeren Japanerin, die in den Diensten von McKinsey stand, einer porzellanhaft feingliedrigen, stets parfümumwölkten Schnepfe, die sich nicht die Bohne für geisteswissenschaftliche Themen zu interessieren schien.
Die Arbeitsgruppe veranstaltete wöchentliche Brainstormings zu so geschmeidigen Themen wie „Hermeneutik für Unternehmer“ oder „Innovation und Kreativität“. Daraus strickte sie handliche Kursprogramme, die sie mit erstaunlichem Erfolg auf Wochenendseminaren feilbot, vor einem Publikum, das mehrheitlich aus orientierungslosen Abteilungsleitern und ausgebrannten Firmenmanagern bestand. Der Kreis wurde von einer Reihe nicht allzu begabter Mainzer Doktoranden und Habilitanden bevölkert, die Meyer-Myrtenrain unter seine persönlichen Fittiche genommen hatte. Verglichen mit ihnen stachen Freundels philosophische Fähigkeiten heraus – weshalb er auch die privilegierte Stelle des Institutsassistenten bekleidete. Dennoch hatte ihm Meyer-Myrtenrain – der in Sachen akademischer Karrieremöglichkeiten einen robusten, zuweilen ins Bärbeißige abdriftenden Realismus an den Tag legte – mit Nachdruck vor Augen geführt, dass die angestrebte Professur eine denkbar hohe Hürde bildete. Hieran ließ sich in der Tat kaum rütteln. Auf dem Markt der Bewerber um Ordinariatsstellen tummelte sich eine erdrückende Konkurrenz begabter, bis zum Erbrechen publikationswütiger Köpfe. Nach einigem Hin und Her hatte der schlohköpfige Institutsleiter seinen Schützling daher überreden können, die vorläufige Mitarbeit in der philosophischen Unternehmensberatung als Chance für ein zweites Standbein zu betrachten.
Freundel vermochte die Motive, die seinen Vorgesetzten dazu bewegten, parallel zu seiner wissenschaftlichen Betätigung ein erhebliches Maß an Zeit in das Geschäft der Arbeitsgruppe zu pumpen, nie ganz zu durchschauen. War es der Wunsch nach sozialer Anerkennung über den Rand der akademischen Manege hinaus, der Meyer-Myrtenrain dazu trieb, seinen zweifellos brillanten Intellekt in den Dienst von Kunden wie Siemens oder Degussa zu stellen? Steckte die beängstigend attraktive Ehefrau mit ihren snobistischen Allüren und ihrer unverhohlenen Passion für die Gravitationskräfte des Big Business dahinter? Oder agierte er schlicht als wohltätiger Menschenfreund, darum bemüht, promovierten und habilitierten Philosophen, die beruflich auf der Strecke zu bleiben drohten, eine erträgliche Einkommensalternative zu verschaffen? Oftmals wirkte er ohne erkennbaren Anlass melancholisch, wenn er, wortlos und in zurückgelehnter Pose, die Brainstormings seiner Zöglinge verfolgte, während er sich bedächtig durch die wallende Haarmähne strich. Auch Freundel selbst vermochte sich an den Arbeitssitzungen des Kreises häufig nur halbherzig zu beteiligen. Regelmäßig schweiften seine Gedanken ab, wenn einer der emsigen Jungdoktoranden vor dem Pinboard herumfuchtelte, um ein weiteres begriffliches Schema zu entwerfen, das dem opaken Dickicht der Geschäfts- und Dienstleistungswelt mittels einer aufgedonnerten Terminologie zu Leibe rücken sollte. Er hatte sich auch nie dazu durchringen können, aktiv an einem der Wochenendseminare mitzuwirken, auf denen solche Begriffsschemata als Lehrinhalte präsentiert wurden. Dabei brachten diese Seminare der Gruppe stets eine erkleckliche Summe Geld ein. Gewinne, die diskret auf dem Konto eines eigens zu diesem Zweck gegründeten, gemeinnützigen Vereins verbucht wurden.
Als Susanne und er an einem strahlenden Frühsommertag, während einer gemeinsamen Wanderung durch den Hochschwarzwald, zum wiederholten Male darüber debattierten, ob es ethisch zu verantworten sei, den Grips der Philosophie in den Dienst ökonomischer Rationalisierungsfeldzüge zu stellen, kam Freundel der entscheidende Einfall. Sie befanden sich auf einem Rundweg, knapp unterhalb des Belchengipfels. Susanne trug ein eng sitzendes, purpurnes Sommerkleid, auf das in leuchtendem Weiß kronkorkengroße Drudenfüße aufgedruckt waren. Dazu Turnschuhe aus blassgrauem Leinen. Ihre hohe, von Sommersprossen übersäte Stirn lag, ebenso wie ihr dunkelblondes Haar, im Schatten eines überdimensionierten Strohhuts, den sie in einem örtlichen Touristenshop erstanden hatten. Tief unter ihnen erstreckten sich eng verzweigte, abschüssige Täler. Sie waren mit einer malachitgrünen Vegetation gepolstert. Davon hob sich gelegentlich eine Gruppe dunklerer Schwarzwaldtannen ab. Der Fußweg wurde in regelmäßigen Abständen von schmalen Sturzbächen unterführt, deren wild schäumender Wasserpegel sich dem regenreichen Frühling verdankte. In südwestlicher Richtung reichte der Blick über das dunstverhangene Rheintal hinweg bis zum Grand Ballon der Vogesen. Weiter südlich konnte man am Horizont die knapp zweihundert Kilometer entfernt liegenden Eisgipfel des Berner Oberlands erahnen. Susanne, der Freundel in Sachen poststrukturalistischer Macht- und Diskursanalyse ebenso wenig das Wasser reichen konnte wie in Sachen neomarxistischer Ideologiekritik, hatte aufgebracht erklärt, die philosophische Unternehmensberatung sei in Wahrheit eine kriminelle Vereinigung. Sie tue nichts anderes, als ohne Skrupel den semantischen Geleitschutz für die Ausbeutung der globalisierten Arbeitnehmerschaft zur Verfügung zu stellen. Ihre Tirade schloss sie mit dem Satz:
„Was ihr da treibt, ist schlichtweg horizontales Gewerbe!“
Wie immer, wenn heftige Wut von ihr Besitz ergriff, trat dabei stärker als üblich ihr südbadischer Akzent hervor; ein Einschlag, dessen alemannische Erdenschwere Freundel überaus sexy fand, seit er Susanne kannte.
Während ihrer Unterhaltung hatte er die zimtfarbenen Schmetterlinge auf den Grashängen beobachtet, die sich seitlich des Wegs in Richtung Gipfel erstreckten. Jetzt wandte er den Blick gen Westen, zum Rheintal hin. Er musste seine getönte Brille aufsetzen, um nicht vom gleißenden Licht der bereits tiefer stehenden Sonne geblendet zu werden. Während Susanne verärgert weiterstapfte und bald darauf hinter einer Kurve des Pfads aus dem Blickfeld entschwand, verharrte er regungslos auf der Stelle. Minutenlang starrte er in die Ferne. Aufrecht und gebannt stand er da, gleich einem Feldposten am Atlantikwall in den frühen Morgenstunden des D-Day. Rings um ihn herum war nichts zu vernehmen als das Plätschern der Gebirgsbäche und das orchestrale Summen der Bienen, das den Beerensträuchern am Wegrand entstieg.
Dann geschah es. Schlagartig und schmutzig formierte sich der Gedanke in seinem Hirn. Das Ganze ereignete sich ohne hinführende Überlegung oder gezieltes Gegrübel. Augenblicklich war ihm klar, dass es sich um eine formvollendete Idee handelte. Eine Vision, deren Elemente wie Zahnräder einer Präzisionsuhr ineinandergriffen. Ein Plan, der so unwiderstehlich schien, dass er mit der Insistenz eines Kobolds danach drängte, in die Tat umgesetzt zu werden. Ein verhängnisvoll zwingender Geistesblitz, der ihm vom ersten Moment an keine wirkliche Wahl mehr ließ.
Als sie eine halbe Stunde später, wieder vereint, an einem der verwitterten Holztische vor dem Berghotel Belchenblick saßen, gemeinsam ihr Radler schlürfend, zögerte er keine Sekunde, Susanne seine Eingebung anzuvertrauen.
„Vorhin, als du die Arbeit in unserer Gruppe horizontales Gewerbe genannt hast, hast du mich auf eine ziemlich verrückte Idee gebracht.“
„So.“
„Ein wirklich abgefahrener Einfall.“
„Das wäre ja nichts Neues.“
„Diesmal ist es aber wirklich grenzwertig.“
„Sag schon.“
„Na gut. Wie fändest du es, wenn ich versuchen würde, aus der Philosophie ganz buchstäblich ein horizontales Gewerbe zu machen und mir mein Geld als Callboy zu verdienen?“
„Bitte?“
Susanne blickte ihn verständnislos an. Die Sommersprossen auf ihrer Stirn glühten im Abendlicht. Der unzähligen Sprenkel wegen hatte er diese Stirn zu Beginn ihrer Liebschaft ‚meinen bestirnten Himmel’ genannt – bis er in einem außergewöhnlichen Moment der Zärtlichkeit und des Enthusiasmus dazu übergegangen war, die Bezeichnung ‚meine gehimmelte Stirn’ zu verwenden.
„Ich könnte als Callboy arbeiten, der gleichzeitig seinen Kundinnen eine Art philosophische Seelsorge und Beratung anbietet. So ungefähr in dem Stil, wie sie das in den philosophischen Praxen machen.“
Sie griff nach seiner Hand, führte sie an ihren Mund und biss ihm, mit einem Lächeln, in den Finger. „Abgemacht. Ich würde dich sofort mieten.“
„Nein, im Ernst. Stell’ dir mal vor, wie erfolgreich das werden könnte. Ich meine, es gibt bestimmt viele Frauen, die sehr gerne einen professionellen Liebhaber engagieren würden, die aber davor zurückscheuen, aus der Befürchtung, sich damit auf etwas Schäbiges oder Erniedrigendes einzulassen. Würde man diesen Frauen eine spirituelle Schiene für den Einstieg in die käufliche Liebe anbieten, würden sie ihre Hemmungen womöglich über Bord werfen. Unter dem Deckmäntelchen der höheren Bildung könnten sie ihren Wünschen frei von jeglicher Scham nachgehen.“
Susannes blaugraue Augen verengten sich zu dem typischen katzenhaften Blick, der in ihr Gesicht trat, sobald sie intellektuell auf Touren kam.
„Weißt du was?“, erwiderte sie. „Eigentlich wäre das Ganze ziemlich subversiv.“
„Subversiv?“
„Na ja, durch den Wechsel von der philosophischen Unternehmensberatung hin zum offen horizontalen Gewerbe würdest du nachträglich den prostitutiven Charakter deiner jetzigen Tätigkeit entlarven.“
„Susanne, es geht mir nicht darum, den Verein von M.-M. zu diskreditieren. Ich brauche einfach Geld. Und zwar Geld, das sich leichter verdienen lässt als durch diese stundenlange Hirnwixerei über Innovation und Investition. Außerdem würde ich das Ganze natürlich nicht publik machen, sondern sehr diskret vorgehen und unter Verwendung eines Pseudonyms arbeiten.“
„Na fein. Du willst also all das, was ich dir in den letzten beiden Jahren beigebracht habe, mit Mehrwert an die Frau bringen. In diesem Fall verlange ich aber eine fette Provision.“
Die hätte Susanne sich zweifellos verdient gehabt. Trotz ihres mädchenhaften Äußeren, das sie in den Augen vieler Menschen auf den ersten Blick eher harmlos erscheinen ließ, war sie eine mit allen Wassern gewaschene Geliebte. Seit jener Zeit, als sie sich noch gelangweilt in den hinteren Sitzreihen seines Seminars zu lümmeln pflegte, und sie gemeinsam auf der verklumpten Rosshaarmatratze unter der Dachschräge von Susannes Studentenzimmer, begleitet von Björks brüchigem Sirenengesang, einer ebenso ungeplanten wie schwindelerregenden Degustation ihrer Körpersäfte erlegen waren, hatte sie ihm so manchen erotischen Schliff verliehen. Dass sie auf seine Idee ohne Umschweife einstieg, war ebenfalls charakteristisch für sie. Gedankliche Tabus waren ihr fremd, und auch zu den abgebrühtesten Phantasien leistete sie stets voller Elan ihren Beitrag.
Später, als sie sich auf dem kratzigen Teppichboden des biederen Ferienappartments, das Susannes Eltern gehörte, geliebt hatten, blödelte sie ausgelassen darüber, welche Rechte und Pflichten ihr als seiner zukünftigen Zuhälterin zukommen würden. Sie ahnte zu diesem Zeitpunkt noch nicht, wie sehr Freundel bereits von dem Entschluss beseelt war, den Biss in die Kehle des Teufels zu wagen und die zynische Vision in die Tat umzusetzen.
Dass Susanne der neuen Form des Broterwerbs – für die ihr kalauerndes Hirn die Bezeichnung „Gripstease“ beigesteuert hatte – zu Beginn tatsächlich ihre Zustimmung erteilte, verdankte sich nicht zuletzt dem Umstand, dass sie zu jener Zeit einer speziellen Minderheitenströmung der feministischen Philosophie anhing. Deren Vertreterinnen geißelten die Prostitution nicht, wie sonst üblich, als patriarchalisches Herrschaftsinstrument. Stattdessen betrachteten sie sie als legitimen Weg zur Selbstbefreiung der Frau, quasi als Keule zur Zerschlagung des herrschenden Geschlechtercodes. Susanne hatte damals sogar erwogen, in ihrer Doktorarbeit die Subversion von Machtpraktiken durch eine ungehorsame Politik des Leibes zu untersuchen. Dabei sollte die Prostitution aus feministischer Perspektive eine ausdrückliche Verteidigung erfahren. Zwar war in diesem Konzept die Umkehrung der Verhältnisse durch männliche Käuflichkeit zunächst nicht vorgesehen: Doch zweifellos bedeutete das Aufkommen weiblicher Zuhälterei eine interessante Zuspitzung der Unterwanderung der herrschenden Körperpolitik.
Jedenfalls hatte Susanne sich damals im Sog ihrer Forschungen derart emphatisch mit der von kühnen Amazonen und transsexuellen Partisanen bevölkerten Schattenwelt der Prostitution identifiziert, dass sie Freundels Vorschlag gedanklich einigermaßen wehrlos gegenüberstand. Hinzu kam, dass sie, seit ihr auf dem Gymnasium ihr intellektuell diabolischer, der 68er-Bewegung entstammender Sozialkundelehrer den Kopf verdreht hatte, Eifersucht und Besitzansprüche gegenüber dem Partner für den Ausdruck einer verkorksten bürgerlichen Denkform hielt. Daher wollte sie sich auch nicht auf das Argument der sexuellen Treue versteifen.
„Solange du mir keine Details berichtest“, lautete ihre Maxime, „ist alles roger.“
„Bist du dir da sicher?“, hatte er nachgehakt.
„Schon. Mit so was kann ich umgehen.“
Womöglich kamen ihr dabei ein Stück weit auch ihre bisexuellen Gelüste entgegen. Jedenfalls empfand sie keinen übertriebenen Ekel bei der Vorstellung, Freundel könne geschlechtlichen Kontakt zu anderen Frauen pflegen und anschließend das gemeinsame Bett mit einem Leib besteigen, dem die Gischtspritzer aushäusiger Wonnen anhafteten. Ein weiterer Grund für ihre nachgiebige Haltung lag darin, dass auch sie unter der ständigen Geldknappheit litt, die bei ihnen herrschte, seit seine befristete Assistentenstelle ausgelaufen war und sie den gemeinsamen Lebensunterhalt von den Brosamen des Promotionsstipendiums bestreiten mussten, das ihr die Graduiertenförderung des Landes Hessen in monatlichen Raten überwies.
Alles in allem stand somit der Umsetzung des frappierenden Einfalls aus dem Hochschwarzwald kein grundsätzliches Hindernis im Weg. Einen unschätzbaren logistischen Vorteil bot zudem die Tatsache, dass sie in der Zwischenzeit Mainz als Wohnort aufgegeben und eine gemeinsame Wohnung im Frankfurter Westend bezogen hatten. Diese befand sich in der Nähe des Instituts für Sozialforschung, an dem Susanne ihrem Dissertationsprojekt nachging. Freundel pendelte einmal pro Woche für einen Nachmittag nach Mainz, um dort seine zweistündige Lehrverpflichtung als Privatdozent zu erfüllen. Wenn er im Frankfurter Raum als Liebesdiener zu Gange war, bestand so kaum die Gefahr, dabei Personen zu begegnen, die seinem eigenen universitären Dunstkreis entstammten.
Es lag inzwischen vier Jahre zurück, dass er begonnen hatte, zwischen Frankfurt und Mainz das barock verschlungene Gleiswerk seines Doppellebens zu verlegen. Bereits nach wenigen Monaten lief das erotische Geschäft weitaus erfolgreicher, als er es anfangs erhofft hatte. Die Kombination aus robuster Sexualdienstleistung und der philosophischen Verführung seiner Kundinnen – die er, zumeist im Anschluss an einen Koitus, geschickt in Gespräche über die Abgründe des Lebens hineinzog oder in behaglich wie Kaminfeuer vor sich hin knisternde Grübeleien über die Rätselhaftigkeit der Welt zu verwickeln wusste – erwies sich als veritabler Knüller. Rasch verhalf ihm dies zu zahlreichen Stammkundinnen, von denen ihn einige sogar im Wochentakt engagierten. In manchen Monaten verdiente er so das Vier- bis Fünffache dessen, was ihm seine Mainzer Assistentenstelle eingebracht hatte. Susanne machte zwar insgesamt einen etwas angespannteren Eindruck als früher, doch auch sie genoss zunächst den unerwarteten Geldsegen. Was sie freilich von Sticheleien nicht gänzlich abhielt.
„Bringst du uns auf dem Rückweg zwei Zanderfilets mit?“, rief sie ihm eines Abends mit belegter Stimme nach, als er zu einer Kundin aufbrach, die auf die exotische Idee verfallen war, ihn in ihren Schrebergarten nach Frankfurt-Louisa zu beordern.
„Das wird zu spät“, parierte er halbherzig. „Dann sind die Geschäfte doch schon zu.“
„Dann kauf den Fisch halt auf dem Hinweg.“
„Das geht nicht. Eine Tüte mit Fisch, die stinkt doch.“
„Die alte Schachtel wird ja wohl einen Kühlschrank haben.“
„Aber nicht in ihrem Schrebergarten. Außerdem ist sie keine alte Schachtel.“
„Wenn ihr an der frischen Luft bumst, macht es doch nichts, wenn du eine Tüte dabei hast, die riecht.“
„Mein Gott, Susanne, bitte kümmere du dich um den Zander. Ich koche dann später.“
„Ich dachte, du bist jetzt bei uns die Tussi. Dann solltest du schon auch den Einkaufskram erledigen.“
Von solchen Nickeligkeiten abgesehen stärkte ihm Susanne jedoch vorerst den Rücken. Von den Gewinnen, die er einfuhr, profitierten sie immerhin beide. Sie schafften sich eine Reihe neuer Möbel an, erstanden für Susanne das langersehnte Fagott und speisten von nun an mindestens zweimal pro Woche in einem der neuen angesagten Restaurants in Bornheim, Ginnheim oder Sachsenhausen. Alles in allem schienen die Dinge sich somit zum Guten zu entwickeln.
Eines jedoch hatte er damals nicht vorhersehen können: Dass man ihm eines Tages ausgerechnet in Frankfurt eine Vertretungsprofessur anbieten würde. Meyer-Myrtenrain – der von Freundels Nebentätigkeit nichts ahnte, der aber dennoch über das scheinbar unmotivierte Ausscheiden seines Schützlings aus der philosophischen Unternehmensberatung nicht allzu verstimmt zu sein schien – hatte daran erheblichen Anteil. Ohne falsche Scham hatte er hinter den offiziellen Kulissen der Kandidatenkür an den Ariadnefäden seines kollegialen Netzwerks gezupft und bei manchem früheren Weggefährten nach Jahren des Schweigens ein herzallerliebstes Glöckchen erschallen lassen.
Natürlich blieben bei der so ins Rollen gebrachten Beihilfe Rückzahlungsbescheide nicht aus.
„Schuhzucker und Jäckle bräuchten für die Richter-Festschrift noch einen raschen Beitrag“, ließ Meyer-Myrtenrain ihn telefonisch wissen. „Kriegen Sie das hin?“
„Notfalls schon“, erwiderte Freundel. „Aber mit dem Richter-Stall hatte ich doch nie näher zu tun.“
„Das macht nichts. Schreiben Sie irgendwas zu Aristoteles.“
„Das Thema der Festschrift ist aber Subjektivität in der Moderne.“
„Jetzt werden Sie mal nicht zimperlich. Hauptsache, Sie liefern denen irgendwas.“
„Egal, was?“
„Es ist völlig wurscht, was.“
Folgsam erledigte Freundel die anbefohlene Aufgabe und übernahm auch gleich noch eine Gutachterrolle in einem Drittmittelverfahren, die einem anderen Amigo seines Mentors lästig geworden war. Der revanchierte sich umgehend mit einem schnarrenden Empfehlungsschreiben, das ihn über Nacht zu einem der gefragtesten Anwärter auf die begehrte Vertretungsprofessur werden ließ. Der Sache förderlich war außerdem, dass Freundels Habilitationsschrift, ein elefantöses Trakat über ontologischen Strukturwandel, in das Sortiment eines renommierten Wissenschaftsverlags aufgenommen und in Fachkreisen mit wohlwollender Aufmerksamkeit bedacht worden war. Auch hatte er in den zurückliegenden Jahren keine Mühen gescheut, sich durch clevere Zeitschriftenaufsätze und durch Vorträge, die er auf Konferenzen von Raperswil bis Reikjavik zum Besten gab, innerhalb der akademischen Zirkusarena mit Bravour ins Rampenlicht zu turnen.
Erstaunlicherweise erwies sich bei all diesen Aktivitäten der zeitraubende Zweitberuf kaum als hinderlich. Im Gegenteil: Die erotische Professionalität, die er sich abverlangte, besaß den eigentümlichen Nebeneffekt, ihn auch beim Verfassen wissenschaftlicher Artikel zu vorzüglicheren Leistungen anzustacheln. Die besoldeten Ausflüge zu den zahlreichen, meist verheirateten Damen der Frankfurter Mittel- und Oberschicht verliehen seinem akademischen Tagwerk eine Beschwingtheit und schöpferische Leichtigkeit, wie er sie zuvor nicht gekannt hatte. Sogar inhaltlich geriet ihm mancher finanziell vergütete Plausch, der sich im Laufe einer diskreten Nachmittagsstunde entwickelte, zur unverhofften Inspirationsquelle. Er hatte es sich nämlich zur Gewohnheit gemacht, spezielle philosophische Theorien für seine jeweiligen Geldgeberinnen zu ersinnen, die er passgenau auf deren geistige und emotionale Bedürfnisse zuzuschneiden versuchte. Nahm er beispielsweise bei einer Kundin einen Hang zur Parapsychologie wahr, lenkte er das Gespräch zielsicher auf einen Punkt, an dem er mit einer Theorie aufwarten konnte, die der Auffassung entgegentrat, die Wirklichkeit sei allein aus physikalischen Prinzipien heraus erklärbar. Bemerkte er hingegen bei einer seiner Bettgenossinnen eine Tendenz, die Geschehnisse des Lebens für eine sinnentleerte Fuge des Schicksals zu halten, wusste er eine ergänzende Betrachtungsweise über die Absurdität der menschlichen Existenz beizusteuern. Stets fand er einen Weg, die Gedanken und Einstellungen seiner heimlichen Gefährtinnen kreativ weiterzuspinnen, um aus dem oftmals harzigen Sirup ihrer Kopfgeburten betörend schillernde Honigfäden zu ziehen und ein elektrisierendes Echo auf sie zu liefern. Dabei geschah es nicht selten, dass er eine Theorie ausheckte, mit der er sich auf philosophisch gänzlich unerschlossenes Gelände vorwagte. Bei einigen dieser freihändigen Gedankengänge, die er als seine „Geschichten“ für seine Kundinnen zu bezeichnen pflegte, gelangte er sogar zu Resultaten, aus denen sich ohne Abstriche eine schmissige Fachpublikation zimmern ließ. Auf diese Weise waren in den letzten Jahren zusätzlich eine Handvoll provokativer Zeitschriftenartikel entstanden, denen seine Publikationsliste jenen beachtlichen Umfang verdankte, der sich bei der Kandidatenkür für die Frankfurter Vertretungsprofessur als günstig erwiesen hatte.
Mit einem Wort: Die von widerstreitenden Kräften zusammengehaltene Konstellation seiner beiden Betätigungsfelder wirkte, ihrer heiklen Statik zum Trotz, nach beiden Seiten hin beflügelnd. In demselben Maße wie ihm die Seriosität der akademischen Weihen bei seinen frivolen Hausbesuchen eine fast schon unverschämte Selbstsicherheit verlieh, die er in seiner bloßen Eigenschaft als Mann niemals hätte aufbringen können, verschafften ihm die professionell ausgeführten Liebesakte, die er in fremden Ehebetten vollzog, bei der mitunter verzwickten Dribbeltätigkeit des Gelehrtendaseins eine Geschmeidigkeit und Ausdauer, die sich in ungeahnter Produktivität niederschlug. In jeder der beiden Welten bewegte er sich umso leichtfüßiger, je deutlicher ihm vor Augen stand, dass es sich nicht um die einzige Welt handelte, auf die er festgenagelt war und deren klar umrissener Horizont ihn umgab. Dieser Effekt der wechselseitigen Rückenstärkung war einer der Gründe dafür, dass Freundel vorerst gezögert hatte, die Existenz von René in dem Augenblick zu beenden, als das unerwartete Angebot an ihn erging, im altehrwürdigen Philosophiebetrieb der Goethe-Universität für zwei Semester als akademische Vollzeitkraft einzuspringen.
Andererseits lag es auf der Hand, dass er sich ein idiotisches Risiko aufhalste, wenn er beiden Professionen fortan innerhalb ein und derselben Stadt nachging. Wie sollte er denn reagieren, sollte durch irgendeinen dummen Zufall eines Tages eine Mechthild, Jutta oder Tamara aus Bockenheim, Bornheim oder Kronberg in seiner Vorlesung aufkreuzen? Dieser Überlegung hielt Freundel entgegen, dass er erhebliche Zeit und Mühen investiert hatte, um im Lauf der Jahre den Kreis seiner Stammkundinnen aufzubauen und zu festigen; auch würde er nach Ablauf der Vertretungsstelle voraussichtlich erneut für längere Zeit auf ein Einkommen aus zuverlässiger Quelle angewiesen sein. Da war es schon vorteilhaft, wenigstens einige seiner treuesten Gefährtinnen bis auf weiteres bei der Stange zu halten.
Zugleich ahnte er selbst, dass in dieser praktischen Erwägung nicht der ausschlaggebende Grund dafür lag, dass René fortlebte. Der entscheidende Grund war anderer Natur: Er liebte Renés Aktivität. Er liebte die sinnliche und intellektuelle Herausforderung, die sie ihm bot, und er liebte die Frauen, auf die er dabei traf und als deren erotischer Erlöser er auf den Plan trat; er liebte ihre Besessenheit und ihre Heimlichkeit, ihre Schamlosigkeit, ihren Zynismus und ihre Melancholie; er liebte die Kühle der Nacht, die ihn umfing, wenn er vor einem fremden Hausportal mit dankbarer Miene verabschiedet wurde, er liebte den verschwörerischen Ton, der den Stimmen seiner Gespielinnen anhaftete, wenn sie auf seinem Anrufbeantworter ihre Terminwünsche hinterließen, und er liebte die Gerüche der ihm unbekannten Waschmittel, die ihre Bettwäschen verströmten.
Hinzu kam etwas anderes, schwerer in Worte zu Fassendes: Eine Art magischer Bann, der vom Flammenwurf seiner Einfälle ausging, gespiegelt in der willigen Hingabe seiner halbgebildeten Zuhörerschaft. Ein arachaischer Reiz, naiv und unverstellt, von keiner Skepsis gestutzt und von keinem Fachdiskurs zuschanden geritten. Entstiegen einer Bodenspalte des Denkens, die den Blick auf tiefere, glühendere, nur schwer zu kanalisierende Strömungen freigab.
Letzteres war ihm nur in Ansätzen bewusst. Eines aber spürte er deutlich: Längst hatte sich, was vor vier Jahren als kühl und durchaus hinterhältig kalkulierter Nebenjob zur Sicherung des finanziellen Auskommens seinen Anfang genommen hatte, in eine mephistophelische Passion verwandelt, die ihren eigenen Gesetzen folgte und die bis ins Mark von ihm Besitz ergriffen hatte.





























