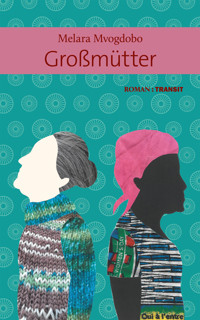
16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Transit
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Zwei Großmütter, die eine aus einer armen Schweizer Bauernfamilie, die andere aus einer wohlhabenden Familie in Kamerun. In einer unglaublich knappen, wie gemeißelten Sprache erzählen sie von ihrer Kindheit, ihren Hoffnungen und Enttäuschungen. Sie heiraten, werden gedemütigt, entwürdigt. Aber dieses Leben, diese Erfahrungen lassen in ihnen eine gewaltige Wut anwachsen, die schließlich, auch mit Hilfe ihrer Enkeltöchter, zu ihrer Befreiung führt. Ein mitreißender, verblüffender Roman.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 73
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
© 2025 by : TRANSIT Buchverlag
Postfach 120307 | 10593 Berlin
www.transit-verlag.de
Foto der Autorin © Privat
Umschlagillustration © Melara Mvogdobo
Umschlaggestaltung und Layout © Gudrun Fröba
Druck und Bindung: CPI Deutschland
eISBN 978-3-88747-456-0
Melara Mvogdobo
Großmütter
AllenGroßmüttern zu Ehren, den lebenden, den toten und denen,die noch geboren werden.
Inhalt
Mein Tod|Regen|GenugBarfuß|Nachdenken|MädchenzeugsDie Schönste|Der Franzli|SchwesterleinDumme Träume|HauswirtschaftsjahrBrüste|Bis zum nächsten Nein eines MannesSchöne Augen machen|BesondersEin Ozean aus Tränen|Ein schöner MannBuurebüebli|Sans polygamie|HochzeitsfotoWeg|Nur Mädchen|Geld zurückSchande|Ein Sohn|Geburt|SpiegelbildDas Kind bleibt hier|FrauenessenReiche Herrschaften|Sei dankbar|SchandeFluch|Kein Bauer|Freude|EnkelinEin Segen|Abschiedsfeier|Verdammt
Hilf mir, kleiner Bruder!|Fliegt, meine Töchter, fliegt!|Dummes Weibsbild|SchleichendWarum nicht meinen|Hellgelbe WändeFreude|Genug|Den Schein wahrenIch hätte Nein sagen sollen|KongossaDer Entschluss|Sans Polygamie|LeichtJetzt sind nur noch wir zwei übrigZum Arbeiten geboren|SorcièreManchmal ist es nützlich, eine Hexe zu seinKafi ond Bröche|GebeteDer letzte Atemzug|Reise|GewissenKomm!|Traurig oder glücklich|Ich weiß, was du getan hast|Blinzeln|Eines TagesGlossar
Mein Tod
Mein Tod ist nah, das kann ich spüren. Auch hören.
Ich höre, was sich die gedämpften Stimmen zuraunen.
Obwohl alle denken, dass ich nichts mehr mitbekomme.
Nur weil ich seit Tagen in dem Spitalbett, in das ich von den fleißigen Schwestern gesteckt wurde, bewegungslos und blind an die Decke starre, heißt das nicht, dass ich ihn nicht spüren kann.
Der Tod kommt von unten. Er hat sich über meine Füße Einlass verschafft und kriecht jetzt langsam, aber wie mir scheint, unbeirrt aufwärts.
Er hat keine Eile. Er ist sich seiner Sache, seiner Beute gewiss.
Recht hat er. Wo sollte ich auch hingehen? Wohin entfliehen?
Mein Leben ist gelebt.
Die Tat vollbracht.
Darüber will ich noch eine Weile nachdenken. Und dann ist es gut.
Sehen Sie, höre ich die leise Stimme der Schwester, das da an den Füßen Ihrer Mutter sind schon die ersten Totenflecken. Sie stirbt.
Meine Tochter kann ich nicht hören. Vielleicht weint sie.
Ich vermute eher nicht.
Wir sind nicht so eine Familie, in der man die Gefühle offen zur Schau trägt.
Auf jeden Fall nicht die Trauer und auch die Freude nicht.
Den Zorn vielleicht.
Zorn stand von jeher aber nur den Männern zu.
Regen
Seit geraumer Zeit sitze ich vor dem großen Fenster des Wohnzimmers und sehe den Wassertropfen zu, wie sie unermüdlich Spuren auf der Scheibe hinterlassen.
Dazu das dumpfe, schwache Geräusch, wenn sie auf dem Fensterglas zerplatzen.
Früher mochte ich den Regen.
In Kamerun kommt der Regen wie eine Naturgewalt über die Stadt.
Man muss sich ihm unterwerfen.
Das Leben steht still.
Die Menschen suchen rennend Zuflucht unter Vordächern, Marktstände werden hektisch abgeräumt, und die Autos gleichen Booten, die hinter sich Wasserfontänen aufsteigen lassen.
Irgendwann müssen auch sie aufgeben und einfach an Ort und Stelle stehen bleiben, bis alles vorbei ist.
Das ist das Schöne an unserem Regen.
Er hat einen Anfang und ein Ende.
Nach einer halben Stunde vielleicht, ab und zu mal auch nach ein oder zwei Stunden, ist der Spuk vorbei.
Die Sonne kommt wieder hinter den Wolken hervor.
Der Boden dampft.
Und alles riecht herrlich nach Leben.
Hier hingegen, in diesem kleinen, reichen Land, ist der Regen mein Feind geworden.
Hier steht man morgens mit demselben Regen, auf mit dem man sich abends wieder ins Bett legt.
Tagelang. Wochenlang.
Er hört einfach nicht auf.
Alles ist grau, kalt und traurig.
Ich will nicht undankbar sein.
Ich weiß, was meine Enkelin für mich getan hat.
Zu Beginn war ich fasziniert von meinem neuen Leben in der Schweiz.
Wie wunderbar, dachte ich,
ein Leben in Europa an der Seite meiner stürmischen Enkelin!
Und vor allem:
Ein Leben ohne IHN.
Doch nun, fast drei Jahre später, vergehe ich vor Sehnsucht nach der roten Erde meiner Stadt.
Genug!
Ich erinnere mich gut an den Moment, in dem es mir reichte. Geradeso, als ob es gestern gewesen wäre.
Er schreit und jammert schon den ganzen Morgen.
Nichts ist ihm recht.
Egal, was ich tue, es ist falsch.
Vorhin habe ich ihm seinen Milchkaffee mit extra viel Kondensmilch gebracht.
Er hat ihn ausgespuckt und wütend gezetert:
Zu heiß! Zu heiß! Willst du mich umbringen?
Dann stößt er wie zufällig mit dem Ellbogen gegen die Tasse.
Er will mich glauben lassen, dass seine Krankheit daran schuld ist. Sie bringt seine Glieder zum Zittern.
Doch während ich die Schweinerei aufwische, kann ich sehen, wie es in seinen Augen genüsslich aufblitzt.
Ich verwende schon lange nur noch Plastikgeschirr.
Bring mich zum Arzt, verlangt er. Ich habe Schmerzen.
Wir betreten das gut gefüllte Wartezimmer.
Bonjour, grüße ich in die Runde der Wartenden. Er sagt nichts.
Hinten rechts entdecke ich zwei freie Stühle.
Ich stütze ihn und passe mich seinen unsicher schlurfenden Schritten an.
Nachdem ich ihm geholfen habe, sich auf den wackligen Stuhl zu setzen, starrt er apathisch ins Leere.
Doch plötzlich ist da dieses Geräusch.
Mein Geist weigert sich, es zu akzeptieren.
Will weghören. Es ignorieren.
Aber ich weiß es. Dieses Geräusch kündigt meine nächste Erniedrigung an.
Es ist ein leises Plätschern.
Ich zwinge mich, ihn anzusehen.
Doch er starrt vollkommen unbeteiligt starr geradeaus,
während er eine große, gelbe Lache auf den Boden pinkelt.
Eine gelangweilte Krankenschwester gibt mir einen unappetitlichen Lappen zum Aufwischen.
Einmal mehr finde ich mich auf meinen Knien zu seinen Füssen.
Genug ist genug!
Ich glühe innerlich vor Zorn.
Während vor all diesen Leuten im Wartesaal des Arztes ein weiteres Stück meiner Würde sich ins Nichts auflöst.
Barfuß
Ich war ein fröhliches Mädchen. Trotz allem.
Wenn ich an meine Kindheit denke, sehe ich mich oft, wie ich mit schwingenden Zöpfen über Weiden hüpfe hinter unseren Kühen her.
Oder auf dem weiten Weg zur Schule mit der kleinen Hand meiner Schwester in der meinen.
Daneben unsere Brüder und die anderen Kinder der umliegenden Höfe, mit nichts als Schabernack im Sinn.
Damals hatten die Familien viele Kinder.
Wir waren nur zu sechst.
Zwei Mädchen und vier Buben.
Wir liefen jeden Tag über eine Stunde über den Hügel und durch den Wald bis zu dem kleinen Schulhaus.
Im Winter, wenn wir bis zum Bauch im hohen Schnee versanken, dauerte es länger.
Im Sommer, bis tief in den Herbst, gingen wir barfuß.
Unsere Fußsohlen waren hart und rau wie das Leder des Gürtels unseres Vaters.
Wie oft habe ich ihn auf meinem Rücken zu spüren bekommen?
Und wie oft erst meine Brüder?
Ihr habt zu viele Flausen im Kopf. Sagte unsere Mutter.
Heute Abend, wenn der Vater vom Stall kommt, werde ich ihm berichten.
Anders lernt ihr es nicht.
Im Winter trugen wir harte Schuhe aus dunklem Leder.
Der Vater schlug mit dem wuchtigen Hammer, den er im Schober neben dem Stall aufbewahrte, schwarze Nägel in die dicken Holzsohlen.
Der Hammer war derselbe, mit dessen Stiel er die großen, hellbraunen Kaninchen mit einem kräftigen Schlag in den Nacken tötete.
Manchmal tat er es auch mit der bloßen Hand.
Ich liebe Kaninchenbraten. Bis heute.
(Obwohl ich schon seit Tagen nur noch künstlich ernährt werde, kann ich mich noch an das Gefühl des zarten Fleisches in meinem Mund erinnern.)
Die stets zu kleinen Lederschuhe hingegen, die ich mir mit meinen Geschwistern teilte und in denen sich meine blutenden Zehen krümmten wie gebratene Hühnerfüße, die verabscheute ich.
Aber kein Winter währt ewig.
Gottseidank!
Nachdenken
Ich muss nachdenken.
Ich will verstehen, wieso mein Leben so ist, wie es ist.
Und noch viel wichtiger: Weshalb ich nicht in der Lage war, mein Schicksal einfach anzunehmen, wie so viele andere Frauen.
Mädchenzeugs
Ich mag die Schule.
Ich bin fleißig und auch recht gescheit.
Glaube ich.
Vielleicht mag ich die Schule auch nur so sehr, weil es dort nicht so anstrengend ist wie zuhause auf dem Hof.
Steh auf, Mädchen!
Hol Holz im Schober!
Feuere ein!
Hol Wasser für den Zuber und vergiss Scheuerseife und Waschbrett nicht!
Ein gutes Mädchen muss Socken stricken und Kleider flicken können.
Los, Mädchen!
Schäl die Kartoffeln!
Füttere die Säue!
Hilf dem Vater und dem Bruder beim Melken!
Pflück die Beeren im Obstgarten und vergiss die Hühner nicht!
In der Schule ist es anders.
Sitz gerade! Sagt der strenge Herr Lehrer.
Schreibt und rechnet!
Betet zum Herrgott.
Das ist alles.
Das ist einfach.
Als ich elf Jahre alt werde, sagt meine Mutter:
Mädchen, ab jetzt bleibst du zuhause.
Ein Mädchen braucht nicht gescheit zu sein.
Ein gutes Mädchen muss arbeiten, einen Haushalt führen können.
Kein Mann mag Mädchen, die gescheit daherreden, aber das Haus nicht sauber halten.





























