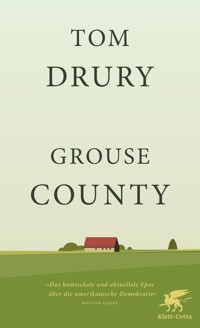
21,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Klett-Cotta
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
»Das komischste und aktuellste Epos über die amerikanische Demokratie« Boston Globe Die USA befinden sich im Wandel. Doch in Grouse County, irgendwo im Mittleren Westen, ist die Zeit stehengeblieben. Hier findet man sie noch, die »echten« Amerikaner, die mit Stolz ihr Tageswerk verrichten und sich nicht gern auf den Arm nehmen lassen. Auch nicht von einem trockenen Alkoholiker, der sich zum Sheriff wählen lassen will. »Drury ist ein großer amerikanischer Autor.« Jonathan Franzen Grouse County ist die Heimat der Darlings und anderer liebenswerter Eigenbrötler. Das Leben der Menschen dort zerbröckelt langsam, aber unaufhaltsam, denn sie alle jagen ihren unrealistischen Träumen nach – gleich, was es kostet. Sie sind der Dorn im Auge des örtlichen Sheriffs, Dan Norman, der bestrebt ist, die Harmonie in seinem County zu wahren. Dafür ist er sogar bereit, sich auf einen Wahlkampf um das Amt des Sheriffs einzulassen. Die jüngere Generation sieht dagegen nur einen Ausweg, um dem ländlichen Mief zu entkommen: Grouse County verlassen und nie mehr zurückkehren. Der Band enthält die drei Romane »Das Ende des Vandalismus«, »Die Traumjäger « und den bisher auf Deutsch unveröffentlichten Roman »Pazifik«, mit denen Tom Drury sich in die erste Liga der amerikanischen Romanciers geschrieben hat. Der Romanteil »Pazifik« war Finalist für den National Book Award
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1102
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Tom
Drury
Grouse
County
Romantrilogie
Aus dem Amerikanischen von Gerhard Falkner und Nora Matocza
Klett-Cotta
Enthält die Romane:
Das Ende des Vandalismus
Die Traumjäger
Pazifik
Impressum
Die Übersetzungen von »Das Ende des Vandalismus« und »Die Traumjäger« wurden für diese Ausgabe vollständig überarbeitet. »Pazifik« erscheint hier zum ersten Mal auf Deutsch.
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Speicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Klett-Cotta
www.klett-cotta.de
Die Originalausgaben erschienen unter den Titeln
»The End of Vandalism«, »Hunts In Dreams« und »Pacific«
bei Houghton Mifflin und Grove Atlantic, New York
© 1994, 2000, 2013 by Tom Drury
Für die deutsche Ausgabe
© 2017 by J. G. Cotta’sche Buchhandlung
Nachfolger GmbH, gegr. 1659, Stuttgart
Alle deutschsprachigen Rechte vorbehalten
Cover: ANZINGER UND RASP Kommunikation GmbH, München
unter Verwendung einer Illustration von © shutterstock/Nelia Sapronova
Datenkonvertierung: Fotosatz Amann, Memmingen
Printausgabe: ISBN 978-3-608-98025-7
E-Book: ISBN 978-3-608-10881-1
Dieses E-Book basiert auf der aktuellen Auflage der Printausgabe.
Inhalt
Das Ende des Vandalismus
Die Traumjäger
Pazifik
In Erinnerung an Veronica Geng
Das Ende des Vandalismus
Verstörte Welt
Eins
Eines Herbstes fand die alljährliche Blutspendeaktion im Geräteschuppen der Feuerwehr von Grafton statt. Sheriff Dan Norman war eigentlich nur als Zeichen seines guten Willens dazugestoßen, aber dann kam eine der Krankenschwestern nicht rechtzeitig, so dass Dan sich bereit erklärte, jedem Blutspender einen Wattebausch in die Armbeuge zu drücken. »Und ich danke Ihnen«, sagte er jedes Mal.
Am frühen Nachmittag kam Louise Darling herein. Dan kannte sie flüchtig. Tiny Darling war auch dabei – ihr Ehemann. Dan nahm an, dass Tiny ein paar Einbrüche in Westey’s Farm Home am Highway 18 begangen hatte. Es gab dafür aber keine stichhaltigen Beweise.
Louise trug ein rotes Tuch über dem Haar. Sie zog ihre Armeejacke aus, damit man ihr Blut abnehmen konnte; darunter trug sie ein dunkelgrünes T-Shirt mit Brusttasche. Dan bewunderte insgeheim ihre schmalen weißen Handgelenke, während er ihr den Wattebausch gegen die Schlagader drückte.
»Ich danke Ihnen, Mrs. Darling«, sagte er.
Dann kam Tiny dran. Er hatte rotes Haar und auf einem Handrücken eine Eule tätowiert. »Ihr solltet das Blut nach Port Gaspar schicken«, sagte er.
»Wohin?«, fragte Dan.
»Nach Port Gaspar«, wiederholte Tiny. »Die Marine hat den Eskimos dort nämlich eine Ladung tiefgefrorenen Lachs verkauft, und es hat sich herausgestellt, dass der vergiftet war. Deswegen sind die jetzt alle krank. Sie haben Blutvergiftung. Und raten Sie mal, was die Marine macht. Die schickt natürlich ein paar Anwälte hin, um die Eskimogemeinde einzuschüchtern.«
»Wo liegt denn Port Gaspar?«, fragte Dan.
»Im Südpol oder so«, sagte Louise. Sie hatte große grüne Augen und ganz zarte Sommersprossen. »Wir haben einen Bericht darüber im Radio gehört. Vielleicht war es ja auch gar nicht die Marine, aber sie sind mit Schiffen von der Marine gekommen.«
»Als Beobachter«, ergänzte Tiny. »Sie sind an Deck hingefahren, in einem eigenen kleinen Bereich, der mit Seilen abgesperrt war. Jetzt müssen die Eskimos alle ihr Blut waschen lassen.«
Sheriff Dan Norman ließ Tinys Arm los und wandte sich an Schwester Barbara Jones. »Wo geht dieses Blut denn nun hin? Alles ans Rote Kreuz?«
»Genau«, sagte sie. »Aber ich will Ihnen was sagen. Meine Großcousine hatte mal eine Blutvergiftung. Damit ist nicht zu spaßen. Dan, die kennen Sie doch – meine Cousine Mary.«
»Mary Ross«, sagte Dan.
»Mary Jewell«, erwiderte die Schwester. »Also, ihre Mutter war eine Ross, Viola Ross. Sie war eine Cousine ersten Grades von Kenny Ross, der dann nach Korea gegangen ist. Also, sie schaffte es damals nicht mal mehr vom Bett bis zum Tisch.«
Louise Darling zog sich die Jacke glatt und warf den Kopf zur Seite. »Ich bin gar nicht sicher, ob es wirklich Eskimos waren.«
»Es war dort jedenfalls so kalt, dass es Eskimos gewesen sein könnten«, sagte Tiny. »Diese Anwälte haben nämlich gesagt: ›Noch eine einzige Beschwerde, und wir machen die ganze Stadt mit dem Schneepflug platt.‹«
»Ihre Häuser waren also aus Schnee«, sagte Dan.
»Sieht so aus«, meinte Tiny.
Das nächste Mal traf Dan Norman mit Tiny Darling zusammen, als es eines Sonntagabends zu einer Schlägerei im Kalkeimer kam. Kneipenschlägereien waren Dan besonders zuwider, seit er einmal mit einem Billardqueue am Rücken erwischt worden war und daraufhin den Sommer bei einem Chiropraktiker verbringen musste, statt draußen sein zu können. Der Chiropraktiker hatte eine Flasche Wodka auf dem großen Safe hinter seinem Schreibtisch stehen und legte Wert darauf, Dr. Young Jim genannt zu werden, weil sein verstorbener Vater, wie er sagte, als Dr. Old Jim bekannt gewesen sei. Bei der jetzigen Schlägerei hielt Tiny Bob Becker an der Kapuze seines roten Sweatshirt fest und stieß ihn mit dem Kopf immer wieder gegen die Griffe des Kickertischs.
Dan schnappte sich Tiny und zerrte ihn nach draußen. Es fiel gerade der erste Schnee, und sie sahen ihn schräg auf die leere Straße niedersinken. Tiny war schon ziemlich betrunken, aber noch ganz munter. So viel Dan mitbekommen hatte, war es bei dem Streit darum gegangen, ob die Country-Sängerin Tanya Tucker abgewirtschaftet habe, und Tiny war nicht dieser Ansicht gewesen.
Im Streifenwagen des Sheriffs fuhren Dan und Tiny auf der Straße von Pinville Richtung Südwesten zum Gefängnis von Morrisville. Auf halbem Weg versuchte Tiny, Dan einen Schwinger zu versetzen, und Dan musste anhalten, Tiny aussteigen lassen, ihm Handschellen anlegen und ihn in den hinteren Teil des Streifenwagens verfrachten.
»Ich dachte immer, du bist gescheit«, sagte Dan durch das Gitter. »Sieht aber so aus, als hätte ich mich da leider getäuscht.«
»Gleich kugelt es mir die Arme aus«, sagte Tiny.
»Das nächste Mal kannst du ja deinen eigenen Kopf gegen die Griffe knallen.«
Es folgte ein langes Schweigen. »Sie haben Schnee auf der Mütze«, sagte Tiny.
Dan bremste für einen Waschbären, der gerade über die Straße tapste. »Wir wissen, dass du das warst, das mit den Einbrüchen bei Westey’s«, sagte Dan. »Übrigens, mit der Tür dort hast du dich ja ziemlich blöd angestellt. Aber das spielt keine Rolle, weil wir es nicht weiter verfolgen, also, ich weiß gar nicht, warum ich überhaupt damit anfange.«
Tiny lachte. »Wie hoch ist dieser Streifenwagen eigentlich? Anderthalb Fuß?«
Im Gefängnis von Morrisville war es dämmerig, und drinnen projizierten die beiden Hilfssheriffs gerade zusammen mit ein paar Freunden Dias von nackten Frauen auf eine Karte des Bezirks. »Wäre das schön, wenn ich heute Abend auf der Farm von Floyd Coffee sein könnte«, sagte Deputy Earl Kellogg Junior soeben. Dan befahl ihnen, sofort damit aufzuhören und sich um Tiny Darling zu kümmern und ihn in eine Zelle zu stecken. Dann setzte er sich, um den Schreibkram zu erledigen.
»Da draußen gibt es eine Menge Dealer, die Dope unter die Leute bringen«, sagte Tiny. »Irgendjemand hat kürzlich sogar diesen Typen in der Gasse hinter der Bank niedergestochen. Und ausgerechnet ich hock jetzt hier – wo ich doch Blut gespendet habe.«
»Wie heißt du richtig, Tiny?«, fragte Dan.
»Charles«, antwortete Tiny. »Ich arbeite als Klempner.«
»Glatte Lüge«, sagte Earl Kellog. »Dan, die Tochter von Ted Jewell hat angerufen. Ich hab ihren Namen vergessen.«
»Das kann Shea oder Antonia sein«, sagte Ed Aiken, der zweite Deputy.
»Ach ja, genau«, sagte Earl. »Die vorletzte Klasse in Morrisville-Wylie veranstaltet einen Tanzabend gegen Vandalismus, und diese Shea Jewell hat gesagt, sie hätten gerne, dass du die Schirmherrschaft übernimmst. Eigentlich sollte das Rollie Wilson von den Rettungssanitätern machen, aber du weißt ja, bei Wilson hat es gebrannt.«
»Mal sehen«, meinte Dan.
»Es ist nur halb offiziell.«
Dan zog den Stecker des Projektors, packte die Dias ein und ging. Es schneite noch immer. Er nahm einen Umweg zurück nach Grafton und ertappte sich dabei, dass er am Haus von Tiny und Louise vorbeikam. Das Hoflicht schimmerte durch die Bäume. Tiny und Louise hatten das weiße Farmhaus gemietet, in dem früher Harvey und Iris Klar gewohnt hatten und das jetzt Jean, der Tochter der Klars, gehörte, die dreißig Meilen entfernt in Reinbeck wohnte und irgendwie bei der dortigen Ziegelei beschäftigt war.
Dan fuhr in die Einfahrt und stieg aus. Ein weißer Hund mit quadratischem Kopf tauchte aus dem Werkzeugschuppen auf und kam über die dünne bläuliche Schneedecke gesprungen. Der Hund gab fast keinen Laut von sich, und Dan redete ihm zu, dass er wieder in den Schuppen gehen solle. Inzwischen hatte Louise Darling die Vordertür geöffnet. Dan ging zum Haus. Jemand hatte Heuballen rings um das Fundament gelegt – das fand er gut. Louise trug Jeans und ein weißes Sweatshirt. Dan trat ein, schloss die Tür und bemerkte dabei, dass Louise weder Schuhe noch Socken anhatte. Im Wohnzimmer war es dunkel, bis auf das violette Licht des Fernsehers.
Louise schaltete eine Tischlampe ein. »Wo ist Tiny?« Sie hatte langes, volles braunes Haar, das sie seitlich gescheitelt trug. In der Ecke stand ein Stativ mit einer Kamera darauf. Louise arbeitete für das Fotostudio Kleeborg in Stone City.
»Tiny hatte im Kalkeimer eine Schlägerei mit Bob Becker«, sagte Dan. »Ihm geht es gut, aber er ist betrunken, deswegen habe ich ihn für heute Nacht in Morrisville ins Gefängnis gesteckt.«
»Er ist aber nicht verletzt?«, fragte Louise.
»Nein. Wie gesagt, er hat den Kampf gewonnen.«
»Was für eine Anklage wird es geben?«
»Ich habe nicht vor, etwas zu unternehmen. Ich wasche meine Hände in Unschuld. Was schauen Sie sich denn gerade an?«
»Was soll das denn heißen. Sie waschen Ihre Hände in Unschuld?«
Dan starrte die ganze Zeit auf den Fernseher. »Er kommt morgen früh wieder raus. Um acht Uhr früh lassen sie ihn frei, wenn die Nachtschicht zu Ende ist.«
Louise ging an den Tisch und trank etwas Bernsteinfarbenes aus einem kleinen Glas. »Verdammt noch mal. Warum können die Leute Tiny nicht in Ruhe lassen?«
Dan setzte sich auf die Armlehne eines Sessels. »Louise, um ganz ehrlich zu sein, das könnte man Tiny auch fragen. Er kann ganz schön unangenehm werden.«
Louise griff nach einer Schachtel Zigaretten und setzte sich auf die Couch. »Das stimmt.«
»Was ist denn das?«, fragte Dan und wies auf den Fernseher.
»KROXComix Classix«, sagte Louise. »Das da ist so ein Pfarrer, der ist gerade schrecklich müde, und diese Mücke in seinem Zimmer macht ihn ganz wahnsinnig. Der Pfarrer war nämlich den ganzen Tag mit dem Fahrrad im Gebirge unterwegs.« Louise zündete sich eine Zigarette an.
»Aha.«
»Das ist eine Komödie aus Italien.«
Sie schauten kurz zu. Dan nahm die Mütze ab und hängte sie sich übers Knie.
»Ich kann schon nicht mehr vor Lachen«, sagte Louise.
Dan fuhr mit seinem Streifenwagen nach Hause. Er aß ein Sandwich mit Spiegelei und trank eine Flasche Bier. Er wohnte in einem türkisgrün und weiß gestrichenen Wohnmobil außerhalb von Grafton. Er warf einen Blick auf die Aktdias, aber sie waren zu klein.
Louise lackierte sich die Zehennägel – das hatte Dan bemerkt. Sie lackierte sich die Zehennägel dunkelrot. Er stellte sich vor, wie sie sich in einem leeren Zimmer in diesem zugigen Farmhaus den Lack abtupfte.
Im Februar begann eine Serie von ungewöhnlichen Diebstählen. Es lagen noch immer Schneewehen über dem Land. Die gestohlenen Sachen waren alle riesengroß – Mähdrescher, Futterlaster, sogar eine gelbe Planierraupe aus der Maschinenhalle des Bezirks, am Ortsrand von Wylie – und schienen sich einfach in Luft aufzulösen. Bald hörte man, dass möglicherweise eine Gang daran beteiligt sei, die man die »Schlepper« nannte. Es wurde viel darüber diskutiert, aber ohne Ergebnis.
Dem alten Henry Hamilton wurde dabei ein Traktor aus seinem Schuppen gestohlen. Als Dan dort erschien, um den Diebstahl aufzunehmen, war Louise Darling ebenfalls gerade anwesend. Es war an einem Sonntagvormittag. Louise trug blaue Ohrenschützer. Henry hielt Hühner, und Louise hatte einen grauen Eierkarton in die Armbeuge geklemmt.
Sie gingen alle drei in den Schuppen, gefolgt von Mike, Henrys Schäferhund-Mischling. Der Schuppen hatte Wände aus Blech und ein Dach aus transparentem grünem Wellkunststoff. Drinnen befanden sich ein blauer Chevy-Pickup, eine uralte silberfarbene Maispflückmaschine und die Stelle, wo der Traktor gestanden hatte. Es war still. Henry kam gleich auf die »Schlepper« zu sprechen.
»Es heißt, dass sie alles heimlich mit Eisenbahnwaggons nach Texas schaffen. Meiner war ein Allis-Chalmers, orange, mit Radio. Im Sommer hab ich immer einen Schirm dran festgemacht, um Schatten zu haben. Der war jetzt natürlich nicht dran.«
»Hatten Sie den Schuppen abgesperrt?«, fragte Dan.
»Ich hab nie irgendwas abgesperrt«, antwortete Henry. »Meine ganzen Schlüssel liegen völlig durcheinander in einer Schublade.«
»Vielleicht sollten Sie da mal was dran ändern«, sagte Dan.
»Ich möchte ja wissen, ob das wirklich diese ›Schlepper‹ waren«, sagte Louise.
Dan ging im Schuppen umher und scharrte immer wieder mit dem Schuh auf dem ungepflasterten Boden. »Diese ganze Geschichte ist zum größten Teil ein Märchen.«
»Wie bitte?«, sagte Louise und nahm das blaue Pelzchen von dem einen Ohr.
»Meiner Ansicht nach ist das Ganze total aufgeblasen«, erwiderte Dan.
»Nicht, wenn man diesem Typen vom Landwirtschaftsamt glaubt«, meinte Henry. »Er sagt, man kann natürlich so manches übersehen, aber doch nicht, wenn man mit der Nase darauf gestoßen wird. Weiter wollte er sich nicht äußern. Also, sollte da nicht einfach mal jemand zum Rangierbahnhof rübermarschieren und die Leute dort ein bisschen ausfragen?«
»Ich dachte, die wollten nur so richtig große Dinger?«, sagte Dan.
Henry zündete seine Pfeife an und wedelte das Zündholz aus. »Meiner war aber auch ein ganz schön großer Traktor.«
Mike hob langsam den Kopf und blaffte ein einziges Mal zu dem kalkfarbenen Licht hinauf, das durch die Decke fiel.
»Mike will uns wohl sagen, dass es Außerirdische waren«, sagte Louise.
»Nein, Mike sieht die Schwalbe, die da oben ihren Kopf rausstreckt«, sagte Henry.
Louise und Dan verließen den Schuppen und gingen zu dem Schweinepferch auf der Vorderseite von Henrys Farm hinüber. Es war kalt. Louise hatte rote Backen. Sie steckte die Stiefelspitze durch das Geländer, und ein paar Schweine kamen herüber, um daran zu knabbern.
»Bei Ihnen fehlt hoffentlich nichts«, sagte Dan.
Louise nahm die Ohrenschützer ab, und die blauen Polster rollten sich zusammen. »Gestern Abend waren Lichter zu sehen. Sonst war nichts. Ich dachte, das könnte Tiny sein – das mit diesen Lichtern, die an der Tapete rauf und runter wandern. Tiny und ich haben uns nämlich getrennt, und da kam mir der Gedanke, dass er deswegen vielleicht sauer ist.«
»Sie und Tiny? Echt wahr?«
Louise wischte sich die Nase mit dem Handschuh. »Uns hat eigentlich nichts verbunden. Wir haben zwar immer geredet, aber es ging nie um irgendwas.«
»Warum glauben Sie, dass er sauer sein könnte?«
»Wer wäre das nicht? Es waren immerhin praktisch sieben Jahre. Man fragt sich irgendwann, was man sich eigentlich die ganze Zeit dabei gedacht hat.«
»Hat er Sie jemals bedroht oder geschlagen?«, fragte Dan.
»Nein«, sagte Louise. »Er hat vielleicht hie und da mal hingelangt, aber es hat nie wirklich weh getan.«
»Es gibt nämlich keinen Grund, warum Sie jetzt dasitzen und Angst haben müssten. Das muss absolut nicht sein.«
»So ist er aber nicht, wenn er sauer ist. Tiny würde niemals gezielt auf jemanden losgehen. Das ist mehr so eine frustrierte Art von sauer.«
»Aber Sie wohnen noch auf der Farm.«
»Ja, stimmt. Tiny ist zu seinem Bruder Jerry Tate nach Pringmar gezogen. Das ist in gewisser Weise gut, weil Jerry am Neujahrsabend seinen Motorschlitten platt gemacht hat. Er hatte einen Schal um, und der hat sich in diesem Treibriemen verfangen.«
»Ach verflucht.«
Louise klappte den Eierkarton auf und zu. »Jerry hat Glück, dass er noch lebt. Das ist erst mal eine Trennung auf Probe.«
»Wir könnten Ihnen eine sogenannte ›besondere Aufmerksamkeit‹ anbieten. Wir können auf jeder unserer Runden kurz bei Ihnen vorbeischauen. Das ist zwar nicht gerade das Nonplusultra an Sicherheit, aber es ist besser als nichts.«
»Ich habe doch nur diesen verrosteten Vega. Bei dem fällt demnächst sowieso der ganze Boden ab. Den können die von mir aus auf der Stelle ›schleppen‹.«
»Ach wissen Sie, manchmal kommt man an so einem Pickup vorbei, der da irgendwie am Straßenrand angehalten hat, und das Blinklicht ist an. Und da liegen jetzt meinetwegen lauter Heuballen auf der Straße herum, und dann vielleicht ein Mann, oder eine Frau, und die heben die Heuballen gerade wieder auf. Also, man sieht gleich, was passiert ist. Aber da ist es dann zu spät, die richtig festzubinden, logisch.«
»Okay, ich seh’s ein«, sagte Louise und blinzelte. Dan schwieg einen Augenblick. Fast glaubte er, ihre Augenlider zu hören – pling, pling.
»Wenn die Heuballen schon runtergefallen sind«, sagte er.
Henry kam mit einem Eimer in der Hand um die Ecke. »Ach ja, du wolltest ja Eier haben.« Er führte die beiden in den niedrigen roten Hühnerstall. Der Raum war warm und dunstig und voller Stroh. Die Hühner schlugen mit den Flügeln und rannten wie verrückt in alle Richtungen davon.
Dan hatte Paul Francis, den Piloten des Sprühflugzeugs von Chesley, dafür gewinnen können, mit ihm eine Runde zu drehen, um nach den gestohlenen landwirtschaftlichen Maschinen Ausschau zu halten. Sie starteten auf dem Flughafen von Stone City und flogen Richtung Süden. Der Bezirk trug seine Winterfarben – grau und rindenbraun mit Streifen von blassem Weiß dazwischen. Nach einer Weile schlug Paul vor – wie alle Sportflugzeugpiloten, die Dan kannte –, dass Dan den Steuerknüppel übernehmen solle.
»Schau nach links«, sagte Paul. »Schau nach rechts. Schau nach oben. Man muss auch nach oben schauen.«
Die Sonne kam durch. »Wo würdest du eine Planierraupe abstellen?«, fragte Dan.
»Die Augen immer in Bewegung halten. Wo glaubst du, wo du im Notfall landen könntest?«
»In dem Fall würde ich einfach dich wieder ranlassen.«
Das kleine Flugzeug dröhnte in die blaue Luft hinein. Der Motor röhrte und die Heizung blies, aber die Kälte lag wie ein funkelnder Vorhang ringsum. Als Dan ein wenig ausprobieren wollte, was man mit dem Steuerknüppel alles machen konnte, neigte sich auch schon der eine Flügel, und das Flugzeug schoss in den wässerigen Raum über ihnen.
»Ausgleichen, ausgleichen«, sagte Paul. Dan inspizierte eine Reihe von schwarzen Instrumenten, die zu einer Medaille in Rot und Gold führten, auf der stand: »Der Himmel gehört Dir, oh Herr.«
»Du schaust ja gar nicht«, sagte Paul. »Lass doch jetzt mal diese Armaturen. Ich kleb dir die Anzeigen gleich mit Klebeband zu.«
»Ich hasse das«, sagte Dan. »Ich will gar nicht Pilot spielen. Dazu bist doch du da, und wie wäre es, wenn du mich jetzt mal über den Martinswald fliegen würdest. Ich mein es ernst. Unterrichtsstunde vorbei.«
»In Ordnung.«
Eine Weile sagten sie nichts. Dan betrachtete die verschneiten Felder, die glänzenden Bachläufe, die Autos auf dem glatten Asphalt.
»Hast du schon mal daran gedacht, unserem methodistischen Gebetskreis beizutreten?«, fragte Paul.
»Nein«, sagte Dan.
Sie flogen noch eine Stunde lang herum. Als Paul in Stone City zur Landung ansetzte, war er mit dem Winkel der Tragflächen nicht ganz glücklich, deshalb zog er noch einmal hoch und drehte eine weitere Runde. Sie flogen direkt der Sonne entgegen, und Dan bedeckte die Augen mit der Hand. Paul gefiel der Winkel auch beim zweiten Versuch nicht so besonders, aber er setzte holpernd auf der Landebahn auf. Dan knallte mit dem Ohr gegen die Tür des Flugzeugs.
Dan traf sich gegen Ende des Tages mit Louise im Fotostudio Kleeborg. Sie fuhren mit dem Streifenwagen zu einem Tuxedo-Laden am alten Highway 18. Auf dem Parkplatz stand ein einziges grünes Auto.
»Sieht aus, als wäre da zu«, sagte Dan.
»Nein, heute ist Donnerstag, und donnerstags haben die Läden alle bis neun Uhr auf«, erwiderte Louise. »Ist das jetzt eigentlich ein Date?«
»Ist was ein Date?«
»Das hier.«
»Ich weiß nicht. Mehr oder weniger.«
Dan stieg aus, und Louise trat zu ihm auf den Gehsteig, wo sie stehenblieben und sich die langen Reihen der glänzenden Jacketts ansahen. »Du wirst mir doch nicht einreden wollen, dass dieser Laden nicht geschlossen hat«, sagte Dan.
Aber als er gegen die Tür drückte, ging sie auf. Ein kleiner Mann in Jeans, mit einem gewaltigen Brustkasten, spitz zulaufenden Koteletten und winzigen Cowboystiefeln stand da und schaute auf einen Leibgurt. »Die Verkäuferin ist fort. Vor einer Weile war eine Dame hier, aber jetzt ist sie fort.«
»Sind das Schlaghosen?«, fragte Louise und zeigte auf die Aufschläge seiner Jeans.
»Das sind Bootcuts«, sagte er, und schon war er zur Tür draußen.
Louise sah ihm nach, wie er in dem grünen Auto davonfuhr. »Bootcuts, so ein Quatsch.«
Dan guckte in einen kleinen Raum am hinteren Ende des Ladens. »Hallo?« Auf einer grünen Couch aus Vinyl lag eine Frau mit geschlossenen Augen.
»Ist sie tot?«, fragte Louise.
Dan schüttelte den Kopf. »Ihre Brust bewegt sich. Ich glaube, sie schläft.«
»Ja, und was machen wir jetzt?«, fragte Louise.
»Also, eine schwarze Jacke habe ich«, sagte Dan, »Und schwarze Hosen auch. Das einzige, was ich ziemlich dringend brauche, ist eine Fliege.« Er nahm eine schmale, rot karierte Schleife, hielt sie sich unters Kinn und räusperte sich.
»Moment.« Louise brachte ein weißes, in Cellophan verpacktes Hemd und drückte es ihm gegen die Brust. »Ich glaube nicht, dass du Schottenkaro tragen musst, außer es ist wirklich der Tartan deines Clans.«
»Vergiss nicht, das ist nur halb offiziell.«
»Das stand im National Geographic. Da hatten sie eine ganze Ausgabe über Schottland.«
»Ich habe schlicht vergessen, was für einen Tartan mein Clan gewählt hat.«
»Nimm das Hemd doch auch.« Louise ging weiter und probierte ein taubenblaues Jackett mit geschwungenem Revers an. Ihre Fingerspitzen sahen gerade noch aus den Ärmelaufschlägen heraus, während sie sich vor einem dreiflügeligen Spiegel drehte. »Schau dir mal dieses Ätzteil an.«
Dan steckte die Fliege ein und kam auf sie zu. Louise schaute in die Spiegelscheiben, das Haar in den Kragen des Jacketts gesteckt. Dan zog Louises Haar heraus und legte es ihr wie ein Tuch auf die Schultern. Im Spiegel sah er eine ganze Reihe von Louisen. Sie schmiegte den Nacken in seine Hände. Ihre Augen gingen zu und wieder auf – pling.
»Du hast dich am Ohr verletzt«, sagte sie. Sie küssten sich.
Beim Tanzabend Das Ende des Vandalismus, der in der Turnhalle von Grafton stattfand, postierte sich Dan am Buffet, um achtzugeben, dass kein Alkohol in die Getränke gegossen wurde. Er unterhielt sich mit Mrs. Thorsen, der Lehrerin für Naturwissenschaften, einer kleinen Frau mit seltsam hoher Taille. Eine Band namens Brian Davis und der Schlackenhaufen spielte eigene Lieder sowie Cover-Versionen, die sie dem Thema des Abends entsprechend verändert hatte. Gelegentlich ging Dan nach draußen, um die betrunkenen Jugendlichen zu verscheuchen, die unter der Straßenlaterne in ihren Autos herumhingen.
Bis auf die Bühnenbeleuchtung war es in der Turnhalle dunkel, und die Musik schepperte durch den Raum wie lauter Blechplatten. Wenn schnell getanzt wurde, fühlte sich Dan an den Pony-Tanz von Chubbie Checker erinnert, und bei langsamen Tänzen musste er an Menschen denken, die sich durch bittere Kälte schleppen. Mitten auf der Tanzfläche hatte die Betriebswirtschaftsklasse ein mysteriöses Gebilde aufgebaut. Eine Reihe von langen, spitzen Holzlatten mit einem dazwischen eingebauten Doppelfenster und einem blinkenden gelben Alarmlicht an der Seite.
»Das ist eine Art Installation aus unterschiedlichen Sachen, die dem Vandalismus oft zum Opfer fallen.« Mrs. Thorsen trug ein gelbes Kleid und hatte die Augen mit Mascara stark betont. »Also Zaun, Fensterscheibe und Baulampe. Eigentlich wollten sie noch eine zweite machen und bei der dann die Scheibe einschlagen und den Zaun besprühen, um das Vorher-Nachher zu zeigen. Ich weiß nicht, warum sie’s dann doch nicht gemacht haben, das wäre wahrscheinlich besser gewesen.«
»Wahrscheinlich«, sagte Dan.
»Aber ich will da gar nichts zu sagen«, sagte Mrs. Thorsen, »denn die Betriebswirtschaftsklasse macht immer so einen totalen Scheiß. Ein Tanzabend ist wie der andere. Sie hätten deren Stairway to Heaven mal sehen sollen.«
Nach der Pause kam Brian Davis mit dem Schlackenhaufen wieder zurück und spielte »Rikki Don’t Throw That Lumber«. Mrs. Thorsen begann Dan von den Chinchillas zu erzählen, die sie zusammen mit ihrem Ehemann züchtete. Sie musste dabei fast schreien. Irgendetwas klappte nicht mit den Chinchillas, Dan verstand aber nicht genau, was. Etwa zu diesem Zeitpunkt tauchte Tiny mit einer blauen Brechstange in der Turnhalle auf. Später sagten alle, es sei wie in einem Musikvideo gewesen, weil die Tänzer sich wie in Hypnose teilten und die Band dazu »China Grove« spielte. Dan stand gerade mit dem Rücken zum Geschehen, aber Mrs. Thorsen in ihrem gelben Kleid sah, wie Tiny an dem Buffettisch vorüberging. Er schlenderte auf die Installation gegen den Vandalismus zu und schlug mit der Brechstange die Fensterscheibe ein, wobei die Glassplitter bis zur Bühne flogen. Er ließ die gelbe Lampe zersplittern und zertrümmerte die Zaunlatten. Dann war Dan bei ihm und versuchte, ihn festzuhalten. Die Band sang »Whoa, whoa, China Grove«. Tiny straffte die Schultern und riss sich aus Dans Griff los. Irgendwie wurde Dan von der Brechstange an der Schläfe erwischt. Das war aber vermutlich keine Absicht gewesen, dieser kleine Schlag an die Schläfe. Dan fiel rückwärts gegen den Zaun, und Tiny rannte hinaus.
Bis das Glas und das übriges Durcheinander aufgekehrt waren und Dan Mrs. Thorsen überredet hatte, mit dem Tanzabend weiterzumachen, war Tiny über alle Berge, und die betrunkenen Jugendlichen hatten ihre Autos aus strategischen Gründen bei der Glitzerkugel auf der anderen Straßenseite abgestellt. Dan zog sein Jackett an und stieg vorsichtig in den Streifenwagen. Er wusste, dass er am Kopf verletzt war, hielt das aber für nicht weiter schlimm. Er wollte eine Funkmeldung zum Geschehen durchgeben, doch als er am Knopf drehte, um die Frequenz einzustellen, ging auf der Anzeige das Lämpchen aus.
Er fuhr auf der Schotterstraße nach Osten zu Louises Haus und fand sie am Küchentisch sitzend, vor sich ordentlich aufgereiht die Einzelteile einer zerlegten Kamera.
»Ich muss übersinnliche Kräfte besitzen«, sagte sie. »Gerade habe ich eine Sendung über die Polizei gesehen, und schon bist du hier in meiner Küche.«
»Ist Tiny hier gewesen?«
»Vor ein paar Tagen. Das war ganz komisch, was er da wollte. Er wollte so ein altes Glas, das er einmal im Sands Hotel in Las Vegas mitgehen lassen hat. ›Wo ist mein kleines Sands-Glas?‹, hat er gefragt. ›Wo ist mein kleines Sands-Glas?‹ Ich hatte keine Ahnung, was er meinte. Ich also: ›Was für ein Glas, Tiny? Ein Glas mit Sand drin?‹ Aber er musste unbedingt dieses Glas haben.«
»Wofür wollte er es denn?«
Sie zuckte mit den Schultern und betrachtete einen Schraubenzieher mit rotem Griff in ihrer Hand. »Wahrscheinlich, um daraus zu trinken. Er wollte auch noch ein paar andere Gläser. Ich denke, sein Bruder Jerry hat nicht viel Zeug für die Küche.«
»Bei dir alles in Ordnung?«
Louise nickte. »Bis auf diese Kamera.«
Dan blickte auf die Kamerateile auf dem karierten Tischtuch: Federn und Spiegel und Stifte.
»Gib mir deine Hand«, sagte er. Das tat sie. Ihre Finger waren kräftig und warm. »Danke.« Sie hielten über den Tisch hinweg Händchen.
»Bitte«, erwiderte Louise.
Dan rief von Louises Telefon aus Deputy Ed Aiken an und machte mit ihm aus, sich am Haus von Tinys Bruder in Pringmar zu treffen. Jerry Tate wohnte in einem grauen Bungalow auf einem Grundstück, das von der Straße aus abfiel. Dichtes Gebüsch umgab das Haus, und in den Fenstern brannte immer noch die Weihnachtsbeleuchtung. Jerry Tate bat sie herein und ließ sie Platz nehmen, sagte aber, er könne keinen Kaffee machen, weil er sich nach neun Uhr abends nicht mehr bewegen solle.
»Ich hatte einen Zusammenstoß mit einem Schneemobil«, sagte Jerry. »Sieben kleine Wirbel sind lädiert. Vielleicht werd ich nie mehr hundertprozentig gesund. Aber der Arzt sagt, dass das meine Pläne wahrscheinlich nicht zunichte machen würde.«
»Was für Pläne denn?«, fragte Dan.
»Das ist nur so eine Redensart«, sagte Jerry.
Also machte Ed Aiken den Kaffee. Sie tranken ihn, und nach einiger Zeit sagte Jerry, dass es ihn ja nichts angehe, aber er könne sich vorstellen, dass Tiny gar nicht erst hereinkomme, wenn er die Streifenwagen vor dem Haus stehen sehe. Dan und Ed gingen hinaus, um ihre Autos ein Stück weiter weg zu fahren und dabei auch die Lage zu besprechen, und als sie zurückkamen, hatte Jerry die Tür zugesperrt und das Licht gelöscht.
Zwei
Louise ließ sich im Frühjahr von Tiny scheiden und stellte fest, dass ihr das Fernsehen gar keinen richtigen Spaß mehr machte. Sie konnte bei keiner Sendung bleiben, sondern musste ständig umschalten. Wenn sie die Quizsendung Jeopardy sah, begann sie, sobald sie eine Antwort nicht wusste, blindlings zu raten – »Fidschi? Was sind die Fidschi-Inseln?« – und wechselte lieber zu einem dieser unsinnigen Krimis, bei dem sie aber auch nicht lange blieb.
Eines Sonntagnachmittags sah sie sich eine Weile ein Basketballspiel an, dann Angeln mit André und Wie Stahl gemacht wird, dann fuhr sie die etwa fünf Meilen bis nach Grafton, um ihre Mutter zu besuchen. Auf dem Beifahrersitz stand eine Tasche mit Lebensmitteln, die Straße war weithin leer, und im Radio kamen drei Songs von Evelyn »Champagner« King hintereinander.
Mary Montrose wohnte im Westen der Stadt in einem grünen Haus mit weißen Fensterläden und einem L-förmigen Grundriss. Louise fuhr die Einfahrt hinauf und sah einen orangefarbenen Plastikeimer neben dem Stamm der Weide stehen. Sie ging auf das Haus zu und sang dabei »Get loose, get funky tonight«.
Louise trat durch die Vordertür und durchquerte die Diele, und gerade, als sie ins Wohnzimmer kam, wurde der ganze Raum in grünes Licht getaucht, weil die Sonne durch die grünen Vorhänge brach. Louise nahm die Einkaufstasche von der einen Hand in die andere. »Ich mach dir überbackene Spaghetti«, rief sie.
Mary Montrose lag mit einem Buch auf der Couch. Sie legte ein Lesezeichen ein und setzte sich auf, eine große Frau mit silbergrauem Haar, das von einem Netzwerk aus Spangen zusammengehalten wurde. »Ich hab mir doch gedacht, dass ich jemanden in der Einfahrt gehört habe.«
»Was liest du da?«, fragte Louise.
»Ach, nur so einen Krimi«, sagte Mary. »Hab ich mir aus dem Buchmobil geholt. Ich weiß noch nicht, ob er mir gefällt. Es wird schrecklich viel gemordet. Gerade sind ein paar Leute bei einem Picknick umgebracht worden.«
»Das ist doch Quatsch.« Louise schaffte die Lebensmittel in die Küche und räumte sie weg. Im Kühlschrank war Wodka, und sie machte sich einen Preiselbeersaft mit Wodka und kehrte ins Wohnzimmer zurück.
»Sieht gut aus, dein Drink.«
»Nennt sich ›Twister‹. – Möchtest du auch einen?«
»Weißt du, was ich gern hätte?«, sagte Mary. »Ein Kleid in diesem Farbton.«
Louise nippte an ihrem Glas. »Und weißt du, was ich gern hätte? Dass ich Rocksängerin wäre. Mein voller Ernst. Das würde ich gerne sein.«
»Du singst ja auch ganz gut.«
»Vielleicht sollte ich auf Tournee gehen. Sag mal, was macht denn dieser Eimer da draußen im Garten?«
»Wo soll denn da ein Eimer sein?« Mary stand auf und ging zum Fenster. »Also wirklich!«, sagte sie. Dann warf sie einen prüfenden Blick auf den Thermostat und kehrte auf die Couch zurück.
Louise setzte sich ihrer Mutter gegenüber in einen Sessel. Er hatte eine verstellbare Rückenlehne, also verstellte Louise die Rückenlehne. Sie zupfte an den dunklen, gezackten Blättern herum, die neben der Armlehne des Sessels rankten. »Meinst du nicht, du solltest den mal zurückschneiden?«, fragte sie. »Schau nur, was er mit der Armlehne von diesem Sessel macht. Und beim Sofa genauso, schau nur. Ich sag ja nicht, dass du ihn wegwerfen sollst. Ich finde nur, dass du ein bisschen was abschneiden solltest. Schau dir das an. Die Armlehne von dem Sessel verwandelt sich praktisch in Erde.«
Mary schaute traurig auf den prachtvollen Efeu, der sich vom Kaffeetisch aus durch den ganzen Raum rankte. »Das bring ich nicht übers Herz.«
»O Gott«, sagte Louise. »Das schaffst du schon, Mom. Das schaffst du schon. Möchtest du jetzt überbackene Spaghetti, oder was?«
»Also, bevor die in dem Buch alle ermordet wurden, haben sie bei ihrem Picknick gerade Hamburger gegrillt, und ich hab richtig Appetit auf Hamburger gekriegt. Könnten wir nicht zum See fahren und uns im Leuchtturm Hamburger holen?«
»Ich könnte Hackfleisch in die Spaghetti tun«, schlug Louise vor.
»Ich komm hier nie raus«, sagte Mary. »Wenn wir kurz mal zum See fahren, davon geht die Welt doch nicht unter. Dein Problem ist, dass du da draußen auf dieser Farm sitzt, da bist du von aller Welt abgeschnitten. Doch doch, du kapselst dich ab.«
»Ich kapsele mich überhaupt nicht ab.«
»Ich wüsste nicht, wie man das sonst nennen sollte.«
»Da gibt es gar nichts zu nennen«, sagte Louise.
»Außerdem«, sagte Mary, »glaubst du nicht, dass Jean Klar früher oder später mal heiratet und dann vielleicht wieder in diesem Haus wohnen will? Du bist nur Mieterin, meine Liebe. Du wohnst nur zur Miete.«
»Ich weiß, dass ich zur Miete wohne. Ich bin mir dessen vollkommen bewusst.«
»Das Haus von Jimmy Coates ist zu verkaufen. Die verlangen Achttausendfünfhundert, aber ich wette, dass man sie auf Sechstausend herunterhandeln könnte.«
»Das Problem bei dem Haus von Jimmy Coates ist, dass es nach Jimmy Coates riechen würde. Und ich hab auch keine sechstausend Dollar.«
Mary seufzte. Sie ging in die Diele und brachte einen hell lackierten Gehstock herein. Louise stellte ihren Stuhl aufrecht und trank den Twister aus. »Wo hast du den denn her?«
Mary reichte Louise den Stock; auf dem Griff war ein Schlangenkopf eingebrannt. »Von Hans Cook.« Sie schlüpfte in eine kastanienrote Jacke und zog den Reißverschluss bis zum Kinn zu. »Er war mit seinem Lastwagen auf dem Rückweg von Ohio, und da hat er einen Zwischenstopp gemacht und irgendwelche Höhlen besichtigt. Die hatten dort ein Museum und so kleine Hütten, in denen man Szenen aus dem Leben der Indianer sehen konnte.«
Louise sah sich den Stock genauer an. »Was willst du denn mit einem Stock? Sobald das Telefon klingelt, saust du doch wie ein Wiesel durchs Zimmer.«
»Das Telefon klingelt ja nie.«
In Wirklichkeit klingelte das Telefon bei Mary recht häufig. Sie hatte im Stadtrat von Grafton den sogenannten Witwensitz inne. Der war natürlich nicht ausschließlich für Witwen bestimmt. Doch Marys Vorgängerin im Stadtrat war Dorothy Frails gewesen, deren Mann durch einen elektrischen Schlag ums Leben gekommen war, als er ein Kabel auf der Veranda verlegen wollte – eine seiner Meinung nach ganz simple Aufgabe. Und vor Dorothy Frails hatte ebenfalls eine Witwe dieses Amt innegehabt, obwohl sich nicht mehr viele Einwohner erinnern konnten, wer das war und woran ihr Mann gestorben war. (Es war Susan Jewell, deren Gatte Howard am 4. Oktober 1962 auf dem Dachboden inmitten der Krüge seiner Krugsammlung einen Mittagsschlaf gehalten hatte und nicht mehr aufgewacht war.) Mary war jetzt schon seit neun Jahren im Stadtrat. Sie befasste sich vor allem mit Angelegenheiten, die Hunde betrafen, und hatte einmal bei einer Tagung in Moline einen Diavortrag über die Entwicklung der Hundeschnauze gehalten.
Louise und ihre Mutter traten nach draußen. Mary ging zielstrebig auf die Weide zu, spießte den orangefarbenen Eimer mit ihrem Gehstock auf und warf ihn über die Hecke in den Garten von Heinz und Ranae Miller.
»Ich dachte, das ist dein Eimer«, sagte Louise.
»Nein, ich glaube, der gehört Heinz«, sagte Mary.
Sie fuhren auf der Route 33 nach Walleye Lake. Louises Vega machte einen Höllenlärm. Am Auspuff hing ein Stück Blech lose. Louise wusste das, denn sie hatte sich hingekniet und nachgeschaut, aber davon wurde die Sache auch nicht besser. Bis zum Sommer war es noch mehr als einen Monat hin, und der Himmel zeigte eine ängstliche Blässe. Mary stemmte während der ganzen Fahrt die eine Hand gegen das Armaturenbrett und klammerte sich mit der anderen am Sitz fest. Louise drückte eine Zigarette im Aschenbecher aus.
»Wie geht es Hans Cook denn?«, fragte sie.
»Ach, Hans Cook geht es ganz gut«, antwortete ihre Mutter. »Aber ich sag dir was, wir waren zusammen in Stone City im Kino, na, so vor zwei oder drei Wochen, und wie er da gelacht hat, also das war mir wirklich peinlich. Der Film galt als ganz witzig. Das weiß ich. Aber irgendwie muss man sich wieder einkriegen.«
»Was war es denn für ein Film?«
»Ach, einer mit Carol Burnett. Annie. Ich wäre am liebsten auf allen Vieren den Gang hinuntergekrochen und hätte mich verdrückt. Andererseits, ich weiß ja, dass er Drogen nimmt.«
»Ach wirklich?«
»Also, er nimmt LSD.«
Louise sah sie ungläubig an. »Hans Cook nimmt LSD? Der dicke große Hans?«
Mary zeigte auf die Windschutzscheibe. »Schon gut. Schau auf die Straße.«
»Mach ich doch. Ist das dein Ernst mit Hans Cook?«
»Er hat Probleme mit seinem Hals. Er fährt ja ständig in der Gegend herum, und er sagt, dass ihm der Kopf irgendwie auf den Hals drückt. Irgendwas stimmt bei ihm nicht. Er hat einen Wirbel zu viel. Oder was weiß ich, irgendwas hat er zu viel. Sagt er jedenfalls. Er behauptet, dass das LSD gut für seinen Hals ist.«
»Und was nimmt er dann bei Kopfweh, Crack?«
Mary nahm die Brille ab und säuberte sie mit einem Papiertuch. Die Brille hatte quadratische Gläser und dramatisch geschwungene Bügel, und ohne sie sahen Marys Augen klein und müde aus. »Nein, ich glaube nicht, dass er Crack nimmt.«
»Vielleicht tut er dir immer was in die Bowle«, sagte Louise, und Mary antwortete nicht, deshalb fuhr Louise fort: »Mein Gott, du nimmst das Zeug doch nicht auch, oder?«
Mary blickte auf ein Windrad, das am Fenster vorbeizog. »Ich habe keinen Zweifel, dass Hans mir welches geben würde. Aber ich würde es nicht nehmen, und das weiß Hans auch. Diese Droge ist aus Papier. Das wäre, als würde man einen Kassenzettel kauen.«
Sie fuhren in die Stadt Walleye Lake ein. Auf der Gegenfahrbahn wollte eine Frau in einem Kombi gerade abbiegen, trat aber auf die Bremse, als Louise hupte.
»So ist es gut, Herzchen«, sagte Louise. »Ich fahre nämlich geradeaus.«
Der Leuchtturm lag gegenüber dem Café Mondblick in der Stadt. Es war ein Drive-In-Restaurant, das um einen Turm in ausgebleichtem Orange gebaut war. Eine grüne Neonröhre drehte sich auf dem Turm, und es brannte Licht, obwohl die Dunkelheit noch nicht hereingebrochen war. In der Hochsaison gingen Kellnerinnen in weißen Matrosenmützen zwischen den Autos herum, aber jetzt im Frühling mussten sich die Kunden an der Theke unter dem Turm anstellen, und an diesem Abend war die Schlange lang. Direkt vor Louise und Mary standen ein Vater und seine kleine Tochter, die ein Plüschpferd im Arm trug. Das Mädchen hatte hellblaue Augen und lange braune Haare. Mary begrüßte es und fragte, wie das Pferd heiße.
»Nicht anfassen«, sagte das Mädchen. »Das geht hammermäßig ab.«
»Hammermäßig – na so ein wildes Pferd!«, erwiderte Mary. »Ich hatte früher auch ein Pferd, das hieß Velvet. Doch doch, so eine riesige alte Dame wie ich. Ich durfte als Einzige von allen Mädchen aus allen Reitvereinen mit meiner Stute Velvet an der Eröffnungsfeier bei der großen Jahresschau in Iowa teilnehmen. Ich hatte weiße Lederhandschuhe an, die ganz weit die Arme rauf gingen, und was glaubst du, wer auf dem Pferd neben mir saß? Kein anderer als Tim Thompson. Er war der beste Tonnenrennreiter des Landes, und er kam aus Kalifornien.«
Der Vater hatte sich herumgedreht, um zuzuhören. Er trug eine Strickjacke mit einem aufgestickten Kegel und hatte dieselben gespenstischen Augen wie seine Tochter. Beide erinnerten sie Louise an die friedlichen, verlorenen Aliens aus dem Weltall, die man in Serien wie Outer Limits zu sehen bekam. Die Kleine knabberte am Hals des Plüschpferds, dann hob sie den Kopf. »Was ist ein Tonnenrennreiter?«
»Das ist einer, der bei einem Rennen um Tonnen herum reitet, wie früher im Wilden Westen«, sagte Mary, die sich nachdenklich auf ihren Stock stützte. »Jedenfalls, dieser Tim Thompson …«
»Warum sind sie um die Tonnen herum geritten?«, fragte das Mädchen.
»Also, Schätzchen, ich nehme an, weil die Tonnen ihnen im Weg waren«, sagte Mary. »Aber auf die Tonnen kommt es jetzt überhaupt nicht an. Die spielen in dieser Geschichte eigentlich gar keine Rolle. Jedenfalls kannte jeder Tim Thompson. Wir reiten also mitten über den Festplatz und dann auf die Rennbahn, und als wir zur Haupttribüne kommen, dreht sich Tim Thompson zu mir um und sagt: ›Mary, du reitest besser als die Frauen in Kalifornien. Du reitest viel besser.‹ Weißt du, meine Art zu reiten hat ihm einfach gefallen, und er hat gesagt, er schenkt mir was. Aber dann ging das Programm los, und es gab ein Rodeo, bei dem er mitmachen musste, und er vergaß das mit dem Geschenk. Also, ich hab es nicht vergessen, aber ich war auf der Heimfahrt sowieso im siebten Himmel. Ich hab ja sonst nie etwas anderes gemacht als Bohnen jäten. Und viel später brachte so ein junger Kerl vom Paketdienst ein Päckchen auf unsere Farm. Dieser Junge hat bei Supersweet in Grafton gearbeitet, und er hieß Leon Felly, und sein Gesicht war über und über voll mit Sommersprossen. Er hat mir eine Pappschachtel überreicht, und wie ich sie aufmache, ist drin ein Efeu von Tim Thompson.«
»Hast du das gehört?«, sagte der Vater. »Die Dame hat ihr Geschenk doch noch gekriegt.« Er rieb sich geistesabwesend die Stirn, und bald darauf drehten er und seine Tochter sich wieder von Mary weg.
»Sie hat eine Krücke«, sagte das Mädchen.
Louise warf einen Seitenblick auf Mary. »Dieser Efeu ist doch von deiner Mutter.«
Mary runzelte die Stirn. »Welcher Efeu? Du bildest dir immer gleich ein, dass du weißt, wovon ich spreche. Es gibt sehr viel Efeu auf der Welt, Louise. Den von Tim Thompson hast du überhaupt nie gesehen. Er ist gleich in dem ersten Winter eingegangen – in dem Winter nach dem Herbst, in dem ich bei der Jahresschau mitreiten durfte. Das war einer der schlimmsten Winter, die wir je hatten, damals kam ein gewaltiger Frost, der sämtliche Malven und sämtliche Efeupflanzen dahinraffte, einschließlich dem Efeu, den mir Tim Thompson geschenkt hatte.«
»Der hat dir doch niemals einen Efeu geschenkt.«
Mary lachte bitter. »In dem Jahr konnten wir direkt aus dem Fenster steigen, weil der Schnee so hoch lag.«
»Ihr seid doch niemals aus dem Fenster gestiegen.«
In der Zwischenzeit war vorn ein Tumult entstanden. Der Vater nahm seine Tochter auf den Arm, und Mary und Louise traten ein Stück aus der Schlange, um besser zu sehen. Ein Kunde, der eine rote Lederjacke mit der in weißen Stoffbuchstaben aufgenähten Aufschrift »Kampfsportschule Geoff Lollard« trug, schrie gerade den Mann hinter der Theke an. Dieser Kunde, ein großer Kerl mit kurz geschorenen Haaren, schlug immer wieder mit der Faust auf den Tresen. Dem Mann hinter der Theke, der jung und dicklich war und eine grüne Schürze trug, war das Gesicht zu einem ängstlichen Lächeln erstarrt.
»Du steckst echt in der Scheiße, du grinsender Hurensohn«, schrie der Kunde. »Ich weiß, wo du wohnst! Ich weiß, wann hier geschlossen wird! Ich weiß auch, wo du arbeitest! Du arbeitest nämlich hier! Hör auf zu grinsen, verdammt noch mal! Ich stech dich ab. Ich schwör’s, das mach ich.«
»Mann, Pete«, sagte der Angestellte. Er hatte eine hohl klingende, traurige, singende Stimme, die den Mann in der roten Kampfsportjacke rasend zu machen schien. »Also wirklich, Pete, beruhige dich doch.«
Pete verfluchte den Angestellten weiter. Er packte einen glänzenden Serviettenspender und verfolgte damit den Angestellten den ganzen Tresen entlang.
»Das ist doch nicht dein Ernst, Pete«, rief der Angestellte, und Pete schleuderte den Serviettenspender mit einer wilden Bewegung auf ihn. Der Angestellte duckte sich, und der Serviettenspender riss einen Frittierkorb von seinem Aufhänger an der Wand hinter der Theke.
Der Angestellte erhob sich wieder. »So, super, Pete, den hast du jetzt kaputtgemacht«, sagte er. »Ich hoffe, du bist zufrieden, der ist kaputt.«
Aber Pete war schon von der Theke verschwunden und stürmte gerade die Kundenschlange entlang, warf dabei den Kopf zurück und verfluchte Gott und die Welt. Augen, Nase und Mund lagen bei ihm ganz niedlich in die Mitte seines großen Gesichts eingebettet, und über dem einen Auge klebte ein Pflaster. Als er an Louise und Mary vorbeirannte, geriet er zu nahe heran und stieß mit dem Stiefel gegen das untere Ende von Marys Gehstock. Der Stock wurde Mary aus der Hand geschlagen und während sie einen Schritt nach hinten machte und gegen den blauäugigen Vater und seine Tochter prallte, schienen Pete und der Stock einen kurzen Kampf auszutragen, worauf sie beide auf den Asphalt stürzten. Offensichtlich hatte Pete sich die Handflächen aufgeschürft, und die Leute in der Schlange sogen die Luft ein und griffen reflexhaft an die eigenen Hände. Pete kämpfte sich auf die Füße und rannte davon, als wäre der Stock hinter ihm her. Er erreichte einen orangefarbenen VW-Bus, der unter der Werbung für ein Pflanzenschutzmittel geparkt war, stieg ein und fuhr davon.
»Geht’s?«, fragte der Mann mit den blauen Augen. Seine Stimme klang gequetscht, weil seine Tochter ihm die Arme so fest um den Hals gelegt hatte. »Wahrscheinlich hat der versucht, Süßigkeiten zu klauen. Ich glaube, er hat eine Tüte Bonbons eingesteckt.«
»Er und der andere Typ müssen sich kennen«, sagte Louise.
»Ganz bestimmt!«, sagte der Mann. »Ich bin sicher, die kennen sich schon ewig. Ich vermute, dieser Typ, dieser Pete, hat gedacht, der andere stellt sich blind, wenn er mit den Bonbons abhaut.«
Mary nahm ihre Spangen aus dem Haar, kämmte sich und steckte sie wieder fest. »Sie glauben also, dass dieser Typ in Rot«, sagte sie und wies dabei in Richtung Herbizidwerbung, »den Koch schon vorher kannte?«
Louise nahm ihr Zigarettenetui, klappte es auf und beugte sich vor, um eine Zigarette anzuzünden. »Das hat er doch gerade gesagt, Ma«, sagte sie.
»Oh ja!«, sagte der Mann. »Keine Frage, dass die sich kennen. Lass jetzt mal los, meine Kleine. Du erwürgst deinen Vater ja. Ich würde auf alle Fälle die Polizei rufen, wenn ich der Typ wäre. Ich versteh nicht, warum er die nicht auf der Stelle ruft. Also ich würde das machen. Da können Sie Gift drauf nehmen, dass ich das machen würde.«
»Aber wissen Sie«, sagte Mary, »der Typ ist mit den Süßigkeiten doch sowieso schon verschwunden.«
Der Mann nickte. »Ja, Pete ist weg.«
»Moment mal«, sagte Mary. »Pete, oder der in der roten Jacke?«
»Pete ist doch der in der roten Jacke«, sagte der Mann.
»Ja, Pete ist in den Lieferwagen gestiegen«, sagte Louise.
Der Mann nickte. »Richtig«, sagte er. »Pete ist in den VW-Bus gestiegen.«
»Hör doch auf mit diesem Pete!«, sagte die Kleine. Sie legte die Hand an ihre Stirn. »Mir ist schlecht.«
»Das kann gar nicht sein«, sagte der Vater.
»Kleb mir ein Pflaster über das Auge«, sagte das Mädchen.
Louise und Mary bestellten California Hamburger und Pommes und zwei Krüge Root-Bier. Louise gab dem Mann an der Theke eine Zigarette und streckte die Hand über den Tresen, um sie ihm anzuzünden. Seine Finger zitterten, während er Louises Feuerzeug abschirmte. Dann stellte er zwei rot-weiß gemusterte Pappschachteln für die Pommes hin. Louise und Mary aßen im Auto, brachten die schweren Glaskrüge wieder zur Theke und fuhren zu Marys Haus zurück. Sie sahen sich einen Fernsehfilm an, bei dem es um einen Mord ging. Louise bemerkte eine gewaltige Unstimmigkeit in der Handlung, und Mary trank ein Glas Milch und setzte sich auf die Couch. Während der Werbung blickte Louise nach der Uhr an der Wand und wandte sich dann Mary zu.
»Findest du wirklich, dass ich mich dermaßen abkapsele?«, fragte sie.
Mary sah sie völlig ausdruckslos an, als wäre sie plötzlich im tiefsten Innern von etwas berührt worden. Sie ging in die Diele und sprach aus der Dunkelheit zu Louise.
»Ich bin ohne meinen Gehstock nach Hause gekommen«, sagte sie.
Am nächsten Tag half Louise dem Porträtfotografen Kleeborg, die Absolventen der Highschool zu fotografieren. Sie trug Make-up auf, drehte und justierte Lampen, legte Filmkassetten in Kleeborgs alte Hände. Der Tag verlief ganz normal, bis ein Mädchen an die Reihe kam, das von Anfang an einen merkwürdigen Eindruck machte. Sie hatte kurze, glatte blonde Haare, aber ihre Augen waren gerötet und ihre Kleidung war zerdrückt. Ihr Foto sollte vor der Kulisse für »Draußen« gemacht werden. Die befand sich in einer Ecke des Studios und bestand aus einem Stück Zaun mit etwas Blattwerk aus Plastik und einem grünen Hintergrund. Doch während Louise versuchte, der Schülerin ein paar Augentropfen zu verabreichen, sank diese mit dem Rücken gegen den Zaun in sich zusammen und stöhnte.
»Ich möchte nicht weg von hier auf die Uni«, sagte sie. Etwas von den Augentropfen lief ihr aus dem Augenwinkel die Wange hinunter. »Ich möchte nicht weg von hier auf die Uni. Und ich hab so einen Kater. Ich rühre in meinem ganzen Leben nie wieder ein Glas Wein an.«
»Warum sitzt sie denn auf dem Fußboden?« Kleeborg kam unter dem schwarzen Tuch hervor und blieb neben der Kamera stehen. »Du hast noch das ganze Leben vor dir!« Er hatte diesen Ausdruck schon die ganze Woche über benutzt, aber jetzt klang es wie eine Drohung. Louise half dem Mädchen auf die Beine, brachte sie zur Toilette und holte ihr ein Alka-Seltzer. Das Mädchen hieß Maren Staley, und es stellte sich heraus, dass sie an der Universität von Oregon angenommen worden war, aber nicht hingehen und ihren Freund Loren hier zurücklassen wollte. Ihre Mutter jedoch, die Loren inbrünstig hasste, hatte sich nun einmal Oregon in den Kopf gesetzt und war so weit gegangen, dass sie begeisterte Briefe an die Uni verfasst und mit Marens Namen unterschrieben hatte.
Maren legte den Kopf in den Nacken und trank das Wasser mit dem Alka-Seltzer. Sie stellte das Glas auf den Spülkasten der Toilette und sagte leicht keuchend: »Es ist ja nur, weil ich nicht von hier weg auf die Uni will.«
Louise legte ihr den Arm um die Schultern. »Vielleicht wird es ja gar nicht so schlimm.«
Sie gingen in den Flur hinaus. Hier stand ein Metallbett, das in einer Werbung für das Kaufhaus Brown benutzt worden war, und Maren streckte sich darauf aus. Dann stand sie wieder auf, ging zur Toilette und übergab sich. Als sie zurückkam, trocknete sie sich das Gesicht mit einem Handtuch ab und legte sich wieder hin. »Wie bin ich bloß auf die Idee gekommen, ich könnte trinken«, sagte sie. »Wie bin ich bloß jemals in meinem Leben auf die Idee gekommen, ich könnte trinken.« Louise kannte die Art von Kater, die das Mädchen jetzt hatte. Dabei verspürte man das Bedürfnis, immer alles mehrmals zu sagen. Bald schlief Maren ein, und erst ungefähr zweieinhalb Stunden später wachte sie wieder auf, ging nach draußen und radelte langsam davon.
Am Mittwochnachmittag fuhr Louise nach der Arbeit nach Walleye Lake, um den Gehstock ihrer Mutter abzuholen, den jemand vom Leuchtturm neben dem Fundsachenregal an die Theke gelehnt hatte. Louise fand den Stock hässlich, sie warf ihn hinten ins Auto und deckte ihn mit altem Zeitungspapier zu. Sie beschloss, unterwegs noch am See vorbeizuschauen. Die Straße zum See war schmal und führte an Bars, einem Friseurladen, einem kleinen Park und einem Versandhandel mit einer zerbrochenen Fensterscheibe vorbei. Ein paar alte Männer mit Anglermützen schauten auf, und einer winkte, als er Louises Auto hörte; Louise hatte den Eindruck, er sei zahnlos, obwohl sie es nicht so genau sehen konnte.
Sie parkte und ging zum öffentlichen Strand hinunter. Das Wasser war bewegt und grau, und Louise flatterte das Haar ums Gesicht. Sie ging direkt ans Wasser und machte sich die Hände nass. Das Seeufer war dünn besiedelt und ziemlich unberührt, und man hatte das Gefühl, es könnte jederzeit ein Team von Fernsehwissenschaftlern eintreffen und hier vielleicht blinde urzeitliche Fische finden. Der Sand war mit schwarzem Tang und winzigen grauen Kieseln bedeckt. Weiter oben am Ufer rief sie plötzlich jemand beim Namen und winkte ihr vom Rand der steinernen Picknickhütte aus zu. Es war Johnny White, der 1974 zusammen mit Louise an der Highschool in Grafton den Abschluss gemacht hatte.
Louise hatte ihn seither noch ein paar Mal gesehen. Einmal an einer Autowaschanlage, wo er gerade ein Wischtuch aus einem Münzautomaten zu zerren versuchte. Einmal hatte sie ihn in Grafton auf einer Bank sitzen sehen, einen großen schwarzen Afghanen neben sich. Sie und Johnny waren in der Highschool eine Weile zusammen gewesen. Sie erinnerte sich, wie sie hinten im Publikum gesessen hatte, als er in dem Abschlussstück der Klasse auftrat, einem Musical über einen Arbeiteraufstand in Kalifornien. Er hatte eine Ballade zu singen, die »Pfirsiche (Such mir ein Mädchen)« hieß. Er breitete seine kräftigen Arme weit aus. »Pfirsiche! Pfirsiche! Diese zwei Arme sind erschöpft von den ewigen Pfirsichen.« Louise hatte vor der Aufführung ein paar Gläser Wild Irish Rose getrunken, und ihr fiel jetzt ein, dass sie damals gedacht hatte, keinen anderen Menschen zu kennen, der den Höllenmut besessen hätte, sich einfach hinzustellen und dieses Lied zu singen. Johnny hatte eine etwas glatte Tenorstimme, die Louise völlig falsch vorkam, aber irgendwie schmälerte das seine Leistung nicht. Jetzt arbeitete Johnny in der Bezirksverwaltung, und er trug eine knielange Jeansjacke über einem grünen Hemd und gelblichbraunen Hosen. Auf der Highschool hatte sein Gesicht noch einen knabenhaften Reiz besessen, aber jetzt wirkte er recht massig, und auf dem Kopf trug er eine bauschige Ledermütze, wie manche Rockstars, wenn sie kahl werden. Aber seine Augen waren immer noch irgendwie hübsch.
Louise und Johnny setzten sich unter die hölzernen Dachsparren der Picknickhütte. Es stellte sich heraus, dass Johnny zurzeit in der ehemaligen Ersten Baptistischen Kirche in Pinville wohnte. (Pinville war eine sehr kleine Stadt an einer Nebenstraße zwischen Grafton und Morrisville.) Diese Kirche hatte Johnnys Vater, ein Farmer und abgebrühter Geschäftsmann, von dem es hieß, er sei »auf dem Papier reich«, schon vor Jahren den Baptisten abgekauft.
»Dad wollte daraus eigentlich einen Luxusnachtclub machen«, sagte Johnny. »Das würde auch jetzt noch gehen. Obwohl, wahrscheinlich eher nicht. Er hat gerade erst einem Typen in Sioux City einen ganzen Schuppen voller Einzelteile zu Brunnenbohrern abgekauft. Er dachte, die könnte er schnell wieder loswerden. Aber mit denen stimmt irgendwas nicht. Ich weiß nicht genau was. Kann sein, dass sie gepfändet sind.«
»Ach wirklich«, sagte Louise.
»Das ist genau wie damals, als ich nach Cleveland gegangen bin. Da waren Lisa und ich gerade ein Jahr lang verheiratet. Wir sind zur Miete in das Haus ihres Onkels in Cleveland gezogen und haben versucht, ein Restaurant hochzuziehen. Wir haben eine Esso-Tankstelle übernommen und daraus ein Restaurant gemacht. Aber bald gab es viel übles Gerede. Es hieß, dass unsere Hotdogs nach Benzin schmeckten.«
»Davon hab ich, glaub ich, mal was gehört. Hat es da nicht eine Explosion oder so etwas gegeben?«
»Nein, es hat überhaupt keine Explosion gegeben. Damals war doch dort überhaupt kein Benzin mehr vorhanden. Wir hatten die Tanks ja geleert, von der Bezirksverwaltung war jemand gekommen und hatte zugesehen, wie wir sie ausleerten. Aber dieses Gerücht mit dem Benzin hat uns ruiniert, denn die Hotdogs waren sozusagen das Standbein des Lokals, Hotdogs und Frankfurter.«
»Das tut mir leid für dich.«
»Wenn wir nicht Pleite gemacht hätten, dann wären Lisa und ich immer noch verheiratet, darauf würde ich wetten. Einmal hab ich aus Versehen die Hand auf den Grill gelegt, und sie hat nur zugesehen. Bei dem Licht hier siehst du die Narbe wahrscheinlich gar nicht. Moment. Schau, da. Irgendwie kommt es einem vor, als wäre die ganze Hand eine einzige Narbe. Ach, ich weiß auch nicht. Wir haben zwei Kinder, Megan und Stefan, und ich kann nur sagen, mir fehlen die Kinder sehr, verdammt noch mal.«
»Sind sie in Cleveland geblieben?«
»Na ja, in Parma. Aber das ist das Gleiche.«
Louise und Johnny unterhielten sich noch eine Weile, und dann ließ Louise ihn allein unter dem Dach der Picknickhütte sitzen und ging zu ihrem Auto. Als sie Walleye Lake verließ, schaltete sie das Radio ein. Johnny Cash sang gerade von einem Automechaniker, der sich selber ein Auto zusammenbaut, aus lauter Teilen, die er im Laufe der Jahre aus der Fabrik geschmuggelt hat.
Der Zigarettenanzünder sprang vor und Louise steckte sich eine Zigarette in den Mund. »Das Auto nehm ich«, sagte sie.
Der Stadtrat hielt seine Sitzungen in der Mensa der ehemaligen Schule von Grafton, einem Ziegelbau von 1916, der seit 1979, als die Schule von Grafton mit der von Morrisville-Wylie zusammengelegt worden war, weitgehend leer stand. Offiziell hieß der Einzugsbereich der Schule, der dadurch entstanden war, Morrisville-Wylie-Grafton, aber das war zu lang, und obwohl es Vorschläge gegeben hatte, die ersten Buchstaben aller drei Städte zu nehmen und das Gebiet Mo-Wy-Gra zu nennen, war das schlicht albern, deshalb hieß es jetzt Morrisville-Wylie, als wäre Grafton von der Landkarte verschwunden. Als Louise, die nur angehalten hatte, um ihrer Mutter den Gehstock zurückzugeben, in den Versammlungsraum kam, hatten gerade vier Männer von der Feuerwehr einen Antrag auf neue Äxte gestellt. Sie hatten ein paar von den alten mitgebracht, um deren altersschwachen Zustand vorzuführen, aber der Stadtrat sagte, sie müssten warten, bis Geld vom Staat komme. Worauf der Vorsitzende Howard LaMott sagte: »Was für Geld vom Staat denn? Es gibt kein Geld vom Staat. Ich bin jetzt hier seit vier Jahren Vorsitzender, und raten Sie mal, wie viel Geld vom Staat es in der Zeit gegeben hat? Null.« Die vier Feuerwehrmänner ergriffen ihre Äxte und gingen hinaus, wobei sie so enttäuscht aussahen, dass man hätte meinen können, sie würden ihre Äxte nehmen und draußen auf der Stelle etwas zerhacken.
Louise sah ihnen nach und entdeckte dabei Hans Cook, der zwei Reihen weiter hinten saß. Die Stühle waren klein, vor allem im Verhältnis zu Hans. Er trug einen Tirolerhut und rauchte eine Tiparillo, deren Asche er jedes Mal im Aufschlag seiner grauen Hose versenkte. Es sah aus, als würde er mit seinem Stuhl leicht kippeln. Der nächste Punkt auf der Tagesordnung war, dass Alvin Gettys Hund Nan Jewell gebissen hatte. Nan Jewell war über achtzig Jahre alt und ging in einem dunkelblauen Kleid mit weißem Spitzenkragen nach vorn – einem schönen Kleid, genau dem Kleid, das eine Jewell tragen musste. Alvin Getty blieb zwischen den Stühlen stehen, seinen deutschen Schäferhund King an der Leine. King trug ein rotes Halstuch, hielt den Kopf gesenkt und wedelte mit dem Schwanz einen Stuhl zur Seite.
»King ist kein bissiger Hund«, sagte Alvin Getty. »Er hat Sie dieses eine Mal gebissen. Okay, das stimmt. Aber schließlich waren Sie ja auch in seinem Garten. Mir macht das nichts aus, aber er ist schließlich ein Hund. Nicht okay, nein, das war natürlich nicht okay. Deswegen bin ich auch bereit, das sage ich jetzt schon den ganzen Abend, seit halb sieben, und jetzt ist es halb zehn, nämlich, ich baue ihm einen prima Zwinger, einen großen, da steck ich ihn rein.«
»Das ist doch gar kein Garten«, sagte Nan Jewell. »Es ist einfach nur ein leeres Grundstück, und überall liegen Autoreifen herum. Ich würde doch in einem solchen Durcheinander gar nicht herumlaufen. Ich halte mich immer in der Mitte vom Gehsteig, sonst könnte mir nämlich schwindlig werden und ich würde hinfallen. Und das weiß jeder.«
»Also, wenn Sie mir auf diesem Grundstück einen einzigen Autoreifen zeigen können, dann fress ich den auf«, sagte Alvin Getty.
Hans Cook lachte herzlich. Louises Mutter stand auf. Sie trug einen schwarzen Rollkragenpullover und darüber einen grünen Jumper mit großen Taschen. »Danke«, sagte sie. »Mit einem deutschen Schäferhund, der beißt, kann man nur eines machen, und was, das liegt, glaube ich, auf der Hand. Der Vorschlag mit dem Zwinger überzeugt mich nicht. Der Hund der Jaspersons sollte auch in einem Zwinger gehalten werden, und wie das ausging, wissen wir alle. So wie wir King heute Abend vor uns sehen, mit seinem hübschen Halstuch, würden wir ihm natürlich alle am liebsten den Kopf kraulen. Aber ich bin der Meinung: Lassen Sie ihn einschläfern. Wer stimmt mir zu?«
»Moment«, sagte Alvin. »Ich habe eine Zeugin. Mrs. Spees ist die Besitzerin der Zoohandlung in Stone City. Und der Laden hat auch eine gute Auswahl. Bitte, Mrs. Spees.«
Doch bevor Mrs. Spees etwas sagen konnte, stand Louise auf und hob die Hand.
»Was gibt es denn, Liebling?«, fragte Mary.
»Das Wort hat Louise Montrose«, sagte Alvin Getty.
»Darling«, sagte Louise. »Louise Darling. Mom, ich hab deinen Stock vom See mitgebracht.«
»Oh, danke schön«, sagte Mary. »Lass ihn einfach an der Tür stehen. Es geht nur um meinen Gehstock, damit Sie alle Bescheid wissen.«
»Ich möchte auch etwas zum Thema sagen«, sagte Louise. »Ich finde, du solltest das mit dem Zwinger versuchen lassen. Ich glaube nicht, dass der Vergleich mit dem Hund von den Jaspersons fair ist, weil die nie einen ernsthaften Versuch gemacht haben.«
»Dank dir für deine Meinung«, sagte Mary. »Niemand würde sich mehr als ich freuen, wenn das mit dem Zwinger funktionierte.«





























