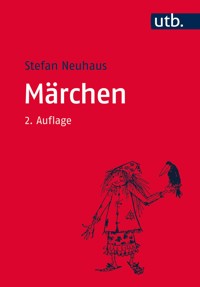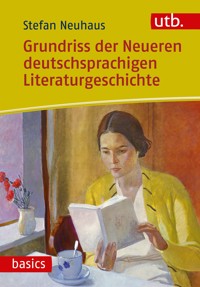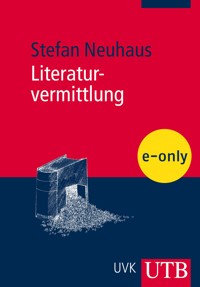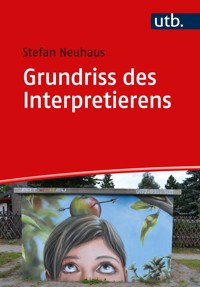
19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: UTB
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Fiktionale Literatur folgt den ihr eigenen Regeln – aber welchen? Wenn Literatur im Zentralabitur verpflichtende Lektüre ist oder mit Preisen ausgezeichnet wird, dann gilt sie als besonders wichtig und wertvoll – was sind die Gründe? Wie wird ‚wertvolle‘ Literatur von Expert:innen erkannt? Das Ergebnis einer Lektüre von Literatur, die versucht, auf Basis der rekonstruierbaren Textintention zu einem besseren Verständnis zu gelangen, wird als Interpretation bezeichnet. Dabei ist bereits das Wahrnehmen von allem, was uns umgibt, ein uns oft unbewusster Prozess des Interpretierens. Die Besonderheiten von Literatur wahrzunehmen kann uns viel von dem, was wir tun und was uns ausmacht, bewusster werden lassen. Wie Literatur interpretiert werden kann, davon handelt dieses Buch.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 298
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Stefan Neuhaus
Grundriss des Interpretierens
Narr Francke Attempto Verlag · Tübingen
Prof. Dr. Dr. h.c. Stefan Neuhaus ist Inhaber des Lehrstuhls für Neuere deutsche Literatur an der Universität Koblenz-Landau, Campus Koblenz.
© Henriette Kriese
Umschlagabbildung: Bemaltes Trafohäuschen in der Wilhelm-Tell-Straße in Wolterdorf bei Berlin. Foto: Marcus Cyron, CC-BY-SA-3.0, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bemaltes_Trafoh%C3%A4uschen_Wilhelm-Tell-Stra%C3%9Fe_Wolterdorf_4.JPG
DOI: https://www.doi.org/10.36198/9783838559209
© 2022 • Narr Francke Attempto Verlag GmbH + Co. KGDischingerweg 5 • D-72070 Tübingen
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetztes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Alle Informationen in diesem Buch wurden mit großer Sorgfalt erstellt. Fehler können dennoch nicht völlig ausgeschlossen werden. Weder Verlag noch Autor:innen oder Herausgeber:innen übernehmen deshalb eine Gewährleistung für die Korrektheit des Inhaltes und haften nicht für fehlerhafte Angaben und deren Folgen. Diese Publikation enthält gegebenenfalls Links zu externen Inhalten Dritter, auf die weder Verlag noch Autor:innen oder Herausgeber:innen Einfluss haben. Für die Inhalte der verlinkten Seiten sind stets die jeweiligen Anbieter oder Betreibenden der Seiten verantwortlich.
Internet: www.narr.deeMail: [email protected]
Einbandgestaltung: siegel konzeption | gestaltung
utb-Nr. 5920
ISBN 978-3-8252-5920-4 (Print)
ISBN 978-3-8463-5920-4 (ePub)
Inhalt
„Unanfechtbare Wahrheiten giebt es überhaupt nicht, und wenn es welche giebt, so sind sie langweilig.“
Theodor Fontane (1899), 7.
„Den Sinn für das Absurde praktiziere ich wie eine Religion.“
Alfred Hitchcock, zit. nach: Truffaut (2003), 250.
Kein Buch ohne Vorwort
Literatur kann man oder frau auf ganz unterschiedliche Weise lesen und es ist schon erklärungsbedürftig, was weshalb zur Literatur gezählt wird und welche Art von Literatur überhaupt gemeint ist. Die eine denkt bei dem Begriff vielleicht an Kriminalromane, der andere an Biographien und jemand Drittes an Sachbücher zu einem bestimmten Themenbereich. Mit der Literatur ist es wie mit dem Essen und dem Trinken – das Angebot ist riesig und es erfüllt ganz unterschiedliche Bedürfnisse.
Die Literatur, von der hier die Rede sein soll, gehört zur Kunst und sie als solche wahrzunehmen und zu lesen oder gar zu interpretieren – das aus dem Lateinischen stammende Verb bedeutet laut Duden „einen Text, ein literarisches Werk, eine Aussage o. Ä. inhaltlich erklären, erläutern, deuten“ (zit. nach www.duden.de/rechtschreibung/interpretieren) – erfordert besondere Kenntnisse. So hat Wolfgang IserIser, Wolfgang, einer der international bekanntesten und einflussreichsten Literaturwissenschaftler der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts, das Vorwort zu seinem Band Das Fiktive und das ImaginäreIser, WolfgangDas Fiktive und das Imaginäre (von 1990) so begonnen:
Literatur bedarf der Auslegung, da das, was sie verschriftlicht, nicht unabhängig von ihr besteht oder gar zugänglich wäre. Dieser Sachverhalt führte zur Ausbildung von Verfahren, die heute als Interpretationsmethoden oder Textmodelle den Grad einer Differenzierung erreicht haben, durch den sie selbst Gegenstand wissenschaftlicher Betrachtung geworden sind. (Iser 1993, 9)
Und das ist ein Fortschritt gegenüber einem ‚naiven‘ Textverständnis, denn Literatur als Kunst beruht auf Voraussetzungen, die nach einer stillschweigenden Übereinkunft von Expert*innen gelten und deren Grundlagen nachgelesen werden können, allerdings muss man oder frau sich dafür besonders einlesen – in die Literaturtheorie, die Literaturgeschichte und nicht zuletzt in Fragen der literarischen Wertung und Kanonbildung, eine besondere Forschungsrichtung, die sich mit Kriterien der Bewertung und qualitativen Einordnung von Literatur beschäftigt.
Natürlich kann frau oder man die sogenannte Höhenkammliteratur oder Literatur im engeren Sinn, die E-Literatur (also die ernsthafte oder ernstzunehmende), im Unterschied zur U(nterhaltungs)-Literatur, wie E-Musik hören und sich trotzdem wenig Gedanken darüber machen. VivaldiVivaldi beim Frühstück sorgt vielleicht einfach nur für gute Stimmung. Wer aber die Kompositionen von Vivaldi ‚verstehen‘ will in dem Sinne, wie sie komponiert sind und wie sie sich auf frühere Kompositionen beziehen und von diesen absetzen, weshalb sie besondere Qualitäten haben und deshalb überhaupt so oft von berühmten Orchestern gespielt werden – die oder der muss sich Fachliteratur besorgen, wenn sie oder er nicht schon Musik studiert hat.
Es ist einfach, wenn man in einem Museum vor einem monochromen Bild von Gerhard RichterRichter, Gerhard steht, zu sagen: „Das kann ich auch.“ Wenn dem so wäre, dann wären alle, die das sagen, vielfache Millionäre. Es gibt Gründe, weshalb monochrome Bilder von Gerhard Richter in Museen hängen und weshalb jedes einzelne dieser Bilder bei einer Auktion einen Preis erzielen würde, der den Kosten für eine Eigentumswohnung in einer deutschen Großstadt entspricht, aber diese Gründe sind in der Regel Expert*innenwissen. Natürlich gibt es auch andere Bilder, es gibt Bilder für viele Geschmäcker – und so ist es mit der Musik und eben mit der Literatur auch. In einem Expert*innendiskurs haben die Bilder von Otto Normalmaler aber leider keinen Wert, auch wenn sie dekorativ aussehen und Onkel Hans froh ist, eines über dem Sofa hängen zu haben; ein Original, wie er seinen Freunden beim wöchentlichen Kaffeetrinken in seinem Wohnzimmer gern sagt. Es würde ihn sicher schmerzen, wenn dann jemand auf die Idee käme zu sagen: Hör mal, Onkel Hans, auf einem Flohmarkt würdest Du vielleicht 20 Euro dafür bekommen, und auch nur für den schönen Rahmen. Onkel Hans ist im Recht. Geschmack ist zunächst einmal subjektiv und er darf es auch sein.
Wenn Onkel Hans, weil seine Frau, Tante Frieda, gestorben ist, nun aber auf die Idee käme, sich ein Hobby zu suchen: er hat immer schon gerne gemalt, und wenn er dann beginnen würde, endlich das zu tun, was er schon als junger Mann tun wollte: Kunstwissenschaften zu studieren, dann würde er das Bild über dem Sofa mit anderen Augen ansehen. Er würde es vielleicht immer noch mögen, aus Nostalgie, aus Gewohnheit, wegen der frohen Farben oder wegen der Landschaft, die Otto gemalt hat und die er so gut kennt. Aber er würde wissen, dass und weshalb das Bild auf dem Flohmarkt nur 20 Euro erzielen würde, und auch das nur wegen des schönen Rahmens. Wenn er nun trotz seines Studiums noch der Auffassung wäre, dass es kaum gelungenere Bilder gibt, dann wäre er im Unrecht. Als Experte sollte er es besser wissen.
Wir leben in einer spezialisierten Gesellschaft und nur, weil Kultur etwas ist, das auf der Seite der Produzierenden richtigerweise keine festgelegte Ausbildung benötigt (so wie andere Bereiche der Gesellschaft, die für alle offen stehen sollen, damit es eine offene, eine demokratische Gesellschaft bleibt), heißt das nicht, dass die Bereiche der Kultur nicht genauso spezialisiert wären wie andere Arbeitsbereiche auch. Welche Regeln gelten, wird nicht gesetzlich verordnet, sondern unter den Diskursteilnehmer*innen ausgehandelt. Es gibt also trotzdem Regeln, auch wenn ihre Nichtbeachtung keine anderen Konsequenzen hat als sich mehr oder weniger zu blamieren und ganz oder teilweise aus dem Diskurs ausgeschlossen zu werden.
Wer also am Diskurs der Expert*innen über Literatur teilhaben und verstehen möchte, wie die in diesem Sinne ernstzunehmende Literatur funktioniert, welche besonderen Voraussetzungen für sie gelten und wie man sie dann auch im Sinne dieses Diskurses ‚lesen‘ und ‚verstehen‘ kann, die oder der hat mit der vorliegenden Einführung die Möglichkeit, Grundkenntnisse zu erwerben. Das Interpretieren von Texten entspricht dem kritisch-genussvollen Verspeisen von Gerichten durch Restaurantkritiker*innen oder dem kundigen Betrachten und Besprechen von Bildern durch Kunstkritiker*innen. Es ist das tägliche Brot der Literaturwissenschaft und auch der Literaturkritik, die viel gemeinsam haben, selbst wenn ihre Aufgaben und Zielgruppen andere sind. Wer gern liest und nicht gern interpretiert (die Unterscheidung wird später klarer werden), die oder der soll auch weiterhin die Liebe zu ihrer oder seiner Literatur pflegen, sollte aber doch wissen, dass es einen Expert*innendiskurs gibt, der von ihrer oder seiner Lektüreweise abweicht.
Zunächst wird es auf den folgenden Seiten darum gehen, Kontext zu dem zu liefern, was hier als ‚Expert*innendiskurs Literatur‘ bezeichnet worden ist, denn die Leser*innen könnten natürlich auf die Idee kommen und sagen: Der kann uns viel erzählen, Papier ist geduldig… Was in dieser Einführung steht, ist nichts bahnbrechend Neues, es wird außerdem – wie in jeder guten wissenschaftlichen Arbeit – belegt. Es gehört natürlich auch zum wissenschaftlichen Diskurs dazu, dass die Expert*innen, die diese Einführung lesen, manches etwas anderes sehen und selbst einen anderen Text geschrieben hätten. Jede Sichtweise auf die Welt ist wahrnehmungsabhängig und Wahrnehmung ist individuell verschieden, auch wenn es durchaus Übereinstimmungen gibt und geben muss – denn sonst könnten wir uns ja nicht verständigen.
Aber ich greife vor und beende dieses Vorwort mit dem Wunsch, dass das Büchlein einigen interessierten Leser*innen helfen wird, Literatur im engeren Sinn leichter so lesen zu lernen, wie es in einem Expert*innendiskurs üblich ist. Und mit einem ganz herzlichen Dank vor allem an Kathrin Heyng, die der Idee für dieses Büchlein sofort Sympathie und Begeisterung entgegengebracht hat und die hoffentlich von dem, was nun vorliegt, ebenso wenig enttäuscht sein wird wie alle, die Geld und Zeit investiert haben, es sich näher anzusehen. Ganz herzlichen Dank auch an Luisa Santo für ihre gründliche Durchsicht!
***
Statt einer Fußnote: Literatur lässt sich ohne Kenntnis als wichtig angesehener Literatur nicht interpretieren, zumindest nicht in einem Expert*innendiskurs. Auf der Kenntnis von dem, was schon da war und noch ist, beruht der wichtigste Teil der Expertise; nur dann können Texte in Entwicklungen eingeordnet und es kann festgestellt werden, was sie von anderen Texten unterscheidet, auf welche früheren Texte sie anspielen (von denen sie sich oftmals zugleich absetzen wollen) und was letztlich so besonders an ihnen ist (oder auch nicht). Um dies zu verdeutlichen, habe ich bereits in der Überschrift zu diesem einführenden Kapitel ein (so nennt es die Intertextualitätstheorie) unmarkiertes Zitat versteckt. „Kein Buch ohne Vorwort“: So ist das Vorwort von Erich KästnerKästner, Erichs autobiographischem Roman (auch solche Zwischengattungen gibt es) Als ich ein kleiner Junge warKästner, ErichAls ich ein kleiner Junge war von 1957 (Kästner 1998a, 9) überschrieben.
Erich Kästner, einer der weltweit meistgelesenen Autoren deutscher Sprache, hat bekanntlich viele Bücher geschrieben und er hat über sich selbst einmal in der dritten Person eine Rede gehalten, in der es heißt:
Unser Gast, meine Damen und Herren, ist gar kein Schöngeist, sondern ein Schulmeister! Betrachtet man seine Arbeiten – vom Bilderbuch bis zum verfänglichsten Gedicht – unter diesem Gesichtspunkte, so geht die Rechnung ohne Bruch auf. Er ist ein Moralist. Er ist ein Rationalist. Er ist ein Urenkel der deutschen Aufklärung, spinnefeind der unechten „Tiefe“, die im Lande der Dichter und Denker nie aus der Mode kommt, untertan und zugetan den drei unveräußerlichen Forderungen: nach der Aufrichtigkeit des Empfindens, nach der Klarheit des Denkens und nach der Einfachheit in Wort und Satz. Er glaubt an den gesunden Menschenverstand wie an ein Wunder, doch eben das verbietet ihm der gesunde Menschenverstand. Es steckt ja jeder in seiner eigenen Zwickmühle. Und auch unser Gast hätte nichts zu lachen, wenn er nicht das besäße, was Leute, die nichts davon verstehen, seinen „unverwüstlichen und sonnigen Humor“ zu nennen belieben. (Kästner 1999, 380f.)
Mit dem unmarkierten Zitat als Überschrift soll, um nun das eigene Vorwort zu interpretieren (oder zumindest, um seine Absicht zu erklären), bereits auch die Richtung vorgegeben werden. Denn das vorliegende Buch ist ein Lehrbuch und hat es sich zur Aufgabe gemacht, auf humorvolle Weise zu unterrichten und zu belehren. Nicht im Medium der Literatur, sondern der Wissenschaft; nicht so brillant und erfolgreich wie Erich Kästner, der dennoch ein Vorbild sein kann und vielleicht auch sein sollte in seinem Bemühen, auf den gesunden Menschenverstand bauend, die aus seiner Sicht wichtigen Themen auf für ihn bestmögliche Weise durch Sprache zu vermitteln.
Vorbild war und ist eine kurze Einführung von Jonathan CullerCuller, Jonathan (Culler 2013), die etwas andere Ziele verfolgt und dennoch hier nachdrücklich empfohlen sein soll, sie wird – wie alle verwendeten Quellen – im Literaturverzeichnis am Ende des Bandes genannt. Anders als bei Culler, der aufbauend zu lesen wäre, bevor der systematische Griff zu den originalen Texten der Literaturtheorie folgt, soll es in dem vorliegenden Band nur, aber doch immerhin um erste Zugänge zu einer professionellen Textlektüre gehen. Wer mehr über literaturtheoretische Zugänge wissen möchte, wird eine Auswahl von weitergehenden Lektürehinweisen finden und auch dies kann nur exemplarisch geschehen, um das eigene Denken und Recherchieren anzuregen.
Wann und weshalb gehören Literatur und Film zur Kunst?
Kunst ist, was als Kunst gilt – wie bereits im Vorwort angesprochen, entscheidet ein Expert*innendiskurs darüber. Dies gilt für alle Bereiche der bildenden Kunst, der Musik und eben auch des Films und der Literatur, die hier besonders in den Blick genommen werden sollen. Dass es nicht so viele Institute oder Fächer für Filmwissenschaft gibt wie für Literaturwissenschaft, hat historische Gründe: Literatur existiert seit mehreren tausend Jahren, das Theater wird ihr üblicherweise zugerechnet, auch wenn es durchaus als Spezialisierung das Fach Theaterwissenschaft an Universitäten gibt. Der Film ist ein relativ junges Medium, ebenso wie Hörmedien, etwa die Schallplatte, und schließlich Hörfunk und Fernsehen, die eine dafür geeignete Infrastruktur voraussetzen (Sendeanstalten, Empfangsgeräte…). Auch das Computerspiel und die sogenannten Neuen Medien sind interessant für Studierende – es gibt bereits entsprechende Angebote an einigen Universitäten, sich mit ihnen intensiver zu beschäftigen, auch im Bereich der Kulturwissenschaften – und bieten Beiträge zum weiten Feld der Kunst.
Beschränkung tut also auch hier Not. Spielfilme und Folgen von Serien können mit literarischen Texten relativ leicht verglichen werden, auch wenn sie anderen Gesetzen unterliegen. Ihre Handlung ist fiktiv (als Handlung erfunden) oder auch fiktional (von außen betrachtet und als Erzählung wahrgenommen), also Teil der Fiktionen, die für Literaturwissenschaftler*innen deshalb so spannend sind, weil sie gestalten, was möglich sein könnte. Dieses Potential gibt Literatur und Film eine diagnostische Qualität, zumindest wird ihnen eine solche immer wieder attestiert. Ein bekanntes Beispiel, wenn es um mögliche zukünftige Welten geht, wäre der Film MetropolisLang, FritzMetropolis (1927), bei dem Fritz LangLang, Fritz Regie führte und der zahlreiche weitere Fiktionen – etwa den Film Blade RunnerScott, RidleyBlade Runner (1982; Regie Ridley ScottScott, Ridley) – und durch diese Fiktionen auch die Vorstellung vieler Menschen etwa von Architektur, sozialen oder politischen Strukturen beeinflusst hat. Als Beispiel für vergleichbare Literatur kann etwa auf Aldous HuxleyHuxley, Aldouss Roman Brave New WorldHuxley, AldousBrave New World (1932) verwiesen werden, der eine dystopische Welt zeichnet und dessen Konzept durch zahlreiche weitere, mehr oder weniger berühmte Romane adaptiert, variiert und weitergedacht worden ist, etwa von George OrwellOrwell, George in 1984Orwell, George1984 (1949) oder von Walter JensJens, Walter in Nein. Die Welt der AngeklagtenJens, WalterNein. Die Welt der Angeklagten (1950) bis hin zu Juli ZehZeh, Juli in Corpus DelictiZeh, JuliCorpus Delicti (2009). Unter den populären Lesestoffen und -filmen, die sich diesen (und anderen) Vorbildern verdanken, wäre Suzanne CollinsCollins, Suzanne’ dreiteilige Romanreihe The Hunger GamesCollins, SuzanneThe Hunger Games (2008-10) zu nennen (dt. Die Tribute von Panem); die darauf basierende vierteilige Filmreihe (2012-15) zählt zu den sogenannten Blockbustern der 2010er Jahre.
Wie diese wenigen Beispiele zeigen, stehen literarische Texte und Filme in einem kulturellen Zusammenhang, indem sie an frühere Texte und Filme anschließen und diese, in der einen oder anderen Weise und mehr oder weniger deutlich markiert, zitieren: In der Literaturwissenschaft heißt dieses Phänomen Intertextualität. Dabei werden Themen, Stoffe und Motive (vgl. Daemmrich 1995) tradiert und variiert – das sind die Fachausdrücke für größere oder kleinere Handlungssequenzen, die ähnlich sind (vgl. Neuhaus 2017a, 114-116). So ist etwa der gemeinsame Liebestod in Romeo und JuliaShakespeare, WilliamRomeo und Julia (1597) von William ShakespeareShakespeare, William oder in Romeo und Julia auf dem DorfeKeller, GottfriedRomeo und Julia auf dem Dorfe (1856) von Gottfried KellerKeller, Gottfried ein Motiv, während es sich bei Faust und dem Teufelspakt um einen Stoff handelt, der in einem Volksbuch aus dem Mittelalter und von Autoren wie Johann Wolfgang GoetheGoethe, Johann Wolfgang in den beiden FaustGoethe, Johann WolfgangFaust-Dramen (1808/32) oder von Thomas MannMann, Thomas in Doktor FaustusMann, ThomasDoktor Faustus (1947) behandelt wurde. Faust ist dabei sowohl eine historische Person als auch (fiktionalisiert) eine Figur in literarischen Texten. Themen wären etwa die sich fatal auswirkenden familiären Konflikte im ersten Stoff-Beispiel, die Pars pro toto für gesellschaftliche Konflikte stehen, und der Drang nach Wissen um jeden Preis im zweiten – die Liste ließe sich je nach Blickrichtung und Interesse erweitern. Für solche Beziehungen zwischen Texten und Filmen auf verschiedenen Ebenen gibt es verschiedene Begriffe, etwa Paratextualität oder Palimpsest – eine Metapher, wird als Palimpsest doch eigentlich die im Mittelalter mangels Material übliche Praxis des Überschreibens von Manuskripten oder Manuskriptteilen bezeichnet (ein komplexes Inventar von Begriffen zur Intertextualität findet sich bei Genette 1993).
Das Alter von medialen Angeboten und ihre Beziehungen untereinander sind auch deshalb so wichtig, weil sie dadurch länger auf das sogenannte kollektive Gedächtnis wirken konnten – ein Begriff, den Jan AssmannAssmann, Jan populär gemacht hat (Assmann 2002) und der mittlerweile eine eigene Forschungsrichtung innerhalb der Kulturwissenschaften bezeichnet. Erinnerung (als aktives Hervorholen von Gedächtnisinhalten) und kommunikatives Gedächtnis (als das, was gegenwärtig erinnert wird) sind verwandte Begriffe, die sich auf die aktuellen Gedächtnisinhalte beziehen (vgl. Welzer 2005), während das kulturelle Gedächtnis als Speicher fungiert, auf den zurückgegriffen werden kann; vergleichbar einer Bibliothek, aus der Bücher erst geholt werden müssen, um sie zu lesen.
Die Bedeutung des kulturellen Gedächtnisses für den Zusammenhalt in einer Gesellschaft ist groß: „Das Gedächtnis rekonstruiert nicht nur die Vergangenheit, es organisiert auch die Erfahrung der Gegenwart und Zukunft“ (Assmann 2002, 42). Wie zuvor der von ihm rezipierte Maurice HalbwachsHalbwachs, Maurice und andere ist auch Jan Assmann der Auffassung, dass „die Vergangenheit […] eine soziale Konstruktion“ darstellt, „deren Beschaffenheit sich aus den Sinnbedürfnissen und Bezugsrahmen der jeweiligen Gegenwart her ergibt“ (Assmann 2002, 48). Vergangenheit als „kulturelle Schöpfung“ (ebd.) zu betrachten wird einem späteren Kapitel vorbehalten sein. Festzuhalten bleibt, wiederum mit Assmann: „Erinnerung ist ein Akt der Semiotisierung“ (Assmann 2002, 77). Wir erinnern nicht einfach etwas, sondern wir passen es in Sinnzusammenhänge ein, in denen „Erinnerungen immer individuell und kollektiv zugleich“ sind (Welzer 2005, 170), so dass „der Übergang von wahren zu falschen autobiographischen Erinnerungen durchaus fließend ist“ (Welzer 2005, 34).
Vielleicht sind deshalb Fiktionen auch so attraktiv und wirkmächtig, weil sie sich so gut mit dem verbinden lassen, was wir fühlen und denken, ganz unabhängig von dem tatsächlichen Wahrheitsgehalt, der oft nur schwer zu ermitteln ist und bestimmt wird durch „Intersubjektivität“ (Welzer 2005, 83), also durch soziale Übereinkünfte. Jedenfalls gelten Produktionen, die als Bestandteil der Kunst angesehen werden, viel – sie bedeuten nicht immer ökonomischen Erfolg, aber zumindest immer Ansehen von der Gruppe der Expert*innen. Und oft genug folgt dem Ansehen auch der ökonomische Erfolg, etwa durch Stipendien und Preisverleihungen. Es gibt Konzepte, die solche Zusammenhänge erklären helfen und die sich unter dem Begriff der Literaturvermittlung zusammenfassen lassen (vgl. Neuhaus 2009).
Wer sich darüber informieren will, welche Filme und welche Bücher als ‚besonders wertvoll‘ angesehen werden, die oder der kann sich sogenannte Bestenlisten (nicht: Bestsellerlisten, die den Verkaufserfolg abbilden wollen) ansehen, für die aktuelle Belletristik etwa die renommierte Bestenliste des SWR (www.swr.de/swr2/literatur/bestenliste/index.html) und für Filme die Seiten der Deutschen Film- und Medienbewertung FBW (www.fbw-filmbewertung.com). Wer wissen möchte, welche Bücher und Filme aus einer historischen Perspektive als besonders künstlerisch und somit auch als besonders wichtig für das kollektive Gedächtnis angesehen werden, für die oder den gibt es verschiedenste Angebote. Für Filme etwa gilt die von einer internationalen Jury zusammengestellte Liste der Zeitschrift Cahiers du Cinéma als besonders wichtig; die von der Zeitschrift ermittelten wichtigsten 100 Filme aller Zeiten finden sich zusammengefasst auf der International Movie Database IMDb (www.imdb.com/list/ls050032005), wobei auffällig ist, dass die hier ebenfalls abgebildeten Bewertungen der Nutzer*innen der Webseite durchaus anders ausfallen (weil Expert*innen oft anders urteilen als Nichtexpert*innen). Bei Literatur reicht das Spektrum von Leselisten auf den Homepages von Germanistik-Instituten (etwa auch der Universität Koblenz; www.uni-koblenz-landau.de/de/koblenz/fb2/inst-germanistik/studium/leselisten) bis zu dem Kanonspiel der Internetzeitschrift für Literaturkritik namens literaturkritik.de (kultur-wissenschaft.de/kanon/index.php), an dem sich alle Nutzer*innen der Seite beteiligen können.
Goethes erstes FaustGoethe, Johann WolfgangFaust-Drama von 1808 gilt Expert*innen als wichtigster Text der deutschsprachigen Literatur und es ist auch bei dem genannten, demokratisch funktionierenden Kanonspiel seit Gründung der Zeitschrift und Einrichtung des Spiels unangefochten auf Platz 1 der „ranghöchsten Erzähltexte und Dramen“ (ebd.). Dabei dürfte die Lektüre des Dramas bei vielen Leser*innen dieser Zeilen unangenehme Erinnerungen wachrufen. Die wenigsten werden es außerhalb der Schule aus eigener Initiative gelesen haben. Die meisten, die es in der Schule gelesen haben, werden große Verständnisprobleme gehabt haben, angefangen mit dem fehlenden Verständnis dafür, dass es für sie sinnhaft sein soll, so einen alten Text über die Probleme eines Wissenschaftlers zu lesen – weshalb viele die Lektüre nur halbherzig betrieben haben dürften, bestenfalls mit dem Ziel, auch ohne „Leselust“ (Anz 1998, 11) im Unterrichtsgespräch und in der Klausur im Rahmen ihres eigenen Notenziels möglichst gut dazustehen.
Zunächst einmal gilt für die Lektüre von Literatur wie für das Leben, dass „Lust und Glück nichts Dauerhaftes“ und „nur im Wechsel mit Unlust zu haben“ sind (Anz 1998, 7). Wer keine Unlust verspürt, die oder der weiß auch nicht, was Lust ist. Das hilft allerdings bei der Faust-Lektüre nicht weiter, etwa nach dem Motto: schön, dass es mir keine Lust bereitet, dass es keinen Spaß macht. Wer Faust oder vergleichbare Texte gern liest, die oder der will sich nicht primär unterhalten lassen, sondern hat den Wunsch, „ästhetisches Vergnügen durch Reflexion darüber zu verstärken“ (Anz 1998, 10), also sich Gedanken über das Gelesene zu machen. In diesem Sinne ist Literatur vor allem Anregung und nicht die Antwort auf eine Frage, sondern die Frage selbst – oder eine ganze Menge Fragen.
Der bereits im Vorwort zitierte Erich KästnerKästner, Erich hat dem Problem, dass Leser*innen von Literatur Antworten erwarten, ein Gedicht gewidmet mit dem Titel Und wo bleibt das Positive, Herr Kästner?Kästner, ErichUnd wo bleibt das Positive, Herr Kästner? Seine lapidare Antwort: „Ja, weiß der Teufel, wo das bleibt“ (Kästner 1998b, 170). Eine Anspielung (in der Literaturwissenschaft sprechen wir von einem unmarkierten Zitat) auf Goethes FaustGoethe, Johann WolfgangFaust enthält folgende Strophe: „Die Spezies Mensch geht aus dem Leime / und mit ihr Haus und Staat und Welt. / Ihr wünscht, daß ich’s hübsch zusammenreime, / und denkt, daß es dann zusammenhält?“ (ebd.). Im Faust heißt es: „Daß ich erkenne, was die Welt / Im Innersten zusammenhält [,]“ (Goethe 1996, 20). Gefordert sind aktive Leser*innen, die sich ihren eigenen Reim auf das machen, wozu Texte nur den Anstoß geben können. Dieses Gedicht von Kästner legt den Finger in die Wunde des Wunsches, sich gern etwas vormachen zu lassen und sich einzubilden, alles sei schon gut so, wie es ist. Literatur, Film und Kunst allgemein möchten kritisches Denken anstoßen und vor allem danach wird ausgewählt, was als kulturell bedeutsam gilt und was nicht.
Ein bekannteres Beispiel für den Versuch von Literatur, einen solchen Reflexionsprozess anzustoßen, ist Bertolt BrechtBrecht, Bertolts Konzept des epischen Theaters. Sogenannte Verfremdungseffekte (von dissonanter Musik über Spruchbänder bis zur direkten Anrede des Publikums durch die Schauspieler*innen mit der Aufforderung, über das Gezeigte nachzudenken) wurden von ihm und anderen Dramatiker*innen wie Theatermacher*innen noch zur Zeit der Weimarer Republik entwickelt, um die Zuschauer*innen davon abzuhalten, sich mit den Figuren zu identifizieren und dadurch nicht über die vorgeführten Probleme der Figuren nachzudenken. Brecht hat viel darüber geschrieben, eine der kürzesten Definitionen seines Konzepts dürfte folgender Aphorismus sein: „Für das Publikum gilt einem Stück gegenüber: Jeder sein eigener Kolumbus“ (Brecht 1997, 89). Jede*r soll die Bedeutung des Gezeigten für sich selbst suchen und finden, die oder der aktive Zuschauer*in ist gefragt und gefordert.
Ein kleiner Streifzug durch den Wertungsdiskurs und die Frage nach dem Kanon der Bücher, die man gelesen haben sollte, um in einem Expert*innendiskurs mitreden zu können, muss nun umfangreichere Darstellungen ersetzen, soll aber einige Lektüretipps für jene geben, die sich umfassender einlesen wollen. Den ‚Problemen der literarischen Wertung‘ hat erstmals Walter Müller-SeidelMüller-Seidel, Walter 1965 eine Studie gewidmet (Müller-Seidel 1965), in einer Zeit also, in der (nicht zuletzt wegen der Instrumentalisierung der Literatur in der NS-Zeit) im Literaturstudium immer stärker nachgefragt wurde, weshalb welche Texte denn überhaupt als kanonisch angesehen werden. 1980 gab es immerhin schon genügend Material, um in der renommierten Reihe „Wege der Forschung“ der Wissenschaftlichen Buchgesellschaft das zu veröffentlichen, was man heute einen ‚Reader‘ nennen würde, angefangen mit Schriften von Gotthold Ephraim LessingLessing, Gotthold Ephraim aus dem Jahr 1759 bis zu in den späten 1970er Jahren erschienenen Aufsätzen (vgl. Gebhardt 1980). Aus dem englischsprachigen Diskurs über literary criticism – dort kennt man die im Deutschsprachigen fundamentale Unterscheidung zwischen Literaturkritik und Literaturwissenschaft nicht – kam 1988 ein wichtiger Input, als Barbara Herrnstein SmithHerrnstein Smith, Barbara die ‚Kontingenz des Wertens‘ in den Mittelpunkt einer Studie rückte (vgl. Herrnstein-Smith 1991). Grundlegende Schlussfolgerungen aus all dem haben Renate von HeydebrandHeydebrand, Renate von und Simone WinkoWinko, Simone in ihrer Einführung in die Wertung von LiteraturWinko, SimoneEinführung in die Wertung von LiteraturHeydebrand, Renate vonEinführung in die Wertung von Literatur gezogen (Heydebrand / Winko 1996), eine Systematik des Wertens, die bis heute einen hohen Standard setzt – zusammen mit dem von Gabriele RipplRippl, Gabriele und Simone WinkoWinko, Simone verantworteten Handbuch Kanon und WertungRippl, GabrieleHandbuch Kanon und WertungWinko, SimoneHandbuch Kanon und Wertung, das 2013 erschienen ist (vgl. Rippl / Winko 2013). Dazu kommen viele andere Publikationen, von Antworten auf die – hier von Hans-Dieter GelfertGelfert, Hans-Dieter – selbstgestellte Frage Was ist gute Literatur?Gelfert, Hans-DieterWas ist gute Literatur? (Gelfert 2006) über die exemplarische Dar- und Vorstellung von ‚Kultbüchern‘ (Klein 2014) bis zur Heranführung an das, was im neuen Jahrtausend aus welchen Gründen zu lesen sein könnte (vgl. Neuhaus / Schaffers 2016). Nachdem das Thema lange vernachlässigt wurde, hat sich in der Forschung viel getan und die Liste der Arbeiten, aber auch die Variationsbreite der Zugänge ist beeindruckend.
Will man oder frau nun wissen, was Kunst und Literatur wirklich sind, oder provokativ am Objekt gefragt: Ist das Kunst oder kann das weg?Saehrendt, ChristianIst das Kunst oder kann das weg?, Kittl, Steen T.Ist das Kunst oder kann das weg?dann lässt sich zunächst allgemein mit Christian SaehrendtSaehrendt, Christian und Steen T. KittlKittl, Steen T. antworten:
In freien Gesellschaften ist die Kunst, ob sie will oder nicht, immer Teil eines Zirkus’, der mit Stars, Rollen, Symbolen und Bedeutungen handelt wie der Bäcker mit Brötchen. Selbst Kunstgueilleros wie BanksyBanksy oder BluBlu akzeptieren diese einfache Weisheit, ohne deshalb die Spraydose in den Müll zu werfen. Denn Kunst hat trotz allem reale Werte, die auch jenseits ambitionierter Avantgarde-Manifeste und Kuratorentheorien zu einem gelingenden Leben beitragen können (Saehrendt / Kittl 2016, 232).
Allerdings haben die beiden Autoren, und das spielen sie hier herunter, eine intellektuelle Vorstellung davon, was ‚ein gelingendes Leben‘ auszeichnet, wenn sie Begriffe wie „Ambiguitätstoleranz“ verwenden (ebd.), die man durch Kunst lernen kann. Der Soziologe Niklas LuhmannLuhmann, Niklas, dem wir eine der wenigen grundlegenden theoretischen Studien über das für unsere Gesellschaft weitestgehend verbindliche Konzept von Kunst verdanken, hat der Idee, Kunst sei marktabhängig wie die eben zitierten Brötchen, schon in den 1990er Jahren eine Absage erteilt: „Die Anlehnung an die Wirtschaft gibt der Kunst, das sollte man nicht unterschätzen, sehr viel mehr Freiheit als die Anlehnung an Mäzene“ (Luhmann 1997, 266), also an Adelige oder andere Höhergestellte, die bis ins 18. Jahrhundert Künstler*innen und Autor*innen gefördert (wir würden heute sagen: gesponsert) haben und ohne die es vor der Moderne kein Kunst- und Literatursystem gegeben hätte.
Mit der Aufklärung wird ein seinerzeit neues, eben modernes Konzept von Kunst immer populärer, dem „Neuheit als Erfordernis von Kunstwerken“ (Luhmann 1997, 323) zugrunde liegt. Vorher galt es, möglichst kunstvoll anerkannte Regeln zu variieren; nun gilt es, etwas Neues zu schaffen, wenn auch durchaus auf der Basis des Bestehenden, damit es überhaupt als ‚neu‘ erkannt werden kann. Das Kunstwerk verweist seither immer zunächst auf sich selbst, in Luhmanns Worten: „Der Schwerpunkt hat sich mit dem Autonomwerden des Kunstsystems von Fremdreferenz auf Selbstreferenz verlagert“ (Luhmann 1997, 240). Selbstreferenz bedeutet, dass Sprache und Form in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit rücken, zumindest bei den Expert*innen, während Handlung und Inhalt, die eher zur Fremdreferenz zu zählen sind, weil sie etwa das Bedürfnis nach Unterhaltung und Ablenkung bedienen (Zwecke außerhalb des Kunstwerks selbst), weniger wichtig werden (vgl. hierzu auch Heydebrand / Winko 1996, 29-33). Durch das Reflexive, das Kunst somit notwendigerweise bekommt, macht sie „Wahrnehmung für Kommunikation verfügbar“ (Luhmann 1997, 82), und zwar eine Wahrnehmung, die von der Realität grundsätzlich unterschieden ist. Wenn etwas real ist, ist es keine Kunst und umgekehrt, es sei denn, Kunst präsentiert etwas aus der Realität, um zu provozieren – auch das hat es oft genug gegeben. Selbst dann geht es aber um die Differenz von Realität und Kunst, auch wenn die Provokation darin besteht, mit einer weitgehenden Einebnung dieser Differenz das Kunstsystem selbst zu provozieren (so wie dies etwa Peter Handke getan hat, vgl. das Beispiel unten).
LuhmannLuhmann, Niklas geht sogar so weit zu sagen, man oder frau könne „an Kunstwerken das Beobachten lernen“ (Luhmann 1997, 90). Diese Feststellung greift noch weiter als praktische Aspekte, wie die oben genannte „Ambiguitätstoleranz“, oder ist überhaupt erst die Voraussetzung dafür, Ambiguität (Mehrdeutigkeit) zu erkennen und eine Toleranz für sie zu entwickeln. Idealerweise sorgen ein Kunstwerk oder ein literarischer Text dafür, die eigene Wahrnehmung zu hinterfragen und, wenn nötig, zu korrigieren: „Der Betrachter wird angeleitet, sein Beobachten zu beobachten und damit auch eigene Eigentümlichkeiten, Vorurteile, Beschränktheiten zu bemerken, die ihm vorher als eigene gar nicht aufgefallen waren“ (Luhmann 1997, 144). Die „Unterscheidung von Kunst und Kitsch“ (Luhmann 1997, 300) lässt sich für Luhmann vor allem bei der Betrachtung des Formwillens treffen: „Auch mißglückte Kunstwerke sind Kunstwerke – nur eben mißglückte“ (Luhmann 1997, 316).
Wenn also ein literarischer Text auf mutige Weise versucht, etwas Neues zu schaffen und dabei durch Sprache und Form die Wahrnehmung seiner Leser*innen zu irritieren, ist das zunächst einmal gut und ein Hinweis darauf, dass der Text Kunst sein will. Wenn er aber von vornherein auf solche Irritationsmomente verzichtet und es seinen Leser*innen möglichst einfach macht, indem er ihre Erwartungshaltung bestätigt – dann ist das ein Hinweis darauf, dass der Text im günstigsten Fall zur Unterhaltungsliteratur zählt, wenn nicht zur Trivialliteratur (eine immer schon abwertende Bezeichnung).
Wer Literatur interpretieren will, die oder der muss sich mit dem „Code als Moment der Selbstorganisation des Kunstsystems“ (Luhmann 1997, 317), also mit den besonderen Regeln auseinandersetzen, die für Kunst gelten – auch dies wird in weiteren Kapiteln noch Thema sein. Literarische Texte funktionieren fundamental anders als etwa Sachtexte – auch, wenn es sich scheinbar um Sachtexte handelt, wie beispielsweise Die Aufstellung des 1. FC Nürnberg vom 27.1.1968Handke, PeterDie Aufstellung des 1. FC Nürnberg vom 27.1.1968 von Peter HandkeHandke, Peter, veröffentlicht in dem Band Die Innenwelt der Außenwelt der Innenwelt von 1969:
Warra
Leupold Popp
Ludwig Müller Wenauer Blankenburg
Starek Strehl Brungs Heinz Müller Volkert
Spielbeginn:
15 Uhr
(zit. nach Frank 2003, 50)
Hier geht es um die Provokation, einen Ausschnitt aus der Realität als Literatur auszugeben, um den seinerzeit elitären Literaturbegriff anzuprangern. Nun ist die Frage, wie und weshalb Literatur auf Realität referieren sollte, eine äußerst komplexe und hier sicher nicht zu beantwortende. Festzuhalten bleibt, dass eine Interpretation dieses Handke-Texts ohne Blick auf den Kontext nicht funktioniert, in den beispielsweise auch Leslie FiedlerFiedler, Leslies berühmte, von marxistischen Theorien inspirierte Rede aus dem Jahr 1968 gehört, mit der Forderung, den ‚Graben‘ zwischen „einer Kunst für die ‚Gebildeten‘ und einer Subkunst für die ‚Ungebildeten‘“ zu schließen (Fiedler 1994, 31). Insofern möchte der Text wohl, mit den eben zitierten Worten Luhmanns, auf die „Vorurteile“ und „Beschränktheiten“ der Leser*innen verweisen, die ‚nur‘ Texte lesen, denen sie einen hochliterarischen Wert unterstellen – ohne diese Texte auf ihren literarischen Wert zu befragen. Über die bloße Absicht hinaus, zum Nachdenken anzuregen, stellt Handkes Text ganz grundsätzlich die Frage danach, was einen Text überhaupt erst lesenswert macht. Möglichkeiten eines solchen intellektuellen Nutzens von Literatur, der über die Befriedigung ‚fremdreferentieller‘ Bedürfnisse wie nach bloßer Unterhaltung hinausgeht, werden in den folgenden Kapiteln vorgestellt.
Was sind Fiktionen?
Grundlagen von Fiktionalität
Fiktiv ist das Fliegende Spaghettimonster, kurz FSM (de.wikipedia.org/wiki/Fliegendes_Spaghettimonster). Dass es sich um eine Religionsparodie handelt, erschließt sich bei näherer Beschäftigung. Als fiktional könnte man die Erzählung vom FSM ansehen, wenn es sich um eine literarische Fiktion handeln würde. Versteht man „literarische Fiktion als ästhetische Funktion“ (Zipfel 2001, 20), dann ist mit Fiktion zwar etwas Erfundenes gemeint, das aber in einer künstlerisch anspruchsvollen Sprache und Form dargeboten wird und das in einem komplexen Verhältnis zur außerliterarischen Realität steht. Fragt man genauer nach diesem komplexen Verhältnis, dann werden sofort einige grundlegende Probleme der Fiktionalität in literarischen Texten sichtbar.
Leser*innen lassen sich auf Texte ein, indem sie für die Dauer der Lektüre annehmen, dass das, was sie lesen, ‚wahr‘ ist. Diese Erkenntnis ist sehr alt, sie geht im Grunde bereits auf die Antike zurück und sie ist 1817 von Samuel Taylor ColeridgeColeridge, Samuel Taylor griffig als „willing suspension of disbelief“ bezeichnet worden, als „unausgesprochene[r] Vertrag“, für den gilt: „Selbstverständlich ist jedem Rezipienten bei der Lektüre einer Fiktion bewusst, dass er eine solche in Händen hält“ (Mader 2017, 73). Mit Philippe LejeuneLejeune, Philippe kann man auch von einem ‚Pakt mit dem Leser‘ sprechen, den ein Text mit seinen Leser*innen schließt, um zu ‚funktionieren‘. Lejeune hat den Begriff des Pakts zunächst auf die Autobiographie bezogen: Wer eine solche liest, geht davon aus, dass es sich um reale lebensgeschichtliche Ereignisse handelt. Die Übertragbarkeit auf andere Gattungen liegt nahe: „Und so wie es einen autobiographischen Pakt gibt, so gibt es auch einen Romanpakt“ (Wagner-Egelhaaf 2000, 67). Wer einen Roman oder einen anderen fiktionalen Text liest, die oder der nimmt an, dass sich die geschilderten Ereignisse eben nicht in der Realität zugetragen haben: „Man kann schließlich sehr wohl wissen, daß der eigenen Imagination keine wirkliche Welt entspricht, so wie man bei optischen Täuschungen die Täuschung sozusagen wegwissen kann, aber sie trotzdem sieht“ (Luhmann 1997, 93).
Doch auch wenn „die Opposition von Wirklichkeit und Fiktion […] zu den Elementarbeständen unseres ‚stummen Wissens‘“ zu gehören scheint, so lässt sich doch fragen, „ob die gewiß handliche Unterscheidung von fiktionalen und nicht-fiktionalen Texten sich an dieser geläufigen Opposition festmachen läßt. Sind fiktionale Texte wirklich so fiktiv, und sind jene, die man nicht so bezeichnen kann, wirklich ohne Fiktionen?“ (Iser 1993, 18). Dass es sich um eine rhetorische Frage handelt, zeigt bereits die implizite Bewertung durch das Adjektiv ‚handlich‘, will sagen: Natürlich ist die Sache nicht so einfach, wie sie zu sein scheint.