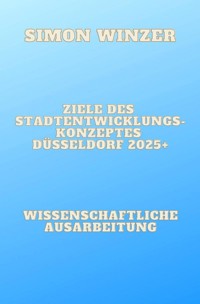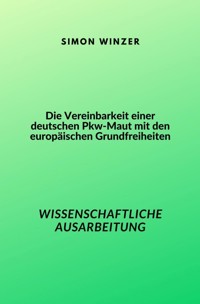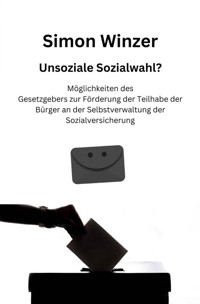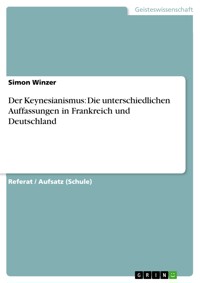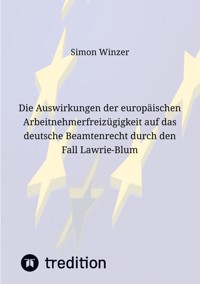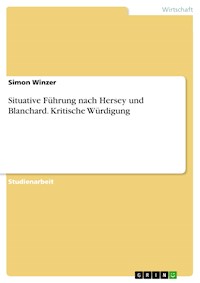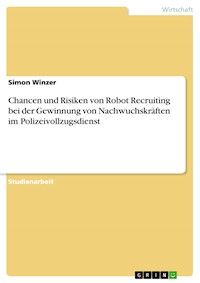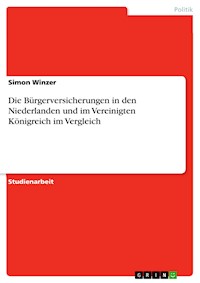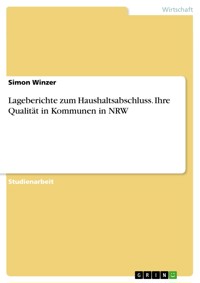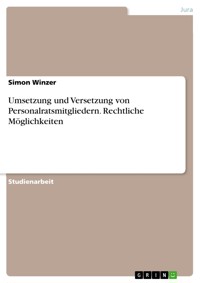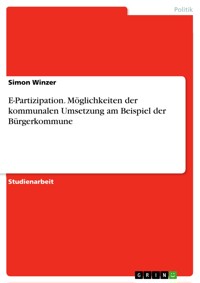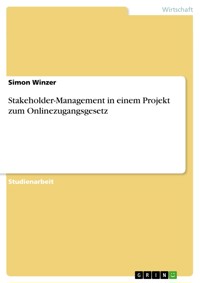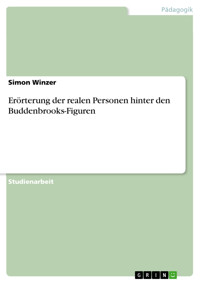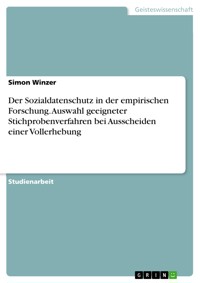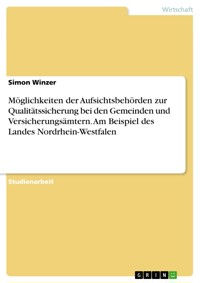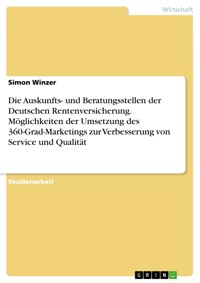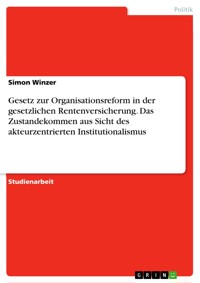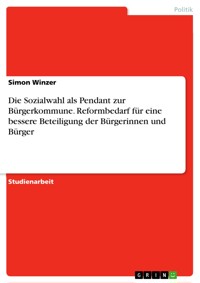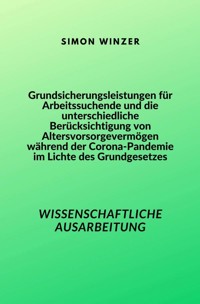
Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende und die unterschiedliche Berücksichtigung von Altersvorsorgevermögen während der Corona-Pandemie im Lichte des Grundgesetzes E-Book
Simon Winzer
2,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Durch die Maßnahmen zur Bekämpfung der Covid-19-Pandemie wurde die Bevölkerung in eine herausfordernde Situation versetzt. So mussten beispielsweise Eltern, bei gegebenenfalls gleichzeitiger Tätigkeit im Home-Office, ihre Kinder unterrichten, da diese die Schule nicht mehr besuchen durften. Auch erlitten zahlreiche Arbeitnehmer durch Kurzarbeit finanzielle Verluste und Solo-Selbständige bekamen keine Aufträge mehr. Doch während abhängig Beschäftigte zumindest über die Arbeitsagenturen Kurzarbeitergeld ohne Einkommens- und Vermögensanrechnung erhielten, konnten Selbständige im Regelfall keine Einnahmen erzielen. In der Folge versechsfachte sich im Zeitraum von April 2020 bis Juli 2021 die Zahl der Grundsicherungsbezieher unter den Solo-Selbständigen von etwa 22.000 auf 134.000 Menschen. Nicht in dieser Statistik enthalten sind jedoch Freiberufler mit einem Restvermögen. Da es sich bei der Grundsicherung für Arbeitssuchende um eine subsidiäre Sozialleistung für Hilfebedürftige handelt, müssen Erwerbslose vor einem Bezug zunächst ihre Ersparnisse bis zum sogenannten Schonvermögen verwerten. Insbesondere bei der Berücksichtigung von Altersvorsorgevermögen führt dies zu sozialen Härten. Arbeitnehmer müssen ihre Ansprüche in der gesetzlichen Rentenversicherung sowie der staatlich geförderten privaten Altersvorsorge nicht veräußern. Selbständige haben hingegen, sofern sie nicht in der gesetzlichen Rentenversicherung versichert sind und/oder nicht mit Rürup-Verträgen vorgesorgt haben, in bestimmten Konstellationen ihre privaten Altersvorsorgerückstellungen aufzubrauchen. Im Zweifel führt dies später zur Altersarmut. Ziel dieser Ausarbeitung ist es, die unterschiedliche Behandlung des Altersvorsorgevermögens im Lichte des Grundgesetzes zu betrachten. Dabei soll der Schwerpunkt auf dem Schutz des Eigentums, der Menschenwürde, dem Gleichheitssatz und dem Gebot der Wirtschaftlichkeit liegen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 20
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende und die unterschiedliche Berücksichtigung von Altersvorsorgevermögen während der Corona-Pandemie im Lichte des Grundgesetzes
Simon Winzer
Rückertstr. 69
48165 Münster
Inhaltsverzeichnis
Hinweis zum Rechtsstand
Einleitung
Vermögensverwertung vor Grundsicherung
Einordnung und Abgrenzung des SGB II
Verwertungspflicht von Vermögen
Beispiele
Methodisches Vorgehen
Verfassungsrechtliche Diskussion
Recht auf Eigentum
Schutz der Menschenwürde
Recht auf Gleichbehandlung
Gebot der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit
Fazit und Ausblick
Quellenverzeichnis
Anmerkungen
Hinweis zum Rechtsstand
Dieses Buch basiert auf dem im November 2021 geltenden Recht.
Einleitung
Durch die Maßnahmen zur Bekämpfung der Covid-19-Pandemie wurde die Bevölkerung in eine herausfordernde Situation versetzt. So mussten beispielsweise Eltern, bei gegebenenfalls gleichzeitiger Tätigkeit im Home-Office, ihre Kinder unterrichten, da diese die Schule nicht mehr besuchen durften. Auch erlitten zahlreiche Arbeitnehmer durch Kurzarbeit finanzielle Verluste und Solo-Selbständige bekamen keine Aufträge mehr.
Doch während abhängig Beschäftigte zumindest über die Arbeitsagenturen Kurzarbeitergeld ohne Einkommens- und Vermögensanrechnung erhielten, konnten Selbständige im Regelfall keine Einnahmen erzielen. In der Folge versechsfachte sich im Zeitraum von April 2020 bis Juli 2021 die Zahl der Grundsicherungsbezieher unter den Solo-Selbständigen von etwa 22.000 auf 134.000 Menschen. [1] Nicht in dieser Statistik enthalten sind jedoch Freiberufler mit einem Restvermögen. Da es sich bei der Grundsicherung für Arbeitssuchende um eine subsidiäre Sozialleistung für Hilfebedürftige handelt, müssen Erwerbslose vor einem Bezug zunächst ihre Ersparnisse bis zum sogenannten Schonvermögen verwerten. [2]
Insbesondere bei der Berücksichtigung von Altersvorsorgevermögen führt dies zu sozialen Härten. Arbeitnehmer müssen ihre Ansprüche in der gesetzlichen Rentenversicherung sowie der staatlich geförderten privaten Altersvorsorge nicht veräußern. [3] Selbständige haben hingegen, sofern sie nicht in der gesetzlichen Rentenversicherung versichert sind und/oder nicht mit Rürup-Verträgen vorgesorgt haben, in bestimmten Konstellationen ihre privaten Altersvorsorgerückstellungen aufzubrauchen. [4] Im Zweifel führt dies später zur Altersarmut.
Ziel dieser Ausarbeitung ist es, die unterschiedliche Behandlung des Altersvorsorgevermögens im Lichte des Grundgesetzes zu betrachten. Dabei soll der Schwerpunkt auf dem Schutz des Eigentums, der Menschenwürde, dem Gleichheitssatz und dem Gebot der Wirtschaftlichkeit liegen. Bei der Prüfung wird nicht der juristische Gutachtenstil verwendet. Vielmehr erfolgt eine auf Gesetzesbegründungen, Ausschuss- und Plenarprotokollen, Kommentaren bzw. der Fachliteratur sowie Rechtsprechung aufgebaute Diskussion. Dabei soll auch erörtert werden, ob hinsichtlich des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch (SGB II) [5] oder der Verwaltungsvorschriften ein rechts- bzw. verwaltungspolitischer Handlungsbedarf besteht.