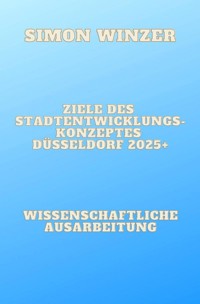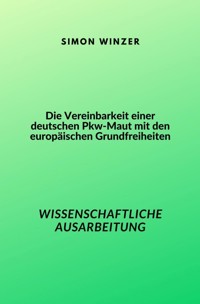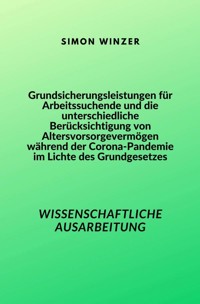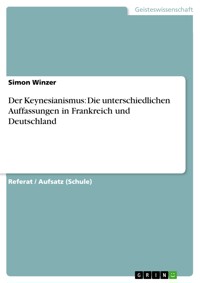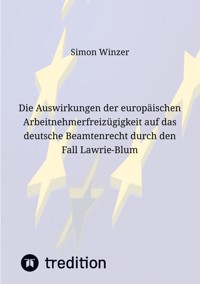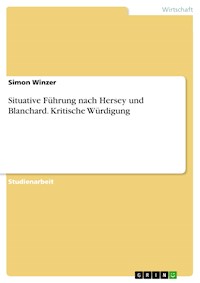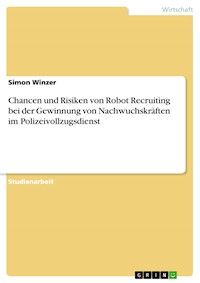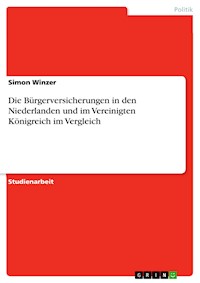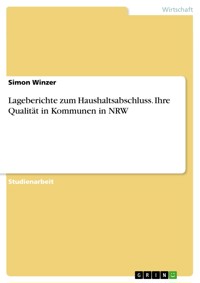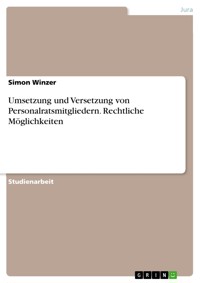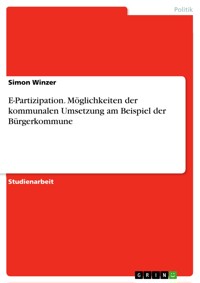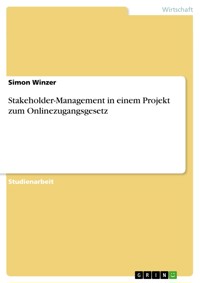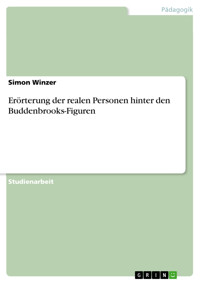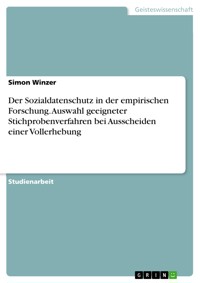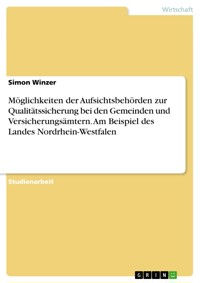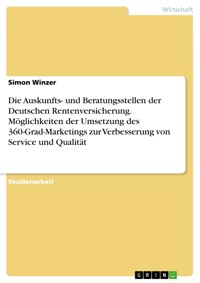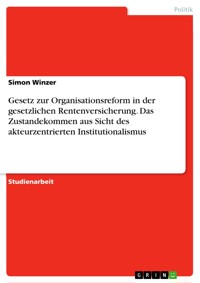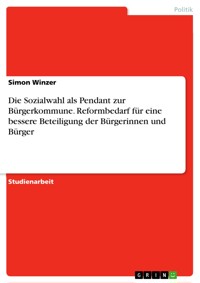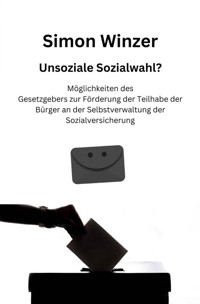
Unsoziale Sozialwahl? Möglichkeiten des Gesetzgebers zur Förderung der Teilhabe der Bürger an der Selbstverwaltung der Sozialversicherung E-Book
Simon Winzer
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
In diesem Buch wird eruiert wie die Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger inder Sozialversicherung erhöht werden kann. Neben Möglichkeiten zur Änderung des Wahlsystems wird erörtert wie sich die Konzepte der Bürgerkommune und der E-Partizipation auf die Sozialwahlen und das Selbstverwaltungsrecht der Sozialversicherungsträger übertragen lassen. Aus den hieraus gewonnenenErkenntnissen wird ein Gesetzesentwurf ausformuliert, der als Petition an den Deutschen Bundestag gerichtet wird. Damit wird das Ziel verfolgt, die Legitimität der Sozialwahlen und der Arbeit der Selbstverwaltungsgremien zu erhöhen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 88
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Unsoziale Sozialwahl? Möglichkeiten des Gesetzgebers zur Förderung der Teilhabe der Bürger an der Selbstverwaltung der Sozialversicherung
Simon Winzer
Rückertstr. 69
48165 Münster
Inhaltsverzeichnis
Hinweis zur gendergerechten Sprache
Einleitung
Problemstellung
Zielsetzung
Methode
Aufbau
Begriffliche und konzeptionelle Grundlagen
Sozialversicherung
Zweige
Historie
Rechtsstellung
Selbstverwaltung
Aufbau
Aufgaben
Vertreterversammlung
Vorstand
Geschäftsführung
Besonderheiten in der gesetzlichen Krankenversicherung
Sozialwahlen
Aktives Wahlrecht
Passives Wahlrecht
Allgemeine Voraussetzungen
Vereinigungslisten
Freie Listen
Wahlhandlung
Ordentliche Wahlen
Friedenswahlen
Bürgerkommune
Kundenrolle
Mitgestalterrolle
Auftraggeberrolle
E-Partizipation
E-Collaboration
E-Democracy
E-Community
Methodisches Vorgehen
Kritische Würdigung des Status-Quo
Fehlende Transparenz
Friedenswahl
Fehlende Wahl bei der Bundesagentur für Arbeit
Beauftragte von Vereinigungen
Fehlende Bürgerbeteiligung
Hürden für freie Listen
Geschlechterungerechtigkeit
Bekanntheitsgrad der Sozialwahl
Reformansätze
Alternative zur Friedenswahl
Erhöhung der Kandidatenanzahl
Bekanntheit der Sozialwahl
Beiblatt zur Renteninformation
Werbekampagnen
Informationsauftrag der Arbeitnehmer- und Arbeitgebervereinigungen
Unterrichtsinhalte in der Schule
Vereinfachungen für freie Vorschlagslisten
Reform der Regelung zu den Stützunterschriften
Reform der Regelung zu den Geschlechterquoten
Beteiligungsmöglichkeiten nicht gewählter Versicherter
Einrichtung eines Online-Selbstverwaltungsportals
Organisation
Bereitstellung
Registrierungsprozess
Informations- und Kommunikationsangebote
Streamangebot
Wissensmanagement und Foren
Mitbestimmungsmöglichkeiten
Online-Vorschlagslisten
Durchführung von Online-Wahlen
Wahlhandlung bei der Bundesagentur für Arbeit
Petition mit Gesetzesentwurf an den Deutschen Bundestag
Problem und Ziel
Lösung
Alternativen
Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand
Erfüllungsaufwand
Erfüllungsaufwand für die Bürger
Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft
Erfüllungsaufwand für die Verwaltung
Weitere Kosten
Gesetzesentwurf
Änderungen des Ersten Buches Sozialgesetzbuch
Änderungen des Dritten Buches Sozialgesetzbuch
Änderungen des Vierten Buches Sozialgesetzbuch
Änderungen des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch
Fazit und Ausblick
Quellenverzeichnis
Anhang
Anhang 1: Hinweis der Deutschen Rentenversicherung Bund auf die Sozialwahl
Anmerkungen
Hinweis zur gendergerechten Sprache
Aus Gründen der leichtbaren Lesbarkeit wird in der vorliegenden Ausarbeitung die gewohnte männliche Sprachform bei personenbezogenen Substantiven und Pronomen verwendet. Dies impliziert jedoch keine Benachteiligung des weiblichen Geschlechts oder anderer Geschlechter, sondern soll im Sinne der sprachlichen Vereinfachung als geschlechtsneutral zu verstehen sein.
Einleitung
„Die Selbstverwaltung ist kein Anachronismus und […] ein wesentliches Grundprinzip der Sozialversicherung und wird nicht durch eine geringe Wahlbeteiligung oder eine Friedenswahl delegitimiert.“ [1]
Mit diesen Worten kommentierte Rainer Schlegel, der Präsident des Bundessozialgerichts, im Herbst 2016 die im Frühjahr 2017 bevorstehenden Sozialversicherungswahlen [2]. Dabei haben die bei den Sozialversicherungsträgern versicherten Bürger sowie die Arbeitgeber alle sechs Jahre die Möglichkeit, die Mitglieder der Selbstverwaltungsgremien zu wählen und selbst zu kandidieren. Bei der Wahlhandlung gilt das Prinzip der Listenwahl, getrennt nach Arbeitgebern und Arbeitnehmern. [3] Die Gremien werden paritätisch aus beiden Gruppen besetzt. Die nächste Sozialwahl findet 2023 statt.
Problemstellung
Das System der Sozialwahlen steht immer häufiger in der Kritik. Insbesondere wird bemängelt, dass eine Kandidatur von Bürgern, die keiner Arbeitnehmer- oder Arbeitgebervereinigung angehören, aufgrund der hohen Anzahl an benötigten Stützunterschriften wenig Aussicht auf Erfolg hat. [4] Des Weiteren wird die sogenannte Friedenswahl kritisiert, die immer dann zum Einsatz kommt, wenn nur eine gültige Liste beim Wahlausschuss eingeht oder die Anzahl der Kandidaten der der maximal verfügbaren Sitze entspricht. Die Wahlvorschläge gelten dann als angenommen und eine Wahlhandlung findet nicht statt. [5] Bestrebungen einzelner Politiker zur Reform dieses Systems, beispielsweise durch den CDU-Bundestagsabgeordneten Kai Whittaker, [6] sowie entsprechende Anträge der Bundestagsfraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN [7] blieben bislang erfolglos.
Im Rahmen der Sozialwahlen 2017 lag die Wahlbeteiligung bei 30,42 Prozent mit einer Spannweite von 11,76 bis 67,6 Prozent bei den einzelnen Versicherungsträgern. [8] Dennoch war die Friedenswahl der Regelfall. Wenngleich seinerzeit 161 Sozialversicherungsträger existierten, fand lediglich bei zwei Renten- und sechs Krankenversicherungsträgern eine Wahlhandlung durch die Arbeitnehmer statt. [9] Das entspricht sechs Prozent aller Versicherungsträger. Zwar gab es 50,9 Millionen Wahlberechtigte, [10] da bei großen Versicherungsträgern wie der Deutschen Rentenversicherung Bund und den Ersatzkassen gewählt wurde. Das ändert aber nichts an der Tatsache, dass zahlreiche Bürger bei kleineren Versicherungsträgern gar nicht wählen durften. Diese hatten keine Möglichkeit, sich bei den Sozialwahlen einzubringen. Insbesondere gilt dies für jene Versicherte, die keiner Gewerkschaft angehören und für die eine Kandidatur mit hohen formalen Hürden verbunden wäre.
Vor diesem Hintergrund stellt sich – trotz der Aussage des Präsidenten des Bundessozialgerichts – die Frage nach der Legitimität der Sozialwahlen. [11] Fehlende Informations-, Gestaltungs- und Mitsprachemöglichkeiten können bei interessierten, aber nicht gewählten Bürgern zu Frust und Verdrossenheit führen. [12]
Zielsetzung
Ziel der vorliegenden Ausarbeitung ist es, Vorschläge für eine stärkere Legitimation der Selbstverwaltung zu entwickeln, um auf dieser Basis einen Gesetzesentwurf zu formulieren, der als Petition beim Deutschen Bundestag eingereicht wird. Beabsichtigt ist dabei, neben Ansätzen zur Veränderung des Wahlsystems das Konzept der Bürgerkommune und der E-Partizipation als Teil des E-Governments zu diskutieren und auf die Selbstverwaltung der Sozialversicherung zu übertragen. Sofern im Zuge dieser Ausfertigung der Schluss gezogen wird, dass umfangreichere Änderungen am Wahlsystem nicht sinnvoll sind, können sich hieraus gegebenenfalls Potenziale für eine stärkere Beteiligung der nicht in die Gremien gewählten Bürger ergeben. Dies könnte das Ansehen der Selbstverwaltung stärken und den Versicherten die Möglichkeit eröffnen, aktiv an den Geschicken des Versicherungsträgers teilzuhaben – ohne selbst gewählt zu sein.
Der zu formulierende Gesetzesentwurf soll sich an jenen des Bundestages orientieren. Thematisiert werden darin somit insbesondere das Problem und das Ziel, Lösungen, Alternativen, die Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand, der Erfüllungsaufwand sowie weitere Kosten. Hinsichtlich der anschließenden Formulierung neuer und der Umgestaltung bereits bestehender Gesetzestexte ist geplant, Vorschriften der Sozialgesetzbücher, insbesondere des SGB IV [13], zu ergänzen bzw. zu ändern.
Methode
Methodisch liegt dieser Arbeit im deskriptiven Part eine Literaturanalyse zugrunde. Anhand plausibilitätsgestützter Anregungen sollen daraus Möglichkeiten für ein Konzept zur Reform der Sozialwahl abgeleitet und in einen Gesetzesentwurf überführt werden. Die Methodik wird in Kapitel 3 detailliert beschrieben.
Aufbau
Für das Verständnis dieser Ausfertigung wird nachfolgend deren Verlauf aufbereitet.
Diese Schrift ist in sieben Kapitel gegliedert. Zunächst werden im zweiten Kapitel begriffliche und konzeptionelle Grundlagen deskriptiv erläutert sowie aufbereitet. Zu thematisieren sind dabei die Sozialversicherung, die Sozialwahl, die Bürgerkommune und die E-Partizipation. Sodann erfolgt im dritten Kapitel eine Beschreibung des dieser Arbeit zugrunde liegenden methodischen Vorgehens.
Daraufhin findet im vierten Kapitel eine intensive Auseinandersetzung mit der von Fachpersonen geübten Kritik an der Sozialwahl statt. Dabei wird diese in den Gesamtkontext eingeordnet und mittels plausibilitätsgestützter Überlegungen diskutiert. Gegenstand des fünften Kapitels sind Möglichkeiten zur Reform der Sozialwahl und zur stärkeren Einbindung der Bürger, ehe im sechsten Kapitel anhand der zuvor aufgezeigten Ansätze der besagte Gesetzesentwurf entwickelt wird. Die Arbeit schließt mit einem Fazit und einem Ausblick im siebten Kapitel ab.
Begriffliche und konzeptionelle Grundlagen
In diesem deskriptiven Kapitel werden die für die vorliegende Ausarbeitung relevanten Termini definiert. Zentral sind dabei die Begriffe ‚Sozialversicherung‘, ‚Selbstverwaltung‘, ‚Sozialwahl‘, ‚Bürgerkommune‘ und ‚E-Partizipation‘.
Sozialversicherung
Die deutsche Sozialversicherung ist Bestandteil des Sozialrechts und lässt sich hier dem Bereich der Vorsorge zuordnen. [14] Durch sie sollen allgemeine Lebensrisiken der Bürger, beispielsweise Krankheit, Arbeitslosigkeit oder Pflegebedürftigkeit, abgedeckt werden. [15] Dabei gelten die Prinzipien der Versicherungspflicht, der Beitragsfinanzierung, der Solidarität, der Äquivalenz und der Selbstverwaltung. [16]
In diesem Abschnitt werden die vier Zweige der Sozialversicherung, die Historie und die Rechtsstellung der Sozialversicherungsträger näher beschrieben.
Zweige
Die Zweige der Sozialversicherung sind in § 4 Absatz 2 Satz 1 SGB I [17] genannt. Sie umfassen die gesetzliche Kranken-, Pflege-, Unfall- und Rentenversicherung einschließlich der Alterssicherung der Landwirte. Die Rentenversicherung und die Alterssicherung der Landwirte gelten dabei als ein Versicherungszweig. [18] Nicht zur Sozialversicherung gehört hingegen die Bundesagentur für Arbeit. [19] Zwar lässt sie sich ihr rechtssystematisch zuordnen, sie wird jedoch in § 4 Absatz 2 Satz 1 SGB I nicht erwähnt und in Artikel 75 Absatz 1 Nr. 12 GG [20] zusätzlich zur Sozialversicherung aufgeführt. [21] Hinzu kommt, dass die Vorschriften zur Sozialwahl nach § 1 Absatz 1 Satz 2 SGB IV nicht für die Bundesagentur für Arbeit gelten.
Die Mitglieder der Selbstverwaltung werden nicht gewählt, sondern gemäß § 377 Absatz 1 SGB III [22] berufen. Dies erfolgt nach § 377 Absatz 2 Satz 1 SGB III durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales. Sozialwahlen finden daher bei den Agenturen für Arbeit nicht statt [23], obwohl die dort Versicherten Beiträge zahlen. Hintergrund hierfür ist, dass sich die Selbstverwaltung der Bundesagentur nach § 371 Absatz 5 Satz 1 SGB III drittelparitätisch aus Mitgliedern in Form von Arbeitnehmern, Arbeitgebern und öffentlichen Stellen zusammensetzt. „Bei den Vertretern der öffentlichen Körperschaften hat das Gesetz die unterschiedlichen Ebenen von Bund, Ländern und Gemeinden zu beachten. Dem trägt die Regelung des § 379 Absatz 2 SGB III Rechnung, der die Vorschlagsberechtigung für die Mitglieder der Gruppe der öffentlichen Körperschaften zwischen diesen drei Ebenen im Verhältnis 3:3:1 aufteilt. Ein Wahlverfahren wird daher im Hinblick auf die öffentlichen Körperschaften diesen unterschiedlichen Ebenen nicht gerecht und trägt auch nicht den Besonderheiten der BA [Bundesagentur für Arbeit] Rechnung.“ [24]
Bezüglich der Pflegekassen als Träger der gesetzlichen Pflegeversicherung ist zu konstatieren, dass ihre Aufgaben nach § 1 Absatz 3 SGB XI [25] von den gesetzlichen Krankenkassen wahrgenommen werden. Dabei entsprechen gemäß § 46 Absatz 2 Satz 2 SGB XI die Selbstverwaltungsorgane der Pflege- denen der Krankenkassen. Das führt zu zwei Besonderheiten: Erstens treffen die Mitglieder der Selbstverwaltungsgremien der Krankenkassen gleichfalls die Entscheidungen für die Pflegeversicherung. [26] Bei den Pflegekassen findet folglich keine eigene Sozialwahl statt. Zweitens sind nach § 20 Absatz 1 SGB XI die in der gesetzlichen Krankenversicherung pflichtversicherten Mitglieder ebenfalls in der Pflegekasse der Krankenkasse pflichtversichert. Die Pflegekasse entspricht damit der Krankenkasse eines Versicherten. [27]
Die Ausführungen in dieser Ausarbeitung betreffen lediglich die gesetzliche Kranken-, Pflege-, Unfall- und Rentenversicherung. Sofern nicht anders beschrieben, gelten die Darlegungen zur gesetzlichen Krankenversicherung ebenfalls für die gesetzliche Pflegeversicherung.
Historie
Die Ursprünge der Sozialversicherung liegen im Mittelalter. Bereits im 14. Jahrhundert schlossen sich erzgebirgische Bergleute zu Gesellschaften zusammen, die im 15. Jahrhundert den Namen ‚Knappschaft‘ erhielten. [28] Die Knappen zahlten wochenweise einen ‚Büchsenpfennig‘, der in das Kirchenvermögen floss. Als Gegenleistung wurden invalide Bergarbeiter bzw. deren Familien bei Krankheit, Invalidität oder im Todesfall versorgt. [29]
Die Sozialversicherung in ihrer heutigen Form existiert hingegen erst seit den 1880er-Jahren. Am 17. November 1881 verkündete Reichskanzler Otto von Bismarck die ‚Kaiserliche Botschaft Wilhelms I.‘. [30] Mit ihr wurden Gesetzesvorhaben zur Errichtung einer Sozialversicherung angekündigt. [31] Auf dieser Grundlage wurde 1883 die gesetzliche Kranken-, 1884 die gesetzliche Unfall- und 1889 die gesetzliche Rentenversicherung eingeführt. [32] In all diesen Zweigen der Sozialversicherung galt von Beginn an das Prinzip der Selbstverwaltung. [33] Allerdings wurden die Mitglieder der Selbstverwaltungsgremien zunächst nur ‚eingesetzt‘. Sozialwahlen, die den heutigen ähneln, sah erst die im Jahr 1911 in Kraft getretene Reichsversicherungsordnung [34] mit Wahlen ab dem Jahr 1913 vor. [35] Diese fanden ausschließlich bei den gesetzlichen Krankenkassen statt. Die hierbei gewählten Mitglieder wählten sodann die Selbstverwaltungsgremien der Unfall- und der Rentenversicherungsträger. [36] Zunächst existierten demnach mittelbare Wahlen. Dies ist in Abbildung 1 veranschaulicht.
Abbildung 1: Wahlverfahren bei den Sozialwahlen ab 1913. Eigene Abbildung in Anlehnung an Wissenschaftliche Dienste des Deutschen Bundestages, Fragen zur sozialen Selbstverwaltung, S. 7.
Schließlich wurde im Jahr 1927 die gesetzliche Arbeitslosenversicherung eingeführt. [37] Im Januar 1933 kam es aufgrund der Machtergreifung der Nationalsozialisten zu einem zwischenzeitlichen Ende der modernen Sozialversicherung. Die Selbstverwaltung wurde durch die NSDAP eliminiert. [38]
Nach Beendigung der NS-Diktatur fanden die ersten Sozialwahlen der Bundesrepublik Deutschland im Jahr 1953 statt. Das Wahlverfahren wurde seitdem nur unwesentlich verändert, wenngleich die Regelungen aus der Reichsversicherungsordnung 1977 in das SGB IV transferiert wurden. [39] Im Jahr 1994 beschloss der Deutsche Bundestag die Einführung der gesetzlichen Pflegeversicherung zum 1. Januar 1995. [40] Sie komplettierte die vier Zweige der Sozialversicherung, die noch heute existieren.