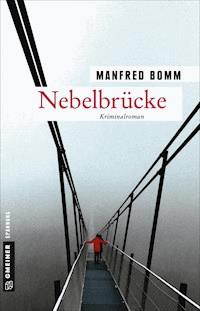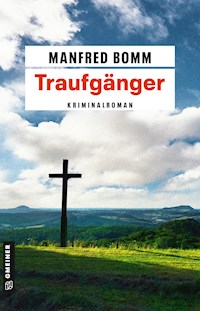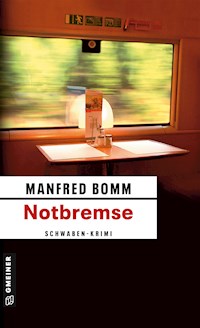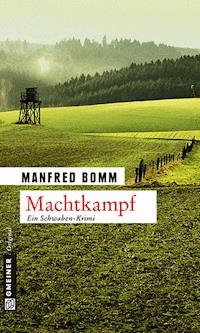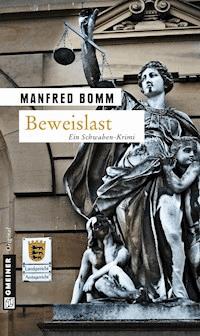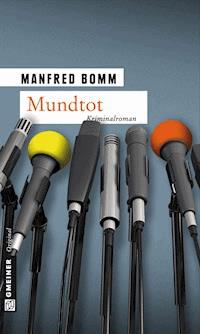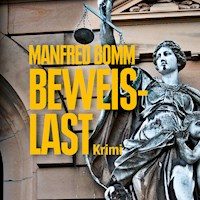Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Besinnliche, humorvolle und satirische Kurzgeschichten für jeden Monat des Jahres. Mitten aus dem Leben im Schwabenland gegriffen.
Das E-Book Grüß Gott im Ländle wird angeboten von Books on Demand und wurde mit folgenden Begriffen kategorisiert:
Satirisches, Nachdenkliches, Ironisches, Geschichten durchs Jahr, Schwabenland
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 174
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Grüß Gott im Ländle - kleine Geschichten durchs Jahr
Gedanken zum Januar
Februar
Der große Lügen-Prinz
MÄRZ
Schutzengel im Pfarrhaus
Merkwürdiger Hinweis
Verblödet und verbohrt
Mord im Morgengrauen?
APRIL
Neuer Banken-Service: Geldschein-Homedrucker
Wenn der Blaumann kommt…
MAI
Die Mär vom SUV und Stadtpanzer
Ungeduldig
JUNI
Sommermorgen im Ried
Juli
AUGUST
Immer mit der Ruhe - cool bleiben
Natur vor dem Haus
SEPTEMBER
Physik im Wanderbus
Rettet die Sprache!
OKTOBER
Meinungsfreiheit - ein hohes Gut
Alles kann schnell anders sein
Das große Klicken
NOVEMBER
Sind sie überall?
Der Elfte-Elfte
Gewalt kurz nach acht
DEZEMBER
Gedanken zum Schluss
Auf ein Wort
Grüß Gott im Ländle - kleine Geschichten durchs Jahr
Grüß Gott. So sagen wir Schwaben, wenn wir uns treffen. Manchmal aber auch nur „hallo“, was irgendwie weltmännischer und globaler klingt. Vor allem aber, was auch Nichtschwaben verstehen. Zugegeben, mancher „Fremdling“ - also aus Regionen fern ab der Schwäbischen Alb - tut sich ohnehin mit der Konversation schwer. Manches mag sich für ihn so anhören, als handle es sich um eine Fremdsprache.
Wer im fernen Schleswig Holstein wird schon wissen, was ein „Xälz“ ist, oder eine „Krombier“? Vom „Breschdleng“ schon ganz zu schweigen.
Keine Sorge, liebe Leser (auch weibliche sind gemeint), dieses Büchle enthält nichts, was Sie nicht verstehen. Auch wenn wir selbst einräumen, zwar vieles zu können, aber halt nicht Hochdeutsch.
Denn wir wollen ja im Kleinen auch zur Völkerverständigung beitragen und hoffen, dass man uns und unsere Mentalität versteht. Dass wir mehr sind, als die ewigen Sparer und Häuslesbauer. Aber derlei Vorurteilen haben wir längst energisch entgegen gewirkt. Immerhin gingen von uns einige umwälzende technische Erfindungen um die Welt. Ertüftelt von Leuten, die „Schwäbisch g’schwätzt hent“. Also: Was wär’ die Welt ohne uns Schwaben?
Um gleich gar kein Missverständnis aufkommen zu lassen: wenn ich vom „Schwaben“ rede, sind alle hier einheimischen und hierzulande gebürtigen Personen gemeint. Also auch jene weiblichen Geschlechts. Ich betone dies deshalb, weil in der deutschen Sprache Frauen schon immer Bürger, Schüler, Studenten, Mitarbeiter, Mitglieder und Autofahrer waren. Niemand hätte gewagt, das Gegenteil zu behaupten.
Umso mehr hat es mich - und vielleicht auch Sie - verwundert, dass sich die Frauen plötzlich absondern und sich sprachlich ins Abseits stellen. Dazu gibt es das wunderschöne Wort „Tschendern“ (geschrieben: gendern). Dies besagt, dass traditionell männliche Begriffe nicht automatisch auch für Frauen gelten sollen. Weshalb man neuerdings Texte und Reden umständlich in die Länge zieht - mit Formulierungen wie: „Zuhörerinnen und Zuhörer“, „Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter“, „Kundinnen und Kunden“ - und so weiter und so fort. Nachrichtensprecher oder Politiker verhaspeln sich meist, wenn sie bei den „Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten“ beinahe einen Knoten in die Zunge kriegen.
Noch schlimmer: In geschriebenen Texten wird die feminine Form mit einem Sternchen (*) angehängt.
Oder mit einem Senkrecht- oder Unterstrich getrennt. Die Verhunzung unserer schönen deutschen Sprache schreitet voran. Denn lesbar und sprechbar sind diese Sonderzeichen nicht. Man soll, so sagen die „Genderer“, zwischen männlicher und weiblicher Schreibweise einen „Gap“ einlegen, eine Pause also. Was sich dann so anhört, als habe man einen Schluckauf. Und weil manche Ober-Genderer diesen „Gap“ quasi verschlucken, hört sich alles so an, als sei nur die weibliche Form gemeint.
Ein Glück, dass es noch das Schwäbische gibt.
Unsere schwäbische Sprache ist ohnehin auf dem besten Wege, salonfähig zu werden. Denn wenn unser „Ländle“ erst im Kreise der Global Player eine noch größere Rolle spielt als bisher, dann wird jeder Manager, der was auf sich hält, nicht mehr zuerst Englisch reden müssen, sondern Schwäbisch. Dann verschwindet auch der großkotzige Begriff „COE“ wieder, was „Chief of Executive“ bedeutet und nicht etwa ein Exekutionskommando ist. In Wirklichkeit ist es halt jene Person, die sich in einem Betrieble besonders wichtig nimmt, was sich natürlich in der fürstlichen Entlohnung niederschlägt.
Klar, der Schwabe ist da doch eher bescheiden und zeigt nicht so gern, was er hat und sich leistet: „der Daimler“ steht in der klimatisierten Garage, das Zweit- oder Drittwägele - Polo oder Fiesta - parkt am Straßenrand. Ein echter Schwabe gibt sich zurückhaltend und protzt nicht. Er lässt gerne die „Großschwätzer von nördlich der Mainlinie“ angeben.
Wenn Champagner fließt, schlotzt der Schwabe lieber seinen „Württemberger“. Oder einen aus Baden.
Wer jemals irgendwo bei einer großen Reise mit anderen deutschen Touristen zusammengesessen ist, kennt das Spielchen zur Genüge: Irgendeiner beginnt beiläufig zu erzählen, was für ein toller Hecht er ist, besonders geschäftlich und im Umgang mit Aktien. Rein zufällig lässt er den Hinweis auf seinen Porsche oder auf mehrere absolvierte Kreuzfahrten fallen, bestenfalls auch auf eine Jacht, schwärmt von dem tollen Seeblick, das er vom heimischen Büro aus habe und klagt, wie komplex doch die Technologie des heimischen Pools sei. Der Schwabe hört zu, schweigt „ond denkt sei Sach.“ Übersetzt: er glaubt dem Schwätzer kein Wort. Manchmal grummelt er auch: „I sag nex, aber was i denk, isch furchtbar.“ (Ich sage nichts, aber was ich denke, ist furchtbar).
Dass nun die Landesregierung auf die grandiose Idee gekommen ist, das „Ländle“ marketingmäßig aufzumotzen, stammte sicher nicht von der „Miste eines Schwaben“ (so sagt man, wenn irgendein Unsinn verzapft wird). Um das (übrigens völlig verkehrte) Image, bieder, konservativ und eigenbrötlerisch zu sein, abzustreifen, musste eine Werbeagentur her.
Koste es, was es wolle. Man spricht von über 20 Millionen Euro. Ja, die Leutchen vom Format der Sprüche-Erfinder und Sprücheklopfer berechnen ihre Honorare und Aufwendungen nach Gehirn-Aktivitätsstunden. Und wer schon mal einen Handwerker gebraucht hat, weiß längst, was allein in diesem doch eher profanen Bereich eine Stunde kostet. Dabei braucht doch ein Handwerker „nur“ Hammer, Schraubenzieher, Schaufel, Pinsel und Farbe, allenfalls noch ein paar Maschinchen. Was ist das schon gegen das viele Hirnschmalz, das bei angestrengtem Nachdenken für einen neuen Slogan fürs Ländle fließen muss? Und dies Stunde um Stunde. Schweißtreibend, am Schreibtisch hängend. Bei einem Sekundenlohn von schätzungsweise 300 läppischen Euro plus Mehrwertsteuer. Mindestens.
Was dabei herausgekommen ist, darf als geradezu revolutionär bezeichnet werden. „Koiner hätt’s denkt“, staunt der dumme Schwabe (übersetzt: keiner hätt’s gedacht) über das, was da einige Nichtschwaben aus nordischen Gefilden zusammengebastelt haben: „The Länd.“ Schwänglisch. Also ein Kauderwelsch aus Schwäbisch und Englisch.
Okay, dieser geniale Einfall soll ja Fremdlinge auf das Schwabenland aufmerksam machen - da muss es schon irgendwie „internäschnel“ (international) klingen. Nur weshalb man gleich euphorisch wochenlang das ganze „Ländle“ mit grell-gelben Plakaten dieser Aufschrift zugekleistert hat, darüber darf gerätselt werden. Wo doch kein Schwabe jemals dieses unglückselige englische „Ti-eitsch“ (das „th“) hat aussprechen können, ohne die Zungenspitze zwischen Schneidezähnen und Unterkiefern in äußerste Gefahr zu bringen. Oder sein Gegenüber unbeabsichtigt zu „duschen“ oder, noch schlimmer, im hohen Bogen das künstliche Gebiss hinauszuschleudern.
Außerdem hat keiner dieser Slogan-Erfinder bedacht, dass „the länd“ zwar ausländisch klingt, man aber wohl außerhalb des deutschen Sprachraums nur selten ein „Ä“ - also einen Umlaut - auf der Computertastatur findet. Nur unter „Sonderzeichen“, von denen kein Mensch weiß, unter welcher Tastenkombination sie versteckt sind. Bei Apple oder Microsoft.
Egal, wie man’s schreibt, wie man’s ausspricht oder wie man drüber denkt: ich sage allen, die dieses Büchle lesen und sich damit humorvoll, nachdenklich und besinnlich durchs Jahr begleiten lassen: „Wellkamm in the Länd.“
Eigentlich brauchen wir gar keinen Slogan. Denn wer nicht weiß, wie schön unser „Länd“ ist, ist selber schuld. Und außerdem sind wir sowieso lieber unter uns. Dann brauchen wir gleich gar kein „astreines Hochdeutsch“ zu versuchen. Jedenfalls ist „the Länd“ das ganze Jahr über traumhaft: bei Schnee auf den Hochflächen, bei Sonne in den Flusstälern und auf der Alb - und, natürlich, am Bodensee. Wobei man natürlich ehrlicherweise sagen muss, dass die genaue geografische Abgrenzung nicht unbedingt etwas mit den Grenzen Baden-Württembergs zu tun hat. Es gibt ein Oberschwaben, womit etwa die Gegend zwischen Donau und dem nördlichen Bodensee-Bereich gemeint ist - und es gibt das Bayrisch-Schwaben, das östlich über die Landesgrenze Richtung Augsburg reicht.
Die typischen Schwaben nordet man gerne ins württembergische Gebiet ein (überwiegend nördlich der Donau Richtung Stuttgart). Wobei heutzutage niemand mehr so genau die Abgrenzung kennt. 1952 ist Baden-Württemberg (nach einer sehr komplizierten politischen Geburt) durch den Zusammenschluss der viel kleineren Vorgängerländer Württemberg-Baden, Württemberg-Hohenzollern sowie Baden entstanden.
Anfangs hatte es nicht den Anschein, als wachse zusammen, was zusammen gehöre. Persönliche Befindlichkeiten von Politikern hatten schon damals eine Rolle gespielt. Im badischen Freiburg stichelte man gegen das wohlhabende württembergische Stuttgart. Auch heute noch überzieht man sich bisweilen mit Spott und Häme. Wie man so weiß, mögen es die Badener gar nicht, als „Badenser“ tituliert zu werden. Bisweilen nennt man sie auch „Gelbfüßler“, wozu das Internet-Lexikon Wikipedia zu berichten weiß, die Bezeichnung gehe auf die württembergischen Weinbauern des Unterlandes zurück, die gelbe hirschlederne Hosen tragen. Oder es bezieht sich auf die Farbe der uniformartigen Bekleidung der Hofbediensteten.
Wo aber nun wird das Schwäbische geschwätzt? Um es gleich klarzustellen: das „richtige“ Schwäbisch gibt es gar nicht. Es besteht aus vielen Dialekten, die sich teilweise nur in Nuancen und teilweise schon von Ort zu Ort unterscheiden. Eingrenzen kann man also den Sprachraum vom Mittleren Neckarraum übers Oberschwäbische bis übers Allgäu ins Bayerische. Nur Insider vermögen herauszuhören, zu welcher Region das Gehörte gehört.
Doch egal, wie man schwätzt: zu jeder Jahreszeit hat „the Länd“ etwas zu bieten: Wintersport im Schwarzwald oder an schneebegünstigten Nordhängen der Schwäbischen Alb, hinter die sich die Sonne zurückzieht. Denn wenn sie im Januar noch tief hinterm Horizont steht, werfen die Berge lange Schatten. Dann ist die Zeit, dass sie bald wieder höher steigt. Vom ersten bis zum letzten des Monats Januar steht die Sonne bereits über eine halbe Stunde länger überm Horizont. Sofern man den vor lauter Berge sieht.
Gedanken zum Januar
Es liegt etwas Drohendes in der Luft. Kaum ist es Mittagszeit, hat es schon wieder zu dämmern begonnen. Als ob es mit der Erde zu Ende ginge. Als würde sich die Sonne langsam zurückziehen und sich allmählich ganz verabschieden. Seit Wochen schon war sie nur noch knapp über dem Horizont zu sehen - und dort, wo es Berge gab, warf sie lange Schatten, hinter dem sie verbogen blieb. Das verhieß nichts Gutes. Ginge dies so weiter, würde in wenigen Monaten das wärmende Licht vollends ganz erlöschen.
Und niemand würde etwas dagegen unternehmen können. Falls der Planet aus dem Gleichgewicht dieser Urkräfte käme, würde die Schöpfung die ganze Quelle ihres Lebens verlieren.
Die Tiere und Pflanzen haben sich längst zurückgezogen - so, als stünde etwas Dramatisches, etwas unaufhaltsam Endgültiges bevor. Es ist still geworden, auch in den Wäldern. Nur vereinzelt wagt es eine aufgeregte Krähe, einen krächzenden Laut von sich zu geben. Ein schauriger Schrei. Vielleicht ein Hilferuf. Einige Spatzen und Meisen streiten im farblosen Park begierig um ein paar Körner. Als sei es der verzweifelte Versuch, dem Untergang noch zu entgehen.
Pfützen sind zugefroren, eisige Kälte hat sich übers Land gelegt. Die Bäume haben längst all ihr Laub verloren und die Tannen auf den Bergen sind weiß-glänzend überzogen, als bereiteten sie sich für den Übergang in eine andere Zeit vor.
Nur die Menschen, so scheint es, taten noch immer so, als gehe sie dies alles nichts an. Im Gegenteil: Ihre Hatz und ihr Stress vergrößerten sich von Tag zu Tag. Je dunkler es wurde, desto emsiger vertieften sie sich in ihre Arbeit. Sie vergaßen sogar, sich an dem Lichterglanz zu erfreuen, am zaghaften Versuch, in die stets länger werdende Dunkelheit wenigstens ein bisschen Helligkeit zu bringen. Es war noch Nacht, wenn sie morgens zur Arbeit fuhren - und es war schon wieder Nacht, wenn sie am Nachmittag müde nach Hause kamen. Und wenn sie am Wochenende ein paar freie Stunden hatten, lag dichter, farbloser Nebel auf dem Land, weil die Sonne die Feuchtigkeit nicht mehr aufsaugen konnte.
Alles war nass oder gefroren. Jeder Atemzug ein feucht-kalter Luftstrom. Und jeder Schritt führte über eine glitschig braune Masse, zu der das einst grüne Laub vermoderte. Leise legt sich Schnee darüber.
Die Sonne hatte alles im Stich gelassen, was im Sommer lebendig gewesen war. Was es bedeutete, kein Licht und keine Wärme zu haben, wurde überall in der Natur sichtbar. Die hohe Zeit der Moose und Pilze schien anzubrechen. Die letzte erfrorene Rose war vor wenigen Tagen geknickt.
Es war, als wolle die Sonne diesen Platz der Erde vergessen, um andere Orte zu beglücken - Orte jedenfalls, die gerechterweise auch ein bisschen Wärme und helles Licht erhalten sollten. In einer Gegend, die hiesige Menschen ein bisschen verächtlich mit „unten“ bezeichneten. Obwohl es da draußen im Nichts des Weltalls nicht wirklich ein „oben“ oder „unten“ gab. Es kam auf die Betrachtungsweise an.
Des einen Leid, des anderen Freud.
Mein Gott, von welchem Kulturschock wird man ereilt, wenn man in diesen Wochen „die Menschen da unten“ besucht, also jene, die südlich des Äquators leben. Die in Sidney beispielsweise, wo in der Fußgängerzone völlig deplatziert ein rotgewandeter Weihnachtsmann sitzt - in der Hitze eines Dezember-Sonnentages. 35 Grad im Schatten. Und in den Schaufenster-Dekorationen winterliche Szenerien mit künstlichem Schnee. Musik von „White Christmas“. Erinnerungen werden auch an einen Thailand-Urlaub wach, als zu dieser Zeit am Hotel-Pool in brütender Hitze mehrmals täglich „Let it snow“ aus dem Lautsprecher tönte. Völliger Irrsinn dann die Skihalle in Dubai. Dicke Glasscheiben trennen die gekühlte Schneepiste vom gnadenlosen Klima der Wüstenstaates.
Ja, auch auf den Kanaren, die zwar auf nördlichen Breitengraden liegen, aber trotzdem einen günstigeren Winkel zur tief stehenden Sonne haben, wird winterliche Weihnachtsseligkeit verbreitet. Aus vielen Lautsprechern erklingt „Felice Navidad“.
An all dies mag man ein bisschen wehmütig denken, wenn heimische Gefilde ins Abseits der Sonne gesunken sind und wenn man darüber nachzugrübeln beginnt, wer dieses Kommen und Gehen unserer lebenswichtigen Wärmequelle so exakt eingerichtet hat. Wie ein Uhrwerk, das nicht mit filigranen Zahnrädchen (oder digitaler Steuerung) angetrieben wird, sondern das aus gewaltigen Kolossen besteht, die von kosmischen Kräften in ihren Umlaufbahnen gehalten werden. Mit atemberaubender Geschwindigkeit und präziser Rotation um die eigene Achse.
Dies allein hätte uns zur Zeitmessung gereicht: einmal um die Sonne ist ein Jahr. Und einmal um die eigene Achse ein Tag. Ergibt rund 365 Tage. Doch für den Auf- und Abstieg der Sonne also für die Jahreszeiten, bedurfte es noch eines weiteren Kniffs. Diesen haben wir der schräg stehenden Erdachse zu verdanken. Laienhaft ausgedrückt: die Achse unseres Planeten zwischen Nord- und Südpol steht nicht im rechten Winkel zur Sonne. Diese schräge Konstellation - wodurch und weshalb sie auch eingerichtet worden sein mag - führt dazu, dass im Laufe eines Jahres mal die nördliche und mal die südliche Erdhalbkugel stärker von der Sonne beschienen wird. Und zwar mit der Präzision eines Uhrwerks.
Wer in einem tief eingeschnittenen Gebirgstal wohnt, kann in der misslichen Lage sein, dass die tief stehende Sonne während der Winterwochen gar nicht über den Berg reicht. Die Betroffenen können aber dank der Himmelsmechanik genau sagen, wann sie verschwindet und wann sie wieder auftaucht. Und zwar auf den Tag genau. Jahrein, jahraus. Seit Jahrmillionen. Und so wird es noch einige Milliarden Jahre weitergehen. So lang die Sonne besteht.
Das bringt Trost für alle, die in winterlicher Dunkelheit die helle Zeit herbeisehnen. Sie können drauf vertrauen, dass es ab dem 22. Dezember wieder der Sonne entgegen geht. Auch wenn es anfangs nur wenige Minuten sind, so glaubt man doch, die Aufbruchstimmung zu spüren. Bald schon werden auch die Vögel wieder aktiver und wenn der Winter nicht allzu grimmig wird, wagen sich in sieben Wochen bereits die ersten Pflänzchen aus der Deckung. Kraftvoll bohren sie sich durch das vermoderte Laub des Waldbodens. Die Natur ist lässt sich nicht bezwingen. Ihr ewiges Spiel beginnt von neuem. Zuverlässig und mit der Gewissheit, dass kein Winter so kalt und dunkel sein kann, dass nicht irgendwann ein wärmendes Licht die Natur erwachen lassen könnte. Ein wunderbares System, in dem alles weiß, wann die richtige Zeit gekommen ist.
Und was wäre, wenn es keinen Winter gäbe? Würden wir uns noch auf eine blühende Blumenwiese freuen, auf das frische Grün der Wälder und auf die Lebendigkeit der Natur, wenn das ganze Jahr über Sommer wäre?
Wer wachsam durch die Natur streift, wird im Wechsel der Jahreszeiten nahezu täglich Neues entdecken. Es kann ganz schön spannend sein, dieses Wunder der Schöpfung zu beobachten.
Je nachdem, ob die Sonne - von der Erde aus gesehen - am Tag ihres tiefsten Wendepunkts vor oder nach Mitternacht diese Konstellation erreicht, kommt entweder dem 21. oder dem 22. Dezember eine ganz besondere Bedeutung zu: er symbolisiert uns, dass es nach jedem Tiefpunkt wieder aufwärts geht. Ganz sicher.
Februar
Stillstand. Nichts bewegt sich, nichts rührt sich.
Nur vielleicht mal eine verängstigte Meise am Vogelhaus, bisweilen ein paar quirlige Spatzen. Im Schutze der langen Dunkelheit huscht ein Mäuschen aus den Spalten einer Natursteinmauer. Nachbars Katzen hegen zwar Verdacht, scheinen aber keine Geduld zu haben. Vielleicht ist es ihnen auch einfach zu kalt. Sie tapsen irgendwie lustlos ums Haus. Die Luft feucht, das Erdreich gefroren. In schattigen Ecken das langweilige Weiß des Schnees.
Doch gerade jetzt, da im Jahreslauf der Tiefpunkt überschritten ist, macht sich Hoffnung breit, die uns allen signalisiert: wenn man ganz tief unten ist, kann es nur noch aufwärts gehen. An diesen eisigen Tagen Anfang Februar scheint die Natur Luft zu holen und sich langsam aus der winterlichen Lethargie herauszuschälen. Noch ist der Blick in den Garten grau und trübe, die Wälder drumrum sind kahl und der mancherorts erst zaghaft von der Sonne erwärmte Boden sumpfig. Auf der vermoderten Pracht des Sommers fühlen sich die Tritte weich wie auf einem Teppich an. Doch am Himmel gibt noch immer viel zu oft ein graues Tuch der kurzen Tageshelle keine Chance.
Wo sind sie jetzt hin, die krabbelnden Käfer und Würmer, die zerbrechlichen Falter und die Kröten und Molche? Wo die lästigen Schnecken, die summenden Bienen und die brummenden Wespen? Was ist mit den bunten Blumen geschehen, deren abgeschnittenen oder geknickten Stängel noch aus frostiger Erde ragen?
Die Kraft und Energie hat sich in Knollen und Wurzeln zurückgezogen. Eier, Larven und Kleingetier verharren versteckt und sicher verpackt im Untergrund, bis kräftigere Sonnenstrahlen einen neuen Anfang versprechen.
Es ist Lichtmess. 2. Februar. Wer auf Anhöhen oder in weitem Land wohnt, wo die Sicht vom Horizont zu Horizont reicht, wird diese Aufbruchstimmung kaum spüren. Ja, die Sonne ist ein paar Monate tiefer gestanden, später auf- und früher untergegangen.
Auch die Schatten waren länger. Aber sie war da, die Sonne - wenn kein grau-trister Vorhang gespannt war.
In den Tälern hingegen lagen lange Schatten und dauerhafte Düsternis. Hier blieb die Sonne wochenlang hinter den steil aufragenden Hängen verborgen.
Die Menschen in den Tälern wissen es deshalb zu schätzen, dass zu Lichtmess die Sonne bereits wieder an Höhe gewonnen hat. Sie haben erkannt, wie es ist, im Einklang mit der Natur zu leben, nicht natur-entwöhnt zu sein und die Himmelsmechanik zu kennen. Sie haben es zu schätzen gelernt, sich auf die wieder zurückgekehrte Sonne freuen zu können.
Lichtmess ist für viele Tal-Bewohner so eine Art Wendezeit. Sie können darauf vertrauen, dass die mächtigen Himmelskörper sekundengenau ihre Bahnen ziehen und sich wie ein Uhrwerk drehen. An Lichtmess markiert die Sonne am Horizont einen Punkt, an dem sich viele Schatten-Bewohner orientieren. Ist sie schon überm Berg oder scheint sie erst durch die bewaldete Hangkante? Oder hat sie es bereits geschafft? Dann wird ihre Bahn von Tag zu Tag einen höheren und somit längeren Bogen beschreiben. Die Berge verlieren ihre langen, kühlende Schatten. Nur vier Wochen noch, dann zieht der Frühlingsmonat März ins Land. Eine neue Lebendigkeit beginnt - mit all der Faszination, die uns das lebensfreundliche Zusammenspiel unseres Planeten mit der Sonne beschert. Alles nur ein Zufall? Oder das geniale Wirken einer unergründlichen Schöpfung, die es zu schützen gilt.
Februar bedeutet neues Licht und Aufbruch. Und Fasching. Ein bisschen Abwechslung vom Alltag.
Zum Beispiel in einem „Wirtschäftle“, wie wir Schwaben zu sagen pflegen. In einer „Boiz“. Wobei es für diesen Begriff keine adäquate hochdeutsche Übersetzung geben kann. Zumal „Boiz“ sogar zwei völlig gegensätzliche Bedeutungen hat. Die offizielle Bezeichnung für „die Beize“ ist zwar „gewöhnliches Wirtshaus, Kneipe.“ Doch im Schwäbischen kann eine „Boiz“ zweierlei sein: Erstens eine Art Spelunke und zweitens schmeichelhaft für ein sehr schönes „Wirtschäftle“ mit nettem Ambiente. Wie so oft im Schwäbischen, kommt es auf die richtige Betonung und das richtige Adjektiv an. Wenn jemand sagt „des isch a schlemme Boiz“ (das ist eine schlechte Kneipe), dann muss auch der Tonfall entsprechend abwertend sein. Sagt aber jemand: „I bin dr Letzte en dr Boiz“ („Ich bin der letzte in der Kneipe“), dann fühlt er sich dort besonders wohl. Vermutlich nicht nur im Fasching. Und der Letzte im „Wirtschäftle“ zu sein, hat ja auch seine Vorteile. Dann kann man nicht zum Gespött eines noch sitzen gebliebenen Lästermauls werden.