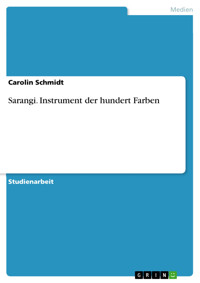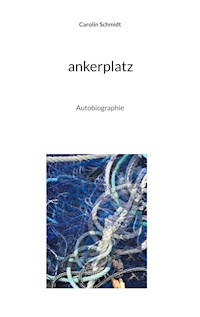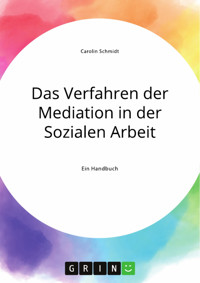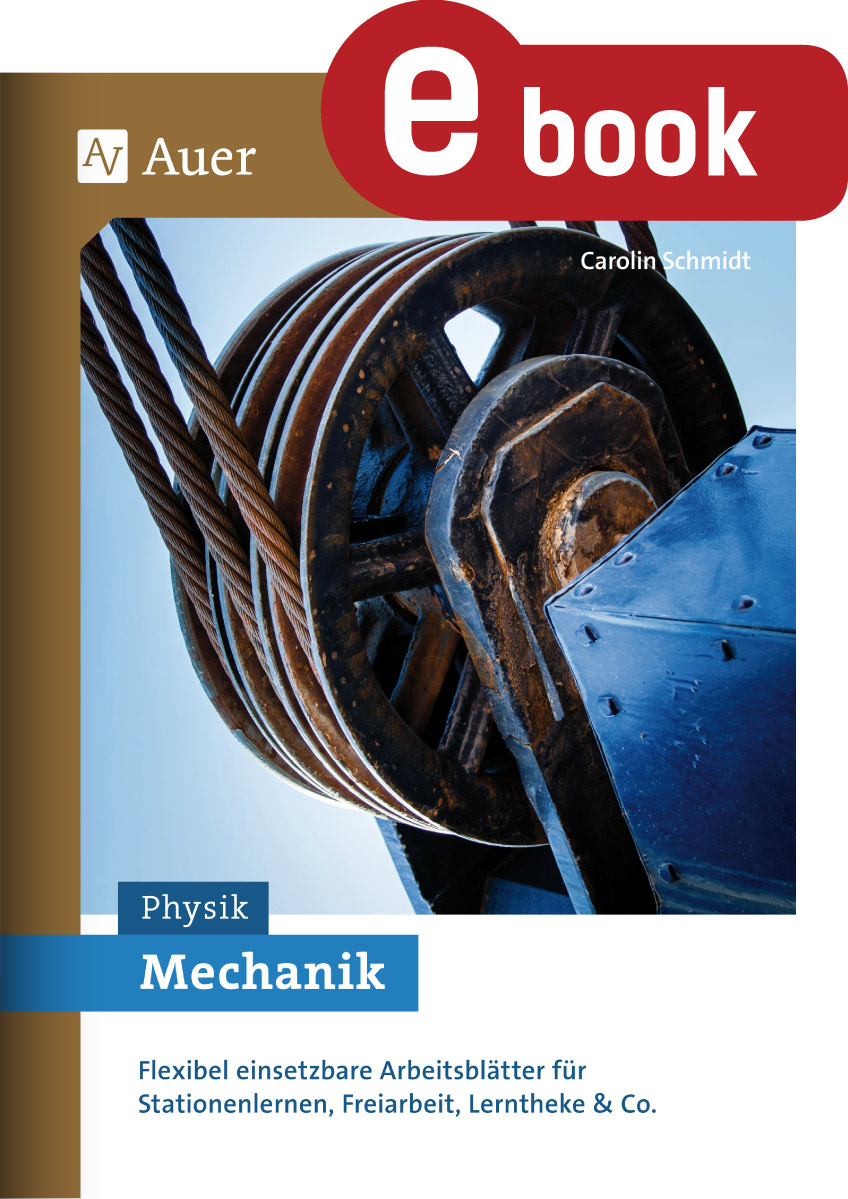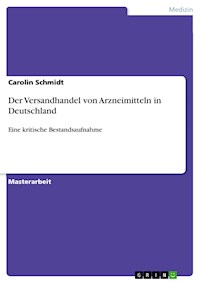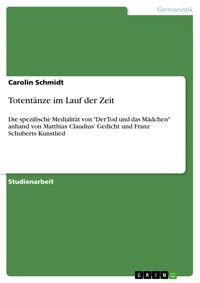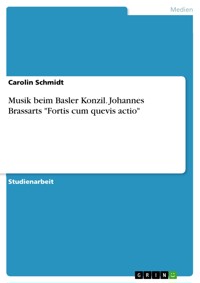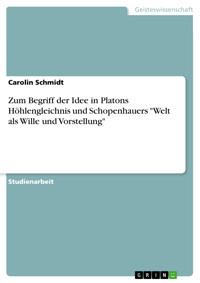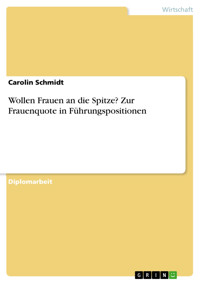18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: GRIN Verlag
- Sprache: Deutsch
Bachelorarbeit aus dem Jahr 2012 im Fachbereich Musik - Sonstiges, Note: 2,8, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, Sprache: Deutsch, Abstract: Im neuen Zeitalter der Ars nova entstanden neue kompositorische Entwicklungen, sowie eine erweiterte Mensuralnotation, durch die der Rhythmus noch besser notiert werden konnte. Mit Guillaume de Machaut, als einen der Hauptvertreter dieser Epoche, entstanden zahlreiche mehrstimmige Liedformen wie Balladen und Virelais. Zwar erreichte die Mehrstimmigkeit bereits während der Notre- Dame Epoche einen Höhepunkt, jedoch erschwerte die damalige Modalnotation die Darstellung der Tondauern, sodass der entscheidende Schritt zur Mensuralnotation unternommen werden musste. Kennzeichnend für die Ars nova sind die isorhythmische Motette, welche die Grundlage für Machauts Messe de nostre Dame bietet, sowie der erweiterte Conductus. Während in zwei der sechs Messeteile ein conductusartiger Satz zugrunde liegt, der frei durchkomponiert wurde, so herrscht in den übrigen Teilen das Prinzip der Isorhythmie. „Strenge Durchführung eines Choraltenors findet sich im Kyrie, Sanctus, Agnus und Deo gracias. So gestaltet Machaut hier einen Großzyklus, der im 14. Jh. nirgends ein Gegenstück hat.“ Im Folgenden wird auf die Epoche der Ars nova genauer eingegangen, sowie auf Machauts literarisches und musikalisches Schaffen. Den Mittelpunkt der Arbeit bildet seine einzig komponierte Messe La messe de nostre Dame, anhand der, die typischen Kompositionsmittel der Ars Nova genauer dargestellt werden. Im Zentrum der Messe steht die Isorhythmie als komplexes Kompositionsgerüst, welche unterschiedliche Verbindungen der Messeteile herstellt. Ohne diese isorhythmischen Geflechte wäre Machauts Messe nicht zu einer solch komplexen und damit einzigartigen Messe geworden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Impressum:
Copyright (c) 2015 GRIN Verlag / Open Publishing GmbH, alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten nur mit Genehmigung des Verlags.
Bei GRIN macht sich Ihr Wissen bezahlt! Wir veröffentlichen kostenlos Ihre Haus-, Bachelor- und Masterarbeiten.
Jetzt beiwww.grin.com
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Ars nova
2.1 Die neue Kunst
2.2 Neue kompositorische Entwicklungen
2.3 Kritik am modernen Stil
3. Guillaume de Machaut
4. La Messe de nostre Dame
4.1 Allgemeines zur Messe
4.2 Kyrie
4.2.1 Kyrie I
4.2.2 Christe
4.2.3 Kyrie II
4.2.4 Kyrie III
4.2.5 Ergebnis
4.3 Gloria
4.3.1 Gloria Amen
4.4 Credo
4.4.1 Credo Amen
4.4.2 Ergebnis
4.5 Sanctus
4.5.1 Ergebnis
4.6 Agnus Dei
4.6.1 Agnus I/III
4.6.2 Agnus II
4.6.3 Ergebnis
4.7 Ite, missa est
4.7.1 Ergebnis
5. Schluss
Literaturverzeichnis
1. Einleitung
Im neuen Zeitalter der Ars nova entstanden neue kompositorische Entwicklungen, sowie eine erweiterte Mensuralnotation, durch die der Rhythmus noch besser notiert werden konnte. Mit Guillaume de Machaut, als einen der Hauptvertreter dieser Epoche, entstanden zahlreiche mehrstimmige Liedformen wie Balladen und Virelais. Zwar erreichte die Mehrstimmigkeit bereits während der Notre- Dame Epoche einen Höhepunkt, jedoch erschwerte die damalige Modalnotation die Darstellung der Tondauern, sodass der entscheidende Schritt zur Mensuralnotation unternommen werden musste. Kennzeichnend für die Ars nova sind die isorhythmische Motette, welche die Grundlage für Machauts Messe de nostre Dame bietet, sowie der erweiterte Conductus. Während in zwei der sechs Messeteile ein conductusartiger Satz zugrunde liegt, der frei durchkomponiert wurde, so herrscht in den übrigen Teilen das Prinzip der Isorhythmie.[1] „Strenge Durchführung eines Choraltenors findet sich im Kyrie, Sanctus, Agnus und Deo gracias. So gestaltet Machaut hier einen Großzyklus, der im 14. Jh. nirgends ein Gegenstück hat.“[2]
Im Folgenden wird auf die Epoche der Ars nova genauer eingegangen, sowie auf Machauts literarisches und musikalisches Schaffen. Den Mittelpunkt der Arbeit bildet seine einzig komponierte Messe La messe de nostre Dame, anhand der, die typischen Kompositionsmittel der Ars Nova genauer dargestellt werden. Im Zentrum der Messe steht die Isorhythmie als komplexes Kompositionsgerüst, welche unterschiedliche Verbindungen der Messeteile herstellt. Ohne diese isorhythmischen Geflechte wäre Machauts Messe nicht zu einer solch komplexen und damit einzigartigen Messe geworden.
2. Ars nova
2.1 Die neue Kunst
Mit dem Beginn des 14. Jh. ging die Epoche der Ars antiqua (alte Kunst) in die der Ars nova (neue Kunst) über. Der Begriff Kunst „betrifft im Falle von Ars antiqua und Ars nova die Notation, die musikalische Notenschrift und die mit ihr verbundenen Prinzipien der rhythmischen Gestaltung einer Komposition.“[3] Die Modalnotation in der Ars antiqua ist „die Aufzeichnung der rhythmisch-metrisch organisierten Musik, […]“ und „stützt sich auf das Zeichensystem der Quadratnotation.“[4] Notenwerte wie Longa, Brevis und Semibrevis waren bereits bekannt. Diese hatten einen besonderen Stellenwert. „Eine Longa lässt sich […] in drei Breven untergliedern, eine Brevis in drei Semibreven.“[5] Diese Dreiteiligkeit stellt eine zeitliche Vollendung, eine perfectio, dar und gilt als musikalisches Abbild der Dreifaltigkeit Gottes.[6] Jedoch konnte der Rhythmus, sowie zeitlicher Notenwert nicht exakt notiert werden. Lediglich der Modus konnte anhand von Ligaturen ermittelt werden.[7]
Bereits die Theoretiker des späten 13. Jahrhunderts erblickten darin einen Mangel, und sie vollzogen den entscheidenden Schritt zu einer Mensuralnotation, in der das (relative) zeitliche Maß einer Note – ihre Dauer also – durch ihre grafische Gestalt ausgedrückt wird.[8]