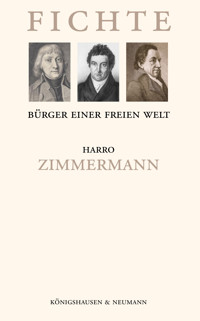Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Osburg Verlag
- Kategorie: Poesie und Drama
- Sprache: Deutsch
Umstritten wie er war, vielfach gelobt und oft niedergeschrien – Günter Grass hat in der Kultur- und Demokratiegeschichte dieses Landes Zeichen gesetzt. Kaum ein anderes Kunst- und Literaturlebenswerk hat nach 1945 die politischen, kulturellen und mentalitären Auf- und Abschwünge der Bundesrepublik in vergleichbarer Repräsentanz widergespiegelt und beeinflusst. Nach Jahrzehnten der Machtperversion des Nationalen war es der 32-jährige Autor aus dem verlorenen Danzig, der das durch Nazi-Wahn, Holocaust und Krieg ruinierte Deutschland in der Blechtrommel zur Kenntlichkeit brachte. Dieser höchst irritierende Roman konnte im Adenauer-Deutschland nur einen Skandal auslösen. In Grass' biographischem Profil – vom surrealistischen Wortkünstler zur Zentralfigur der literarischen Opposition, vom SPD-Wahlkämpfer zum ›Wappentier‹ der Republik, vom geistigen Repräsentanten der rot-grünen Regierungsära zum »vaterlandslosen« Kritiker der deutschen Un-Einheit, vom Waffen-SS-Streit zum Antisemitismus-Vorwurf – spiegeln sich wichtige Phasen der deutschen Diskurs- und Mentalitätsgeschichte nach 1945. Im Blick auf Grass' Lebenswerk und Wirkung als Künstler und Intellektueller ist in diesem Buch vom ›Nationalautor‹ die Rede, ja vom Dichter der deutschen Einheit, lange bevor sie Wirklichkeit werden konnte. Harro Zimmermann legt die erste große Biographie des Blechtrommel-Autors vor. Die internationale Forschung zu Günter Grass und sein umfangreicher Nachlass werden in diesem Buch aufgearbeitet, zahlreiche seiner Wegbegleiter, Kritiker und Zeitzeugen kommen zu Wort.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1441
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Hans Grunert, Günter Grass in seiner Werkstatt, ›Ulvshale‹ (2002)
Harro Zimmermann
Günter Grass
Biographie
Osburg Verlag
Der Band enthält in der Buchmitte einen achtseitigen Bildteil zur künstlerischen Arbeit von Günter Grass.
Erste Auflage 2023
© Osburg Verlag Hamburg 2023
www.osburgverlag.de
Alle Rechte vorbehalten,
insbesondere das der Übersetzung, des öffentlichen Vortrags sowie der Übertragung durch Rundfunk und Fernsehen, auch einzelner Teile.
Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder andere Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Lektorat: Bernd Henninger, Heidelberg
Korrektorat: Alexander Blumtritt, Fischbachau
Umschlaggestaltung: Judith Hilgenstöhler, Hamburg
Satz: Hans-Jürgen Paasch, Oeste
Druck und Bindung: CPI books GmbH, Leck
Printed in Germany
ISBN 978-3-95510-332-3
eISBN 978-3-95510-350-7
Margot, Mathias, Maike und Moritz gewidmetin unserer Zeitund für später
Auch meinem Großvater Wilhelm Giese,der mich früh ahnen ließ,was es mit Büchern auf sich habe
Unter den großen Schriftstellern der Welt ist er
der Inbegriff des Künstlers der Ungewissheit.
Ein wahrer Gigant, eine Inspiration, ein Freund.
Salman Rushdie
Wir in der Schwedischen Akademie sahen ihn
als den Höhepunkt des 20. Jahrhunderts. Er war
das 20. Jahrhundert, mindestens nach Thomas Mann.
Per Wästberg
Die ›Blechtrommel‹ war literarisch
überwältigend und politisch der Dammbruch
für ein kritisches Verhältnis zur NS-Vergangenheit.
Ich erinnere die ganz außerordentliche Erregung,
das war zum ersten Mal ›unsere‹ Stimme.
Jürgen Habermas
Wir haben in der Bundesrepublik einen politischen
Schriftsteller, den man nicht genug rühmen kann:
Günter Grass. Er hat sich als wirklich unabhängig
erwiesen.
Karl Jaspers
Sehr erfreut war ich über deine Worte über
Günter Grass, ja, man kann ihn gar nicht genug
rühmen.
Hannah Arendt
Grass in allen Journalen. Grass in allen Zeitschriften.
Bild von Grass. Text von Grass. Text über Grass.
Die Grass-Anekdote. Grass liegt in allen Vitrinen.
Grass tönt aus allen Röhren. Ich ersticke, versinke,
ertrinke in Grass.
Grass grinst von allen Kiosken.
Ich hab’ schon einen Grass-Komplex.
Süddeutsche Zeitung (1963)
Günter Grass hat die Bundesrepublik ziviler, freier
und demokratischer gemacht, kurz: bewohnbarer.
Klaus Wagenbach
Der Ehrgeiz, in der Zeitung auf der ersten Seite (Politik)
zu erscheinen neben Henry A. Kissinger, Franz Josef Strauß,
Dayan etc. Wenn der Kreis größer ist, wenn Fremde zugegen sind,
kann er nicht umhin, redet er Instanz: GERMANY’S GÜNTER GRASS.
Max Frisch
Grass hat sich als Aufklärer immer eisern gegen den
Zynismus bewegt, der jetzt gegen den Humanismus
schreit.
Peter Rühmkorf
Die Romane von Grass sind Weltliteratur, weil sie
im Mikrokosmos der Provinz die condition humaine
in all ihren imponierenden und weniger imponierenden
Seiten schildern.
Johano Strasser
Von Günter Grass bleibt, dass er der letzte war,
der ein Werk vorgelegt hat, das alle gelesen haben
›mussten‹. Nicht nur in diesem Sinne ist er wohl
der letzte Klassiker der deutschen Literatur.
Jochen Hörisch
Willkommen, nicht Abschied erleuchtet die Schrift.
Günter Grass
INHALT
PROLOG
Die Zeiten sind wie aufgehoben
ERSTES KAPITEL
Überschattete Kindheit. Lehrjahre des Künstlers
Danzig – ein historisches Paradox
Labesweg
Zerfetzte Heldenträume
Egozentrische Unbeirrbarkeit
Im biedermeierlichen Babel
Berlin, die Schreibmaschine, Tod der Mutter
Zerstrittene Kunstmoderne oder Zaubern auf weißem Papier
Aus entrückter Perspektive
›Windhühner‹ – spielerisch, artistisch, kunstverliebt
ZWEITES KAPITEL
Die Pariser Episode
Selbstbehauptung vor absurdem Welthorizont
Paul Celan oder In herzgrauer Freundschaft
Theater – von Weltmetzgern und Reinheitsaposteln
Panoptikum des Antitotalitären
DRITTES KAPITEL
›Die Blechtrommel‹ – Komik des Grauens
Verlust macht beredt
Das Abgesegnete aus den Grabkammern holen
Ein Weltentwurf von Heimatgeschichte
Unbehaust und ohne Gnade
Des Chaos wunderlicher Sohn
›Kultur, die den Mord gebar‹
Versagen, Schweigen, Scham
Dem Äußersten sich gleichgemacht
Der erste ordentliche Literaturskandal der Nachkriegszeit
VIERTES KAPITEL
Der Dichter probt die Demokratie
Umzug nach Berlin, neue Gedichte – ›Gleisdreieck‹
In literarischer Opposition
›Die laue brave muffige SPD‹
Zerrissenheit als Identität – deutsche Literaturhändel
›Katz und Maus‹ – Pathogenese des Heldenmythos
Die heimatlose Linke oder Ein Abgrund von Landesverrat
›Hundejahre‹ – Lügengeschichten vom Ende der Humanität
Der Sänger Kaschubistans
FÜNFTES KAPITEL
Intellektuellenpolitik oder Die deutsche Kulturnation
Internationale Resonanzen
Mit der ›Gruppe 47‹ in Schweden
Für Vernunft und Aufklärung oder Assistenz durch Dreinrede
Des Zukunftskanzlers Barde – Wahlspektakel
Adorno, Büchner und die deutsche Misere
Theaterskandal mit Ansage – die ›Plebejer‹
Brecht und das Elend der Intellektuellen
Narrenschelte in Princeton
SECHSTES KAPITEL
Zwischen Bürgerrepublik und Stadtguerilla – 1967/1969
›Ein bisschen Kennedy‹ in der Frontstadt
Familienszenen in Friedenau
Monströse Kumpanei – die Große Koalition
›Das ungleiche Paar Güntergrass/Ulrikemeinhof‹
Wirklichkeitstheater oder Vietnam-Gefühl
Am Ende des Konsensmilieus
Wetterleuchten der Utopie, Pogromstimmung
Deutsche und Israelis – Abgrund der Erinnerung
Linke Ohnmacht oder Deutschland als kommunizierende Mehrzahl
Arnold Zweig und der Faschismus-Streit
Bürgerkriegshysterie oder Mangel an radikalen Demokraten
Die Kehre von den Wörtern zur Gewalt
›Davor‹ oder Der Feind steht links
›Örtlich betäubt‹ – wider das messianische Bewusstsein
SIEBENTES KAPITEL
Der Citoyen und die politische Moral
Die SPD-Wählerinitiative oder Brückenschlag zu den fortschrittlichen Kräften
Melancholie, Utopie und Politik
Dichter im Staatsornat?
Närrischer Gewaltkult
Schneckengang und Lebenskrise
Kritiker oder SPD-Bonze – Deutscher Herbst
Schlafmütziger Kanzler
ACHTES KAPITEL
Hunger ist Krieg – Politik als humanitäres Projekt
Der Staatsschriftsteller oder Das weltumfassende Erschrecken
Das Dilemma der Intellektuellen
Lebenszyklus und Geschlechterkrieg
Liebesturbulenzen – Familienglück
›Der Butt‹ – Herrschaftsikone, Sinnstifter, Wunscherfüller
Maskottchen der Weiber?
Terrorismus – Überlebenskampf der Linken
›Der Poeten Heiterkeit in Jammer‹ – ›Das Treffen in Telgte‹
›Grassnost‹
Gegen die Barbarisierung der Politik – Oskar im Film
In fröstelnder Gesellschaft – ›Kopfgeburten‹
Krieg und Frieden – Ost und West
NEUNTES KAPITEL
Geistig-moralische Wende oder Widerstand der Vernunft
Anti-Amerikanismus oder Heilig nüchterne Nation
Der Akademie-Präsident und die Wehrkraftzersetzung
Das Ende der Berufsaufklärer?
Demokratischer Patriotismus oder konventionelle Nation
Wider die zynische Vernunft
Das beschädigte Projekt Aufklärung – ›Die Rättin‹
Ein katastrophales Buch?
Wie Fremdes vertraut wird und fremd bleibt – ›Zunge zeigen‹
Verlagswechsel
ZEHNTES KAPITEL
Kritiker der unversöhnten Einheit
Zwischen Bürgerbewegung und Wiedervereinigungsgerede
›Schreiben nach Auschwitz‹
›Jetzt endlich kennen wir uns‹
Die kopflos ertrotzte Einheit – ›Was bleibt?‹
›Unkenrufe‹ im toten Holz oder Reden ohne Echo
›Novemberland‹ – Jagdszenen aus dem Sekundärbetrieb
Patriotische Phantasmagorien – ›Ein weites Feld‹
Mobilmachung an der literarischen Front
Die Fremde als andauernde Erfahrung
ELFTES KAPITEL
Dichter-Noblesse in der ›Berliner Republik‹
Aufbruch zu Rot-Grün
Deutsche Friedenskultur und serbischer Terror
›Mein Jahrhundert‹
Der Literaturnobelpreis
Der Schamane als Repräsentant
Nie wieder Schweigen – Der Schriftsteller als ideeller Brückenbauer
Die Deutschen als Täter und Opfer – ›Im Krebsgang‹
Stolz auf Deutschland – neue Weltoffenheit?
Letzte Tänze, rot-grüne Erwartungen
ZWÖLFTES KAPITEL
Späte Konflikte
›Beim Häuten der Zwiebel‹
Achtzig Jahre oder Feiern in der Verdachtskultur
Nationale Selbstaufklärung – ›Grimms Wörter‹
›Was gesagt werden muss‹ – ein Fall von Antisemitismus?
›Nie hört das auf‹
›Endlichkait‹
Anmerkungen
Bibliographie
Personenregister
Bildnachweis
Dank
PROLOG
Ich kam nie an, suchte kein Endziel,
blieb unterwegs, bin es immer noch
Die Zeiten sind wie aufgehoben
Der 18-jährige ›prisoner of war‹ mag bei seiner Entlassung im April 1946 eines schon geahnt haben – in diesem ›neuen‹, westlich verorteten Vaterland musste man mit dem Fremden als andauernder Erfahrung rechnen. Gehörte nicht auch er zu der Generation »ohne Jugend […], ohne Glück, ohne Heimat und ohne Abschied«, die Wolfgang Borchert damals beklagt? Noch Jahrzehnte später wird Günter Grass das Empfinden von Ankunftlosigkeit und Unaufgehobenheit begleiten, als Alltagsproblem und als intellektuelle Herausforderung. Denn schon am Ende der Kriegskatastrophe war der Danziger Junge in ein Niemandsland zwischen zwei antagonistischen Welt(un)ordnungen geraten. Zuinnerst aufgewühlt von Gewalttraumata und ideologischem Massenterror ist er in dieser Zeit, entrissen jeder persönlichen und kulturellen Vertrautheit und bald misstrauisch gegenüber allem, was sich als zukunftsverheißend ausgeben will. Derweil hat die Nation der Deutschen ringsum nur Ruinenfelder und bloodlands, nichts als Moralwüsten zu gewärtigen. Verlassen scheint sie von allem abendländischen Humanismus, selbst noch vom Heiligen Geist. Und so sind es bohrende Erinnerungen an Nazi-Wahn und Menschenvernichtung, zunehmend auch persönliche Schuldgefühle, die dem ehemals zwangsrekrutierten Waffen-SSler auf der Seele liegen. Währenddessen droht die unwirtliche ›Republik ohne Leitbild‹ mehr und mehr dem Verdrängungssyndrom der ›Stunde Null‹ zu verfallen. Dem gebrannten, halbkaschubischen Kriegs- und Flüchtlingskind aber wird sein lern- und kunstbegieriges Ich viel später noch als ortlos und unstet erscheinen, ja unheilbar auf Widerspruch gestimmt. Und schon früh dürfte ihm klargeworden sein, dass besonders den Fremden und Heimatlosen die Horizonte weiter gespannt [sind] als den Bewohnern kleiner und größerer Erbgrundstücke. Günter Grass habe in seiner Zeit zum ›Künstler der Ungewissheit‹ werden müssen, sollte der Migrant Salman Rushdie einmal sagen.
Grass’ Romandebüt ›Die Blechtrommel‹ (1959), dieses seit je kaum vergleichbare Erzählmonstrum, brachte es angesichts der Jahrhundertkatastrophen in Deutschland und Europa zu einer Art literarischem Vulkanausbruch. Das Buch verfolgte eine maßgebliche Intention, es wollte dem »abgefeimten Konformismus« (Theodor W. Adorno) der neuen deutschen Bürgermentalität in grotesker Manier widerstreiten. Nach Jahrzehnten der Wesensvergötzung und Machtperversion des Nationalen war es dieser 32-jährige Autor, der ein durch Nazi-Wahn, Krieg und Holocaust ruiniertes Land zu jenem Ausnüchterungs-Epos modellierte, das dem Ungeist von Beschweigen und falscher Versöhnung das Höllengelächter eines kleinbürgerlichen Schuld-Syndroms entgegenhielt. Dem Erzählimpetus der ›Blechtrommel‹ zufolge durfte das künftige Selbstverständnis der Deutschen nicht länger in Gestalt kunstgeweihter Nationalmythen daherkommen, sondern musste als historisches Projekt einer alltagsgrauen Sühnepflicht erkennbar werden. So waren es die in der jungen Republik umstrittenen Bedingungen der Möglichkeit von Wissen und Verantwortung gegenüber sozialer Dekadenz, Menschenmord und Weltkriegsinferno, die als moralischer Reflexionskern der ›Danziger Trilogie‹ artistische Erzählfunken schlugen. Der Dämonie des Nationalsozialismus samt seiner ideologischen Nachhut will der junge Grass mit kaltem Gelächter den verlogenen Schauer zersetzen.
Vielen in der linken Intelligenz, von Hans Magnus Enzensberger bis Ulrike Meinhof, wurde damals klar, dass es sich bei dem misswüchsigen Blechtrommler Oskar Matzerath um mehr als einen literarischen Schelm, sondern um das Vexierbild eines bundesdeutschen Oppositionshabitus handelte: »Oskar ist unser«. Das sei zum ersten Mal »unsere Stimme« gewesen, hat Jürgen Habermas Jahrzehnte später noch über die ›Blechtrommel‹ gesagt. Deren ungestalte und stigmatisierte, so aufsässige wie gewitzte Anti-Heldenfigur stellte nicht weniger dar als eine fiktionale Ausgeburt des desaströsen 20. Jahrhunderts. Nur ein diabolisch diskursgewandter Homunkulus, der so unterkühlt und genau zu erzählen vermochte, schien fähig, der Bestialität, der Infantilität und der Verbrechen des Nazitums dezidiert gegenwartskritisch beizukommen. Dieser irritierende Roman konnte im Adenauer-Deutschland der Sechzigerjahre nur einen Skandal auslösen: Bürgerschreck, Prostituiertenjargon, kindhafte Regression, Revolte des Schwachsinns, klinische Phantasmagorie, krude Geschlechtlichkeit, Kirchenschändung, ja ein episches Crescendo des Absurden und Abstoßenden, so lauteten einige der hysterischen Verdikte gegen das erfolgreiche Buch und seinen Verfasser. Dieses Werk eines Nihilisten dürfe man niemals jungen Menschen in die Hand geben, es heile nicht, sondern verletze nur. Denn nicht allein die dekadente Sucht nach der Entwertung aller Werte tobe sich in dem Machwerk aus, sondern der Mensch als solcher werde durch seine »zoologische Auffassung« zutiefst diffamiert. Das Buch zeige nichts als die verkehrte Seelenentfaltung von Individuen, ja es propagiere den Absturz aller Autoritäten, zumal derjenigen des väterlichen Leitbildes. Und so musste der Anti-Grass-Kanzelton im rechten Milieu des Politikspektrums, besonders bei den Ost-Vertriebenen, höchst diffamierend ausfallen. Vom »Groß-Verzichtler auf urdeutsches Land«, von einem »Bastard« war hier die Rede, der »erbbiologisch wie auch visuell alle Merkmale eines kaschubischen Mischlings« zeige.
Intellektueller Enthusiasmus und Aufschreie der blanken Empörung in der frühen Bundesrepublik, ein avantgardistischer Roman als Massenlektüre – das hatte es in deutschen Landen nur äußerst selten einmal gegeben. Enervierender noch, die ›Blechtrommel‹ machte in kurzer Zeit auch international Furore. In ganz Europa und in Amerika erschienen bald die ersten Übersetzungen dieser »creation of a hilarious, unsentimental […] and unforgettable satire on the Third Reich […] and on Mankind«. Der US-Kritiker Richard Kluger schrieb, ›The Tin Drum‹ stamme von einem der bedeutendsten Epiker des 20. Jahrhunderts. Für Enzensberger war die bundesrepublikanische Literatur mit diesem Werk geradezu am »Klassenziel der Weltkultur« angekommen. In der Tat befand sich Günter Grass zu Anfang der Sechzigerjahre bereits auf dem ersten Höhengrat seines Dichterruhms. Ein Monolith exquisiter Literatur der aufgeklärten Moderne war mit der ›Blechtrommel‹ in die Welt gekommen, und das aus dem Land der abenddämmrigen Politik-Mythen und schwerblütigen Romantizismen. So oder ähnlich lauteten die überraschten Erfahrungen im Ausland. Grass wurde zum Inbegriff einer sich wandelnden Eigenwahrnehmung des einstigen Nazi-›Tätervolks‹. Jenseits der deutschen Grenzen galt der (selbst-)kritische Schuld-Diskurs bei diesem Schriftsteller als unverkennbar.1
Es war der so fremdartig wie vertraut wirkende Künstler-Autor aus dem verlorenen Danzig, schon früh eine Berühmtheit der ›Gruppe 47‹, der in den Sechzigerjahren zur Ikone einer neuen, umstrittenen literarischen Opposition in der Bundesrepublik werden sollte. Mit seinem außergewöhnlichen Symbolkapital prägte Grass seit 1961 auch die Diskussionen und Verhandlungen mit den SPD-Größen um Willy Brandt. Der einstige Emigrant und charismatische Sozialdemokrat wurde für den Dichter zur Leit- und Vaterfigur, Brandt zog ihn in die Nähe der Parteiräson und vermittelte seiner Politikauffassung, seinem aufgeklärten Revisionismus, manche Inspiration. Vor allem deshalb sollte Günter Grass im eigenen Kollegenkreis immer wieder als eine ebenso illustre wie beargwöhnte Figur erscheinen, die Beziehung zur Sozialdemokratie wird sich in den intellektuellen Fraktions- und Autonomie-Kämpfen künftig noch oft genug als Ferment und als Scheidelinie erweisen. Dass sich ein Schriftsteller als Bürger in die parteipolitische Tretmühle begab, war im historischen Wahrnehmungsspektrum (linker) deutscher Intellektualität bis dato nicht vorgesehen.
Doch wenn Grass die Werbetrommel für die SPD schlug, tat er dies aus staatsbürgerlichem Verantwortungsbewusstsein wie auch mit dem Mut des unabhängigen Geistes. Er wollte mehr sein als ein »ehrwürdiger Neinsager«, den Martin Walser damals beklagte, er warb um das pragmatische Engagement der Intellektuellen, er forderte Sachkompetenz, parteiorientierte Streitbarkeit und dennoch jede Freiheit zur geistigen Selbstentfaltung. Der Autor der ›Blechtrommel‹, von ›Katz und Maus‹ und ›Hundejahre‹ wurde zum Duz-Freund Willy Brandts, zum prominenten wie berüchtigten Wahlredner, zum Politik-Vordenker und (Partei-) Kritiker. Auf der anderen Seite verlor der Intellektuellendiskurs dank Günter Grass seine betriebsnotorische Selbstbezüglichkeit und entwickelte sich zum Faktor des Meinungskampfes auf der parlamentarischen Bühne der Republik. Die Figur des öffentlich dreinredenden Intellektuellen in Bundesdeutschland erhielt durch diesen Künstler-Schriftsteller entscheidende Impulse. Ein derartiges Lehrstück plebiszitärer Demokratie musste Irritation und Empörung bei vielen Politikgranden auslösen, gewann aber unter der Wahl- und Lese-Bevölkerung immer mehr Plausibilität und Anerkennung. Die Wählerinitiativen für die SPD, deren kritischer Impuls später zu den ersten Bürgerinitiativen führen sollte, gingen auch auf Grass’ politische Bemühungen zurück. Der Dichter wurde für nicht wenige Zeitgenossen zum schnauzbärtigen Inbegriff einer so bürgerbewegten wie zunehmend konfliktfähigen Debattenkultur.
Günter Grass und die ›glückende‹ Demokratie der Bundesrepublik, das umfasste vor allem die Sinn- und Mentalitätsgeschichte von Auschwitz, jenen dunklen Komplex nationaler Erinnerungskultur, den der Autor-Künstler nicht nur in frappierenden Erzählbildern und moralischen Reflexionen fassbar werden ließ, sondern schon als öffentliche Person verkörperte. Für die mediale Ikonisierung seines umstrittenen Status als Intellektueller hat der Sprachmetz und Bild-Werker lebenslang in ›heraldischer‹ Manier selber gesorgt. So ergab sich eine Glanz- und Glücksgeschichte des Literaturnobelpreisträgers von 1999, aber auch die Kontrovers- und Ketzerhistorie eines wortmächtig hervortretenden Ostmigranten, dessen Lebenswerk auf komplexe Weise in der jungen Bundesrepublik geerdet war. In seinem biographischen Profil – vom surrealistischen Künstler zum Inbegriff der jungen literarischen Opposition, vom SPD-Wahlkämpfer und Revisionisten im linken mainstream zum ›Wappentier‹ der Republik, vom nobelpreisgekrönten Repräsentanten der rot-grünen Regierungsära zum ›vaterlandslosen‹ Kritiker der deutschen Uneinheit, vom Waffen-SS-Streit bis zum Antisemitismusvorwurf – spiegeln sich wichtige Phasen der deutschen Diskurs- und Mentalitätsgeschichte nach 1945.2
Schon der jugendliche Grass erfuhr seine Orientierungsnöte in der frühen Nachkriegsära als einen Zeitbruch, der jedes überkommene Selbstverständnis und Wertesystem der Nation ins Bodenlose gestürzt hatte. Wo nichts Vertrautes mehr galt, konnte die Gegenwart ihre Legitimität nicht länger allein aus sich selbst gewinnen, sondern musste sie aus »Spiegelbildern ›herbeigezogener‹ Vergangenheiten schöpfen.« (Jürgen Habermas). Zeiterfahrung und Zeiterwartung traten nach 1945 so fundamental auseinander, dass die Gegenwart als tiefreichende Umwälzung, ja als geradezu übermächtige Geschichtsruptur erscheinen musste. Nicht weniger als dies sollte sich bei Grass zum Fokus einer Erinnerungsarbeit entwickeln, die sinnvoll nur unternommen werden konnte in pragmatischer (Selbst-)Verantwortung vor Jetztzeit und Zukunft der Deutschen. Dabei waren es sein Kunstbegehren und seine Literaturobsession, die ihm alle Möglichkeiten boten, das Kontinuum der verflossenen, präsenten und kommenden Zeitläufte imaginativ zu überspringen oder parallelzuschalten und sich mit der Reduzierung unserer Wirklichkeit, mit einem fragwürdigen Begriff von Gegenwart nicht abzufinden. Sollte man nicht Jetztzeit und Zukunft […] aus vergegenwärtigter Vergangenheit einsichtig machen können? Bereits der ›Blechtrommel‹-Autor sah sich gezwungen, die ›Universalgeschichte‹ zu studieren, im Kern ging es dabei um nicht weniger als einen übergreifenden Solidarzusammenhang in der Humanhistorie. Mit dem verehrten Ernst Bloch wusste Grass schon früh, dass die Geschichte ein »vielrhythmisches und vielräumiges, mit genug unbewältigten und noch keineswegs ausgehobenen, aufgehobenen Winkeln« behaftetes Menschenprojekt darstellte: Wie sich die Zeiten ablagern und durchsuppen. In jedem Danach liegt ein Davor begraben.
Was zwischen 1933 und 1945 im deutschen Reich und in Europa an menschengemachten Gräueln geschehen war, konnte auch ein Oskar Matzerath keineswegs als abgelebte, zu nichts mehr verpflichtende Vergangenheit betrachten. Denn beherrschend wurde für seinen Erzeuger ein historisches Deutungskonzept, das zutiefst durch die Erfahrung von Auschwitz begründet war. Dieses singuläre Ereignis hatte jede vernünftig-lineare ›Erziehung des Menschengeschlechts‹ in katastrophischer Weise ad absurdum geführt. So blieb Grass davon überzeugt, dass jedwede Geschichte, die heute in Deutschland handelt, schon vorJahrhunderten begonnen hat, dass diese deutschen Geschichten mit ihren immer neuen Schuldverschreibungen nicht verjähren, nicht aufhören können. Bei aller Absurdität und Ungleichzeitigkeit historischer Entwicklungen, der ›Blechtrommel‹-Autor sah seine Landsleute befangen in einer polychronen Kontinuität von Schuldfortschreibungen. Demzufolge hielten längst hingeschwundene Epochen ihre Erwartungen und Hoffnungen immer noch auf die Lebenden gerichtet, weshalb sich die Gegenwart im Gewesenen wiedererkennen musste als von ihm mitgemeint. Die Jetztzeit stand um ihrer Zukunft willen in einem moralischen Problem-, ja Pflichtverhältnis gegenüber dem Damals: Die Zeiten sind wie aufgehoben: Vergangene Barbarei kommt uns spiegelverkehrt entgegen. Wir meinen zurückzublicken und erinnern dennoch bekannte Zukunft. Der Fortschritt, so scheint es, liegt hinter uns. Die Geschichte, so betonte Grass immer wieder, dürfe nicht zu einem ständigen Prozess der Liquidierung von Gegenwart verkommen. Wer sich seiner und der gemeinsamen Vergangenheit nicht zu stellen bereit war, drohte der eigenen Identität, seines Lebens- und Denkorts zwischen Jetztzeit und Zukunft verlustig zu gehen.3
Theodor Fontane hat die bedeutenden Dichter der Welt verglichen mit großen Strömen, »auf denen die Nationen fahren und hineinsehen in die Tiefe«. Münzt man dieses Wort auf das Lebenswerk des Schriftsteller-Künstlers Günter Grass um, so tritt seine fortwährende Beschäftigung mit den Spannungsfeldern deutscher und eigener Schuldgeschichte(n) noch einmal ins Licht. Allenthaben ging es um moralische Dilemmata und Konflikte von gezeichneten Individuen, um Kämpfe zwischen ethischer Verantwortung und ihrem Zusammenprall mit den Gewaltmächten von Politik, Sozialpathologie und ideologischem Wahn. Schon als sich der junge Bildkünstler, Lyriker und Dramatiker in Paris daran machte, einen autobiographischen Roman zu schreiben, verwandelte er die eigene Lebenshistorie in ein groteskes Erzählpanoptikum zur Frage der Möglichkeit von Vergangenheitsbewältigung als humanitärem Gegenwartsproblem schlechthin. In der ›Blechtrommel‹ wurde eine bizarre, die Schuld und die Scham ihres Autors verlarvende Künstlergeschichte aufgeblättert, eingeschrieben in das gemeine Anpassungssyndrom von Kleinbürgern an nazistische Wahn- und Mordverhältnisse, für die damals und auch später kaum jemand Verantwortung übernehmen wollte.
Die Erzählung ›Katz und Maus‹ exemplifizierte diesen Befund im Sinne einer Pathogenese des Nazi-Heldenmythos, dessen seelische Destruktivität noch in der deutschen Nachkriegszeit als Schuldsaldo immer weniger wahrnehmbar zu werden drohte. In grotesken Erzählbildern denunzierte der Roman ›Hundejahre‹ eine durch Herrenrassenwahn, Staatsterror und Krieg auf den Hund gekommene deutsche Gesellschaft, die noch Jahre nach 1945 das heideggernde Seinsgeraune zum Tremolo der Erinnerungslosigkeit und Schuldverweigerung in ihrem Wirtschaftswunderland machen wollte. Der ›Butt‹ handelte in Auseinandersetzung mit dem feministischen Diskurs der Siebzigerjahre vom Triebschicksal aller Männlichkeit, von einer dunklen Kehrseite des Zivilisatorischen, den Jahrtausende alten Macht- und Machbarkeitswahn der zerstörerischen Endzielmänner, ja von ihrer zwanghaft verdrängten Rückkehrsehnsucht in den Schoß des Mütterlich-Weiblichen. Hingegen stand ›Die Rättin‹ bereits im Schatten der atomaren Bedrohungsangst (nicht nur) in der Bundesrepublik der Achtzigerjahre. NATO-Nachrüstung, Umweltzerstörung, apokalyptische Nöte wurden reflektiert in einem tragikomischen Traumspiel. Unaufhaltsam schien sich bei schwindender Zukunft der Menschen die Pervertierung des Humanprojekts Aufklärung immer weiter zu verschärfen. Denn natur- und vernunftfeindliche Rationalitäten hatten sich zu einem globalen technokratischen Verblendungs- und Gewaltverhängnis der Moderne verdichtet. So wurde der Zivilisationsabgrund aus historischer Schuld und moralischem Versagen der Menschheit in dieser Romangroteske ein weiteres Mal hochgerechnet auf ihre hoffnungslos bedrohte Zukunft.
Erst in dem Berlin- und Wende-Roman ›Ein weites Feld‹ sollte sich Günter Grass freimachen vom melancholisch getönten, großen deutschen Ernst der früheren Erzählpanoramen. Das Buch entfaltete ein humoreskes (Be-)Deutungsspiel zum Thema der nationalen Macht-, Mentalitäts- und Einheitshistorie in den vergangenen 150 Jahren. Im kunstfertigen Perspektivwechsel zwischen Fontane-Imago und pittoreskem (Berlin-)Roman der Wendezeit ging es um die geschundene Volkssouveränität einst und jetzt, um kapitalistischen Abwicklungsfuror und Profitwahn unterm Geschichtszeichen von Auschwitz, ja um den demokratischen Substanzverlust im wüsten Feld deutscher Machthistorie nach 40 Jahren satrapischer Abspaltung des DDR-Regimes, ausgelöst durch Naziterror, Krieg und Holocaust. Noch einmal gerieten Jahrhundertprozesse zu einem bitter-ironischen Mahn- und Warnbild für die seit 1989/90 wieder nationalstolz auftrumpfenden Deutschen der ›Berliner Republik‹. Grass zufolge trugen sie im Sinne der Wiederholungstäterschaft eine Verantwortung gegenüber der Reichseinheit von 1871, jenem aristokratisch-großbürgerlich geblähten Herrenmenschentum. Das verhängnisvolle Weltmachtgehabe des preußischen Eliteklüngels durfte in der Bundesrepublik nach 1989 keine fröhliche Urständ feiern.4
Der jahrzehntelange publizistische Erfolg des Günter Grass rührte nicht zuletzt von einem Synergie-Effekt her, den er so sprachmächtig wie bildvirtuos in Szene gesetzt hat – der Verklammerung von politischer Parteinahme und literarisch-ästhetischer Imagination. Es war besonders dieser Tatbestand, der in gut fünf Jahrzehnten wiederholt zu ausufernden Meinungskonflikten und Diskurskrisen mit dem Intellektuellen und Kunst-Wort-Werker geführt hat. Günter Grass mischte sich lauthals und namens universeller Werte in die politischen Kontroversen der Gegenwart ein, und er versuchte als Künstler – komplementär dazu –, den Reizstoff wichtiger Zeitdiskurse in phantastische Gegenwirklichkeiten zu verwandeln, die gleichsam das »Quere, Undurchsichtige, Unerfasste« (Theodor W. Adorno) der aktuellen Problemlagen in (erkenntnis-)kritischer Distanz zum Ausdruck bringen sollten: Das Gedicht kennt keine Kompromisse; wir aber leben von Kompromissen. Wer diese Spannung aushält, ist ein Narr und ändert die Welt. Das umschrieb eine gleichermaßen künstlerische wie politische Denkfigur, die keineswegs bei jedermann verfangen konnte. Selbst für die feuilletonistische Kritik hat der meinungsstarke Avantgardist oft genug Bücher mit sieben Siegeln vorgelegt. Seine Gegengeschichten kamen als kunstvoll irritierende Denkbilder daher, Grass schwelgte in so zeitenthobenen wie welt(be)deutenden Phantasmen, wobei es sich allemal um die imaginative Suspension dessen handeln sollte, was in der Gegenwart als Vergessenwollen, Konformismus und borniertes Bewusstsein in Erscheinung trat. Nicht zuletzt von seinem Pariser Freund Paul Celan dürfte der junge Romancier eines gelernt haben: »Wirklichkeit ist nicht, sie will gewonnen und gefunden sein.« Die Probleme menschlicher Schuld und historischer Verhängnisse, die Jetztzeit eingeschlossen, konnten nur kraft der Deutungsautonomie des Künstlerischen anschaubar werden und zu wahrheitstauglicher (Selbst-)Erkenntnis gelangen.
Wenn Günter Grass über die Gräuel, das hündische Wesen und die ideologischen Nachwirkungen des Nationalsozialismus schrieb, über den männergeprägten Zivilisationsverfall, den Substanzverlust aufgeklärten Denkens im Triumph ruinöser technologischer Rationalitäten, über die Gefährdung von Demokratie und Nationalkultur im wiedervereinten Deutschland, ja über die eigene Schuldgeschichte, dann tat er dies oft im rück- und vorausblickenden Erzählmodus der Mythen, Märchen und Sagen, im Erstaunen vor der humanistischen Geistesmacht von Barockliteratur und deutsch-europäischer Aufklärung und Romantik, nicht selten auch im parodistischen Fiktionsspiel mit ihnen. Das war für viele Leser immer wieder ein faszinierendes Sprach- und Phantasie-Erlebnis, für andere jedoch bedeutete es – zumal im Blick auf den provozierenden Intellektuellen – eine Unausstehlichkeit, resp. eine Überforderung. Dabei konnte der Grass’sche Erzählkosmos oft mit nationalgeistig temperierter Fabulierlust aufwarten, auch mit humoresken Heimat- und Identitätsofferten an die Deutschen. Die sollten in einer Art universellem »Märchenbuch der Wahrheit« (Alexander Kluge) mit verklärten und verdrängten Gegenwartsproblemen konfrontiert werden, als literarisch entrücktes, kritisches Widerspiel zu ihren ideologischen Anfälligkeiten und Gefühlsblockaden.
Das Traumgetier der Märchen und Mythen erlaube es, uns klarer, wenn auch mit gesteigertem Ausdruck in unserer existentiellen Not und Wirrnis darzustellen, davon war und blieb Grass überzeugt. Aber gerade auch diese Einfälle wunderbarer Art, verwoben mit dem politischen Impetus des Intellektuellen, die ›falschen‹ (Selbst-)Wahrnehmungen der Deutschen durch sichtschärfende Wort-Bild-Artistik aufzustören, haben den Diskurs mit ihm bzw. über ihn oft zu einem Wirrsal von Missverständnissen, zorniger Abkanzelei und obstinater Verketzerung geraten lassen. Was der Schriftsteller in blühenden Erzählmaterien zu entfalten verstand, spiegelte sich noch einmal wider in den Chimären des Kunstwerkers. Über das Bildmotiv der schwarzen Köchin in der ›Blechtrommel‹ hat Grass einmal gesagt, es stehe für den Inbegriff alles Bedrohlichen, Irrationalen, Nicht-Fassbaren, einen ungeklärten Rest, ja es wachse parallel mit dem, was in der Zeit geschieht. Dergleichen konnte nicht jeder nachvollziehen, um einem Autor-Künstler gerecht zu werden, der als politischer Intellektueller und als phantasierender Spätromantiker in Erscheinung trat. Doch Günter Grass hielt daran fest, dass die Literatur, der Aufklärung ungeratenes Kind, immer noch jene subjektiven, niemals restlos kommunizierbaren Erfindungs- und Gefühlspotenzen besaß, die einem unverkürzten Begriff von Vernunft substanziell zugehörten. Erst wenn die Individuen wieder in Bildern und Zeichen zu denken gelernt hätten, schrieb er, wenn sie ihrer Vernunft erlauben, an Märchen zu glauben, wie närrisch mit Zahlen und Bedeutungen zu spielen, der Phantasie Auslauf zu gewähren, werde die aufgeklärte Rationalität ein Überlebensmittel für die Menschheit sein können. In solchem Befreiungssinn hat der Intellektuelle und Wort-Künstler noch die machttechnokratisch auftrumpfende Politik fassen [wollen], ehe sie sich als Geschichte tarnt.5
Erstaunlich und oft irritierend erschien Grass’ beharrliches Vertrauen auf das Schamanische in der Kunst, auf die Bildschöpfung und Sprachmagie des kreativen Subjekts, sein Glaube an die Aufschlusskraft der Wörter und Zeichen in artifiziellen Symbolals Wahrheitsspielen. Das konnte vielen Zeitgenossen beileibe nicht als zeitgemäß oder als avantgardistisch erscheinen. Doch der Autor-Künstler blieb dabei, die Literatur lebe in ihrem Kerngehalt vom Mythos, sie schafft und zerstört Mythen, kraft dessen erschien sie ihm als eine Existenznotwendigkeit für die Kultur jeder Gesellschaft. Und weil allein die Freisetzung des ›Anderen‹ der Vernunft die Menschen vor dem Frost rationalistischen Verfügungsdenkens bewahren könne, teilte er auch mit Adorno den emphatischen Begriff des ›Negativen‹ der Kunst als Schule einer gegenweltlichen Wahrnehmung, als imaginativen Spürsinn für die »Entstelltheit und Bedürftigkeit« jedweder Erkenntnis. In einer meinungsstarren Gesellschaft ging es darum, das »ungenormte Urteil« aus mythisierten oder märchenhaften Gegengeschichten zu gewinnen, die das ›Falsche‹ sehen lehrten, indem sie die Idee des ›Richtigen‹ aufscheinen ließen. Künstlerische Imagination und chimärische Gestaltung sollten als Fermente einer verjüngenden Diskursivität, der Erschließung neuer Lese-, ja Erfahrungspotenziale wirksam werden. Gegen Ende seines Lebens legte Grass mit ›Grimms Wörter‹ sein letztes Empfehlungswerk zur humanistischen Ermutigung der Nationalkultur vor. In den tiefen Wortbrunnen und Traditionsräumen des deutschen Sprach-Vermögens lasse sich das eigene Nationalbewusstsein gut begründen – jenseits von Nationalismus. Das umschrieb nicht weniger als seinen Beitrag zum ›Weltdeutschtum‹ im Geist Thomas Manns, zur diskursiven Konstruktion eines Nationsbewusstseins, das sich mit etlichen ›Normalitäten‹ in der Bundesrepublik nie hat anfreunden wollen.6
Von Henrik Ibsen stammt das Wort: »Leben ist: dunkler Gewalten Spuk bekämpfen in sich, Dichten: Gerichtstag halten über das eigene Ich.« Auch diese Sentenz lässt sich mit guten Gründen auf das Lebenswerk des ›Blechtrommel‹-Autors übertragen. Die verflochtene Motivgeschichte der Schuldandeutung und Schuldverlarvung, des Scham-Diskurses in der Grass’schen Werk-Evolution ist so evident wie kaum bekannt und oft verzerrt wahrgenommen worden. Schon in der ›Blechtrommel‹ erschien die Narrenkappe als Tarnkappe des Autors, aber damals und auch später noch blieb alles verkapselt […]: schamvoll Verschlucktes, Heimlichkeiten in wechselnder Verkleidung. In ›Katz und Maus‹ trat seine frühe Nazi-Obsession in ein selbstkritisches Licht, in den ›Hundejahren‹ wurde seine Ahnungslosigkeit von der braunen Animalität erkennbar und im ›Tagebuch einer Schnecke‹ erkundete Grass das Schicksal der Danziger Juden, das ihm zur Jugendzeit keinen Gedanken wert gewesen war. An der Figur des einstigen SS-Schergen Manfred Augst, der nach dem Krieg immer noch auf seine Erlösung im nationalen Kollektiv hofft, entwickelte er eine Art Gegenfiktion zur eigenen Biographie. So wie der Gemeinschafts-Enthusiast Augst hätte auch er nach 1945 noch einmal um den politischen Verstand kommen können. Wiederum legte Grass ein verlarvtes Bekenntnis zum eigenen Versagen als junger Mensch ab, er war selbstbewusst genug, darin ein Menetekel gegen die ideologische Radikalisierung der 68er-Studenten zu sehen.
Von hier aus lassen sich Linien ziehen bis zur Frankfurter Poetik-Vorlesung ›Schreiben nach Auschwitz‹ (1990) und zu ›Beim Häuten der Zwiebel‹ (2006). Noch dem Literaturnobelpreisträger ging es um die Fatalität moralischer und ideologischer Korrumpierbarkeit, die eigene Schuld und ihr Beschweigen hatten sich für ihn sedimentiert zu einer Art Ur-Szene der deutschen ›Vergangenheitsbewältigung‹. So konnte die Selbstwahrnehmung des Intellektuellen Züge einer gleichsam repräsentativen Schamhaltung gegenüber dem nationalen Mordkomplex Auschwitz annehmen. Nach dem Eingeständnis seiner Waffen-SS-Beteiligung sollte das öffentliche Urteil über Günter Grass abgründiger werden, man entdeckte damals die subjektive Brüchigkeit einer (politischen) Moralinstanz, jenes über viele Jahre verheimlichte schreibenergetische Schuld- und Schamstigma des Blechtrommlers. Aber das Gros der Deutschen hat ihm seine jugendliche Waffen-SS-Verstrickung und sein allzu langes Schweigen nicht wirklich übelgenommen.
Denn immer wieder hat sich eines gezeigt – Grass’ Person und Werk provozierten nicht nur, sie verkörperten selber die Präsenz des Mementos Auschwitz im Bewusstseinshaushalt der Bundesrepublik. Wo der reizbare Patriotismus des Dichters sich erkältete, schien die Nation einen Schnupfen zu bekommen, und dies oft vor den Augen der Weltöffentlichkeit. Das verschärfte noch einmal die wechselseitigen Empfindlichkeiten im Lande und konnte manchen Überschwang in der rhetorischen Zurüstung erklären. Die Vorurteilsbelastung der Grass-Rezeption wurde besonders deutlich an dem Verdikt, er sei ein Verächter Israels, ja ein mehr oder minder verkappter Antisemit. Die Wurzeln derartiger Tiraden lagen im Verdachtsklima der Sechzigerjahre begründet und haben sich durchgehalten bis 2012, als es zu einer deutschlandweiten, ja globalen Auseinandersetzung um sein Gedicht ›Was gesagt werden muss‹ kam. Damals bediente man sich eines Antisemitismus-Begriffs, der sein »ursprüngliches emanzipatives Aufklärungspotenzial nahezu vollends zugunsten interessengeleiteter, perfider Diffamierungstaktiken und -strategien« eingebüßt hatte, wie der israelische Historiker Moshe Zuckermann schrieb. Günter Grass als Antisemit – dieser deutsche Intellektuelle und Künstler, der sich zeitlebens in die von Schuld, Scham und Nichtvergessendürfen grundierte Auseinandersetzung mit dem Zivilisationsbruch Auschwitz vergraben hatte, sollte zum Verächter des Jüdischen gestempelt werden. Dabei hatte er seit je auf den »begrifflichen Trennschärfen von Auschwitz als dem singulären Verbrechen« der Deutschen bestanden. Und lange bevor sich der Antisemitismuskomplex mit der Problematik eines neuen, z. T. geschichtsrelativierenden Rassismus-Diskurses verquickte, war es dieser Globalreisende, der Krieg und Hunger, Rassismus und ethnische Diskriminierung als (Über-)Lebensprobleme der Dritten Welt wie der westlichen Zivilisation ins Licht gerückt hatte. Auschwitz war und blieb für Günter Grass ein moralisches Absolutum der Deutschen, doch die Maxime des ›Nie wieder!‹ durfte keine andere Form rassistischer Inhumanität und Gewalt aus den Augen verlieren.7
Hochgelobt wurde Grass, oft aber auch verdammt und heruntergemacht von wetterwendischen, nicht selten hysterisierten Meinungsmatadoren, eine Mittellage der Rezeption gab es zumeist nur in der einschlägigen Literaturwissenschaft. Von einer kritisch-toleranten Dichterverehrung, von der reflektierten Akzeptanz eines ›Nationalautors‹ war der mainstream des bundesdeutschen Identitätsdiskurses in Sachen Grass lange Zeit signifikant entfernt. Doch einen ›Widersprechkünstler‹ (Jean Paul) seines Schlages konnte man nicht mundtot machen. Selbst wenn ihm in der Öffentlichkeit Fehler, Schwächen und Maßlosigkeiten vorgehalten wurden, sein alter, im Gemütshaushalt vieler Zeitgenossen sedimentierter Nimbus schien sich Mal um Mal zu verjüngen und rief neben Abneigung und Überdruss bezeichnende Sympathiewellen hervor.
Nach wie vor erkennen sich viele Bundesrepublikaner in diesem einst multimedial präsenten Zeitzeugen wieder, auch wenn seine publizistische Allgegenwart und seine Polarisierungsenergie nicht wenigen zu schaffen gemacht hat. Aber dem standen und stehen unverkennbare Sympathiewerte in der Dichter-Nation-Beziehung gegenüber. Grass mag in öffentlichen Auseinandersetzungen einen penetranten Erziehungseifer an den Tag gelegt haben, aber dass die Deutschen aus ihrer Vergangenheit gelernt hätten und passable Demokraten geworden seien, beteuerte er gegen Ende seines Lebens oft und nicht ohne Stolz. Es sollte kein Zweifel daran bestehen, wie sehr ich dem Wohl und Wehe der Bundesrepublik und damit dem immer noch nicht abgeschlossenen Versuch, hierzulande die Demokratie zu etablieren, verbunden bin. […] Kritik soll auch Fürsprache sein. Mehr noch galt das immer schon für seine Liebe zu dieser wunderbar reichen, biegsamen, verführbaren Sprache.
Günter Grass hat das ›Modell‹ Bundesrepublik in den politischen Ordnungsmaßen der Sechziger- und Siebzigerjahre am stärksten verinnerlicht. Wenn es bei ihm ein ›linkes Projekt‹ gab, dann ein solches, das seit je so beharrliche wie originär idealistische Konturen aufwies. Sehr wohl hat der revisionistische Sozialdemokrat die politischen Brennpunkte des globalisierten 20. und frühen 21. Jahrhunderts im Blick gehabt – die Verelendung und die Hungerkatastrophen in der Dritten Welt, die neuen Kriegsherde und geostrategischen Interessenkonflikte, das Wuchern von Nationalegoismen und reaktionärer Protestpotenziale auch im Westen, ja die langwierigen Verzagtheiten der liberalen Opposition gegen den mundanen Kapitalismus-Overkill. Doch wie nachhaltig jeder linken Widerstandskultur im neuen Jahrtausend der eindeutig identifizierbare Politik-Kontrahent abhandengekommen war, wie stark sich die Souveränität auch westlicher Demokratien durch die internationalen Finanzgewalten stranguliert sehen musste, und wie wenig die Desaster von weltweitem Klimawandel und diffundierender Digitalmoderne noch auf einen ›vernünftigen‹ Fortschritt und die demokratische ›Erziehung des Menschengeschlechts‹ hoffen ließen – das vermochte Günter Grass nurmehr auf seine Weise wahrzunehmen. Mit Beharrlichkeit hat er das Modell Bundesrepublik als ein weltoffenes Gemeinwesen in der Tradition von Aufklärung, demokratischem Sozialismus und nationaler Geschichtsverantwortung sehen wollen, das im streitbaren Konsens zwischen Parlamenten und Parteien, diskursfähiger Öffentlichkeit und mutiger Zivilgesellschaft die deutschen Geschicke von jeder ökonomischen wie ideologischen Heteronomie freizuhalten vermöchte. Für eine kürzere Zeitspanne, in der Willy Brandt sein Inspirationsmittelpunkt war, dürfte er dieses Projekt als reale, wenn auch am Ende nur bedingt einlösbare Chance betrachtet haben. Ursprung und Fokus seiner politischen Einsichten und Emphasen ist es gleichwohl geblieben bis an sein Lebensende. Ganz so wie der Republikaner Thomas Mann wollte auch Grass der »bürgerlich-deutschen Selbsttäuschung [widerstreiten], man könne ein unpolitischer Kulturmensch sein – diesem Wahn, der Deutschlands Elend verschuldet« habe.
Günter Grass hat Entscheidendes beigetragen zur Ausprägung der Intellektuellenfigur und eines ermutigten, konfliktbewussten Bürgerdiskurses im Nachkriegsdeutschland, und doch verstand er sich nie als Praezeptor Germaniae. Vielmehr nahm er den eigenen Dichterruhm gern in die Pflicht für eine Art Wächteramt über die demokratische Verfassungswirklichkeit seiner Heimat. Während der Sechziger- und Siebzigerjahre war er in die Rolle einer öffentlichen Kontrastfigur zum ›restaurativen‹ CDU-Staat der Ära Adenauer, Erhard und Kiesinger hineingewachsen. Der Trommler für die ›linke‹ Sozialdemokratie wurde wahrgenommen als ›Wappentier‹ einer Republik im Umbruch, als intellektuelle Gegeninstanz, die zivilgesellschaftliche Streitkultur und überkommene Staatsräson in ein angespanntes Wechselverhältnis zu rücken vermochte. Bürgermitsprache – das war und blieb für den grimmbärtigen Autor-Künstler mehr als ein periodischer Urnengang, sondern ein Prozess plebiszitärer Selbstermächtigung der jungen deutschen Demokratie. Sein Credo – politischer Reformwille im Schneckengang als bedachtsame zivilisatorische Evolution. So hat Günter Grass – im Widerstreit mit den Meinungskonjunkturen einer buntscheckigen Linken – den (Rechts-)Staat nie als bloß verschleierte Agentur des Kapitalismus wahrgenommen, auf die im Prozess der Republik-Erneuerung kein Vertrauen gesetzt werden könne. Andererseits blieb ihm auch jede Form von Etatismus und konservativer Machtsklerose grundverdächtig. Nur zu oft konnte der Blechtrommler deshalb in Politik und Kultur als eine Art agent provocateur zwischen die Fronten verbissen ausgefochtener Positionskämpfe geraten. Der 68er-Studentenrevolution widerstritt er nicht ohne Sympathien, vielmehr im Interesse einer liberalen politischen Pragmatik. Und selbst noch die rot-grüne Ära der Republik dürfte bei ihm manche Hoffnung auf die künftige Vitalität eines demokratischen Sozialismus genährt haben. Allenthalben sorgte er sich um die Bedingungen der Möglichkeit eines staatsbürgerlich engagierten, ernüchterten und geschichtsbewussten Patriotismus der (Bundes-)Deutschen inmitten einer globalisierten Welt. Doch er selber hatte mit dem ersten Dezennium des 21. Jahrhunderts den Höhengrat seines öffentlichen Einflusses überschritten. Zugleich war ihm die nationale Einheit in Uneinigkeit ans Herz gewachsen, das zeugte noch einmal vom sympathisierenden, schneckenhaften Optimismus des engagierten Demokraten. Er war der Dichter der deutschen Einheit, lange bevor sie Wirklichkeit werden konnte.
Der Intellektuelle und Künstler solle ein Bekennender zur Universalität der Menschenrechte und ein sachkompetenter, pragmatischer Homo politicus sein, das hat Günter Grass lebenslang als Leitbild festgehalten. Drei Problemkomplexe waren es, um die sein empfindliches politisches Gespür und seine unverhohlenen Befürchtungen immer wieder kreisten – das Vergessen von Auschwitz mitsamt dem Verlust der deutschen Schuldbesonnenheit, das Reüssieren irrationaler, rechts- wie linksideologischer Kräfte und die Stigmatisierung und Aussonderung fremder, zumal migrantischer Minderheiten. Was während seiner Nazi-Jugend geschehen war, schien auch Jahrzehnte später an potenzieller Bedrohlichkeit nichts verloren zu haben. Der erinnerungssüchtige Halbkaschube aus dem verlorenen Danzig hatte in seinem Leben die totalitäre Perversion der Macht, einen inhumanen Kollektivismus und die Fatalität politischer Heilsversprechen hautnah zu spüren bekommen. Für ihn war und blieb die dräuende Wiederkehr alles Gewesenen ein unabgegoltenes Menschheitsproblem: Das war es – ist es wohl immer noch: Zeitenwende. Erlösung. Das Reinigende, Befreiende.
Kaum ein anderes Kunst- und Literatur-Lebenswerk nach 1945 ist ersichtlich, das die politischen, kulturellen und mentalitären Auf- und Abschwünge der Bundesrepublik in vergleichbarer Repräsentanz widergespiegelt und beeinflusst hätte wie dasjenige des Künstlers und Intellektuellen Günter Grass. So möge der nun vorliegende Einblick in sein Leben, in seine blühenden Denkwelten und geharnischten öffentlichen Auseinandersetzungen die Bedeutung dieses Dichters der Deutschen noch einmal ins Licht rücken. Er war ein so entschiedener wie umstrittener Demokrat und Citoyen, ein Aufklärer, ein spätromantischer Poet und Künstler, der reiche humanistische Quellen auszuschöpfen verstand.
ERSTES KAPITEL
Überschattete Kindheit. Lehrjahre des Künstlers
Ich glaube, es ist ein sehr gutes Gefühl,
nicht einen ganz bestimmten Ort zu haben.
Also nervös zu sein, verstört zu sein, draußen
zu sein, zu den Verlierern zu gehören, zu wissen,
was man verloren hat
Danzig – ein historisches Paradox
Das alte Danzig, Günter Grass’ Heimatstadt, ist im 20. Jahrhundert nicht verschont geblieben vom politischen Exitus der Weimarer Republik und von zwei Weltkriegen, von völkischem Wahn, Staatsterror und Judenvernichtung. Vielmehr sollte die ehemalige Ostsee- und Hanse-Metropole an der Weichselmündung zum initialen Schicksalsort eines nie gekannten Menschheitsdesasters werden. Auch für den 17-jährigen verwundeten Waffen-SSler brach im Mai 1945 die gesamte (klein-)bürgerlich-deutsche Weltordnung der Vergangenheit mit infernalischem Getöse in sich zusammen. Seitdem sollte das Erbe dieser Ur-Katastrophe des Jahrhunderts über die Maßen schwer auf ihm lasten. Zumal der junge Mann schon in der Wirklichkeit eines ideologieschwangeren und hochprekären Waffenstillstands aufgewachsen war, wie später auch sein bizarrer Romanheld Oskar in der ›Blechtrommel‹. Der Erste Weltkrieg hatte sich in den Zwanzigerjahren vom Schlachtfeld in die entzündeten Seelen und Köpfe der Menschen zurückgezogen. Und schon nach kurzer Zeit sollte der erste Versuch einer Republikanisierung Deutschlands in einem neuerlichen, noch grauenhafteren Vernichtungskrieg auf dem gesamten Kontinent enden. Jeder zivilisatorische Fortschritt schien damals von Grund auf zerstört zu sein. Kein Wunder, dass auch der kleinwüchsige Oskar vor einer herkulischen Schreib- und Deutungsaufgabe stehen wird. Es ist die ungeheuerliche Geschichte der Deutschen im 20. Jahrhundert, die sich als seine eigene hochprekäre Daseinshypothek erweisen sollte – einerseits erscheint sie ihm als amorphe Anschauungsmasse, als Reflexionsmaterie vor absurdem Welthintergrund, andererseits wird er persönlich in sie verstrickt und macht sich als Handelnder vor den Mitmenschen schuldig. Doch kann ein unzuverlässiger Zeuge wie Oskar Matzerath die Historie solcher Zeiten, ja den Roman seines beschädigten Lebens in den Griff bekommen, wenn – nach einem Wort Walter Benjamins – die Kunst des Erzählens sich ihrem Ende zuneigt, weil die epische Seite der Wahrheit, die Weisheit, ausgestorben ist?1
Auch für Danzig sind der Zeitbruch und der Veränderungsdruck seit dem Kriegsinferno von 1914/1918 unabweisbar geworden. Alles und jedes scheint den Kräften des politischen und sozialen Wandels unterworfen, und dennoch droht in Zukunft vieles auch zu bleiben wie es immer war. Hinter zahllosen Türen und Fenstern Danzigs stocken der Mief und die Beschränktheit des kleinbürgerlichen Daseins. Aber ist dies nicht der Stoff, aus dem die materielle Geschichte der Menschengattung und auch die Erzählungen über sie bestehen? Das scheint erst recht für einen gewöhnlichen Vorort wie Langfuhr zu gelten, in dem Günter Grass wie auch der Gnom Oskar das triste Glühbirnenlicht der Welt erblicken. In der mittelständischen bis kleinbürgerlichen Bevölkerung vermengen sich deutsche und polnische, kaschubische und jüdische Ethnien, ein buntes Kulturen- und Sprachengemisch erfüllt den privaten und öffentlichen Raum. In der Exklave Danzig und ihrer Umgebung steht es nach dem Krieg mit der Wirtschaft und auch mit dem Lebensgefühl der Bevölkerung nicht zum Besten, besonders seit dem 15. November 1920, diesem ›Paradox ihrer Geburtsstunde‹. Von diesem Tag an existiert ein Miniaturstaat namens ›Freie Stadt Danzig‹ unter dem Protektorat des Völkerbundes, eine Tatsache, die der konfliktreichen politischen Kompromissbildung im Versailler Friedensvertrag geschuldet ist.
Am 28. Juni 1919 ist der sogenannte ›Schandfrieden‹ unterzeichnet worden. Fortan verfügt der Miniaturstaat Danzig nur noch über erheblich eingeschränkte Souveränitätsrechte, seine Eisenbahn-, Post- und Hafenverwaltung wird an Polen abgetreten, ebenso die Organisation der auswärtigen Angelegenheiten. Zudem setzt man einen Hohen Kommissar als schlichtende Instanz zwischen die beiden Nachbarstaaten. Die ehedem freie Hansestadt Danzig ist nun ihrer selbst politisch nicht mehr mächtig, doch ebensowenig wie die deutsche kann die polnische Regierung schalten und walten, wie sie will. Ein allseits ungeliebtes, heterogenes Staatswesen ist entstanden, in dem von Anbeginn ein sich immer aggressiver zuspitzender Kleinkrieg zwischen dem Danziger Senat und der polnischen Regierung herrscht. So macht die deutsche Seite den Polen zunehmend ihre politischen und sozialen Rechte streitig, während die Polen diesem Gärungszustand durch die Errichtung eines militärischen Transitdepots auf der Halbinsel Westerplatte und durch den Ausbau des Konkurrenzhafens Gdingen immer wieder Nahrung geben. Der Danziger Senat betreibt in den Zwanziger- und Dreißigerjahren eine zunehmend rigide Anti-Polen-Politik, den Polen werden nicht nur etliche Beteiligungs- und Staatsbürgerrechte vorenthalten oder nur restriktiv zuerkannt, vielmehr entwickeln sich zwei konkurrierende Währungen, und die deutsche Innen- bzw. die polnische Außenrepräsentanz der Stadt befinden sich ständig im Widerstreit. Polnische Zollgesetzgebung und Zolltarife sollen den Danziger Warenverkehr regeln, weshalb fortlaufend neue Zusatzabkommen zwischen den Verwaltungen geschlossen werden müssen. So verschlechtert sich die Wirtschaftslage im Verlauf der Zwanzigerjahre erheblich, und immer wieder gibt es beiderseitige Proteste und harte öffentliche Auseinandersetzungen.
Zu Beginn der Dreißigerjahre, vor allem infolge der Weltwirtschaftskrise, ändern sich die politischen Bedingungen deutlich, im Januar 1931 übernimmt der deutschnationale Politiker Ernst Ziehm das Amt des Senatspräsidenten und bildet eine von der NSDAP geduldete Regierungskoalition aus DNVP, Zentrum und Liberalen. Ziehm regiert mit Hilfe von Ermächtigungsgesetzen, unter weitgehendem Ausschluss des Stadtparlaments, des Volkstags. Dass im Reich aggressive Propaganda für die Repatriierung Danzigs betrieben wird, ist der dortigen Regierung nur recht, und so muss man auf die polnische Gegenpropaganda und das weitere Aufheizen der politischen Stimmung in der Stadt nicht lange warten. Scharfe öffentliche Konfrontationen, Handelsboykotte, politische Konflikte vor dem Völkerbund sind nun immer wieder an der Tagesordnung. Während Glücksritter und Bankiers in Danzig üppige Geschäfte machen, leiden immer mehr Menschen unter Armut, Geldentwertung und Arbeitslosigkeit. Dass aus dem einstigen Fischerdorf Gdingen in wenigen Jahren eine erfolgreiche polnische Hafenstadt wird, im Kontrast zum alten, wirtschaftlich geschwächten Danzig, kann die politische Gesamtsituation nur noch stärker belasten. Bald tritt mit dem NS-Gauleiter Albert Forster ein aggressiver Parteimann auf den Plan, der es zum ›kleinen Adolf‹, zu einem der ›Vizekönige‹ Hitlers und 1939 schließlich zum ›Staatsführer‹ der Freistadt Danzig bringen sollte. Unter seinem Dominat gelingt es der NSDAP, wenn auch mit Verzögerungen gegenüber dem Reich, trommelnd und fahnenschwingend die Faschisierung des ›ewig deutschen‹ Danzig durchzusetzen und die überkommene Wählerkonstellation, das protestantische national-liberale Lager sowie die sozialistische Arbeiterbewegung, mit ideologischem Furor und brutaler Repression aufzubrechen.2
Der Stadt droht nun ein Unglück, das immer größere Stiefel anzieht, wird es später in der ›Blechtrommel‹ heißen. Am Ende dieser schleichenden Machtergreifung werden die vollkommene Paralyse der alten Macht- und Ordnungsstrukturen und die Errichtung eines neuen Reichsgaus Danzig-Westpreußen (1939) stehen. Insofern erlebt die Stadt seit Beginn der Dreißigerjahre die gleiche Radikalisierung des öffentlichen Lebens wie sie im Reich an der Tagesordnung ist, überall brüllen, trommeln und prügeln die braunen und schwarzen Nazi-Büttel auf die Menschen ein. Forster soll allein vom Oktober 1930 bis Oktober 1931 44 Massenveranstaltungen und über 2000 kleinere Parteikundgebungen durchgeführt haben. Hetzkampagnen, Schlägereien, Gewaltakte werden zu etwas Alltäglichem. Und dann ist es endgültig soweit, am 28. Mai 1933 erringt die NSDAP mit 50,03 Prozent der Wählerstimmen und 38 Mandaten die absolute Mehrheit im Volkstag. Wenige Wochen später haben die Nationalsozialisten auch den Senat der Stadt in alleiniger Hand. Nun lösen die politischen Großereignisse einander nur so ab – die Paradeaufmärsche, die Sonnenwendfeier mit riesigem Fackelzug, im September 1933 die ›Danziger Braune Messe‹, die Gründung einer Gauschule der NSDAP in Stutthof, der verordnete ›Deutsche Gruß‹ für die Beamtenschaft. Wo staatliche und soziale Ordnungsstrukturen zerfallen und der soldatische Chauvinismus zum Sturm bläst, wo gewählte Regierungen, Parteien, Gewerkschaften, Kirchen und Synagogen der brutalen Gewalt ausgesetzt sind und schließlich aufgelöst werden, besitzen die ›nicht-deutschen‹, also die polnischen Bevölkerungsgruppen und die Juden, immer weniger Lebensrechte.
Auch den Danziger Juden sollte die sogenannte ›Reichskristallnacht‹ vom November 1938 nicht erspart bleiben. Schon fünf Jahre zuvor ist die Synagoge von Langfuhr überfallen worden, wurden jüdische Geschäfte und Wohnungen beschmiert und geplündert, wenige Monate später führte man auch in der Freien Stadt Danzig die Nürnberger Rassegesetze ein. Dann sollten die Nazis sogar vor der Zerstörung der Großen Synagoge nicht mehr zurückschrecken. Trotz aller Proteste der jüdischen Gemeinden und der internationalen Politik gegen die zunehmende faschistische Gewalt sollte bereits im März 1939 ein umfangreicher Transport die Stadt in Richtung Palästina verlassen. Durch legale und illegale Auswanderung sinkt im Lauf der Dreißigerjahre die Anzahl der Danziger Juden von über 11 000 auf 1660 Personen.
Im September 1939 beginnt die SS mit dem Bau des Gefangenen- und Arbeitslagers Stutthof, das im Februar 1940 in das System der SS-Konzentrationslager aufgenommen werden und seit 1944 am Programm der sogenannten ›Endlösung‹ beteiligt sein sollte. Insgesamt hat man hier am Ende 65 000 Menschen zu Tode gebracht, allein von den inhaftierten 52 000 Juden wurden 35 000 ermordet. Auch Danzig wird in dieser Zeit zu einer Schaltstelle von Völkermord, Raub und Vertreibung, unzählige Schreibtischtäter legen hier mithilfe von SS und Gestapo blutig Hand an, doch die ›Normalität‹ des Lebens in der Stadt hat damals von all dem wenig Notiz nehmen wollen. Man vermutet, dass um 1940 in Danzig noch etwa 1200 Juden lebten, im August gelang es 527 von ihnen, die Heimat in Richtung Palästina zu verlassen, wo sie erst nach dem Krieg ankommen sollten. Seit Oktober 1941 haben die Danziger Juden in der Öffentlichkeit Davidsterne zu tragen, nahezu alle der dann noch in Danzig lebenden werden wenig später ins Warschauer Ghetto oder nach Auschwitz und Theresienstadt deportiert. Ganze 22 Menschen erleben damals im ›Judenhaus‹, einem Speichergebäude in der Mausegasse, das ersehnte Kriegsende.
Stumm passen sich die meisten Danziger damals der Nazi-Gewaltherrschaft an, viele von ihnen treten aber auch der NSDAP bei, so wie Günter Grass’ Vater. Die Partei sollte 1937 in der Stadt 45 000 Mitglieder besitzen, prozentual gesehen dreimal so viele wie im Deutschen Reich. Selbst die jungen Menschen gehören formell der Hitlerjugend, die Kinder den Pimpfen an, auch ihr Alltag wird mehr und mehr politisch reglementiert. Ein nationaldeutsches, insgesamt konservativ bis reaktionär gestimmtes Kulturleben wird damals gefördert, das Danziger Staatstheater etwa soll zu einer NS-Musterbühne werden. Doch die allgegenwärtige Apotheose von auserlesenem Deutschtum und nationaler Führerschaft hat das epidemische Angst- und Hetzklima in Danzig nur notdürftig übertünchen können. Allzu deutlich tritt die wachsende Wiederaufrüstung der Stadt in den Vordergrund. Vollends als die Polen im März 1933 eine schwer bewaffnete Militäreinheit auf der Westerplatte stationieren und dort schrittweise weitere militärische Anlagen aufbauen, kann Gauleiter Albert Forster diesen ›Coup auf Danzig‹ zum Vorwand nehmen für die immer brutaler werdende anti-polnische Propaganda und Repression. Spätestens seit Frühjahr 1939 wird die Stadt vom Reichsgebiet her offen remilitarisiert, man verlegt eine Artillerie-Abteilung sowie das 3. Bataillon der ›SS-Totenkopfstandarte‹ hierher, die ›SS-Heimwehr‹ und der ›SS-Wachsturmbann Eimann‹ werden ins Leben gerufen, und nicht zuletzt rekrutiert sich nun der ›Verstärkte Grenzaufsichtsdienst‹ aus den einstigen braunen Sturmabteilungen.
Danzig ist innerhalb kurzer Zeit für einen erwarteten Waffengang hochgerüstet, und der sollte ab dem 1. September 1939 tatsächlich stattfinden, mit dem zunächst erfolglosen Beschuss der Westerplatte durch das deutsche Schlachtschiff Schleswig-Holstein und dem anfangs ebenso fehlgehenden Handstreich gegen die erbittert verteidigte Polnische Post. Der mörderische Zweite Weltkrieg hat begonnen. Schon vor 1939 war erkennbar, dass die Stadt an der Weichsel für die nazistischen Lebensraum- und Expansionspläne in Richtung Osten eine herausgehobene Rolle spielen würde. Tatsächlich sollte die entlegene Heimat von Günter Grass seit dem Herbst des Jahres 1939 zu einem Schicksalsort deutscher und europäischer Geschichte werden, oder wie es in den ›Hundejahren‹ heißt: Langfuhr war so groß und so klein, dass alles, was sich auf dieser Welt ereignete oder ereignen könnte, sich auch in Langfuhr ereignete oder hätte ereignen können.3
Labesweg
Das Haus Labesweg 13, in dem Günter Grass groß wird, eine Mietskaserne […] zwischen Max-Halbe-Platz und Neuem Markt, ist 1908 errichtet worden und hat den Zweiten Weltkrieg nahezu unversehrt überstanden. Es handelt sich um ein schlichtes, vierstöckiges und unterkellertes Haus mit jeweils vier Wohnungen pro Etage. Im Erdgeschoss auf der rechten Seite befinden sich die Räumlichkeiten des Ehepaars Wilhelm und Helene Grass, sie leben dort mit den beiden Kindern Günter und Waltraut in einer Wohnung von etwa 56 Quadratmetern. Davon entfallen rund 14 Quadratmeter auf das familiäre Kolonialwarengeschäft. Die Wohnung besteht aus einem Wohnzimmer mit Blick auf Vorgarten und Straße und einem Schlafzimmer auf der Hinterhofseite. Zum Wohnzimmer führt ein längerer schmaler Flur hinter dem Kolonialwarenladen entlang und vorbei an der Küche. Im Jahr 1933 muss ein Teil der Küche geopfert werden zur Erweiterung des Geschäfts durch einen Verkaufsraum für Milch, Butter und Frischkäse. Übrig bleibt eine fensterlose Kammer mit Gasherd und Eisschrank.
Doch das Wohnzimmer der Familie Grass zeigt Anflüge von Kultur und Bildung, hier befindet sich ein stirnhoher Bücherschrank aus Nussbaum neben dem rechten Fenster, mit blauen Scheibengardinen und sorgfältig gearbeiteten Zierleisten. Seitlich des linken Fensters das Klavier von Mutter Helene, an einer der gemustert tapezierten Wände Böcklins Bild ›Insel der Toten‹. Nicht weit davon steht ein Kachelofen, daneben ein Buffet, es gibt einen Esstisch, eine Standuhr und eine Chaiselongue, auf der Günter in späteren Jahren schlafen sollte. Ihm und Waltraut bleibt jeweils eine Nische unter den beiden Wohnzimmerfenstern, hier kann der Junge mancherlei Utensilien aufbewahren und seinem Lesehunger ein kleines Refugium schaffen: In welch begrenzter Welt musste sich der junge Mensch heranbilden! Zwischen einem Kolonialwarengeschäft, einer Bäckerei und einer Gemüsehandlung musste er sein Rüstzeug fürs spätere mannhafte Leben zusammmenlesen, sollte es später in der ›Blechtrommel‹ über Oskar Matzerath heißen. In diesem Mietshaus der Familie Grass, in dem es kein Badezimmer und nur eine gemeinschaftliche Toilette auf dem Flur gibt, hat es sich kaum anders gelebt als vielerorts in Langfuhr. Der kleine Günter hat diese schlecht gelüftete Enge tagtäglich zu spüren bekommen: Der Geruch, den garender Weißkohl freigibt, wurde vom Gestank kochender Wäsche übertönt. Ein Stockwerk höher roch es vordringlich nach Katzen oder Kinderwindeln. Hinter jeder Wohnungstür miefte es besonders. Säuerlich oder brenzlig. […] Proletarier- und Kleinbürgergeschichten.4
Günter Grass zwischen seiner Mutter, Helene Grass, und seiner Großmutter, Danzig (1929)
19 Familien leben damals im Labesweg 13: ein Angestellter, ein Oberrangierer und ein Rentner, ein Kriegsbeschädigter und zwei Invaliden, ein Dachdecker, ein Kaufmann, ein Uhrmacher und ein Musiker, zwei Tischler, eine Näherin, drei Arbeiter und zwei Witwen – es handelt sich um ein durchweg kleinbürgerlich-proletaroides Quartier. Bis in die Namensgebung hinein wird sich der Autor der ›Blechtrommel‹, der ›Hundejahre‹ und ›Katz und Maus‹ von diesem Personal und seinem Milieu inspirieren lassen, gerade an den Wonnen der Gewöhnlichkeit in Danzig sollten ihm die politischen und menschlichen Ungeheuerlichkeiten des 20. Jahrhunderts aufgehen. Ist jedes persönliche Leben und seine soziale Mitgift nicht doch vom Zufall, vom bloßen Schicksal abhängig? Nicht auf Strohdeich und Bürgerwiesen, / nicht in der Pfefferstadt – ach, wär ich doch / geboren zwischen Speichern auf dem Holm! / in Strießbachnähe, nah dem Heeresanger / ist es passiert, heißt es in dem autobiographischen Gedicht ›Kleckerburg‹. Günter Grass ist das Kind kleiner Leute.5
Das Glühbirnenlicht der Welt erblickt er am 16. Oktober 1927 in der Danziger Frauenklinik, drei Jahre vor seiner Schwester Waltraut. Die Familie wohnt zu jener Zeit noch im Langfuhrer Kastanienweg 5a, erst 1928 zieht man um in den Labesweg 13, der Ulica Lelewela im heutigen Wrzeszcz. Wilhelm Grass, genannt Willy, der Vater beider Kinder und Sohn des Tischlermeisters Friedrich Grass, ist gebürtiger Danziger. Er hatte eine Bürolehre durchgemacht und dann als Vertreter für Papierwaren gearbeitet, bis zu dem Zeitpunkt, als das Lebensmittelgeschäft seiner Frau die Familie einigermaßen ernähren konnte. Helene Grass, genannt Lenchen, deren Familie auf kaschubische Wurzeln zurückgeht, muss als die tüchtige Seele der Familie bezeichnet werden. Sie ist katholisch erzogen worden und erweist sich später als eine kulturbewusste und tugendhafte Frau, die mit ihrer Religion allerdings keinen Fanatismus verbindet. Die Glaubensverhältnisse in der Familie Grass erscheinen eher als indifferent. Friedrich Grass, der Großvater väterlicherseits, wohnte schon vor dem Ersten Weltkrieg in Langfuhr und eröffnete dort im eigenen Haus an der Ecke zum Labesweg eine Bau-, Kunst- und Möbeltischlerei, die er bis zum Kriegsende führen konnte. Friedrich Grass war ein recht wohlhabender Mann, was man von seinem Sohn Wilhelm später nicht sagen kann. Günter Grass’ Großeltern mütterlicherseits, die er nicht mehr kennengelernt hat, stammten aus der Kaschubei, Helenes Vater Vinzenz Knoff hatte 1889 die in Ramkau geborene Eigentümertochter Elisabeth Krauze, später Krause, geheiratet. Vinzenz war zu dieser Zeit Schmiedegeselle in Danzig, doch schon 1914 ist er im Ersten Weltkrieg bei Tannenberg gefallen. Ebenso die drei Söhne der Familie, Arthur, Paul und Alfons, deren unterschiedlichen Neigungen zur Schriftstellerei, zum Schauspiel und zum Kochen sich Grass später verbunden fühlen sollte.6
Helene Grass mit ihren Kindern Günter und Waltraut (1931)
Helene Elisabeth Grass, geborene Knoff, muss als eine so lebenskräftige wie kluge und künstlerisch begabte Frau gelten, ihrem häuslichen Klavierspiel und ihrer Verseschmiederei wird Sohn Günter mancherlei Anregungen verdanken. Zupackendes Tätigsein, Regsamkeit im Kopf und schöngeistiger Genuss sind ihr lebensnotwendig: Ich habe eine gute Stütze an meiner Mutter gehabt, die so gelegentlich Gedichte für den Sonntagsteil einer Zeitung geschrieben hat, Spaßgedichte oder Rätselgedichte. Kein Wunder, dass Helene Grass es zu einem eigenen kleinen Kolonialgeschäft bringt, von dem die Familie leben kann, und in dem auch ihr Mann Wilhelm ein berufliches Unterkommen finden wird. Helene hatte eine Lehre im Einzelhandel bei ›Kaiser’s Kaffee‹ gemacht und zeitweise den kleinen Stubenladen ihrer Mutter Elisabeth geführt, bis sie 1928 im Labesweg 13 das seit Längerem bestehende Lebensmittelgeschäft übernehmen konnte. Sie war und blieb die entscheidende Kraft in der Familie, ihrem Mann Willy wurden eher Hilfsdienste überlassen: Er dekorierte das Schaufenster, kümmerte sich um Einkäufe bei Grossisten und beschriftete Preisschilder, heißt es in Grass’ Autobiographie über diesen nicht besonders geliebten Vater, der ein guter Koch gewesen sei.7
Die Geschäftstüchtigkeit der Mutter sollte sich später auch bei ihrem Sohn als Charakterzug wiederfinden. Er wird von ihr beauftragt, als eine Art Geldeintreiber die säumigen Schuldner ihres Ladens aufzusuchen und fällige Bezahlungen zu kassieren. Einen kleinen Prozentsatz davon darf Günter als Taschengeld behalten. Auf diesen kleinen Schuldenfeldzügen habe er Eindrücke für sein Lebenswerk gesammelt, schreibt er später, und so Material aus dem Alltag verarmter Mieter, zerstrittener Nachbarn, einsamer Hausfrauen, trunksüchtiger prügelnder Väter und hochmütiger Verwaltungsbeamter gewonnen.
Insgesamt bildet die Familie des späteren Künstler-Schriftstellers ein vielfarbenes Volks-, Sprachen- und Religionsgemenge, ein spannungsvolles Charakter- und Temperamentsgemisch. In diesem Gebrabbel werden die gewöhnlichen Geschichten eines unerhörten Alltags laut, hier beredet man die Schicksalsereignisse in Familie, Region und Nation. Genussfreude, Humor und Fabulierlust lassen die Phantasien sprießen. Hier sollte der Junge auch seine ureigene Sprachfärbung finden – den gaumigen Zungenschlag des Günter Grass: baltisch, tückisch, stubenwarm. So lauscht der erfahrungshungrige Junge mit Hingabe den besonderen Mundfertigkeiten und Sprachgewohnheiten der Kaschuben: Ihr verlangsamtes Reden glich abgestandener Dickmilch, auf die sie geriebenes Schwarzbrot, gemischt mit Zucker, streuten. Die Tatsache, dass er einer deutsch-kaschubischen Mischehe entsprungen sei, habe ihn als offener Zwiespalt bis ins hohe Alter wachgehalten, wird der Autor-Künstler später erklären. Als Halbkaschube sei er nicht lupenrein, sondern auf doppelt genähte Weise in einem Spannungsfeld aufgewachsen.8
Es sind nicht mehr viele Verwandte, mit denen Vater Willy und Mutter Helene in den mittleren und späten Dreißigerjahren noch Umgang haben, die Nächststehenden sind eine Schwester von Helenes Mutter und deren Familie, die Krauses. Vor allem Franz Krause, der Lieblingsvetter und Beamte auf der polnischen Post in Danzig, hat zur Familie Grass enge Beziehungen unterhalten. Doch schon seit der Errichtung des Freistaats Danzig im Jahre 1920 stehen sich beide Teile der durchmischten Familie in zwei verschiedenen Territorien gegenüber – die Knoffs/Grass im deutschen, die Krauses/Krauzes im polnischen Staatsgebiet. Die Situation der Zweistaatlichkeit bleibt nirgends ohne Folgen: Meine Mutter konnte zwar kaschubisch sprechen, und als Kind hatte ich ein paar Brocken parat, aber das war erstens nicht fein und irgendwann ja auch nicht mehr opportun, politisch gesehen, kaschubisch oder gar polnisch zu sprechen. Während der Dreißigerjahre wird in Danzig die Hetze gegen Nicht-Deutsche, gegen Polen, Kaschuben und Juden immer aggressiver, bald muss darunter auch die Geselligkeit zwischen der Familie Grass und ihren Verwandten leiden: Die kaschubische Verwandtschaft […] lebte auf dem Land, war nicht richtig deutsch, zählte nicht mehr, seitdem es Gründe gab, sie zu verschweigen. An Frantizek Krauze, dem vertrauten Cousin von Mutter Helene, sollte im September 1939 die völkische Randständigkeit und Minderbewertung der Kaschuben auf schmerzhafte Weise spürbar werden. Denn Frantizek, der sich nicht mehr Franz Krause nennen darf, wird als einer der Verteidiger der Polnischen Post von den Deutschen standrechtlich erschossen. Mit diesem Trauma hält der Zweite Weltkrieg Einzug in das private Schicksal der Familie Grass, aber dieser gewaltsame Tod wird hier nicht als Verbrechen, Skandal und böses Omen wahrgenommen, sondern auf peinliche Weise nahezu schamhaft verschwiegen.9
Alles in allem wächst der junge Mann in bescheidenen und behüteten Verhältnissen auf, doch jäh sollte diese Kindheit enden, mit Beginn des Krieges im Herbst 1939, da ist er gerade einmal zwölf Jahre alt: Mein Lehrer hieß Krieg. Die Schule war aus. Der Junge wird in jenen Jahren zutiefst geprägt durch die Ideologiewelt Nazi-Deutschlands. Bomben- und Granatensplitter sammeln er und seine Freunde mit Bewunderung und Grausen. Günter kennt die Namen und die Tonnagen aller bedeutenden und weniger bedeutenden Kriegsschiffe und U-Boote, in seinen Ohren dröhnen Sondermeldungen von den verschiedenen Fronten, sie prägen und erweitern – wie es später auch von Oskar Matzerath heißen wird – seine Geographiekenntnisse. Hingebungsvoll hört der kleine Junge, als Katholik mit Glaubensklängen vertraut, in den Wochenschauen oder auf öffentlichen Plätzen die Donnerwörter der Nationalsozialisten – Opfersinn und Treue, Volksgemeinschaft und ›Heilig Vaterland in Gefahr‹. Das Heldenhafte, das strahlend Mächtige, das Reine und Identische, das Völkische und allzeit Überlegene, ja eine Art sakrale Erlösungsinbrunst wird zum Inbegriff alles Deutschen. Die Erziehung zum Idealismus, dieses Grundübel, wie Grass später sagen wird, bildet den Kern seiner jugendlichen Edukation: Immer wieder erlag ich dem Rausch der Erfolge. Tapferkeit, die ausschließlich an militärischen Leistungen gemessen wurde, geriet meiner Generation zum Glücksbegriff. Ab September 1939 ist überall Krieg, wohin man schaut, aber der Krieg ist nicht alles, was dem Sonntagskind, wie seine Mutter sagt, beschieden sein sollte.10
Kaffee-Ausflug der Familie Grass (1935)
Familienausflug, Günter Grass als Siebenjähriger mit Mutter und Schwester (1935)
Der kleine Günter Grass ist in der Langfuhrer Herz-Jesu-Kirche getauft worden, einige Jahre später wird er dort Messdiener, etwa zu jener Zeit, als sein Vater in die Nazi-Partei eintritt. An die regelmäßigen Gebete für den Führer und an die Einsegnung der deutschen Waffen kann er sich noch im Alter gut erinnern. Die beiden Sozialisationsinstanzen Katholizismus und NSDAP, Kirche und Hitler-Jugend, kommen in mancherlei überein, was die weitere Zurüstung des Jünglings für das ›Tausendjährige Reich‹ angeht. Verordnete Glaubensinnigkeit und politische Kampfrhetorik liegen damals wie ein Alp auf dem öffentlichen Leben. Er habe von katholischer Seite nie ein kritisches Wort gegen die Nazis gehört, wird er später sagen. Doch irgendwelche Zweifel hätten seine Kinderjahre auch nicht getrübt: Vielmehr machte ich, leicht zu gewinnen, bei allem mit, was der Alltag, der sich aufgeregt aufregend als ›Neue Zeit‹ ausgab, zu bieten hatte. Das bündische Abenteuertreiben im Zeltlager hat dem kleinen Grass großes Vergnügen bereitet, ungleich mehr als die katholische Messe-Litanei in der Kirche, sein Glaube sei schon damals weniger christlich, eher heidnischer Natur gewesen. Gegenüber der nationalistischen Euphorie, in die Deutschland geraten ist, sperrt er sich nicht, gläubig schwört auch dieser kleine Mitläufer zur Fahne, die mehr bedeuten soll als den Tod: Ich war als Hitlerjunge ein Jungnazi. Gläubig bis zum Schluss.11
Welche Autorität konnte unter solchen Umständen die Schule noch beanspruchen? Der Knabe Grass war kein schlechter, aber ein dreister, oft genug widerspenstiger Zögling, der nicht nur die Quarta wiederholen, sondern insgesamt dreimal die Anstalt wechseln musste, stets aus disziplinarischen Gründen. Er spricht später von seiner außerordentlichen Aufsässigkeit als Junge. Vom Conradinum in Langfuhr wurde er versetzt in die St. Petri-Oberschule, weil er einem prügelnden Turnlehrer paroli geboten hatte. Ähnliches dürfte gegolten haben für seine Abordnung von St. Petri auf das Gymnasium St. Johann, und sogar noch ein drittes Mal hat man den Schüler von seiner Lehranstalt verwiesen: Bei anhaltender Schieflage stand ich permanent auf der Kippe. Der Eins in Deutsch stand die Fünf in Mathematik gegenüber.12
Kurz vor Beginn des Krieges sind Schule und Erziehung auch in Danzig keine ernstzunehmenden öffentlichen Instanzen mehr. Der jugendliche Günter Grass, dieser teils faule, teils ehrgeizige, doch unterm Strich schlechte Schüler, erwirbt seine Bildung nicht auf Schulbänken, sondern im Leben, in der Verquickung von prekärer Privatheit und öffentlicher Hysterisierung, zwischen Heiligem Geist und Hitlers Bild. Am Ende wird der Krieg stehen. Es ist eine in vieler Hinsicht enteignete Jugend, inmitten einer Welt der ideologischen Brandreden und Losungen, der Fahnenappelle und Aufmärsche, des trommelnden Gefolgschaftszwangs und der immerwährenden Heldenanbetung. Unüberhörbar hallt auf den Straßen Danzigs das ›Fahnenlied‹ der Hitlerjugend: »Wir marschieren für Hitler / Durch Nacht und Not / Mit der Fahne der Jugend für Freiheit und Brot / […] Unsere Fahne ist mehr als der Tod.«13