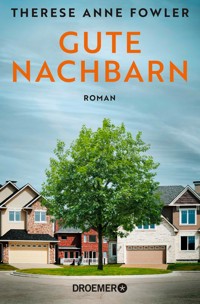
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 17,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 17,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Droemer eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein Gesellschaftsroman, den man nicht aus der Hand legen kann, weil er auf schmerzliche Weise unsere heutige Zeit verhandelt. In Oak Knoll, einem Vorort in North Carolina, USA, ist das Leben noch in Ordnung: Die Nachbarschaft ist grün und der Zusammenhalt zwischen den Nachbarn eng. Hier zieht die alleinerziehende Forstwirtschaftlerin Valerie Alston-Holt ihren Sohn Xavier groß. Er ist ein Musiktalent und das College-Stipendium ist ihm so gut wie sicher. Dennoch hat er zu kämpfen, denn Valerie ist schwarz, Xaviers Vater weiß, und er selbst passt nirgends so richtig hin. Als auf dem Grundstück nebenan die Whitmans mit ihren Töchtern einziehen, verändert sich langsam, aber stetig die Gemengelage in dem kleinen Vorort. Sie sind die scheinbar perfekte weiße Familie, die den amerikanischen Traum lebt. Doch ganz so einfach ist es nicht, denn hinter der Fassade verbirgt sich manches Geheimnis. Manchmal braucht es nur noch eine sterbende Eiche und eine Teenager-Liebe, um eine hübsche Nachbarschaft von einer Katastrophe erschüttern zu lassen. Mit chirurgischer Präzision nimmt Therese Anne Fowler ihre Charaktere Stück für Stück auseinander und zeichnet mit ihrem Gesellschaftsroman ein erschreckendes Bild des heutigen Amerika, das noch immer von Rassismus, Sexismus und Vorverurteilungen geprägt ist. Ein Buch, über das man sprechen möchte. »Ein wahres Lesefest: fesselnd, herzzerreißend und notwendig.« Jodi Picoult
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 453
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Therese Anne Fowler
Gute Nachbarn
Roman
Aus dem amerikanischen Englisch von Nicole Seifert
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Ein Gesellschaftsroman, den man nicht aus der Hand legen kann, weil er auf schmerzliche Weise unsere heutige Zeit verhandelt.
In Oak Knoll, einem Vorort in North Carolina, ist das Leben noch in Ordnung: Die Nachbarschaft ist grün und der Zusammenhalt zwischen den Nachbarn eng. Hier zieht die alleinerziehende Forstwirtschaftlerin Valerie Alston-Holt ihren Sohn Xavier groß. Er ist ein Musiktalent, und das College-Stipendium ist ihm so gut wie sicher. Dennoch hat er zu kämpfen, denn Valerie ist schwarz, Xaviers Vater weiß, und er selbst passt nirgends so richtig hin.
Als auf dem Grundstück nebenan die Whitmans mit ihren Töchtern einziehen, verändert sich langsam, aber stetig die Gemengelage in dem kleinen Vorort. Sie sind die scheinbar perfekte weiße Familie, die den amerikanischen Traum lebt. Doch ganz so einfach ist es nicht, denn hinter der Fassade verbirgt sich manches Geheimnis. Manchmal braucht es nur noch eine sterbende Eiche und eine Teenager-Liebe, um eine hübsche Nachbarschaft von einer Katastrophe erschüttern zu lassen.
Mit chirurgischer Präzision nimmt Therese Anne Fowler ihre Charaktere Stück für Stück auseinander und zeichnet mit ihrem Roman ein erschreckendes Bild des heutigen Amerika, das noch immer von Rassismus, Sexismus und Vorverurteilungen geprägt ist. Ein Buch, über das man sprechen möchte.
Inhaltsübersicht
Widmung
Danksagung
Teil I
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
Teil II
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
Teil III
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
39. Kapitel
40. Kapitel
41. Kapitel
42. Kapitel
43. Kapitel
44. Kapitel
45. Kapitel
46. Kapitel
47. Kapitel
48. Kapitel
49. Kapitel
50. Kapitel
51. Kapitel
Epilog
Für Wendy und John, die mir immer beistehen
Danksagung
Diese Geschichte nahm in meinem Kopf Gestalt an, lange bevor ich bereit war, ein Wort davon aufzuschreiben. Gute Nachbarn ist ganz anders als die historischen Romane, für die ich bekannt bin, und den Kurs zu ändern war durchaus ein berufliches Risiko. Doch hatten diese Figuren und ihre miteinander verflochtenen Schicksale, die Geschichte von ihren Konflikten und deren Auswirkungen für mich etwas Dringliches. Ihre Geschichte aufzuschreiben war nötig, eine Art Aktivismus in unseren bewegten und beunruhigenden Zeiten.
Und dann war da noch der Punkt, dass ich als weiße Autorin die Perspektive zweier afroamerikanischer Figuren einnehmen musste, die für die Geschichte von zentraler Bedeutung sind. Ich näherte mich dem Projekt mit Respekt und dem Ziel einer genauen Darstellung, in dem vollen Bewusstsein, dass das weißen Autor*innen auch schon misslungen ist. Ungefähr zu dieser Zeit hörte ich einen Vortrag von Zadie Smith. Auf die Publikumsfrage, ob weiße Autor*innen überhaupt aus der Perspektive schwarzer Figuren schreiben sollten, sagte Smith, im Grunde könne und dürfe man schreiben, worüber man wolle. Sie sagte, wenn die eigenen Figuren anders seien als man selbst, müsse man eben seine Hausaufgaben machen. Das bestätigte meine Überzeugung. Ich recherchierte intensiv (zu diesem Thema und zu allen anderen, die relevant waren) und schrieb diesen Roman mit all dem im Hinterkopf, was ich dadurch gelernt habe.
Ich sehe auf diesen Seiten meine Freunde und Nachbarn, die Gesichter meiner Umgebung und meines Landes und unserer vernetzten Welt. Es ist eine Geschichte, die Leser*innen hoffentlich dazu bringen wird, darüber nachzudenken, wie leicht gute Menschen schlechte Entscheidungen treffen, nicht aus Bosheit, sondern meistens aus Gewohnheit oder Konvention, aus Unachtsamkeit oder Angst. Es ist aber auch eine Geschichte, die zugesteht, dass es Bosheit gibt und dass wir das Bollwerk werden müssen, das ihren Sieg verhindert.
Ich möchte denen meinen Dank ausdrücken, deren Rat, Hilfe, Überprüfung, Beistand, Unterstützung und/oder Freundschaft mir geholfen haben, dieses Buch zu veröffentlichen: Wendy Sherman, Sarah Cantin, Sally Richardson, Jen Enderlin, Lisa Senz, George Witte, Dori Weintraub, Rachel Diebel, Jessica Zimmerman, Lucy Stille, Jenny Meyer, Cherise Fisher, Trina Allen. Besonders danken möchte ich Olga Grlic für den Entwurf eines weiteren umwerfenden Covers, dem gesamten Marketing-Team der St. Martin’s Press und den Buchhändler*innen und Autor*innen, die sehr früh gelesen und begeistert kommentiert haben.
An der Heimatfront werde ich ewig dankbar sein Sharon Kurtzman, die alles hört und nichts erzählt. Und den hiesigen Schreibmädels, deren Kameradschaft mein Autorinnenleben in Myriaden Weisen bereichert. Genau wie meine weiter entfernten Kolleg*innen. Ihr rockt und seid meine Felsen in der Brandung.
Grüße gehen raus an meine Söhne; ihre Mutter zu sein hat mir so viele Erkenntnisse verschafft, die diesem Roman zugutegekommen sind – außerdem sind sie einfach großartige Kerle. Und last but not least, an den anderen großartigen Kerl in meinem Leben, den unfassbar erfolgreichen Autor John Kessel, der mich endlos unterstützt, wertvolle Vorschläge und Mitgefühl für mich hat, der für mein Wohl sorgt und nichts dagegen hat, wenn ich den ganzen Tag im Bademantel arbeite, weil er das oft genauso macht.
Teil I
1
Ein hochpreisiges neues Haus in einem einfachen, alten Viertel. Auf einer Liege neben einem Swimmingpool ein Mädchen, das in Ruhe gelassen werden will. Wir beginnen unsere Geschichte hier, in den Minuten vor dem kleinen Ereignis, das alles verändern wird. Ein Sonntagnachmittag im Mai, an dem unser Viertel noch seinen prekären Frieden wahrt, das ungefähre Gleichgewicht von alt und neu, uns und denen. Später in diesem Sommer, bei der Beerdigung, werden die Medien vollmundig spekulieren, wer Schuld hat. Sie werden die Anwesenden auffordern, vor der Kamera zu sagen, auf wessen Seite sie stehen.
Fürs Protokoll: Partei zu ergreifen war nichts, was wir wollten.
Juniper Whitman, das Mädchen am Pool, war siebzehn. Ein schwieriges Alter, ohne Frage, selbst wenn alles gut läuft – was in diesem Fall wohl so war, schien uns. Es wäre abgedroschen zu sagen, der Anschein kann täuschen, deshalb sagen wir das nicht. Wir sagen, man kennt niemanden je wirklich, wenn man nur nach dem äußerlich Sichtbaren geht. Wir sagen, die meisten von uns verbergen, was uns umtreibt und irritiert, und stellen stattdessen die Seiten zur Schau, die den anderen hoffentlich gefallen, das, was andere hoffentlich mögen. Juniper verbarg etwas, und sie wusste nicht, ob sie sich schämen oder wütend sein sollte oder was genau sonst.
Der Garten dieses neuen Hauses war deutlich kleiner als Junipers alter – gerade mal tausend Quadratmeter, der alte war zehnmal so groß gewesen. Wo sollte sie denn hin, wenn sie mal raus wollte, aber nicht weg durfte? Es gab kaum einen Flecken, der nicht vom Haus und vom Pool eingenommen wurde, und was es gab, war nicht überdacht. Es gab überhaupt keine Privatsphäre. Bei der vorigen Adresse saß Juniper gern zwischen den hohen Sumpfkiefern hinten auf dem Grundstück, weit genug vom Haus entfernt, wo sie das Gefühl hatte, atmen und denken zu können. Sie mochte die Biota, wie es wissenschaftlich hieß. Dort ging es ihr besser. Schon immer.
Aber wer dieses große, glänzende weiße Haus erbaut hatte, hatte das Grundstück von den stattlichen Laubbäumen befreit, die das kleine Haus beschatteten, das hier gestanden hatte, das Haus, das umstandslos abgerissen worden war wie Bauschutt nach Stürmen oder Erdbeben. Nur dass es keinen Sturm gegeben hatte, kein Erdbeben. Da waren einfach nur ein attraktives Viertel mitten in einer attraktiven Stadt in North Carolina und Käufer, die bereit waren, Geld auszugeben. So einfach war das, und jetzt war hier dieses tolle große Haus mit seinem kleinen, aber teuren, kahlen Garten und seinem Pool und seiner Liege und seinem Mädchen mit seinem Buch.
Juniper dachte, das Rascheln, das sie im angrenzenden Garten hörte, käme von Eichhörnchen – ein Garten, in dem es noch einen kleinen Wald aus Hartriegel, Walnuss-, Pekannussbäumen und Kastanien gab, Kiefern und eine gewaltige Eiche, die dort schon länger stand, als irgendjemand im Viertel lebte. Sie mochte keine Eichhörnchen. Klar, sie waren süß, aber man musste immer damit rechnen, dass sie einem direkt unters Auto liefen, wenn sie einen kommen sahen. Und sie klauten immer die Kerne aus den Vogelhäuschen. Juniper versuchte sich wieder auf den Roman in ihrem Schoß zu konzentrieren. Die Geschichte war gut, und sie war mittlerweile richtig gut darin, sich in Geschichten zu flüchten.
»Hey«, sagte eine Stimme, die keinem Eichhörnchen gehörte. Juniper blickte auf und sah einen Jungen in ihrem Alter am Rand ihres Gartens stehen, in der einen Hand eine Harke, die andere zum Gruß erhoben. »Du musst unsere neue Nachbarin sein«, sagte er. »Ich war gerade dabei, ein paar Blätter wegzumachen und hab dich gesehen, da dachte ich, ich sag mal Hallo.«
Sein Auftauchen war in zweierlei Hinsicht überraschend. Zum einen hatte Juniper nicht gewusst, dass jemand in der Nähe war. Und selbst wenn sie vermutet hätte, dass da jemand war, ein Junge, ein Teenager wie sie, hätte sie angenommen, er sähe aus wie sie – also, weiß. In ihrem alten Viertel waren alle weiß. Aber er war schwarz, da war sie ziemlich sicher. Mit ziemlich heller Haut und Korkenzieherlocken im denkbar dunkelsten Goldton.
»Hey«, sagte sie. »Ja. Wir sind gestern eingezogen – meine kleine Schwester, meine Eltern und ich.«
»Seid ihr von woanders hergezogen?«
»Nein, nur vom Stadtrand.«
Er lächelte. »Cool. Na ja, ich wollt nicht stören. Nur, du weißt schon, herzlich willkommen.«
»Kein Problem. Danke.«
Wenn es dabei geblieben wäre, wenn sie sich einfach begrüßt und es dabei bewenden lassen hätten – alles wäre sehr viel einfacher gewesen, für alle. Um das Mindeste zu sagen.
2
North Carolina hat ein gemäßigtes Klima, was entscheidend zu seiner Attraktivität beiträgt. Die Winter sind mild. Der Frühling kommt zeitig. Ja, die Sommer sind heiß, aber der Herbst bringt Erleichterung und hält lange an. Die Eichen behalten ihre Blätter bis weit in den Dezember, und manchmal, wenn der Winter besonders freundlich ist, behalten manche Arten – die Lebenseiche ist eine davon, mit ihren schmalen, federförmigen, zart wirkenden Blättern – ihr Laub den ganzen Winter über.
Der Junge, der Juniper an jenem ersten Tag begrüßt hatte, Xavier Alston-Holt, wusste eine Menge über Bäume. Sie waren aber nicht von besonderer Bedeutung für ihn; Musik interessierte ihn weit mehr, vor allem Musik, für die man Akustikgitarren brauchte. Gitarren waren allerdings aus Holz, wenn seine Mutter ihm also endlos was über alle möglichen Bäume erzählte, ihre Standorte, ihre Bewohner, ihre Eigenschaften, ihre Feinde (diese Liste wurde angeführt von gierigen Bauherren), passte er meistens auf. Als seine Mutter weinend im Garten stand und filmte, an dem Tag, als das angrenzende Grundstück geräumt wurde, an dem Tag, an dem Männer mit Kettensägen und Schleifsteinen bei Sonnenaufgang anfingen und bis Sonnenuntergang weitermachten, rauschten ihm noch die ganze Nacht die Ohren, und er blieb im Garten, den Arm und ihre Schultern gelegt, weil es das war, was er für sie tun konnte. Sie hatte so viel für ihn getan.
Xavier war also nicht überrascht, und wir auch nicht, dass seine Mutter nicht besonders erpicht darauf war, die Nachbarn kennenzulernen, die das neu gebaute Haus hinter ihrem gekauft hatten. Valerie Alston-Holt wusste nicht genau, wie sie freundlich sein sollte zu der Art Leute, die ihr Geld sparten, um davon ein altes Haus abzureißen und Bäume zu fällen. Alle Bäume. »Solche Leute«, sagte sie mehr als einmal – denn so etwas passierte in Oak Knoll mittlerweile in verschiedenen Abstufungen immer wieder –, »solche Leute haben kein Gewissen. Es ist, als würden sie die Natur vergewaltigen. Ermorden. Bäume sind Leben. Nicht nur mein Leben«, fügte sie hinzu, denn Forstwirtschaft und Ökologie waren ihre Fachgebiete, »sondern einfach Leben, Punkt. Sie stellen buchstäblich Sauerstoff her. Wir müssen mindestens sieben Bäume pro Mensch auf diesem Planeten behalten, sonst wird die Menschheit ersticken. Überleg dir das mal.«
Xavier ging in den bewaldeten vorderen Teil des Gartens, wo seine Mutter Pfingstrosen für den Nachttisch einer kranken Nachbarin schnitt. Die Blumenbeete rund um ihr bescheidenes Backsteinhaus, das 1952 erbaut und seitdem kaum renoviert worden war, waren Valeries Lieblinge, direkt nach ihrem Sohn und einem Baum: der massiven alten, fünfundzwanzig Meter hohen Eiche, die ihren Garten dominierte. Man sollte nicht meinen, dass ein Baum einem Menschen so viel bedeuten kann. Dieser Baum jedoch war mehr als ein prächtiges Stück arboreale Geschichte; für Valerie Alston-Holt war er ein Zeitzeuge und ein Begleiter. Sein dicker Stamm war das Erste, was sie sah, jedes Mal, wenn sie aus dem Fenster in den Garten blickte. Er erinnerte sie an so viele Augenblicke in all den Jahren, die sie hier lebten, nicht zuletzt an die Sommernacht, in der sie dort gestanden, ihre Stirn an die schrundige graubraune Borke gepresst und geweint hatte, während Xavier in seinem Bettchen schlief, noch zu klein, um zu verstehen, dass Gott ihnen gerade das Wichtigste genommen hatte.
Sechs Sorten Iris. Pfingstrosen in vier verschiedenen Farben. Azaleen, Phlox, Schneeglöckchen, Kamelien, Rhododendren, Klematis, Geißblatt, Jasmin – welche Pflanze Ihnen auch einfallen mag: Sofern sie in diesem Staat wuchs, hatte Valerie Holt sie irgendwo auf dem Grundstück. Sich um ihre Pflanzen zu kümmern, war ihre Therapie, sagte sie gern, ihre Art, den Stress abzubauen, den es mit sich brachte, Studenten im Grundstudium zu unterrichten – oder den Stress, den es mit sich brachte, sich mit dem Institutsleiter und dem Dekan auseinanderzusetzen. Die jungen Leute waren eigentlich ganz toll. Neugierig. Klug. Politisch auf eine Weise, die ihr gefiel – auf eine nutzbringende Weise, die half, natürliche Lebensräume zu schützen. Oder zumindest versuchten sie das, und das war schon eine Menge wert. Junge Leute würden die Welt vor sich selbst retten. Und sie würde sie dazu ermuntern, auf jede erdenkliche Weise.
»Es ist so weit«, sagte Xavier jetzt zu ihr.
»Was ist so weit? Gehst du irgendwo hin?« Sie legte die Blumen und die Schere in den Korb und richtete sich auf. »Ich dachte, du würdest das alte Laub für mich entsorgen.«
»Tue ich auch. Wir haben neue Nachbarn.«
»Ach, das. Ich weiß. Das war unvermeidlich. Wie der Tod«, fügte Valerie mit einem kläglichen Lächeln hinzu.
»Eine habe ich gerade kennengelernt«, sagte Xavier. »Sie sagt, es sind sie, ihre Schwester und ihre Eltern.«
»Nur vier Leute in dem großen Haus?«
Xavier zuckte mit den Schultern. »Schätze schon.«
»Wie alt?«
»Das Mädchen? So alt wie ich, ungefähr. Und eine kleine Schwester, hat sie gesagt. Ich hab nicht weiter gefragt.«
Seine Mutter nickte. »Okay. Danke für die Info.«
»Soll ich dir Bescheid sagen, falls die Eltern rauskommen?«
»Nein. Ja. Natürlich. Ich werde eine gute Nachbarin sein.«
»Bist du immer.«
»Danke, Zay.«
»Ich sag nur, wie es ist.«
»Das müssen wir auch, soweit wir können.«
Xavier kehrte in den hinteren Teil des Gartens zurück und begann, die Blätter dort zusammenzurechen, wo seine Mutter vorhatte, einen Karpfenteich anzulegen. Da er bald nach San Francisco gehen würde, aufs Konservatorium, brauchte sie, wie sie sagte, neue Wesen, die sie beschäftigt hielten, schon damit sie ihn nicht jeden Tag anrief, um zu hören, ob er ohne sie am anderen Ende des Landes auch überlebte. Er wusste, sie machte Witze; sie würde so oder so nicht jeden Tag anrufen. Sie würde es wollen, aber sie würde es nicht tun. Er verstand das. Sie waren lange Zeit ein ziemlich exklusives Duo gewesen.
Er hatte gesagt: »Leg den Teich an, und vielleicht gehst du mal aus, mit jemandem von hier.«
»Ach, ausgerechnet du redest vom Ausgehen?«
Er schenkte ihr das schiefe Lächeln, das ihn bei den älteren Damen in Oak Knoll so beliebt machte, und bei den Mädchen an seiner Schule bestimmt auch, da waren wir sicher. Er sagte: »Ich bin zu beschäftigt für eine Freundin.«
»Wohl eher zu wählerisch.«
»Das bist du, aber ich?«, sagte er.
Tatsache ist, Xavier war sowohl sehr beschäftigt als auch wählerisch – aber in erster Linie wählerisch. Er hatte noch keine kennengelernt, die ihm das Gefühl gab, seine Prioritäten überdenken zu müssen. Er hatte massig Freundinnen, darunter auch Mädchen, die mit ihm ausgegangen wären, wenn er sich auf diese Weise für sie interessiert hätte. Das tat er aber nicht, denn er kannte sich selbst gut genug, um zu wissen, dass er ein Typ für alles oder nichts war. Schon immer gewesen war. Er hatte sich im letzten Jahr mit ein paar Mädchen getroffen, nach Lust und Gelegenheit, aber eine Beziehung kam für ihn im Moment nicht infrage. Seine Liebe galt der Musik.
Er sah zu dem Mädchen am Pool hinüber, der neuen Nachbarin, dem Mädchen, das er gerade kennengelernt hatte. Wie heißt sie?, dachte er. Warum willst du das wissen?, dachte er gleich darauf. Mach einfach deine Arbeit.
Xavier war sechs Jahre alt gewesen, als er zum ersten Mal auf einer Gitarre geschrammelt hatte, bei einer Geburtstagsparty der Tochter von einer Kollegin seiner Mom. Mehrere Erwachsene hatten Instrumente mitgebracht – Gitarren, Mandolinen, Bongos, eine Mundharmonika –, und nach dem Kuchen und den Geschenken versammelten sich alle auf den Plastikstühlen auf der unebenen Terrasse, um zu musizieren und zu singen. Erst waren es Kinderlieder, dann viel von Neil Young und den Beatles und ein bisschen was von James Taylor. Xavier fand die Musik schön, aber eine bestimmte Gitarre machte ihn richtig neugierig. Ihm gefiel, wie sie aussah, genau wie ihr klarer, hoher Klang. Er fragte den Besitzer, einen Geschichtsprofessor namens Sean, ob er mal probieren dürfe. Sean drückte ihn auf einen Stuhl und legte ihm die Gitarre in den Schoß. Das Instrument war riesig, verglichen mit dem dünnen kleinen Jungen. Xavier hielt das Instrument am Hals, griff einmal darüber, strich über die Saiten, und das war’s, es war um ihn geschehen. Eine Woche später nahm er seine erste Stunde. Mit zehn war er auf klassische Musik festgelegt; nur Klassik ließ ihn Schönheit fühlen, und er brauchte dieses Gefühl, um das ganze emotionale Rauschen seiner Welt durchzustehen. Zu Beginn dieses Jahres, inzwischen achtzehn, hatte er sich dann um einen der begehrten Plätze am Konservatorium in San Francisco beworben und ihn bekommen.
Xavier rechte die Blätter zu einem Haufen und fing an, sie in die biologisch abbaubaren Säcke zu stopfen, die Valerie in einem Laden gekauft hatte, in dem alles viermal so viel kostete wie seine günstigere, meist aber (auf die ein oder andere Weise) giftige Alternative. Der Großteil ihrer Putzmittel, Hygieneprodukte, Lebensmittel und Klamotten stammte von dort. In Anbetracht dieser Ausgaben und des Gartens und Xaviers Musikstunden war es kein Wunder, dass kein Geld für eine Renovierung da war, wäre Valerie überhaupt daran gelegen. Wir machen uns manchmal über sie lustig – so, wie wir uns über unseren Freund lustig machten, der die Paleo-Diät so weit trieb, dass er nicht mal mehr Körner essen wollte, wenn diese Körner nicht von Hand mit einem Stein gemahlen worden waren. Valerie erwiderte unsere Neckerei, wie sie gemeint war: mit Zuneigung. Denn wir konnten gar nicht anders, als eine Frau zu lieben, die derart fürsorglich war und ihrer Sache so treu blieb.
Die neue Nachbarin lag noch auf der Liege neben dem blau glitzernden, in den Boden eingelassenen Pool und las. Xavier gefiel der Anblick (des Mädchens, in erster Linie, obwohl der Pool wirklich einladend aussah). Er hatte zwar noch keine Gelegenheit gehabt, ihre Züge eingehend zu studieren, aber sein erster Eindruck war wohlwollend. Weißes Mädchen. Richtig lange braune Haare. Hübsches Gesicht. Kariertes Hemd, in der Taille gebunden, hochgekrempelte Ärmel. Abgeschnittene Jeansshorts. Keine Schuhe. Dunkler Nagellack auf den Zehennägeln – grün? Er behielt sie, während er arbeitete, im Auge und hatte das seltsame, aber angenehme Gefühl, dass sie sich seiner sehr bewusst war, während sie las.
»Sonnencreme, Juniper«, sagte eine Frauenstimme. Xavier blickte auf und sah durch die hohe französische Flügeltür eine Frau auf die überdachte Veranda kommen, in der Hand eine Tube Sonnencreme.
Juniper.
Die Frau hatte blonde Haare, lang, aber nicht so lang wie die von Juniper. Sie trug sie zu einem hohen Pferdeschwanz gebunden über goldenen Kreolen, die Xaviers Meinung nach nicht zu dem engen Fitnessoberteil, den Shorts und Tennisschuhen passten, alles in modischen Farben und Mustern, die, wie ihm aufgefallen wäre, hätte er sich mit Fitnessmode ausgekannt, aus der Frühjahrskollektion von Ultracor stammten. Sie sah aus wie dem Katalog entsprungen.
Xavier betrachtete die Frau und dachte, gepflegt, ein Ausdruck, den die Freundinnen seiner Mutter manchmal benutzten, wenn sie zum Buchklub kamen. Jedes Mal begann der Abend mit Klatsch und Tratsch, bevor sie dann dazu übergingen, über das Buch zu sprechen, welches auch immer es gerade war. In letzter Zeit war der Ausdruck gepflegt im Klatsch-und-Tratsch-Teil ziemlich häufig gefallen, und immer im Zusammenhang mit der zunehmenden Zahl hochwertiger Immobilien in ihrer Nähe. Die Frauen versuchten es wie eine reine Beobachtung wirken zu lassen, aber Xavier merkte, dass es ein Urteil war. Diese Frauen waren alle berufstätig: Einige waren Lehrerinnen oder Professorinnen, wie seine Mutter; andere arbeiteten im Gesundheitswesen, leisteten soziale Arbeit oder führten kleine Unternehmen. Keine von ihnen ließ sich von ihrem Mann aushalten.
Xavier gesellte sich gern ein bisschen zu ihnen, nicht um zu tratschen (das war deren Sache), sondern um von dem Fingerfood und den Salaten zu profitieren, die sie mitbrachten. Wein brachten sie auch mit. Viel Wein. Er war jetzt achtzehn, alt genug, um für dieses Land zu sterben, also auch alt genug, um ein Glas Wein zu Hummus und Oliven zu trinken, zu mit Ziegenkäse gefüllten Feigen, zu Linsen-Spargel-Salat und so weiter, das sagten sie jedenfalls gern. Xavier mochte Wein gar nicht so gern, aber zu dem heißen, angemachten Frischkäse mit Rotel-Tomaten und scharfer Wurst würde er nie Nein sagen. Er wollte sich für sein Wohnheimzimmer einen Schmortopf kaufen, um das Zeug selbst zubereiten und davon leben zu können.
»Juniper«, sagte die gepflegte Frau wieder, diesmal ziemlich verärgert.
»Juniper«, sagte Xavier leise vor sich hin, um es auszuprobieren. Dann dachte er, Idiot. Für so was hast du keine Zeit.
»Im Ernst, Mom?«, sagte Juniper.
»Im Gesicht? Natürlich. Arme und Beine auch. Du musst jetzt auf deine Haut achten, sonst gibst du später viel zu viel Geld aus, um die Hautschäden zu reparieren. Willst du mal aussehen wie Grandma Lottie? Ich wünschte, meine Mutter wäre so klug gewesen wie ich.«
»Wenn du das schon selber meinst«, sagte Juniper und nahm die Sonnencreme entgegen.
»Du sagst Grandma aber nicht, dass ich das gesagt hab.«
Als Nächstes kam ein braun gebrannter Mann nach draußen, mit nacktem Oberkörper und geblümten korallenfarbenen Shorts unter einem vorstehenden Bäuchlein, wie es so viele Männer mittleren Alters hatten. Er ließ die hohe Tür hinter sich offen. »Ist das ein Leben, oder?«, sagte er. Er hatte in einer Hand eine Flasche Bier und in der anderen einen Krug mit irgendwas Rosafarbenem. Er stellte den Krug auf den großen Teakholztisch und fragte: »Wer schwimmt eine Runde mit?«
»Ich!«, rief ein kleines Mädchen, das hinter ihm nach draußen gehüpft war.
»Meinst du, das Wasser ist schon warm genug?«, fragte die Frau. »Sie haben es gestern erst einlaufen lassen.«
Das kleine Mädchen, vielleicht sieben Jahre alt, im pinkfarbenen Bikini, mit großer gelber Sonnenbrille, stemmte die Hände in die Taille und sagte: »Mami, bist du ein Mann oder eine Maus?«
Xavier, dem bewusst wurde, dass er starrte, machte den Sack voll, legte die Harke hin und ging seine Mutter suchen. Sie konnten die Vorstellungsrunde auch direkt hinter sich bringen. Er hatte erst ein paar Schritte gemacht, da rief der Mann: »Hey, Junge.«
Xavier drehte sich um. Der Mann winkte und kam auf ihn zu.
»Hör mal«, sagte er und kam in den Garten, »kannst du vielleicht auch für mich arbeiten, wenn du hier fertig bist? Wir sind gerade eingezogen und ich muss noch Kartons rumschleppen und auspacken, ein paar Möbel umstellen – meine Frau konnte sich nicht entscheiden, solange die Umzugsleute da waren, deshalb …« Er kicherte. »Fünfzig Doller, okay? Ich bräuchte dich nur eine Stunde oder so – ist doch ’n ziemlich guter Stundenlohn, oder?«
»Also, ich … ich helfe eigentlich nur meiner Mutter.« Xavier deutete aufs Haus. »Ich bin Xavier Alston-Holt. Die meisten nennen mich Zay«, sagte er und streckte die Hand aus.
»Ah«, sagte der Mann und schüttelte Xavier die Hand. »Brad Whitman, Whitman HLK, Heizung, Lüftung und Klimatisierung. Du kennst bestimmt meine Werbespots.«
»Kann sein«, sagte Xavier. »Wir haben keinen Fernseher.«
»Ich bin auch im Internet und im Radio.«
»Okay, na dann.«
Brad Whitman beugte sich vor, drückte Xavier die Faust auf die Schulter und sagte: »Und ich dachte, du würdest für die alte Dame arbeiten, die hier lebt.«
Xavier lächelte höflich. »Ich glaube nicht, dass meine Mom gern als alte Dame bezeichnet werden würde.«
»Nein, vermutlich nicht. Welche Frau mag das schon?«
»Sie ist erst achtundvierzig.«
»Wirklich? Dann hat mein Makler wohl was falsch verstanden«, sagte Brad Whitman. »Aber es gibt hier im Viertel viele alte Damen, das ist doch so?«
Xavier nickte. »Und ein paar alte Männer. Eigentlich alles.«
»Klar«, sagte Brad. »So will man es doch, oder?«
Xavier nickte. »Also, ich wollte meine Mom gerade holen. Sie wollte sich vorstellen.«
»Klar, gut. Hol sie her.« Brad deutete auf sein Haus. »Julia hat gerade rosa Limo gemacht. Die Mädchen lieben sie. Ich gebe dir auch ein Bier, wenn in deinem Ausweis steht, dass du einundzwanzig bist.«
»Noch nicht, aber danke. Bin gleich wieder da.«
Xavier war schon fast beim Haus, als Brad Whitman rief: »Bring deinen Dad auch mit, wenn er zu Hause ist. Für den hab ich auf jeden Fall was Kühles.«
Xavier hob die Hand, um ihm zu bedeuten, dass er es gehört hatte.
Seinen Vater holen? Er wünschte, das wäre möglich. Das hatte er sich schon immer gewünscht.
3
Bevor wir die erste Begegnung der anderen wichtigen Akteure unserer Geschichte schildern, müssen wir mehr über die Kulisse sagen, in der sich diese langsame Tragödie entfaltete. Wie der ortsansässige Englischprofessor sagen würde, der Ort der Handlung ist genauso eine Figur wie alle Menschen, insbesondere in Geschichten aus den Südstaaten, und von der Handlung nicht zu trennen – in diesem Fall sogar notwendig dafür.
Valerie Alston-Holt hatte sich in unser Viertel, Oak Knoll, verliebt, als sie zum ersten Mal auf einem seiner Gehwege stand. Sie war in Michigan geboren, hatte zwei Jahre zuvor ihre Promotion abgeschlossen, seit zwanzig Monaten eine Stelle an der Universität, war seit einem Jahr verheiratet und im siebten Monat schwanger. Sie und ihr Mann, Tom Holt-Alston, ein junger Soziologieprofessor, hatten eine gemütliche Wohnung in der Nähe des Campus gemietet. Aber nun war es an der Zeit, ein Haus zu kaufen – und dies war das Viertel, das ihren Kollegen am besten gefiel. Damit konnten Tom und Val nichts falsch machen, das sagte jeder.
Wie so viele amerikanische Vororte eines gewissen Charakters war Oak Knoll in den Aufschwungjahren nach dem Zweiten Weltkrieg angelegt worden. Breite Straßen, Gehwege und – weil wir hier in North Carolina sind, wo es viele Bäume gibt und viel Lehm – Ranchhäuser aus Backstein auf weitläufigen Grundstücken voller Bäume, mit einer Grundausstattung von drei Zimmern und einem Bad, klein, aber funktional.
Der Frühling war für Oak Knoll die Zeit zum Prahlen: weißer und rosa Hartriegel blühte zeitgleich mit Kastanien, Birnbäumen, Schneebällen und Kamelien, Kirschen, Persimonen, Weißdorn, Stechpalmen. Nicht zu vergessen die Tulpenbäume, diese Vorboten, die manchmal ungeduldig bereits rosa wurden, nur um dann von einem späten Frost abgestraft zu werden. Das Viertel war besonders für seine Hartriegel bekannt, empfindliche, langsam wachsende Pflanzen, die zwei Jahrzehnte brauchten, um so groß zu werden wie ein sechsjähriger Ahorn. Valerie kam mit Tom für einen Spaziergang her, damit er selbst sehen konnte, wie schön es hier war, wie perfekt es wäre für sie beide und das Kind, das in ihr heranwuchs. Einige von uns erinnern sich noch, die beiden an jenem Tag gesehen zu haben, Valerie so schwanger, so dunkelhäutig, so ein Kontrast zu ihrem großen, blonden Ehemann. Wir werden nicht so tun, als hätte dieser Kontrast keine Aufmerksamkeit erregt. Natürlich fiel es uns auf. Vor allem hatten wir das Gefühl, dass es ihnen etwas Exotisches verlieh, eine Art Promistatus in einem Viertel, das sich zwar für fortschrittlich hielt, aber nicht viel dafür tat. Das Äußerste, was man sagen konnte, war, dass einige Anwohner weiß waren und andere nicht, einige hatten ein festes Einkommen und andere waren Berufsanfänger in Branchen, in denen schlecht bezahlt wurde, und wir behandelten einander mit Freundlichkeit und Respekt. Was konnte man schließlich sonst tun?
Niemand hielt Oak Knoll für ein besonders angesehenes Viertel, jedenfalls bis vor Kurzem nicht. Leute, die richtig Geld hatten, lebten im benachbarten Hillside. In Hillside wohnten die Blaublüter, Politiker, Chirurgen, die Gründer der Firmen und großen Einzelhandelsketten, viele von ihnen in gigantischen Häusern aus Stein und Backstein, Märchenschlösser mit Toren und Efeu und langen Auffahrten und Säulen und Büschen, die aussahen wie Skulpturen, und natürlich mit gewaltigen Eichen. Valerie bewunderte diese Villen wie auch die weniger aufwendigen Versionen auf den kleineren Grundstücken – auch sie waren schön, auch diese Gärten saftig grün. Wer hätte sie nicht bewundert? Aber für sie gab es keine Möglichkeit, nicht in diesem Leben, Hillside zu ihrem Zuhause zu machen (es sei denn, sie knackte einen Lotto-Jackpot mit mehreren Millionen Dollar). Aber selbst wenn sie Millionen gehabt hätte, hätten viele, die in Hillside lebten, gefunden, dass eine schwarze Frau mit einem weißen Mann weniger Recht hatte, dort zu sein, als die schwarze Haushaltshilfe, denn die wusste wenigstens, wo sie hingehörte.
Die Zeit verging und die Stadt wuchs, und die Art Leute, die man damals Yuppies nannte, kaufte reizlose Häuser auf neuen, abgelegenen Parzellen von einem halben Hektar und mehr, wo man Grundbesitz »Land« nannte und viele Familien neben drei oder vier Autos noch ein Golfmobil in der Garage stehen hatten. Die Whitmans hatten in so einem Viertel gelebt, denn, wenn man mal ehrlich ist, bekam man da draußen sehr viel mehr Haus für sein Geld, und die Nachbarn sind nicht so nah, dass sie einem in die Karten gucken könnten. Außerdem war Whitman HLK eine wachsende Firma, keine alteingesessene, und um die Art Haus zu bekommen, die er wollte, für eine Hypothek, die er sich leisten konnte, wenn er weiter seinen BMW fahren und Julia einen neuen Lexus SUV schenken und die Privatschulen der Mädchen bezahlen wollte, musste Brad Whitman, der sich heimlich nach dem Prestige von Hillside sehnte, Zugeständnisse machen.
Dann erfand er irgendein Gerät oder ein Teil eines Heizungssystems (ganz klar ist uns das nicht), ließ es patentieren, verkaufte es einem großen Hersteller und strich einen Reingewinn von zwei Millionen Dollar ein. Das bedeutete, dass er es sich leisten konnte, mit Julia und den Mädchen in ein Haus in Hillside zu ziehen. In eins der kleineren Häuser, stimmt; keine vierhundert Quadratmeter, nicht sechs- oder achthundert. Aber Brad gefiel sein Plan; er würde weniger Grundsteuer zahlen als bei einer großen Villa, und trotzdem hätte er eine dieser beneidenswerten Hillside-Adressen.
Der Plan der Whitmans war gewesen, dort hinzuziehen, nur dass sehr gute Freunde, die Jamisons (Jimmy war in der Pharmaindustrie, ihm ging es gerade bestens) dann Oak Knoll entdeckten mit seinen alternden Häusern und, in vielen Fällen, alternden Bewohnern. Alternde Bewohner, die sich einer nach dem anderen für betreutes Wohnen entschieden und ihre Häuser abstießen. Oder sie starben, und ihre Kinder hatten kein Interesse daran, wieder in die engen Häuser ihrer Kindheit mit nur einem Badezimmer zu ziehen, Häuser, die inzwischen nach Mottenkugeln und Hämorrhoidencreme rochen und Nikotinflecken an Decken und Wänden hatten. Also wurde der Nippes verscheuert und die Häuser verkauft, wie sie waren.
Anders als in Hillside, wo die Häuser mindestens genauso alt, wenn nicht älter waren (allerdings rochen sie besser – manchmal – und waren besser erhalten), musste man in Oak Knoll nicht so tief in die Tasche greifen, um das Haus zu kaufen, und dann noch mal, um alles zu modernisieren. Die Häuser in Oak Knoll waren so billig, dass man sie abreißen und eine funkelnagelneue Sehenswürdigkeit errichten konnte, mit den besten Materialien, der besten Technologie, großartiger Dämmung und Niedrigenergieglas; man würde niedrigere Unterhalts-, Energie- und Steuerrechnungen haben und eine höhere Rendite, wenn man wieder verkaufte – Oak Knoll war der Ort der Stunde, sagte Jimmy Jamison zu Brad. Er hatte sich seinen Bauunternehmer schon gesucht, und Brad würde niemals glauben, was der für ein Mediensystem geplant hatte. Jimmy nahm Brad mit, um ihm eins der Häuser zu zeigen, die der Bauunternehmer gerade fertiggestellt hatte (es gehörte jetzt Mark und Lisa Wertheimer). Die Männer standen in der Küche mit der drei Meter hohen Decke und der Marmorarbeitsplatte, der Kühl-Gefrier-Kombination und dem teuren Herd, und Brad sagte: »Scheiße. Schätze, so eins sollte ich für Julia und mich auch kaufen.«
Aus der sehr viel einfacheren Alston-Holt-Küche sah Valerie, während sie die Pfingstrosen in Vasen arrangierte, Xavier mit dem neuen Nachbarn sprechen. Optisch entsprach der Mann genau den Erwartungen, die sie an die Bewohner dieses Hauses gehabt hatte: weiß, Ende vierzig, modische Markenbadehose passend zum Pool und dem riesigen Edelstahl-Gasgrill auf der Terrasse. Er trug Flipflops und eine Baseballkappe mit dem Schirm nach hinten. Ein Kind mit Geld.
Von denen gab es heutzutage viele. Sie hatte sich mit ein paar von ihnen getroffen, arrangiert von einem Freund an der Technischen Hochschule, der regelmäßig mit Männern aus hiesigen Firmen zu tun hatte. Vielleicht eher so was wie eine Vor-Verabredung: Man traf sich irgendwo zur Happy Hour und guckte, ob die Chemie stimmte; sie versuchte abzuschätzen, ob die Gründe, die der Typ dafür hatte, eine schwarze Frau zu treffen, einem ehrenhaften Platz seiner Seele entsprangen. Valerie Alston-Holt war keine exotische, sexbesessene Tussi, die nur darauf wartete, die Sexsklavenfantasien eines weißen Mannes zu befriedigen – und ja, es gab wirklich Männer, denen diese Vorstellung gefiel und die davon ausgingen, dass sie ihr auch gefallen würde.
Xavier gegenüber erwähnte Valerie nichts davon. Sogar wenn es mit einem Mann ernst wurde, ging sie zurückhaltend damit um. Genauer gesagt, ging es um einen Mann, den sie bei einer Konferenz in Virginia vor fast drei Jahren kennengelernt, den Xavier aber erst zwei Mal gesehen hatte. Sein Name war Chris Johnson – der nichtssagendste Name überhaupt, fanden wir. Aber was er machte, klang großartig, als unkündbarer Professor an der Universität von Virginia am Frank-Batten-Institut für Staatswissenschaften. Außerdem sang er als Bariton in einem preisgekrönten Quartett. Bisher bestand ihre »Beziehung« aus regelmäßigen FaceTime-Gesprächen und gelegentlichen Wochenendtrips, jetzt, wo Xavier allein zu Hause bleiben konnte.
Valerie lud Chris nicht ein herzukommen, von den bereits erwähnten beiden Malen abgesehen, und sie sprach auch nicht viel über ihn. Wie alle alleinstehenden Elternteile wissen, ist eine Romanze kein einfaches Unterfangen, wenn man gleichzeitig ein oder mehrere Kinder aufzieht. Valerie wollte Xavier nicht mit etwas beunruhigen, das vielleicht passieren würde, vielleicht aber auch nicht. Wenn der Junge sich einmal an etwas festbiss, fiel es ihm schwer, wieder loszulassen. Das war ihr früh an ihm aufgefallen: eine Lieblingsdecke, Lieblingsessen, ein Spielzeug, ein Buch, ein Autor – einen Sommer lang hatte er mal nichts anderes gelesen als die Redwall-Romane von Brian Jacques, sämtliche zweiundzwanzig. Er hatte zwei enge Freunde, die er seit der Vorschule kannte. Und natürlich waren da seine Musik und seine Gitarren.
Ein weiteres Beispiel für die Intensität des Jungen: Die Möglichkeit, dass das College, das Xaviers erste Wahl war, ihn nicht nehmen könnte, hatte ihn nächtelang wach gehalten. Dabei war er genauso geeignet und talentiert wie die, mit denen er über die Jahre konkurriert hatte. Zur Freude aller, die nahe genug lebten, um ihn bei mildem Wetter und offen stehenden Fenstern spielen zu hören, übte Xavier täglich eine Stunde vor der Schule und zwei am Abend, wenn er von seinem Job im Lebensmittelgroßmarkt nach Hause kam. Dann machte er Hausaufgaben. Zwei Tage vor und einen Tag nach seinem Vorspiel am Konservatorium im Januar konnte er kaum was essen, was einiges heißen will. Und obwohl er nach ihrer Rückkehr aus San Francisco zu einer normaleren Routine zurückfand, blieb er angespannt, bis Mitte März die Zusage kam. Diese Art junger Mann war er. Valerie hatte versucht ihm beizubringen, wie er diese Intensität für sich nutzen konnte. Gute Noten, gute Arbeitsmoral, gute Zeugnisse von seinen Lehrern und seinem Chef – und es hatte sich gelohnt.
Aber es konnte genauso gut gegen ihn arbeiten, und das konnte es immer noch. An wie vielen Abenden hatte Valerie in den letzten Jahren auf ihren Sohn gewartet und gebetet, dass er und seine Freunde nicht von der Polizei angehalten wurden? Gebetet, dass er nicht in eine Situation geriet, in der er sich ungerecht behandelt fühlte, sich verteidigen wollte und diese Intensität gegen die Polizisten richtete? Er war groß. Er war schwarz. Valerie hatte ihm so oft gesagt: »Wenn sie Angst vor dir bekommen, schießen sie.« Sie hasste es, dass es überhaupt nötig war, das zu sagen, hasste es, dass das Hinarbeiten auf eine postrassistische Gesellschaft, das sie und ihr Mann und andere so leidenschaftlich betrieben hatten, nun umgekehrt wurde. Warum konnten wir uns gegenseitig nicht einfach als Menschen betrachten und am selben Strang ziehen, verdammt? Der Planet lag im Sterben, und die Menschen stritten sich darum, wer am amerikanischsten war – oder wer überhaupt amerikanisch war.
Sie beobachtete, wie Xavier das Kind mit Geld stehen ließ und aufs Haus zuging. »Jetzt sind alle draußen«, sagte er, als er zu ihr in die Küche kam.
»Ich hab’s gesehen. Ich mach das hier nur fertig und wasche ab.«
Xavier lehnte sich an die Theke, nahm einen Apfel aus einer Schale und putzte ihn mit seinem T-Shirt ab. Dann legte er ihn zurück, machte dasselbe mit einem anderen und sagte: »Er dachte, ich würde für dich arbeiten.«
»Wundert uns das?«
»Er dachte auch, du wärst eine alte Dame. Also, nicht du speziell. Er dachte, hier würde eine alte Dame leben. Hat ihm wohl sein Makler erzählt.«
»Da hat er sich wohl getäuscht.« Sie trocknete sich die Hände an einem Küchenhandtuch ab. »Weißt du, wie er heißt?«
»Brad irgendwas. Heizung, Lüftung und Klimatisierung. Das macht seine Firma. Er sagt, er macht Werbespots, als müsste ich ihn kennen.«
»Ach, alles klar. Ellen hat gesagt, dass eine lokale Berühmtheit hier baut. Sie konnte sich nur nicht mehr erinnern, wer genau oder welches Haus es war. Mit Heizung, Lüftung und Klimatisierung kann man natürlich gut verdienen.«
Valerie überlegte kurz und entschied sich dagegen, ihr verschwitztes T-Shirt und die ausgefransten Shorts zu wechseln. Sollten sie sie nehmen, wie sie war – oder auch nicht. Sie setzte eine Sonnenbrille und einen Hut auf, dann gingen sie und Xavier zusammen zu den Whitmans, von ihrem Paradies aus Holz zu den abgezirkelten Rasen- und Mulchstreifen, die Terrasse und Pool der Whitmans umgaben.
»Guten Tag«, rief sie, als sie auf die Steinplatten trat. Wenigstens hatten die Whitmans Naturstein gewählt und nicht Beton ausgegossen. Bedachte man die Auswirkungen exzessiver Versiegelung der Erdoberfläche auf die Umwelt, war allerdings auch dieser Stein keine tolle Entscheidung. Der Bauunternehmer musste beim Pool und bei der Terrasse von den Auflagen abgewichen sein, beim Haus vermutlich auch, oder wie hätte er sonst so viel Bodenfläche bebauen können? Immerhin hatten Steinplatten eine etwas höhere Durchlässigkeit als Beton und wirkten viel natürlicher.
Riskant war das vor allem für die Bäume, die in der Nähe standen. Große Bäume, wie die alte Eiche in Valeries Garten, hatten eine flache Wurzelstruktur, die sich seitlich ausbreitete, manchmal mehr als hundert Meter um den Stamm herum. Valerie, die (unter anderem) Kurse zum Thema nachhaltige Waldbewirtschaftung unterrichtete, wusste das besser als irgendjemand von uns. Sie überprüfte die Eiche auf Anzeichen von Stress, seit der Abriss auf dem Grundstück der Whitmans begonnen hatte.
Dieser Baum bedeutete ihr eine Menge. Sie konnte ihn nicht anschauen, ohne ihr Baby in der leuchtend roten Segeltuchschaukel vor sich zu sehen, die sie an einen der unteren Äste gehängt hatten; den vierjährigen Xavier auf der Holzschaukel »für große Jungs«, die sie als Nächstes hatten; wie er zum ersten Mal die Beine vor und zurück schleuderte, um Schwung zu kriegen; den zehnjährigen Zay und seinen Onkel Kyle, wie sie das Baumhaus bauten, in dem Zay und seine besten Freunde, Dashawn und Joseph, in den nächsten Jahren ungezählte Stunden mit ihren Comics und Videospielen und massenweise Snacks verbrachten. Beides gab es noch, das Baumhaus und die Schaukel. Xavier und seine Freunde benutzten es immer noch manchmal, als wollten sie diese Bande mit ihrer Kindheit genauso wenig zerreißen, wie Valerie ihnen dabei zusehen wollte.
Julia Whitman war die Erste, die Valeries Gruß erwiderte. Sie erhob sich aus ihrem gepolsterten Teakstuhl auf der Terrasse. »Hi, kommen Sie her. Ich bin Julia. Ich gieße Ihnen beiden gleich mal Limonade ein.«
»Hi. Valerie Alston-Holt.« Sie richtete ihre Worte an Julia, ging aber geradewegs auf Brad Whitman zu, mit ausgestreckter Hand. Sie wusste aus Erfahrung, dass es nötig war, von Anfang an den Ton zu setzen. »Sie müssen Brad sein.«
»Brad Whitman, Whitman HLK, Heizung, Lüftung und Klimatisierung. Schön, Sie kennenzulernen. Danke, dass Sie vorbeigekommen sind.«
Valerie schüttelte Julias Hand und nahm ein volles Glas entgegen, dann setzte sie sich auf den Stuhl, der Brad am nächsten stand. »Wir warten schon seit Ewigkeiten, dass dieses Haus fertig wird«, sagte sie.
»Wir auch«, sagte Julia so fröhlich wie der orangefarbene Stempeldruck auf ihren Shorts.
»Acht Monate lang Lärm und Unruhe«, sagte Valerie, ohne die Absicht gehabt zu haben, das Thema anzuschneiden, aber irgendwie mit dem Wunsch. »Die Druckluftkompressoren und Nagelpistolen und Sägen und die laute Musik der Trockenbauleute den ganzen Tag … Wirklich, jeder freie Tag, den ich seit September hatte, wurde von diesem Lärm verdorben.«
»Oh«, sagte Julia. »Das tut mir so leid.«
»Jetzt ist es ja vorbei«, sagte Brad. »Ende gut, alles gut.«
»Es sei denn, man geht nach nebenan oder guckt nach gegenüber. Da werden Sie es ja selbst erleben«, sagte Valerie. »Meinen Sohn Xavier haben Sie schon kennengelernt?«
»Brad ja. Hi«, sagte Julia. »Limonade?«
Xavier setzte sich auf den Stuhl neben seiner Mutter. »Nein, danke.«
»Das im Pool ist Lily«, sagte Julia, »und das ist Juniper.« Sie deutete auf ihre ältere Tochter, die ihr Buch zur Seite gelegt hatte und aufgestanden war, um zu den anderen auf die Terrasse zu kommen.
Lily hängte sich an den Rand des Pools und sagte: »Hallo, Frau Nachbarin. Tut mir leid, ich hab Ihren Namen nicht mitbekommen.«
»Das ist Mrs. Alston-Holt«, sagte Julia. »Das habe ich doch richtig verstanden?«
»Ms. Alston-Holt«, berichtigte Valerie. Ihr persönlich machte es zwar nichts, wenn die Kinder ihren Vornamen benutzten, aber viele Eltern in den Südstaaten bestanden auf der formal richtigen Anrede. Und wenn die Leute nun mal so tickten, sollte wenigstens die Anrede stimmen.
»Die Namen Ihrer Mädchen gefallen mir«, fügte sie hinzu. »Wacholder und Lilie. Pflanzen sind mein Ding.« Dann sagte sie: »Brad, Sie sagten, Sie haben beruflich mit Heizungen zu tun? Vielleicht könnten Sie sich meinen Kompressor mal ansehen. Der macht so ein komisches Geräusch.«
Sie warf Xavier einen Blick zu. Der unterdrückte ein Lachen. Er wusste, dass das keine ernst gemeinte Frage war, dass es kein komisches Geräusch gab. Valerie nervte Brad Whitman, weil er Xavier für ihre Gartenhilfe gehalten hatte.
»Aber gern«, sagte Brad. Er stellte sein Bier auf den Tisch. »Ich hol nur ein Hemd und Schuhe und –«
»Oh. Ich meinte nicht sofort.« Sie hatte nicht erwartet, dass er bereit wäre, es selbst zu machen. »Aber danke. Er macht das Geräusch auch gar nicht die ganze Zeit. Heute habe ich es noch gar nicht gehört. Du, Zay?«
»Heute nicht«, sagte Xavier.
»Es kann warten. Außerdem würde ich Sie nie an einem Sonntag damit behelligen.«
»Der Tag Gottes«, sagte Juniper, die sich neben Julia gesetzt hatte. »Nur dass wir gar nicht mehr in die Kirche gehen.«
»Manchmal schon«, sagte Julia.
Lily sagte: »Gott ist überall, sogar direkt hier im Pool.«
»So ist es, Zuckerschnute«, sagte ihr Vater. Und an Valerie gewandt: »Ich gestehe: Sonntagvormittags gehe ich gerne Golf spielen. Beste Zeit dafür.«
»Er würde am liebsten jeden Tag Golf spielen«, sagte Julia. »Aber er geht nur samstags und sonntags.«
Valerie sagte: »Wir gehen auch nicht regelmäßig in die Kirche. Schon gar nicht zu dieser Jahreszeit. Ich arbeite sonntagvormittags gern im Garten.« Auch das war eine kleine Spitze. Diese Leute hatten kaum einen Garten, und was sie hatten, war professionell so angelegt worden, dass darin fast nichts lebte. Arbeit mit dem Garten würden sie nicht haben, da war Valerie sicher, nur Gartenarbeiter.
Brad sagte: »Sie werden denken, Was für ein aufdringlicher Kerl, aber ich gehöre nun mal zu den Leuten, die Dinge gern wissen, deshalb frage ich einfach: Gibt es einen Mr. Alston-Holt?«
Valerie sagte: »Nein. Es gibt nur uns zwei.«
»Klar«, sagte Brad. »Kein Problem.«
»Ich bin Witwe«, stellte sie klar.
Brad und Julia reagierten, wie neue Bekannte immer reagierten: ein schneller überraschter Blick, gefolgt von Ach, das tut mir aber leid und schwelender Neugier, der sie zu höflich waren nachzugeben.
Julia sagte: »Juniper ist in der zwölften Klasse der Blakely Academy. Gehst du aufs College, Xavier?«
»Ich mache in ein paar Wochen meinen Abschluss am Franklin Magnet.«
»Ach, Highschool. Ich dachte, du wärst älter. Gratuliere!«, sagte Julia zu ihm. »Das ist bestimmt ein gutes Gefühl. Gehst du dann ab Herbst aufs College?«
Valerie antwortete. »Er hat ein Stipendium für das Musikkonservatorium in San Francisco. Ich bin sehr stolz auf ihn.«
»Ein Teilstipendium«, sagte Xavier. »Aber, ja. Ich spiele Gitarre.«
»Hey, wie Jimi Hendrix!«, rief Brad.
Xavier schüttelte den Kopf. »Akustik. Klassisch. Keine Sorge, das sagt niemandem etwas.«
Juniper wandte sich an ihn. »Stimmt es, dass ihr am Franklin Pistolen dabeihabt, weil es dort Bandenkriege gibt? Und dass es nur deshalb keine Schießereien gibt, weil Wachmänner die Waffen konfiszieren?«
»Was?«, sagte Xavier. »Nein. Wo hast du das denn gehört?«
Juniper sah Brad an. »Hast du das nicht erzählt?«
Brad warf ihr einen scharfen Blick zu, wie Valerie fand. Diese Reaktion (wenn sie sie richtig verstand) legte nahe, dass seine fröhliche Jungenhaftigkeit nur Fassade war. Wundern würde es sie nicht. Ihrer Erfahrung nach waren manche Männer – vor allem gut betuchte, weiße Männer – so an ihre Autorität und ihre Privilegien gewöhnt, dass sie sie für ihr Recht hielten.
Juniper schien ihr trotz des botanischen Namens ein ganz normaler Teenager zu sein. Vielleicht ein kleines bisschen feindselig, aber das war nicht überraschend, wenn man bedachte, dass sie kurz vor Ende des Schuljahrs, wo sie sicher Arbeiten schreiben und Projekte abgeben musste, mit ihren Eltern in ein neues Haus ziehen musste. Wenigstens würde sie für ihr letztes Schuljahr nicht die Schule wechseln müssen. Ein Vorteil von Privatschulen.
»Da verwechselst du was, Schatz«, sagte Brad jetzt in freundlichem Ton zu Juniper, und Valerie beschloss, dass sie sich verhört und ihn falsch eingeschätzt hatte. Sie war voreingenommen gewesen wegen des Kahlschlags. Mach dich mal locker, sagte sie sich. Gib dem Mann eine Chance.
Brad fuhr fort: »Vielleicht habe ich etwas über irgendeine andere Schule gesagt. Oder vielleicht hast du von deinen Freunden was gehört.«
»Vielleicht«, sagte Juniper. »Wahrscheinlich.«
»Fürs Protokoll«, sagte Valerie, »Franklin ist eine der leistungsstärksten Schulen im ganzen Staat.«
»Gut, klar«, sagte Brad. »Guckt euch Zay hier doch an. Klassische Gitarre. Ich weiß nicht genau, was das ist, aber wenn du ein Stipendium dafür bekommen hast, musst du gut sein. Juniper nimmt Klavierunterricht – ich glaube allerdings nicht, dass sie für ihr Spiel irgendein Stipendium bekommen wird.«
Julia sagte: »Sie müsste mehr üben. Aber sie ist sehr gut im Crosslauf. In der neunten Klasse war sie in der Auswahlmannschaft.«
»Super«, sagte Xavier zu Juniper. »Willst du das dann auch auf dem College machen?«
»Du meinst als Fach?«, fragte Juniper. »Nein, ich glaube, ich will Zoologie oder Botanik studieren. Ich hoffe, dass ich in Washington State in so ein Programm komme.«
»Seit wann das denn?«, fragte Julia.
»Ich überlege das seit einer Weile.«
»Wir werden sehen«, sagte Brad. »Deine Mutter wird es sicher nicht so toll finden, wenn du zum Studieren so weit weggehst.«
»Dass sie überhaupt weggeht«, sagte Julia schulterzuckend. »Was soll ich machen? Sie ist mein erstes Baby. Ich will nicht, dass sie groß wird.«
Valerie wollte Julia gerade beipflichten, als ein halbes Dutzend Latino-Männer in identischen leuchtend gelben T-Shirts um das Haus der Whitmans herum an die hintere Grundstücksgrenze kam. Einer der Männer trug einen Spaten, ein anderer einen gasbetriebenen Pfahlbohrer.
»Da sind sie ja«, sagte Brad und stand auf. »Die Zaunleute. Das sollte eigentlich längst gemacht sein – sind wohl in Verzug geraten, weil es letzte Woche so geregnet hat. Aber die Baugenehmigung haben wir ja; ich kenne einen Typen bei der Genehmigungsstelle. Der war mir schon mehrfach nützlich«, sagte er zwinkernd. Dann ging er zu dem Trupp.
»Sie bauen einen Zaun«, sagte Valerie zu Julia. »Natürlich. Die Regelung hatte ich ganz vergessen. Bis vor Kurzem hat sich in Oak Knoll niemand einen Pool leisten können.«
Julia sagte: »Aber ein schöner, aus Holz, keine Sorge. Kein Maschendraht.«
Es war nicht das Material, das Valerie Sorgen machte. Es war die zusätzliche Störung, dem das Wurzelsystem ihrer Bäume ausgesetzt sein würde. Und was konnte sie dagegen machen? Nichts. Der Pool war schon da. Da war ein Zaun erforderlich.
Brad wandte sich der Terrasse zu. »Die brauchen nur ein paar Tage dafür«, sagte er. »Ich entschuldige mich jetzt schon für den Lärm. Aber ist doch gut, oder nicht? Mehr Privatsphäre für alle.«
»Sicher«, sagte Valerie.
Sie wünschte sich aufrichtig, dass der Lärm das größte Problem sein würde. Und abgesehen von dem Wurzelschaden war ihr sehr recht, dass zwischen ihrem und deren Garten ein Zaun sein würde. Sie hatte nicht das Bedürfnis, jedes Mal, wenn sie aus dem Fenster guckte, diesen Pool und die Terrasse zu sehen, die allein mehr gekostet haben mussten, als sie und Tom für das Haus bezahlt hatten. Sie war auch nicht besonders erpicht darauf, den ganzen Sommer über die junge, hübsche Julia Whitman am Pool liegen zu sehen – am besten noch im Bikini –, wie sie ihren Fünf-mal-die-Woche-Fitnesstraining-Körper zur Schau stellte, während Valerie zehn Pfund zu viel hatte, die sie seit ebenso vielen Jahren nicht loswurde.
Sie sagte: »Sie wissen ja, was Frost sagt: Ein guter Zaun schafft gute Nachbarn.«
»Was für ein Frost?«, fragte Lily.
Juniper sagte: »Robert Frost. Das war ein Dichter.«
Valerie nickte anerkennend. Ja, die Jugend würde sie noch alle retten.
Und so saßen die Whitmans und die Alston-Holts noch ein Weilchen im Schatten der überdachten Terrasse und sprachen über belanglose Dinge, bis die Zaunleute nach zwanzig Minuten in die Gänge kamen und sie aufstanden – Brad und Valerie zufrieden, dass sie sich nun so gut kannten, wie sie sich kennen sollten. Es war ein vielversprechender Auftakt ihrer Beziehung, so vielversprechend, wie man nur hoffen konnte. Niemand von uns dachte weiter über die drei und ihre Kinder nach.
4
Zwei Tage später stand Xavier in der Küche, um sich zum frühen Abendessen ein Sandwich mit Schinken und Käse zu machen, als seine Mutter hereinkam.
»Wie war’s in der Schule?«, fragte sie, kam zu ihm und legte ihm den Arm um die Taille. Er war fast dreißig Zentimeter größer als sie, was ihm immer noch komisch vorkam. Den Großteil seines Lebens hatte er sich gewünscht, größer, länger, erwachsen zu sein – und jetzt sah er auf die meisten Erwachsenen herab, nicht zu ihnen auf. Jetzt konnte er seiner Mutter auf den Kopf gucken und war mit 1,92 Meter drei Zentimeter größer als sein Vater gewesen war. Er wünschte, er hätte jedes Mal einen Dollar – nein, besser zehn – bekommen, wenn jemand vermutete, dass er Basketball spielte.
»Wir haben für die Klausuren geübt«, sagte er zu Valerie, »ziemlich öde.« Er zündete eine Herdplatte an und stellte eine Pfanne darauf.
»Die Ziellinie ist ja in Sicht.« Sie drückte ihn und ließ ihn dann los. »Hey, also, ich hab darüber nachgedacht und wollte dich auch fragen: Was denkst du über unsern berühmten neuen Nachbarn, Brad Whitman?«
»Wie meinst du das?«
»Ich fand ihn … undurchsichtig. Ich konnte nicht sagen, ob er so gut ist, wie er scheint.«
»Ich fand ihn in Ordnung«, sagte Xavier. Er bestrich zwei Brote mit Butter und legte sie in die Pfanne. »Soll ich dir auch welche machen? Ich muss dann zur Arbeit.«
»Gern, danke.« Sie nahm sich eine Tomate, ein Messer und ein Brett und setzte sich an den Küchentisch. »Vielleicht bin ich zu empfindlich. Ich will nicht das Schlechteste annehmen, wo ich die Leute kaum kenne. Vorurteile sind hässlich. Am liebsten wäre ich gar nicht in der Lage, welche zu haben.«
»Ich sag es dir ungern, aber du bist nun mal menschlich«, sagte Xavier und machte ihr Sandwich fertig. »Außerdem sind es keine Vorurteile, wenn du die Leute bereits kennengelernt hast, oder?«
»Ich habe praktisch in der Sekunde angefangen, mir ein Urteil über sie zu bilden, als die Kettensäge zum ersten Mal zu hören war, und das ärgert mich. Ich versuche, jedem eine Chance zu geben, wie soll ich mich sonst beklagen, wenn Leute mich vorverurteilen?«
Xavier legte drei Sandwiches in die Pfanne. Sie zischten, die heiße Butter schickte Lipidmoleküle in die Luft. Duft war Chemie. Atmen war Chemie. Verdauung war Chemie. Pflanzenwachstum und die Sauerstoffproduktion dieser Pflanzen waren auch Chemie. Seine Mom hatte ihm insbesondere über Pflanzen alles beigebracht, vielleicht in der Hoffnung, dass er ihre Leidenschaft für Ökologie teilen würde. Er hatte sich viel damit beschäftigt, ein paar Monate lang, dann war sein Interesse befriedigt.
Das geschah oft. Xavier hatte die Erfahrung gemacht, dass es viele verschiedene Gebiete gab, die ihn interessierten, aber nur wenige, die er liebte. Trotzdem ermunterte seine Mom ihn jedes Mal, wenn er sich in etwas Neues stürzte, und sagte ihm, er solle es so lange weiter verfolgen, wie er wollte. Sie sagte, das gehöre zu dem, was die Bürgerrechtler erkämpft hätten, dass er als Kind eines weißen Mannes und einer studierten schwarzen Frau in einem Mittelklassehaushalt in einem Land aufwachse, wo man ausprobieren könne, was man wolle. Alles. »Und du bist einfach ein Kind, kein schwarzes Kind. Das muss man auch mal anerkennen, Zay, und nicht für selbstverständlich halten.«
Er wusste, dass das nicht ganz stimmte, diese Behauptung einfach ein Kind, kein schwarzes Kind. Er wusste, dass auch sie das nicht glaubte. Es gab heutzutage mehr Leute, die versuchten, ihr Verhalten gegenüber anderen Menschen nicht an deren Hautfarbe auszurichten, ja. Es gab aber auch die Menschen – überwiegend ältere Weiße –, die ihn mit finsterem Blick ansahen oder ihn in Geschäften mit Adleraugen beobachteten, als würde er sich gleich die Taschen vollstopfen oder eine Pistole ziehen. Einmal hatte er seine Mom gefragt: »Warum ist halbweiß nicht weiß, so wie halbschwarz schwarz ist?« Ihre Antwort, eine kurze Geschichte der Ein-Tropfen-Regel, ergab Sinn, stellte ihn aber nicht zufrieden. Faktisch war er genauso weiß wie schwarz.
Jetzt sagte er: »Du hast ein Problem damit, was die Whitmans getan haben, nicht damit, wer sie sind. Eine Beschwerde sollte in der Sache selbst begründet sein, Punkt.« Auch das hatte sie ihm beigebracht. Denk logisch. Bleib fair. Zeig deine Humanität und Integrität, so wie Dr. und Mrs. King es immer getan haben, so wie John Lewis es immer noch tut.





























