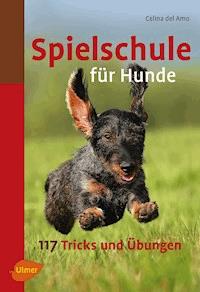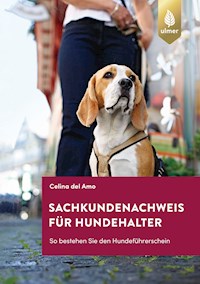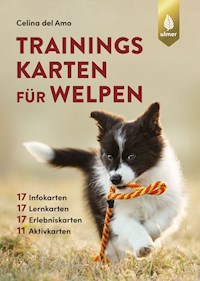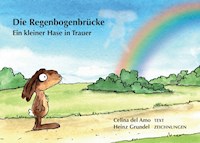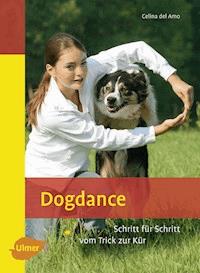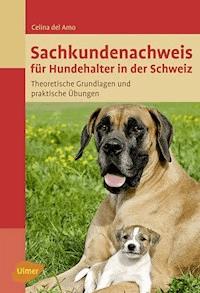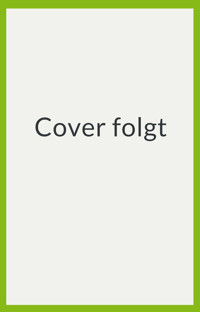
48,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Verlag Eugen Ulmer
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Dieses umfassende Handbuch auf Basis neuester wissenschaftlicher Erkenntnisse rund um das Hundetraining, den Hund und die Kundenbetreuung bietet sowohl angehenden als auch erfahrenen Hundetrainern einen breiten Überblick über die wichtigsten Themen für das Hundetraining. Ob Anatomie des Hundes, Lerntheorien, Aktuelles aus der Verhaltensbiologie, Ideen zur Kursgestaltung oder rechtliche und betriebswirtschaftliche Tipps: Dieses Handbuch von zahlreichen namhaften Experten ist das ideale Werkzeug für Berufseinsteiger oder Trainer mit langjähriger Erfahrung.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 819
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Celina del Amo | Dr. Viviane Theby (Hrsg.)
Handbuch Hundetraining
5., aktualisierte und erweiterte Auflage
120 Fotos 12 Zeichnungen
Inhalt
Entwicklung des Hundetrainings
Vom Umgang mit dem zum Hund gehörenden Menschen
Der erste Kontakt(Schalke)
Am Telefon
Das erste Treffen
Die homogene Gruppe(Schalke)
Der Halter
Organisation und Planung
Rassen berücksichtigen
Lernatmosphäre(Theby)
Das Erscheinungsbild
Freundlichkeit und Humor
Höflichkeit
Pünktlichkeit
Der zum Menschen gehörende Hund
Die Lernumgebung(Theby)
Die Gruppenzusammenstellung(Theby)
Immer nur ein Schritt nach dem anderen(Theby)
Trainingsschritt 1 – das gewünschte Verhalten
Positiv bestärken
Signal einführen
Ablenkung einbinden
Umstellung auf variable Belohnung
Richtig belohnen und korrigieren(Theby)
Wirkungsvoller Einsatz von Belohnungen
Sinnvoller Einsatz von Korrekturen
Wie Lernen funktioniert(Theby)
Vorhandenes Wissen integrieren
Kundengerecht erklären
Mentaltraining(Theby)
Allgemeine Gelassenheit
Souveränität
Die einzelnen Übungen
Unterschiedliche Menschentypen(Gerhardt)
Denken, Fühlen, Handeln
Alle Erkenntnis beginnt bei einem selbst
Stärken des Schülers im Training nutzen
Stärken und Schwächen der Hundehalter erkennen
Körpersprache der Menschen(Theby)
Stimmungsübertragung
Was versteht der Hund?
Ein Wirrwarr an Signalen
Vorsicht beim Belohnen
Praktische Übungen zur Vertiefung des Gelernten(Theby)
Verhaltensbiologie
Grundlagen der Verhaltensbiologie(Gansloßer)
Entwicklung der Verhaltensbiologie
Verhalten einordnen – Tinbergens Fragen
Methodisches Vorgehen
Ethogramm(Gansloßer)
Die Hinde’schen Ebenen(Gansloßer)
Vorbemerkungen
Ebene der Aktionen und Signale
Ebene der Interaktionen
Ebene der sozialen Beziehungen
Ebene der sozialen Strukturen
Optisches Ausdrucksverhalten des Hundes(Bartels)
Ausdrucksverhalten als Mittel der Kommunikation
Kommunikationsformen des Hundes
Kommunikationsprobleme
Einzelsignal und Gesamtausdruck
Ethogram/Funktionskreise/Verhaltenskategorien
Nutzen und Gefahren der Kategorisierung
Ausdrucksmittel des Hundes
Grundstimmungen
Verhaltenskategorien des Hundes
Mobbing
Rasseeigenschaften(Mahnke)
Eigenschaften
Rassehundezucht
Rassetypen
Herdenhunde
Jagdhunde
Hunde vom Urtyp
Schlittenhunde
Hofhunde
Schutzhunde
Gesellschafts- und Begleithunde
Fazit
Gene und Umwelt(Wree)
Genetische Zusammenhänge
Qualitativ oder quantitativ?
Doppelt hält besser!
Vom Gen zum Merkmal
Die Mendelschen Regeln
Dominante und rezessive Erbgänge
Erbkrankheiten beim Hund
Rettung aus einem Dilemma
Wann begann die Hundezucht unserer Vorfahren?
Selektion von Verhaltensmerkmalen oder „kurz mal weggezüchtet“
Erblichkeit („Heritabilität“) – lohnt sich die Selektion?
Selektion auf Arbeitsleistungen
Inzestzucht/Inzucht/Linienzucht
Inzuchtwahrscheinlichkeit einer Population
Das genetische Nadelöhr
„Qualzuchten“ in der Tierzucht und das Tierschutzgesetz
Tierzucht und das Kaufrecht
Verhaltensentwicklung von Hunden(Appleby)
Forschungsweg
Emotionale Zustände und ihre Effekte auf die Verhaltensentwicklung
Sensible Phase der Verhaltensentwicklung
Was der Züchter tun sollte
Was der Welpenhalter tun sollte
Welpenkurse(del Amo)
Besonderheiten der Kursausrichtung
Anforderungen an den Trainer bei Ausrichtung eines Welpenkurses
Inhaltliche Ausrichtung des Kurses
Beißhemmung (Theby)
Zeit nach der Welpenphase
Lerntheorie
Formen des Lernens(del Amo)
Gewöhnung (Habituation)
Sensibilisierung (Sensitivierung)
Klassische Konditionierung
Instrumentelle Konditionierung
Soziales Lernen
Signalaufbau(del Amo)
Überschattung
Generalisierung/Verallgemeinerung
Diskriminierung/Unterscheidung
Extinktion/Löschung(del Amo)
Verhalten fließend beherrschen(Theby)
Latenzzeit
Möglichst schnelle Ausführung
Korrekturen im Trainingsalltag(del Amo)
Korrekturwort
Konditioniertes Meideverhalten
Auszeit
Wie sage ich im Training: Das ist falsch? (Theby)
Clickertraining(Winkler)
Was ist Clickertraining?
Warum ausgerechnet ein Clicker?
Clickertraining in der Hundeschule
Basiswissen zum Clickertraining
Clicker-Einsatzmöglichkeiten in der Übersicht
Clicker-Stilrichtungen
Clickertraining im Grunderziehungskurs
Erste Übungen im Kurs
Ist Clickertraining für jeden geeignet?
Das „vergiftete Signal“
Hilfsmittel in der Ausbildung(del Amo)
Hilfsmittel zur leichteren Kontrolle
Andere gebräuchliche Hilfsmittel in der Hundeausbildung
Aversive Hilfsmittel im Rahmen von Strafen
Hilfsmittel im Rahmen von Belohnungssituationen
Wie beeinflussen Anatomie und Physiologie das Verhalten?
Körperbau des Hundes(del Amo)
Nervensystem(del Amo)
Das zentrale Nervensystem
Das vegetative Nervensystem
Das periphere Nervensystem
Neurotransmitter
Sinnesorgane(del Amo)
Auge und Sehsinn
Ohr und Hörsinn
Nase und Geruchssinn
Maul und Geschmackssinn
Körperoberfläche und Tastsinn
Hormone(Mahnke)
Stresshormone
Oxytozin und Vasopressin
Schilddrüsenhormone
Sexualhormone
Körperliches Unwohlsein und Erkrankungen(del Amo)
Übersicht über häufige Erkrankungen beim Hund
Schmerzen
Stress
Ernährung des Hundes(Hebeler)
Energie
Nährstoffe
Futterart und Fütterungspraxis
Fütterungs- und Tränketechnik
Fütterungsbedingte Störungen
Fütterung bei besonderer körperlicher Leistung
Fütterung bei verschiedenen Leistungen
Leckerchen
Erste Hilfe beim Hund(Behr)
Unfallprophylaxe
Erkrankte Hunde
Notfälle
Häufige Notfallsituationen
Übungsgestaltung
Motivation(del Amo)
Konkurrenz der Motivationssysteme im Training und im Alltag
Motivationsfähigkeit beeinflussende Faktoren
Motivation und Training(del Amo)
Ausnutzung von Motivationsmechanismen
Motivationsprobleme
Kreativitätstraining
Übungsaufbau für den Familienhund(del Amo)
Grundgehorsam
Trainingsübungen für „Familien- und Begleithunde“
Stadttraining
Beschäftigung
Orientierungshilfe in Bezug auf die rassenabhängige Arbeitseignung
Trainingsgestaltung
Erstellung eines Trainingsplans(Theby)
Warum brauchen wir einen Trainingsplan?
Trainingsplan für ein einzelnes Verhalten
Trainingsplan für eine einzelne Person
Belohnung
Erwartungen des Hundehalters
Kursgestaltung(Theby)
Eingangsvoraussetzungen
Einzeltraining oder Gruppentraining
Gruppengröße
Kurse oder offenes Training
Kursgestaltung nach Alter der teilnehmenden Hunde
Länge der Trainingsstunde/des Kurses
Hausaufgaben
Könnenblatt(Theby)
Könnenblatt(Theby)
Ängstliche und aggressive Hunde im Training(Theby)
Voraussetzungen für das Problemhundetraining
Schulung des Besitzers
Management
Sicherheitstraining
Selbstbeherrschungs- und Entspannungsübungen
Gehen an lockerer Leine
Target-Übung
Probleme möglichst vermeiden
Arbeiten an den Grundlagen
Trainingsschwierigkeiten(Theby)
Zu große Ablenkung
Schlechte Motivationslage
Ein Hund führt ein Signal nicht aus
Hohe Erregungslage
Abwechslung im Training(Theby)
Grundausbildung abwechslungsreich und vielfältig gestalten
Mal was anderes – neue Betätigungsfelder im Training
Trainingsspiele für den Menschen
Hund und Recht
Hunde im Rechtssystem(Stiff)
Tierhalterhaftung
Musterverträge(Stiff)
Vertrag über die Führung oder Abrichtung eines Hundes
Musterverträge
Hundeunterbringungs- und Tierpensionsvertrag
Musterverträge
Hundeausbildungsvertrag
Tieraufseherhaftung nach § 834 BGB
Gesetzestexte(Theby)
Tierschutzgesetz (TschG)
Tierschutz-Hundeverordnung (TierSchHuV)
Straßenverkehrsverordnung (StVO)
Liste von Gesetzen, die Hunde betreffen
Einführung ins Marketing und betriebswirtschaftliche Grundlagen
Definitionen(Frost/Theby)
Aufgaben des Marketing
Die vier Marketing-Instrumente
Marketing-Management
Praktischer Marketing-Mix
Betriebswirtschaftliche Aspekte
Hundeschule der Zukunft
Training – eine angewandte Wissenschaft(Theby)
Matching Law und seine Bedeutung im Training(Theby)
Hundehalter wollen nicht Hundetrainer werden
Wie könnte Training künftig aussehen?(Theby)
Viele Vorteile
Autorenübersicht
Service
Für Karli und Carlo
Entwicklung des Hundetrainings
Eine gewisse Art des „Hundetrainings“ gibt es mit Sicherheit schon seit es Hunde gibt. Die Menschen, die mit Hunden zusammenlebten, beobachteten sie, nutzten ihr Verhalten zu ihren Gunsten und versuchten wahrscheinlich auch, es in ihrem Sinne zu verändern. Alte Höhlenzeichnungen zeigen schon die Zusammenarbeit von Menschen und Hunden – vornehmlich bei der Jagd.
Weitere Stationen der Entwicklung des Hundetrainings:
Von den Römern wurden uns die ersten Texte übermittelt, die sich mit der Welpenaufzucht und dem Training von Hütehunden beschäftigen.
Im 18. Jahrhundert gab es die ersten uns dokumentierten Hundeausstellungen. Dort ging es hauptsächlich um den Vergleich von jagdlich geführten Hunderassen.
In größerem Stil begann das Hundetraining im ersten Weltkrieg. Damals wurden Hunde für die unterschiedlichsten militärischen Zwecke ausgebildet, z. B. als Sanitätshunde, Botenhunde, aber auch zum Zerstören feindlicher Panzer, indem man ihnen beibrachte, mit einer Bombe unter den Panzer zu laufen und diese dann zündete.
Aus dieser Zeit kommen die Begriffe „Kommandos“ und „Befehle“ die man auch heute noch häufig in der traditionellen Hundeausbildung benutzt. Auch der mitunter raue Umgangston in der Ausbildung zeigt deutlich den militärischen Ursprung.
Das Hundetraining hat sich über Jahrzehnte weiterentwickelt und verbessert.
1922 wurde der Schäferhund Rin Tin Tin berühmt, der einem amerikanischen Soldaten gehörte und im Kino sein Können zeigte. 1943 eroberte Lassie die Kinowelt und die Herzen vieler Hundehalter.
Ungefähr zur selben Zeit wurde in Versuchslaboren immer mehr über das Lernen geforscht. Die lerntheoretischen Forschungen gehen auf Pawlow, Thorndike und Skinner zurück (s. Seite 141 ff. Lerntheorie). Die daraus entwickelten Trainingstechniken bzw. deren Wirkungen sind wissenschaftlich genauestens erforscht, beschrieben und belegt. Dabei wurde zum Teil das bestätigt, was einige Praktiker bereits durch persönliche Trainingserfahrung herausgefunden haben.
So hat z. B. schon Konrad Most (1934) das Prinzip des sekundären Verstärkers beschrieben. Es dauerte jedoch etliche Jahre, bis das Wissen aus den wissenschaftlichen Laboren im Hundetraining umgesetzt wurde. Dieser Prozess setzt sich heute noch fort und wird wohl auch zukünftig das Training beeinflussen.
Zu den Erkenntnissen aus dem sogenannten Behaviorismus, bei dem es nur um das von außen erkennbare Verhalten geht, fließt auch immer mehr Wissen aus der Hirnforschung in modernes Hundetraining ein. Man weiß inzwischen einiges darüber, wie das Lernen auf neuronaler Ebene funktioniert. Auch Forschungsergebnisse bezüglich Emotionen und Motivation werden im modernen Training bereits genutzt (s. Seite 202 und 261). Es ist zu erwarten, dass die Gehirnforschung zukünftig noch einiges an Neuerungen im Training bringen und Antworten auf noch offene Fragen geben wird.
Ein weiterer Stützpfeiler für die Umsetzung von artgerechtem Hundetraining sind die Erkenntnisse aus der Ethologie. Wissenschaftlich betrachtet war Hundeverhalten lange ein Stiefkind, was sich aber mehr und mehr ändert (s. Seite 38, Gansloßer).
Vor diesem geschichtlichen Hintergrund finden wir heute unterschiedliche Ausbildungsmethoden. Manche sind wissenschaftlich fundiert, andere basieren auf eher fragwürdigen Theorien Einzelner.
Der Hundehalter von heute steht vor der Schwierigkeit, bei den bestehenden Trainingsangeboten zwischen Mythos und gesichertem Wissen zu unterscheiden.
Modernes Hundetraining, wie es im Folgenden dargestellt wird, nutzt all das verfügbare Wissen. Ein moderner Hundetrainer ist aus diesem Grund sein ganzes Berufsleben lang zur eigenen Ausbildung und fortwährender Weiterbildung bereit, um den Weg zu finden, die Hunde auf artgerechte Weise, zeitlich effektiv und ohne unerwünschte „Nebenwirkungen“ auszubilden.
Vom Umgang mit dem zum Hund gehörenden Menschen
Auch wenn der ausschlaggebende Punkt für die Berufswahl vieler Trainer die Liebe zum Hund war, bestimmt in der Realität als „Hundeausbilder“ der Umgang mit dem Menschen einen Großteil der Arbeit. Schließlich hat man es mit einem Mensch-Hund-Team zu tun. Tatsächlich ist es so, dass nur derjenige ein guter Hundeausbilder sein kann, der auch ein Händchen für den Umgang mit Menschen hat. Dies kann man lernen. Und zum Glück unterscheidet sich der Mensch in vielen Bereichen gar nicht so sehr vom Hund. Das muss man sich nur bewusst machen.
Der erste Kontakt
Der Tierhalter spielt in der folgenden Ausbildung eine ganz wesentliche Rolle. Nur mit seinem Einverständnis kann ein Trainingskonzept umgesetzt werden. Wichtig hierfür ist es, dass wir ihm als Trainer den Sinn und Zweck der Ausbildungsschritte verständlich machen können, ihm die entsprechenden „Werkzeuge“ an die Hand geben und ihn auf dem Weg der Ausbildung begleiten. Streng genommen sollten die Hund-Halter-Teams, die wir ausbilden, bei jedem Training immer wieder neu unter folgenden Gesichtspunkten beurteilt werden:
Wo steht das Team?
Wo will es hin?
Welchen Weg wählen wir am besten für eben genau diesen Hund mit seinem Halter?
Am Telefon
Der erste Kontakt mit dem Hundehalter findet in der Regel am Telefon statt. Bereits an dieser Stelle sollte geklärt werden, was die Motivation des Halters ist, eine Hundeschule aufzusuchen.
Hat der Tierhalter einen
Welpen oder jungen Hund
und sucht ein wenig Unterstützung in der
Erziehung
?
Möchte er seinen schon
erwachsenen Hund
geistig und körperlich
auslasten
?
Sucht er dabei
Kontakt zu anderen
gleich gesinnten Hundehaltern?
Manche Hundebesitzer möchten eine ganz
spezielle Hundearbeit
machen und wollen oder können aus den unterschiedlichsten Gründen keinen Hundesportverein aufsuchen.
Andere Hundebesitzer melden sich aber auch in der Hoffnung, dass ein Training in der Hundeschule helfen kann, das
Verhaltensproblem
ihres Hundes zu lösen.
Achtung: Hunde mit Problemverhalten
An dieser Stelle ist Vorsicht geboten – eine Hundeschule ist in aller Regel nicht der richtige Ort für eine fundierte Verhaltenstherapie. Denn jedes Verhaltensproblem, egal worum es sich handelt, bedarf einer gründlichen Diagnostik und speziellen Therapie. Dabei erfordert die Diagnostik spezielle Kenntnisse über die Ethologie des Hundes, über das Lernverhalten, über Physiologie, Neurologie und innere Medizin. Hunde mit Verhaltensproblemen sollten also zunächst an einen Tierarzt überwiesen werden, der sich auf Verhaltenstherapie spezialisiert hat. In einigen Bundesländern führen diese Tierärzte die Zuatzbezeichnung „Verhaltenstherapie“ und können über die entsprechende Tierärztekammer ermittelt werden. Wenn eine entsprechende Diagnosestellung schon erfolgt ist, kann die Zusammenarbeit mit einer Hundeschule jedoch für den Tierhalter entscheidende Vorteile bringen.
Bei dieser Form der Zusammenarbeit ergänzen sich die Fähigkeiten und Möglichkeiten von Tierarzt und Hundetrainer hervorragend. Das bedeutet aber auch, dass die Kontakte schon im Vorfeld hergestellt werden müssen. Man muss sich gegenseitig kennen und vertrauen, damit es für alle beteiligten Parteien, den Hundehalter selbstverständlich mit eingeschlossen, harmonisch verläuft.
Tipp
Auch das Hund-Halter-Team, das mit einem Trainingsauftrag und nicht mit einem Therapiewunsch zu Ihnen kommt, sollten Sie zuerst alleine, außerhalb der Gruppe kennenlernen.
Manche Hundetrainer haben sich im Bereich des Problemverhaltens fortgebildet und bieten eine Verhaltensberatung in ihrer Hundeschule an. Dies sollte immer an speziell dafür ausgemachten Terminen stattfinden. Eine kurze Beratung zwischen Tür und Angel, also zwischen zwei Trainingsgruppen oder innerhalb einer Gruppenstunde ist nicht zielführend.
Das erste Treffen
Vereinbaren Sie während des Telefonats ein Treffen, an dem Sie eine ganze Stunde Zeit nur für dieses Hund-Halter-Team haben.
Wenn der Halter gerne am Gruppenunterricht teilnehmen möchte, Sie grundsätzlich keine Bedenken haben, und wenn Sie mit einem weiteren Kollegen zusammenarbeiten, können Sie den Halter an dem entsprechenden Tag zu einem Kurs eines Kollegen dazukommen lassen. Während Ihr Kollege auf dem Platz die Gruppe leitet, kümmern Sie sich auf einem separat abgetrennten Stück um Ihren neuen Kunden. Auf diesem Wege schlagen Sie zwei Fliegen mit einer Klappe: Der Halter bekommt einen Einblick in Ihre Art des Trainings und Sie einen ersten Eindruck von Hund und Halter. Dabei sollte Ihr Augenmerk erst einmal auf ganz allgemeinen Punkten liegen:
Wie alt
ist der Hund?
Zu welcher
Rasse
gehört er bzw. wenn es sich um einen
Mischling
handelt, welche Rassen stecken in dem Hund (falls das bekannt ist)?
Welches
Ausdrucksverhalten
zeigt der Hund beim Ausführen der Signale?
Zu welchem
Persönlichkeitstypus
gehört der Hund? Ist er eher introvertiert oder extrovertiert?
Die Punkte haben Einfluss auf das Konzentrationsvermögen und die Lerngeschwindigkeit des Hundes. Gerade in Hundegruppen ist es aus zwei Gründen sehr angenehm, wenn die Hunde sich in Lerngeschwindigkeit und Konzentration ähnlich sind. Das Ausdrucksverhalten gibt ein Hinweis auf die zugrundeliegende Emotion/ Motivation, das Verhalten zu zeigen. Für Sie als Trainer ist es wichtig zu wissen, ob dem Hund die Übung Spaß macht oder ob er nur eine Strafe vermeiden will. Möchten Sie auf dieser Übung aufbauen, und der Hund verbindet damit negative Emotionen, kann es sein, dass Ihr nachfolgendes Training irgendwann zusammenbricht wie ein Kartenhaus.
Der Persönlichkeitstyp hat direkten Einfluss auf den Trainingsweg für dieses Tier. Neuere Untersuchungen haben gezeigt, dass Erziehungsstile in Abhängigkeit der Persönlichkeit Einfluss auf mögliche, spätere Verhaltensprobleme haben.
Die homogene Gruppe
Ähnliche Lerngeschwindigkeit und Konzentrationsfähigkeit der Hunde wirken sich in einer Gruppe positiv aus, dafür gibt es verschiedene Gründe.
Der Halter
Der erste Faktor ist hierbei der Halter! Sind die Lerngeschwindigkeiten und die Frustrationsgrenzen der Hunde zu unterschiedlich, dann passiert es schnell, dass der Halter des etwas langsameren Hundes unter Umständen frustriert wird, wenn er das Gefühl hat, alle Hunde sind besser als sein eigener. Diese Frustration kann schnell auch auf Ihre Hundeschule projiziert werden. In seinen Augen sind Sie nicht in der Lage, seinen Hund richtig auszubilden. Bedenken Sie: Unzufriedene Halter sind keine gute PR für Ihre Hundeschule!
Beispiel: Junge Hütehunde entwickeln sich zu Beginn sehr schnell und haben schon frühzeitig ein recht langes Konzentrationsvermögen. Daher lassen sich viele Besitzer dazu verführen, zu viel mit ihren jungen Hunden zu machen. Die Kleinen müssen manchmal schon mit ein paar Wochen so viel leisten als ginge es darum, in den nächsten Tagen eine Begleithundeprüfung zu bestehen. Diese Überforderung rächt sich häufig erst sehr viel später. Nicht selten fällt es diesen Hunden im Erwachsenenalter extrem schwer, auf Spaziergängen oder auch zu Hause zu entspannen. Problemverhalten wie eine Hund-Hund-Aggression, eine Stereotypie oder das Jagen von unerwünschten Beuteobjekten wie Joggern oder Autos sind keine Seltenheit.
Versuchen Sie im Gespräch herauszufinden, was der betreffende Halter von seinem Hund fordert. Sie werden so erfahren, wie ehrgeizig er in Bezug auf schnelle Trainingserfolge ist.
Organisation und Planung
Der zweite Grund, weshalb es wichtig ist, dass die Hunde ein ähnliches Lern- und Konzentrationsvermögen haben, ist rein organisatorischer Natur: Sie können Ihre Übungseinheiten gleichmäßig gestalten. Ihre Vorbereitung muss dann nicht individuell auf jeden einzelnen Hund abgestimmt sein, sondern Sie können für das Training z. B. eine „Sitzübung“ mit dem gleichen Schwierigkeits- und Ablenkungsgrad für alle Hunde planen.
Für das enge Herankommen muss die Vertrauensbasis stimmen.
Rassen berücksichtigen
Bei der Planung bzw. Zusammenstellung der Gruppe empfiehlt es sich, den Lernweg von teilnehmenden Rassen abhängig zu machen. Beispiel Molosser: Es handelt sich häufig um sehr ausgeglichene Hunde. Diese emotionale Ausgeglichenheit spiegelt sich auch in einer ruhigeren Bewegungsaktivität wider. Dieser Zusammenhang zwischen Emotionalität und Bewegungsaktivität wurde bereits in den fünfziger Jahren erforscht. Für Hunde dieses Typs ist das freie Formen als Methode in aller Regel nicht der Weg der ersten Wahl, denn sie zeigen eine geringere Bereitschaft, spontan Verhalten anzubieten. Hund und Halter können bei dieser Methode schnell die Motivation für die Arbeit verlieren. Auch das Gefühl von Überforderung oder Misserfolg steht im Raum – einer der größten Stressoren in der Arbeit mit dem Hund.
Beispiel Hüte- und Treibhunde: Bei ihnen ist es klug, sie zuerst ganz ruhig lernen zu lassen, was sie genau machen sollen, bevor man sie dazu motiviert, das Verhalten dann schnell oder mit einer sehr hohen Spannung zu zeigen. Andernfalls sind negative Ersatzhandlungen wie permanentes Bellen oder sich nach jedem Job im Kreis zu drehen praktisch vorprogrammiert.
Vorkenntnisse: Neben dem Alter und der Rasse ist selbstverständlich der Ausbildungsstand des Hundes und das Vorwissen des Halters in Punkto Hundetraining von großer Bedeutung. Es empfiehlt sich, ihn erst einmal erzählen zu lassen, was der Hund schon alles kann. Dabei sollten Sie sich im Detail erklären lassen, was der Halter unter der genannten Übung oder dem jeweiligen Hörzeichen versteht. So kann es z. B. sein, dass ein Hundehalter, der noch keine Erfahrungen im Hundesport gesammelt hat, unter „Fuß“ etwas ganz anderes versteht, als jemand, der mit seinem Hund schon einmal eine Begleithundeprüfung absolviert hat. Während der eine von seinem Hund erwartet, dass er sich einfach nah bei ihm aufhält und mitgeht, möchte der andere einen Hund, der ganz akkurat mit seiner rechten Schulter an seinem linken Knie geht, ihn anschaut und sich sofort setzt, wenn er anhält.
Ziel: Hier können sich dann auch sofort die Fragen anschließen, was der Hundehalter mit seinem Hund trainieren möchte, und warum er dafür ganz speziell zu Ihnen kommt. Häufig eilt einer Hundeschule ein ganz bestimmter Ruf voraus, der dazu führt, dass ein Interessent sich genau dieser Hundeschule zuwendet. Eine solche konkrete Abklärung der Erwartungshaltung des Besitzers hilft häufig, spätere Missverständnisse zu vermeiden. Eine Kollegin sagte während ihres Kommunikationsseminares einmal zu mir: „Wenn du einen Kunden in deiner Hundeschule hast, der ständig ‚ja … aber‘ sagt, dann bist du noch nicht zu seinem Problem vorgedrungen, weshalb er bei dir ist.“
Einen Eindruck gewinnen: Sobald Sie den Ausbildungstand und das Ziel in einem Gespräch abgeklärt haben, sollten Sie sich die Übungen beim ersten Treffen vorführen lassen. Dabei sind vor allem diese Punkte am Hund und einer am Halter wichtig:
Führt der Hund das vom Besitzer beschriebene Verhalten wirklich aus?
Falls ja: unter welchen Umständen (Schwierigkeitsgrad, Dauer und Ablenkungsgrad)?
Wie steht es mit der Geschicklichkeit des Hundehalters. Ist er körperlich in der Lage, seinen Hund zu führen? Dabei spielen sowohl Schnelligkeit als auch Kraft eine Rolle. Diese Bedingungen haben unter anderem auch Einfluss auf das
Hilfsmittel
, welches für dieses Team gegebenenfalls gewählt werden kann. Ist der Halter beispielsweise nicht besonders schnell, eine punktgenaue Belohnung bei dem Hund aber von entscheidender Bedeutung, dann wäre die Verwendung eines Clickers eine gute Möglichkeit. Anfangs können auch Sie selbst als Trainer das Clickern übernehmen, indem Sie den Belohnungszeitpunkt mit dem „Click“ markieren. Der Hundehalter hat dann nur noch die Aufgabe seinem Hund den primären Verstärker (z. B. ein Leckerchen) zu geben.
Verträglichkeit: Wenn der Halter mit seinem Hund gerne an einem Gruppentraining teilnehmen möchte und dem Wunsch vom Trainingsstand des Hundes her betrachtet nichts entgegensteht, sollten beim ersten Treffen auch noch folgende Punkte geklärt werden: Wie verträglich ist der Hund im Umgang mit ihm unbekannten Hunden und Menschen? Das beinhaltet jede Form und Abstufung von aggressivem Verhalten. Achten Sie dabei auch darauf, ob der Hund vielleicht andere Hunde mit festem Blick anschaut. Diese sehr subtile Art der Provokation wird leider sehr häufig übersehen, stellt für den angestarrten Hund aber eine massive Belastung dar. Aber auch Hunde, die Angst haben und aus diesem Grund Meideverhalten zeigen oder Erstarren, sollten nicht bzw. nicht ohne besondere Betreuung in ein Gruppentraining aufgenommen werden. Für diese Hunde gilt, dass zuerst das Problem behandelt werden muss und dass sie danach langsam in eine Gruppe integriert werden können.
Temperament: Der nächste Punkt, der geklärt werden muss, ist das Temperament des Hundes:
Passt er von seinem
Temperament
her in die angedachte Gruppe?
Passt sein
Spielverhalten
zu den anderen Hunden?
Passt er von der
Körperkraft
dazu? Oder gleicht er vielleicht mangelnde Kraft durch ein gutes
Selbstbewusstsein
wieder aus?
Und natürlich – lässt er sich durch die anderen Hunde nicht so sehr
ablenken
, dass ein Training für ihn nicht effektiv wäre?
Wenn all diese Fragen geklärt sind und der Halter sich dann für ein Training bei Ihnen (einzeln oder in der Gruppe) entschieden hat, können Sie loslegen. Machen Sie mit dem Tierhalter einen Trainingstermin aus und bereiten Sie für diesen Termin einen strukturierten Trainingsplan vor.
Hunde, die mit Artgenossen nicht vertraut oder unverträglich sind, sollten nicht unkontrolliert mit ihnen zusammengebracht werden.
Lernatmosphäre
Um optimal lernen zu können, muss man entspannt, konzentriert und aufmerksam sein. Es gilt zu bedenken, dass die meisten Menschen aufgrund unseres Schulsystems das Lernen nicht unbedingt positiv verknüpft haben. Auch wenn es um Hundetraining geht, ist unabdingbar, dass der Hundehalter selbst mitlernt. Um ihm das zu erleichtern, sollte stets eine positive Lernatmosphäre herrschen, sodass er gerne zum Training kommt, sich wohlfühlt und weitestgehend entspannt ist. Dafür müssen wir als Hundetrainer die geeigneten Voraussetzungen liefern. Egal, ob Sie zum Training zu den Hundehaltern nach Hause gehen oder ob diese zu Ihnen kommen, es gibt bestimmte Dinge, die Sie beachten sollten.
Das Erscheinungsbild
Um eine gute Lernatmosphäre herzustellen, ist ein gepflegtes Äußeres nicht zu unterschätzen. Natürlich müssen wir auf dem Hundeplatz nicht mit Schlips und Kragen herumlaufen. Die Kleidung sollte zweckmäßig, aber sauber und ordentlich sein. Beim Umgang mit anderen Menschen sollte ein gepflegtes Aussehen selbstverständlich sein.
Freundlichkeit und Humor
Für ein gutes Lernklima ist es wichtig, dass wir dem Kunden freundlich und verständnisvoll gegenübertreten. Wir sollten seine Wünsche und Sorgen ernst nehmen. Folgende Slogans aus den Schulen der skandinavischen Länder sind auch für die Trainerarbeit passend:
Nicht unterrichten, sondern aufrichten! Niemals einen Menschen beschämen!
Beispiele
Oftmals ist es beschämend für den Tierhalter, wenn der Trainer Übungen – womöglich auch mit dem Hund des Hundehalters, mit dem er selbst Probleme hat – perfekt vormacht. Solch ein
Zurschaustellen der eigenen Fähigkeiten
erzeugt beim Tierhalter schnell Frustration.
Kommentieren Sie niemals schlechte Leistung oder Fehler eines Kunden
vor der Gruppe
. So etwas beschämt und stresst den betroffenen Menschen sehr und schränkt seine Fähigkeit zu lernen ein. Bei den umstehenden Kunden schürt solch ein Vorgehen übrigens die Angst selbst einmal als Negativbeispiel vorgeführt zu werden und senkt somit auch deren Konzentrationsfähigkeit!
In seltenen Fällen kann es aber vielleicht doch einmal wichtig sein, einen bestimmten
Fehler vorzuführen
, um ihn wirklich deutlich zu machen. Das ist dann der
Job des Trainers
. Manchmal erfordert es zwar schon etwas schauspielerisches Talent, ganz bewusst Fehler zu machen, aber für die Kunden ist es allemal besser, als wenn hierfür einer aus ihrer Mitte genommen wird. Eine derartige Showeinlage wird übrigens von vielen Hundebesitzern mit viel Humor aufgenommen, was die Situation weiter auflockern kann.
Humor
ist generell geeignet, die Lernatmosphäre zu verbessern. Wenn positive Emotionen beteiligt sind, behält sich das Gelernte auch besser (s. Seite
202
). Allerdings sollte man
Witze nie auf Kosten anderer
Menschen machen, auch wenn diese nicht anwesend sind. Bei den anderen Hundebesitzern kann sonst leicht der Verdacht aufkommen, dass in ihrer Abwesenheit auch über sie so „hergezogen“ wird.
Höflichkeit
Höflichkeit im Umgang mit dem Kunden sollte eine Selbstverständlichkeit sein. Im Hundetraining ist es häufig üblich, dass jeder jeden duzt. Dagegen ist an sich auch nichts einzuwenden. Allerdings sollten immer alle Teilnehmer gefragt werden, ob sie damit einverstanden sind, geduzt zu werden. Wenn das bei jemandem nicht der Fall sein sollte, sollte das ganz selbstverständlich akzeptiert werden.
Zur Höflichkeit gehört auch, dass man andere Menschen nicht ungefragt anfasst. Denn auch Menschen haben eine Individualdistanz für körperliche Nähe, deren Missachtung als unangenehm und ggf. auch stressig empfunden wird.
Sollte für eine Übung eine körperliche Berührung notwendig sein, ist es wichtig, vorher unbedingt um Erlaubnis zu bitten (s. Seite 28). Dies gilt für einen männlichen Hundetrainer im Umgang mit weiblichen Kunden ganz speziell. Hat man auch nur den Verdacht, dass dem Gegenüber eine Berührung nicht so recht ist, tut man gut daran, sich eine andere Möglichkeit zur Demonstration zu suchen.
Pünktlichkeit
„Fünf Minuten vor der Zeit ist des Meisters Pünktlichkeit“ sagt ein altes Sprichwort, was wir auch als Hundetrainer beherzigen sollten. Es ist unhöflich, wenn man als Ausbilder zu spät kommt und es fördert gewiss nicht die Lernatmosphäre. Bei einem Trainingstreffen draußen oder auf dem Hundeplatz kann eigene Unpünktlichkeit schnell Stress und Unsicherheit bei den Trainingsteilnehmern hervorrufen: „Habe ich etwas verpasst? Fällt der Unterricht heute aus?“ „Ich habe anschließend noch etwas vor und kann nicht länger bleiben!“ usw. könnten mögliche Reaktionen sein.
Oft ist es notwendig, auch die Hundehalter zur Pünktlichkeit zu „erziehen“. Da wir auch mit den Menschen über die positive Verstärkung arbeiten sollten, kann man zu Beginn der ersten Stunden im übertragenen Sinn einige „Bonbons“ bieten. Das kann in einer Theoriestunde ein kurzer Film sein, man kann lesenswerte Bücher vorstellen oder Ähnliches, um die pünktlichen Teilnehmer zu belohnen. So haben die, die zu spät kommen, nicht inhaltlich, aber durchaus vom Gefühl her etwas vom Unterricht verpasst. Oft reicht so etwas, dass sie beim nächsten Mal pünktlich erscheinen.
Beginnt der Unterricht pünktlich, kann er auch pünktlich beendet werden. Dies ist für einen selbst und die Teilnehmer wichtig für die Zeiteinteilung des Tages, weil vor oder nach der Hundestunde jeder noch andere Dinge zu erledigen hat.
Je nach Unterrichtsstoff bietet es sich an, am Ende der Stunde einige Minuten für eventuelle Fragen einzuplanen. Organisatorisch kann man das gut lösen, indem man beispielsweise beim Handy den Alarm anstellt oder sich einen Timer in die Tasche steckt, der sich dann zehn Minuten vor Schluss meldet. Mit einem solchen Trick kann man es außerdem vermeiden ständig auf die Uhr zu sehen, was beim Trainingsteilnehmer einen fragwürdigen Eindruck hinterlassen kann.
Der zum Menschen gehörende Hund
Der eigene Hund ist dem Kunden sehr wichtig, sonst käme er nicht mit ihm in die Hundeschule. Entsprechend sensibel sollten Sie auch im Umgang mit den Hunden sein.
Dazu einige eigene persönliche Fehlerbeispiele aus der Praxis:
In einer meiner ersten Trainingsstunden rutschte mir direkt nach der Begrüßung über einen teilnehmenden Hund der Satz heraus: „Der ist aber ziemlich dick!“ (In der Tat war der Hund wirklich stark übergewichtig.) Obwohl wir ansonsten eine sehr angenehme Stunde miteinander hatten, kam die Tierhalterin nicht wieder. Sie hat mir den negativen Kommentar über ihren Hund wohl sehr übel genommen.
In einer Welpengruppe gerieten sich zwei kleine Terrier so in die Haare, dass ich ausnahmsweise mal eingreifen musste. Um die Lage zu entspannen, versuchte ich es mit folgender Erklärung: Terrier seien große Hunde in kleiner Verpackung und eben echte Kämpfernaturen. Schließlich müsste ein Terrier bei der Arbeit im Bau, um erfolgreich zu sein, oftmals auch erst zubeißen und dann nachsehen, wer sein Gegenüber war. Trotz dieser sachlich ausgerichteten Erläuterung habe ich eine der Terrierbesitzerinnen so sehr gekränkt, als ich ihren netten kleinen Hund als Kämpfer bezeichnet hatte, dass sie wütend schimpfend den Platz verließ.
Kommunikationsfehler wie aus den Beispielen können immer einmal auftreten, sollten aber nicht damit abgetan werden, „dass der Mensch wohl ein arges Problem hat“. Denn damit ist keiner Partei geholfen.
Die emotionale Bindung an den eigenen Hund sollte niemals unterschätzt werden. Über sich selbst können sich viele Menschen sehr viel schlimmere Dinge anhören, als über ihre Hunde. Ein Trainer sollte sehr sensibel sein mit dem, was er über einen jeweiligen Hund sagt. Nicht immer muss das, was man gerade auf der Zunge hat, auch ausgesprochen werden.
Anders herum ist es immer sehr leicht Brücken zu bauen, indem den Kunden nette Sachen über ihre Hunde gesagt werden. Allerdings sollten die Kommentare auch ernst gemeint sein! Heucheleien werden in aller Regel sofort durchschaut und helfen nicht weiter! Bei entsprechender Übung ist es jedoch praktisch immer möglich, über einen beliebigen Hund etwas Nettes zu sagen – und sei es nur, dass er ein schönes Halsband trägt – was letztendlich wieder zu einer guten Lernatmosphäre beiträgt.
Die Lernumgebung
Neben einem verständnisvollen, freundlichen, kompetenten und einfühlsamen Trainer gehört zu einer guten Lernatmosphäre auch eine entsprechend geeignete Umgebung.
So trägt ein freundlich gestalteter Hundeplatz in einer ruhigen Gegend mehr zu einer guten Lernatmosphäre bei, als ein unordentlicher Platz direkt an einer Hauptstraße. Oder die Möglichkeit, im Trockenen und Warmen zu trainieren mehr, als draußen im Regen in der Kälte zu stehen.
Natürlich kann man sich den Trainingsplatz nicht immer aussuchen und längst nicht jeder hat die Möglichkeit, irgendwo unter einem Dach zu trainieren. Mit ein paar Überlegungen lassen sich aber schnell überall einige Verbesserungen einführen. So ist eine Thermoskanne mit heißem Tee und Tassen eine nette Geste, wenn man in der Kälte trainieren muss. Einen ungemütlichen Hundeplatz kann man durch einige Blumen, eine Sitzgelegenheit und z. B. Sonnenschirme freundlicher gestalten.
Wenn man nicht die Möglichkeit hat, bei ungemütlichem Wetter im Warmen zu trainieren, wäre eine Lösung vielleicht in der Stadt nach Geschäftsschluss auf einen großen Parkplatz zu gehen. Oftmals sind die Parkplätze sogar beleuchtet. Außerdem ist der Boden befestigt und nicht matschig.
Die Gruppenzusammenstellung
Die Zusammenstellung der Gruppe kann einen entscheidenden Effekt auf eine gute Lernatmosphäre haben. So könnte sich eine Rentnerin in einer Gruppe mit lauter Jugendlichen vielleicht überfordert vorkommen. Dasselbe gilt für ein Kind in einer Erwachsenengruppe. Das soll jetzt nicht heißen, dass das immer unmöglich ist. Man sollte nur ein Gespür dafür entwickeln, um gegebenenfalls souverän mit einer solchen Situation umgehen zu können.
Immer nur ein Schritt nach dem anderen
Nicht nur im Training mit dem Hund sind immer eine Menge Wiederholungen nötig, bis der Arbeitsablauf perfekt beherrscht wird. Dies gilt für sämtliche Tätigkeiten: Denken Sie an das Beherrschen eines Musikinstruments. Wenn jemand sehr gut darauf spielen kann, hat er sich schon Zehntausende von Stunden damit befasst.
Wir als Hundetrainer haben uns schon etliche Male mit bestimmten Abläufen im Training beschäftigt. Wir haben sie immer wieder wiederholt, mit unterschiedlichen Hunden, und beherrschen sie einigermaßen gut. Vielleicht könnte man immer noch etwas verbessern. Aber auf jeden Fall haben wir dem normalen Hundehalter Einiges voraus. Dessen müssen wir uns immer wieder bewusst sein!
Was für uns ganz automatisch abläuft, ist für die meisten Menschen, die mit ihrem Hund zu uns kommen, zum Teil völlig neu. Wenn wir dann einem Hundehalter beibringen wollen, wie er seinem Hund am besten das „Bei Fuß“-Gehen beibringt, ist das für ihn etwa genauso schwierig, wie das Erlernen der ersten 20 Buchstaben auf der Schreibmaschine nach dem 10-Finger-System. Genauso wie man bei der Schreibmaschine Buchstaben für Buchstaben lernt, gilt das auch für jedes einzelne Kriterium, das beim „Bei Fuß“-Gehen wichtig ist. Vermeiden Sie es deshalb strikt, die Teilnehmer mit Anweisungen „zu bombardieren“. Kein Mensch kann sich auf alles gleichzeitig konzentrieren. Genauso wie dem Hund die Lerninhalte in einzelnen Trainingsschritten vermittelt werden, sollten auch die Menschen Schritt für Schritt angeleitet werden.
Beispiel
Nehmen wir das „Bei Fuß“-Gehen und zerteilen das Training in kleine Schritte. Wir entscheiden uns hier für den Trainingsweg, bei dem der Hund zunächst vom rückwärts gehenden Menschen gelockt wird und dieser sich dann in die richtige Position dreht, während der Hund weiter geradeaus läuft (siehe Übung S. 272).
Zuerst sollten wir den Hundehaltern das Trainingsziel (s. Seite 299) erklären: „Der Hund soll auf das entsprechende Signal hin parallel zu uns an unserer linken Seite gehen, mit seiner Schulter immer dicht an unserem Knie bleiben und die ganze Zeit zu uns aufblicken. Er soll Tempo- und Richtungsänderungen mitmachen, ohne dafür neue Kommandos zu bekommen.“
Dann erklären wir dem Hundehalter die einzelnen Trainingsschritte für den Hund. Diese sind für jede beliebige Übung ausschlaggebend (siehe Kasten unten).
Für jeden dieser einzelnen Schritte muss der Hundehalter gleich mehrere Dinge lernen. Übrigens hilft es nicht, dem Tierhalter die aufgeführte Liste der Trainingsschritte vorzulesen. Die allermeisten Menschen können ein Training nur anhand einer solchen Trainingsanleitung nicht umsetzen – oft sogar nicht einen einzigen Schritt davon. Das ist normal. Gerade deshalb buchen die Teilnehmer eine Stunde bei Ihnen. Dennoch sind sie keinesfalls zu „dumm“ diese Dinge umzusetzen. Sie können es (noch) nicht, denn es ist oft einfach zu neu für sie. Unsere Aufgabe als Hundetrainer ist es, die Menschen darin zu unterrichten, diese einzelnen Trainingsschritte in Zukunft auch alleine auszuführen. Wir sind hier also gefordert! Ist ein Hundehalter in der Gruppe, der einfach nicht zu verstehen scheint, was wir ihm erklären, sollten wir uns immer zuerst fragen, ob wir es ihm auch verständlich genug erklärt haben (s. Seite 27, Menschentypen).
Trainingsaufbau
Wir müssen erreichen, dass der Hund das gewünschte Verhalten zeigt (in diesem Fall, indem wir den Hund in die richtige Position locken).Wir verstärken das gewünschte Verhalten positiv, damit der Hund es immer wieder gerne zeigt.Sobald der Hund das Verhalten zuverlässig zeigt, führen wir ein Signal ein.Wir trainieren unter immer stärkerer Ablenkung.Wir stellen auf variable Belohnung um.Trainingsschritt 1 – das gewünschte Verhalten
Wir müssen erreichen, dass der Hund das gewünschte Verhalten zeigt. Mit den meisten Hunden ist es relativ einfach, sie mitzulocken, während man selbst rückwärts geht. Ist der Hund schön aufmerksam, dreht man sich in die richtige Position und schon geht der Hund „bei Fuß“.
Den Hund zwei Schritte locken: Für den Trainingsneuling ist dies aber vermutlich genauso schwierig, wie für einen Schüler aus einem Schreibmaschinenkurs, am ersten Tag die Zahlen von 1 – 10 zu schreiben ohne hinzuschauen. Lassen wir den Hundehalter also im übertragenen Sinn zuerst „mit dem kleinen Finger der linken Hand einige Male die 1 tippen“, d. h. er soll seinen Hund nur zwei Schritte mit sich locken, während er selbst rückwärts geht.
Helfen Sie dem Hundehalter zunächst einmal sich klar zu machen, was zwei Schritte sind. Das hört sich jetzt vielleicht banal an, aber die meisten Menschen sind bei dieser Übung so sehr auf den Hund konzentriert, dass sie die Anzahl der Schritte gar nicht beachten. Natürlich kommt es auch uns nicht exakt auf die Anzahl der Schritte an, sondern darauf, dass der Hund schon für seine ersten Schritte umgehend belohnt wird. Und genau das versäumen die Menschen anfangs, weil sie ganz unbewusst zu viele Schritte machen. Lassen Sie Ihre Teilnehmer deswegen vor der eigentlichen Übung – ohne den Hund zu locken – ganz bewusst zwei Schritte rückwärts gehen. Dann ist das später kein Problem mehr.
Danach soll der Hundehalter ein Stück Wurst oder etwas ähnlich Leckeres in die Hand nehmen, den Hund damit aufmerksam machen und exakt zwei Schritte mitlocken. Das Stück Wurst bekommt der Hund genau in dem Moment, wenn er aufmerksam mitkommt.
Hier kommen wir schon in unseren zweiten Lernschritt, was sich aber nicht ganz vermeiden lässt. Das Ganze soll der Hundehalter nun einige Male wiederholen. Das bedeutet, die Strecke, die der Hund mitgelockt wird, wird langsam gesteigert. Die ersten Male können Sie als Hundetrainer den Zeitpunkt der Belohnung vorgeben. Erklären Sie dabei, dass es wichtig ist, den Hund immer zu belohnen, bevor er wegschaut. Erklären Sie warum und machen Sie es ggf. auch vor. Dann soll der Hundehalter es alleine üben.
Denken Sie daran, den Hundehalter auch entsprechend dafür zu loben!
Die Drehung: Der nächste Lernschritt wird ohne Hunde durchgeführt, denn das lockert das Training auf, bringt dem Hundehalter wieder einen Teilaspekt der Gesamtübung in einem kleinen Lernschritt bei und erspart dem Hund Verwirrung. Das Vortraining ohne Hund ist einfach umzusetzen und macht auch viel Spaß.
Ohne Hund: Es sollen sich immer zwei Teilnehmer zusammentun. Einer ist der Mensch, der andere spielt den Hund. Der „zweibeinige Hund“ wird dann von seinem „Halter“ mitgelockt. Er kommt auch schön mit und macht nicht etwa irgendwelche Schwierigkeiten. Der „Halter“ konzentriert sich jetzt nur auf seine Drehung, die er machen muss, um an die rechte Seite seines „Hundes“ zu gelangen. Der „Hund“ soll dabei geradeaus weitergehen. Der „Halter“ dreht sich so, dass er sich während der Drehung dem „Hund“ zuwendet und noch etwas weiter, bis er parallel rechts neben dem „Hund“ herauskommt. Schon ist der „Hund“ in der „Bei Fuß“-Stellung. Dieser Bewegungsablauf ist mit Worten schwierig zu beschreiben und eben auch entsprechend schwierig zu verstehen. Hat das aber jeder einmal gesehen und selber ausprobiert, gibt es keinerlei Probleme mehr. Die Rollen werden getauscht. Wenn sie dann ihren Hund dazunehmen, beherrschen sie die Übung schon.
Einige wenige Menschen haben trotzdem Schwierigkeiten diese Übung umzusetzen, selbst wenn sie sie mehrere Male gesehen haben. Für die betroffenen Teilnehmer kann es dann hilfreich sein, wenn sie einmal durch diese Drehung geführt werden. Denken Sie daran, zuerst nachzufragen, ob Sie denjenigen z. B. an den Schultern anfassen dürfen. Drehen Sie sich dann gemeinsam in der Übung. Spätestens dann „fällt der Groschen“ und dieser Mensch kann anschließend diese Übung mit seinem Hund erfolgreich ausführen. Denken Sie auch hier wieder daran, Ihre Teilnehmer für die Umsetzung dieser Übung gebührend zu loben.
Wenn der Mensch rückwärtslaufend startet und der Hund ihm an einem Lockmittel schnüffelnd folgt, kann durch eine halbe Drehung um die eigene Achse leicht das Laufen in der Fuß-Position erarbeitet werden.
Mit Hund: Um das Training für den Hund möglichst erfolgreich zu gestalten, sollte der Hund nach der Drehung bereits für den ersten Schritt in der richtigen „Bei Fuß“-Position belohnt werden. Lassen Sie hierzu Ihre Teilnehmer zunächst einmal ganz bewusst einen Schritt machen. Denn genau wie beim Rückwärtslaufen kann es auch hier passieren, dass die meisten Hundebesitzer direkt fünf oder mehr Schritte gehen. Dies hat den Nachteil, dass der Hund bis dahin oftmals schon längst weggeguckt hat. Dass Wegschauen überhaupt möglich ist, sollte er aber im Idealfall erst gar nicht lernen!
Im nächsten Zwischenschritt wird die Anzahl der Schritte mit dem Hund in der richtigen Position mehr und mehr gesteigert. Wieder können Sie als Hundetrainer zunächst dem Menschen den richtigen Zeitpunkt vorgeben, bevor er ihn dann nach einigen Durchgängen selber erfolgreich bestimmen kann.
Ein gemeinsames Spiel macht Hund und Mensch gleichermaßen Spaß.
Positiv bestärken
Wir verstärken das gewünschte Verhalten positiv, damit der Hund es immer wieder zeigt. Belohnen üben: Obwohl wir diesen Schritt ja schon teilweise in den ersten Schritt einfließen lassen mussten, wird er jetzt noch einmal ausführlich behandelt. Das hat den Vorteil, dass der Hundehalter nicht zu schnell zu viele Schritte mit seinem Hund in der „Bei Fuß“-Position gehen kann, denn auch beim Hund müssen sich die Übungsabläufe erst festigen. Bevor man die Hundehalter also immer wieder ermahnt, dass sie nicht zu weit gehen sollen, konzentriert man sie besser auf etwas anderes. Dieses Prinzip kennen Sie auch schon aus dem Hundetraining: Man kann ein unerwünschtes Verhalten verringern, indem man ein alternatives Verhalten positiv verstärkt. Dasselbe gilt hier auch für den Menschen.
Konzentrieren wir uns also für einige Trainingsschritte nur auf die positive Verstärkung des Hundes. Wichtig ist hierbei das Timing. Das Timing der Belohnung wurde zwar schon im ersten Schritt mitgeübt, es kann aber gar nicht oft genug wiederholt werden. Denken Sie wieder daran, auch die Hundehalter ganz präzise für ihr gutes Timing zu belohnen!
Beispiel
Wir hatten einmal ein Seminar bei einem englischen Chefhundeführer von der Polizei. Dieser Bär von einem Mann quietschte mit den Hunden in den höchsten Tönen, dass jeder von ihnen verrückt danach war, mit ihm zu arbeiten. Das war beeindruckend und auch ein schönes Beispiel für die Männer in der Gruppe. Leider können wir dies den Männern bei uns immer nur erzählen und nicht so schön vormachen, weil wir eben nicht so große stattliche Männer sind …
Helfen Sie dem Hundehalter dann bei der Einschätzung, ob die für den Hund gedachte Belohnung auch wirklich eine Belohnung ist. Dabei ist es sinnvoll, den Hundehalter z. B. zu fragen: „Sieh dir mal deinen Hund an! Hast du das Gefühl, dass er sich wirklich belohnt fühlt?“ Sollte der Hundehalter es noch nicht erkennen, können Sie ihm helfen mit „Achte auf seinen Blick, seine Ohren, seinen Schwanz. Was würde er wohl jetzt im Moment sagen, wenn er sprechen könnte?“ Die allermeisten Leute haben eigentlich ein sehr gutes Gefühl für ihre Hunde, wenn Sie ihn sich bewusst ansehen.
Zeigen Sie den Hundehaltern die verschiedenen Möglichkeiten der Belohnung und üben Sie diese. Bringen Sie die Hundehalter Schritt für Schritt dazu, z. B. im Spiel mal richtig aus sich herauszugehen. Auch das fällt den meisten gar nicht so leicht.
Oft bleibt uns als Hundetrainer nichts anderes übrig, als die Menschen in kleinen Schritten dahin zu formen, dass sie bei der Belohnung der Hunde mehr aus sich herausgehen.
Signal einführen
Sobald der Hund das Verhalten zuverlässig zeigt, führen wir ein Signal ein.
Wenige Worte: Den meisten Menschen fällt es sehr schwer, das Kommando so lange zurückzuhalten. Da für uns Menschen die Sprache das wichtigste Kommunikationsmittel ist, tendiert man dazu, dem Hund über Sprache das zu erklären, was man von ihm will. In Wirklichkeit verwirrt das den Hund jedoch nur.
Am besten machen Sie den Hundehaltern die Problematik mit einem Beispiel deutlich. So sollen diese sich z. B. vorstellen, sie hätten die Aufgabe, einem Chinesen, der kein Wort deutsch versteht, das Wort „Kaffee“ zu erklären. Wenn sie dafür nur eine leere Tasse als Hilfsmittel haben, könnten sie natürlich erklären, dass darin oft Kaffee ist. Der Chinese, der aber kein Wort Deutsch versteht, wird vielleicht sogar das Wort Kaffee hören, was es bedeutet, weiß er jedoch nicht. Verknüpft er es mit „Tasse“ oder auch mit „Tee“, wir wissen es nicht. Besser ist es, wir haben wirklich Kaffee da, vielleicht sogar in verschiedenen Ausführungen, d. h. in der Tasse, in einer Kanne, vielleicht im Päckchen gemahlen und als ganze Bohnen. Damit können wir ihm leicht die Vokabel „Kaffee“ beibringen. So ähnlich geht es auch mit dem Hund: Erst wenn wir das Verhalten etabliert haben, können wir ihm die dazugehörende Vokabel beibringen.
Aber auch hier ist wieder das Timing von entscheidender Bedeutung. Haben Sie zunächst mit den Hundehaltern ein Handzeichen trainiert, z. B. die an seiner linken Hüfte flach aufliegende Hand, muss er jetzt lernen: Erst das Wort, dann das Handzeichen einzusetzen. Für die meisten Menschen eine echte Herausforderung!
Tipp
Manchmal ist es ganz hilfreich, die Hundehalter einmal bei der Belohnung zu filmen. Dann können sie erstens mit mehr Ruhe und Abstand ihren Hund betrachten und sehen mehr als genau in dem Augenblick, in dem sie mit dem Hund selbst aktiv zu tun haben. Zweitens können sie sich selbst beobachten, ob sie denn wirklich für den Hund mitreißend und belohnend wirken oder nicht. Das Filmen ist jedoch nur für ganz hartnäckige Fälle empfehlenswert. Denn der Nachteil ist, dass beim Filmen Fehler oder Misserfolge so deutlich festgehalten werden, dass es für ein zügiges erfolgreiches Vorwärtskommen in den meisten Fällen eher hinderlich ist.
Außer der theoretischen Erklärung, warum das so sein muss, ist es ganz wichtig, dass Sie diesen Vorgang – am besten zunächst auch wieder ohne Hund – einige Male mit den Menschen üben. Dann gibt es später im Training mit dem Hund am schnellsten Erfolgserlebnisse.
Ablenkung einbinden
Wir trainieren unter immer stärkerer Ablenkung. Für diesen Trainingsschritt ist es wichtig, den Hundehaltern deutlich zu machen, dass es nicht dasselbe ist, ob ein Hund ein Verhalten zuhause ohne Ablenkung ausführt oder z. B. draußen in der Fußgängerzone unter sehr hoher Ablenkung. Das kann man schön dadurch erklären, dass man einem Kind, das im ersten Schuljahr das Rechnen lernt, noch nicht eine Aufgabe aus der Integralrechnung stellt. Denn obwohl es eine Idee von den ersten Rechenaufgaben hat, ist es bis zum Rechnen von anspruchsvolleren Aufgaben noch ein langer Weg. Bis dahin muss es noch viele Schuljahre durchlaufen. Genauso ist es mit dem Training unter Ablenkung.
Wichtig beim Training: das richtige Timing.
Sehr sinnvoll ist es, schon auf dem Trainingsplatz allmählich steigende Ablenkung einzubauen, damit die Hundehalter ein Gefühl dafür bekommen, was damit genau gemeint ist und wie sie damit umgehen sollen. Hier ist vor allem Ihre Fantasie als Hundetrainer gefragt!
Umstellung auf variable Belohnung
Der Hund bekommt nicht mehr für jedes gewünschte Verhalten eine Belohnung. Die variable Belohnung ist eine der schwierigsten Dinge in der Ausbildung von Hunden und eine Fähigkeit, die wirklich erlernt werden muss. Wir Menschen neigen nun mal dazu, immer in bestimmte Schemata zu verfallen.
Hinzu kommt, dass wir selbst sehr lange dafür „belohnt“ werden, wenn wir immer mit einer Belohnung mit dem Hund arbeiten. Solange wir das Leckerchen in der Hand haben, macht der Hund alles sehr gut. Verhalten, das sich lohnt, wird wieder gezeigt. Das gilt eben auch für uns Menschen. Aus diesem Grund müssen wir uns hier immer wieder mit unserem Verstand ermahnen, einen weiteren Schritt in der Ausbildung zu machen.
Generalisierungsübungen (hier Fuß-Laufen ohne Blickkontakt zum Hund) sind wichtige Trainingsinhalte.
Helfen Sie den Hundehaltern, indem Sie die Übungen so gestalten, dass die Menschen trotz der Umstellung immer noch Erfolg haben. Erklären Sie, dass sie bei der Umstellung zunächst kleinere Schritte belohnen sollten und nicht gleich so viel erwarten sollten, wie mit dem Leckerchen in der Hand.
Eine gute Vorübung für das variable Belohnen sind gängige Generalisierungsmaßnahmen (siehe S. 154, Training):
Kann der Hund auch „bei Fuß“ gehen, wenn der Hundehalter seine Arme seitlich ausstreckt?
Kann er „bei Fuß“ gehen, wenn der Hundehalter in den Himmel guckt?
Kann er „bei Fuß“ gehen, wenn verschiedene Winkel eingebaut werden?
Kann er in verschiedenen Geschwindigkeiten „bei Fuß“ gehen?
Kann er unter unterschiedlicher Ablenkung „bei Fuß“ gehen?
Gestaltet man die Übung auf diese Weise immer wieder abwechslungsreich, fördert das zum einen die Motivation des Hundes und zum anderen bekommt der Mensch ein Gefühl für das Variable.
Erst im nächsten Schritt soll der Tierhalter dann wirklich versuchen, seinen Hund variabel zu belohnen. Ziel ist es, dass im Durchschnitt nur etwa jedes dritte Verhalten belohnt wird. Erklären Sie wieder gut, was d. h., und helfen Sie den Hundehaltern während der ersten Durchgänge, bis alle das Prinzip verstanden haben.
Vielleicht denken Sie nach dieser ausführlichen Abhandlung der einzelnen Lernschritte jetzt: Das ist mir viel zu umständlich, ich mache es lieber anders. Nur zu, denn Kreativität hat noch nie geschadet! Bedenken Sie aber, dass die Ausführungen der letzten Seiten prinzipiell für den Aufbau jeder Übung gelten, denn an den lerntheoretischen Gesetzen kann man sich nicht vorbei mogeln. Die Übungsbeispiele waren zufällig gewählt, jedoch haben sie in vielen Jahren Hundetraining, auf etlichen Seminaren bei den meisten Hundehaltern zu schnellen Erfolgen geführt. Probieren Sie es aus!
Schrittchen für Schrittchen
Machen Sie sich bewusst, dass es für alle Übungen wichtig ist, sie nicht nur für den Hund, sondern auch für den Hundehalter in viele kleine Schritte zu zerlegen. Versteht ein Hundehalter eine Übung einfach nicht, wurden häufig die Trainingsschritte für ihn selbst nicht klein genug gewählt und es wurde zu viel auf einmal von ihm erwartet.
Richtig belohnen und korrigieren
Im vorigen Kapitel wurde bereits berichtet, wie wichtig es ist, auch den Menschen zu belohnen, wenn er etwas richtig ausführt.
Wirkungsvoller Einsatz von Belohnungen
Genauso wie der Hundehalter sich Gedanken über das richtige Belohnen seines Hundes machen sollte, sollten Sie sich Gedanken über das Belohnen des Hundehalters machen. Denn auch hier gilt, dass noch lange nicht jede vermeintliche Belohnung wirklich ein positiver Verstärker für ein bestimmtes Verhalten ist. Worauf kommt es also an?
Genauigkeit: Die Belohnung sollte sich präzise auf ein bestimmtes Verhalten beziehen. Schulen Sie sich darin, ganz präzise zu loben. Es ist oftmals viel hilfreicher für den Hundehalter, wenn Sie z. B. sagen: „Dein Timing war gerade sehr gut“, als einfach nur „Das sah alles ganz gut aus.“ Da Sie dem Hundehalter im Training mit dem Hund einen Schritt nach dem anderen vermitteln, sollten Sie sich auch beim Belohnen auf einzelne Aspekte beschränken. Dann weiß der Hundehalter genau, was gemeint war und kann es sich so einprägen.
Timing: Die Belohnung sollte sich zeitlich direkt auf eine bestimmte Leistung beziehen.
Durch unsere Sprache sind wir in Bezug auf den Menschen nicht ganz so sehr an die einzelne Sekunde gebunden, wie bei der Ausbildung der Hunde. „Gerade war dein Timing sehr gut,“ reicht also als Lob für den Hundehalter in aller Regel aus, auch wenn es fünf Sekunden später kommt, weil Sie erst abwarten, bis der Hundehalter seinen Hund belohnt hat. Ein Markersignal (wie der Clicker) beschleunigt jedoch auch beim Menschen das Lernen. Das könnte ein „Ja!“ sein, genau in dem Moment, wenn er etwas gut macht. Nachher kommt dann die genaue Erklärung, was gut war. Nicht umhin kommt man aber, das Training für den Menschen durchaus in möglichst kleine Schritte zu unterteilen und jeweils Einzelleistungen präzise anzuloben. Eine zu lange Zeitverzögerung zwischen der Handlung und dem Lob ist genau wie beim Hund auch beim Menschen nicht sinnvoll. Sie wissen selber: Manche Sachen vergisst man schon nach wenigen Sekunden oder nimmt sie erst gar nicht wirklich wahr. Ein Lob mit schlechtem Timing fördert aber immer noch eine gute Lernatmosphäre. Es ist also nicht ganz vergeudet. Einen positiven Lerneffekt beim Schüler Mensch hat es jedoch nicht mehr.
Clicker-Training beim Menschen
In verschiedenen Studien am Menschen wurde auch hier der ungeheure Nutzen des Clickers beim Lernen nachgewiesen. Eine Studie befasste sich mit Jugendlichen im Sportunterricht beim Lernen einer Anzahl von Übungen, wie Handstand, Rad, Flickflack, Salto usw. Es gab drei unterschiedliche Gruppen. Bei zwei Gruppen wurde jeweils die Hälfte der Übungen mit Clicker trainiert und die anderen ohne. Diese beiden Gruppen unterschieden sich jedoch darin, dass jeweils die anderen Übungen mit bzw. ohne Clicker trainiert wurden. In einer dritten Gruppe wurden alle Übungen ohne Clicker trainiert. Interessanterweise lernten alle Jugendlichen, die mit Clicker trainiert wurden, die Übungen deutlich schneller.
Es ist wichtig, auch den Hundehalter genau dann zu loben, wenn alles gut klappt.
Die genauen Gründe, warum das so ist, können noch nicht im Detail genannt werden. Sicher liegt es zum Teil an den kleinen Trainingsschritten. So werden die Turnerinnen auf jedes kleine Detail aufmerksam, was zu einer erfolgreichen Übung gehört. Auf der anderen Seite lernt der Körper quasi mit, wenn er im richtigen Moment den Click hört und das mit einer entsprechenden Haltung verknüpft wird. Denn genau das Spannungsgefühl der Muskulatur in Worte zu fassen ist schwierig, aber der Mensch verknüpft natürlich auch dies.
Vom Körpergefühl her gesehen sind die Anforderungen, die im Training an den Hundehalter gestellt werden nicht so anspruchsvoll, wie die Turnübungen in der Untersuchung. Daher kann man es sich im Hundetraining sparen, den Menschen zu clickern. Dieses Beispiel sollte nur zeigen, dass ein Markersignal ein exaktes Timing der Belohnung ermöglicht und daher auch für den Einsatz beim Menschen sehr sinnvoll ist.
In den USA ist das Clicker-Training für Menschen unter dem Namen TAG-Teach (Training with Acustical Guidance) bekannt und entwickelt sich in vielen Bereichen rasant.
Ehrlichkeit: Die Belohnung sollte ehrlich gemeint sein. Wenn Sie Ihren Hundehaltern zu viel „Honig um den Bart schmieren“, besteht die Gefahr, dass der jeweilige Mensch das nicht so ernst nimmt, weil es ihm überzogen und nicht ehrlich vorkommt. Vielleicht meinen Sie es ja auch nicht ehrlich, sondern denken sich insgeheim: „Dieser Trottel, der lernt es ja doch nie!“
Üben Sie sich darin, wirklich nur ehrlich gemeintes Lob zu verteilen. Irgendetwas findet man immer, was man ehrlich belohnen kann. Nehmen Sie auch beim Menschen kleinste Fortschritte wahr, nicht nur beim Hund. Es lohnt sich wirklich, das zu üben. Versuchen Sie außerdem Begeisterung in Ihr Lob einzubauen, von dem sich die Hundehalter anstecken und motivieren lassen. Letztendlich bringt das sowohl dem Hundehalter als auch Ihnen den Erfolg, der für motiviertes Arbeiten nötig ist. Außerdem werden Sie feststellen, dass das „Training der Menschen“ immer mehr Spaß macht: Wenn Sie immer mehr Fortschritte bei den Trainingsteilnehmern sehen, können Sie wirklich ehrlich loben und das wiederum motiviert alle Beteiligten, diesen Weg weiter zu verfolgen.
Gerecht verteilt: Achten Sie darauf, alle Kursteilnehmer zu loben. Wenn nur ein Teilnehmer gelobt wird, weil er eine Aufgabe besonders gut gemacht hat, ist das fast so schlimm, wie wenn man einen Einzelnen vorführt, der seine Aufgabe schlecht umgesetzt hat! Im Klartext heißt das, dass sich alle anderen Teilnehmer schlecht fühlen, wenn stets nur der Beste gelobt wird. Das sollte man vermeiden. Denken Sie immer wieder daran, dass sich auch für den Menschen, dem die Übungen schwer fallen, ganz sicher eine Lob-Gelegenheit ergibt, wenn das Training in kleinen Schritten aufgebaut ist.
Eine Belohnung zum Mitnehmen: Menschen lieben Belohnungen genau wie die Hunde. Und wenn sie dann noch etwas sozusagen Schwarz auf Weiß besitzen, ist das umso motivierender. Dazu ein Beispiel: Es gibt die Möglichkeit, den Kunden ein „Könnenblatt“ auszugeben, an dem sie während des Kurses arbeiten. Darauf stehen die einzelnen Aufgaben, wie „Der Hund zeigt fünfmal hintereinander „Sitz“ auf Sichtzeichen“ oder „Der Hund bleibt zwei Minuten sitzen, wenn der Besitzer dreißig Meter entfernt ist“ oder auch – mit Schwerpunkt auf das menschliche Können – „Der Mensch kann clickern, ohne eine weitere Bewegung auszuführen“ usw. Der Fantasie und den Anforderungen an Hund und Mensch sind dabei keine Grenzen gesetzt. Hat ein Hundehalter nun eine bestimmte Aufgabe gelöst, wird das auf dem Könnenblatt notiert – z. B. in Form eines Knochenstempels, eines Sternchenaufklebers, eines einfachen Häkchens oder wie auch immer. Es ist kaum zu glauben, wie motivierend das ist! Die Teilnehmer lieben es in der Regel ihre „Punkte“ zu sammeln. Ein schöner Nebeneffekt ist, dass so etwas auch sehr zur Kundenbindung betragen kann, weil der Ehrgeiz geweckt wird, noch weitere dokumentierte Belohnungen zu verdienen.
Sinnvoller Einsatz von Korrekturen
Genau wie einen Hund könnte man den dazugehörenden Menschen über positive Verstärkung ausbilden. Da wir Menschen aber nicht nur durch Erfahrungen (Versuch und Irrtum), sondern auch durch Erklärungen lernen können, kann der Trainingserfolg beschleunigt werden, wenn Korrekturen sinnvoll eingesetzt werden.
Korrigieren heißt aber nicht, althergebrachte Methoden umzusetzen, bei denen die Lerntheorien ignoriert werden und der Hundetrainer auf dem Hundeplatz mit einem Megaphon in der Hand die Teilnehmer anbrüllt: „Was machst du denn da? Ich hab doch gesagt, ihr sollt die Leine in die rechte Hand nehmen! Leine stramm! Merkst du nicht, was du da für einen Scheiß machst? Guck mal, wie du schon wieder daher schleichst. Wie soll der Hund da ordentlich mit dir gehen?“, etc.
Dass solch ein angebrüllter Hundehalter daher schleicht, ist dann eigentlich nicht verwunderlich. Wundern könnte man sich darüber, dass immer noch einige Menschen für eine solche Behandlung freiwillig Geld bezahlen! Aus der modernen Forschung wissen wir aber längst, dass das Erleben von Stress das Lernen blockiert (s. Seite 230). Es geht viel besser mit den nachfolgend beschriebenen Techniken! Nutzen Sie das! Einsatz der „Sandwich-Regel“: Die Sandwich-Regel ist bei der Arbeit mit Menschen so etwas wie die hohe Kunst der Korrektur, denn obwohl Sie den Trainingsteilnehmer korrigiert haben, wird er gleichzeitig motiviert! Die Sandwich-Regel besagt: Zuerst ein Lob, dann die Korrektur und schließlich noch einmal ein Lob! Beispiel: „Sehr schön, du hältst die Leine jetzt sehr ruhig in deiner linken Hand. Du könntest sie noch ein klein wenig nachgeben, damit sie wirklich durchhängt. Deine Körperhaltung ist schon sehr schön gerade“. Auf diese Art und Weise wirkt eine Korrektur nicht einschüchternd. Der Tierhalter weiß, es sieht eigentlich schon ganz gut aus, aber mit einer Kleinigkeit an Veränderung ginge es noch besser. Wahrscheinlich wird er Ihre Korrektur direkt umsetzen können und dadurch wieder ein motivierendes Erfolgserlebnis bekommen.
Der Weg der Einzelschritte: Auch bei der Korrektur ist es wichtig, den Weg der einzelnen Lernschritte zu gehen. Verlangen Sie pro Korrektur stets nur eine Veränderung, denn für den Tierhalter ist es einfacher, sich auf ein einzelnes Detail zu konzentrieren. Sobald er in diesem Detail Sicherheit gewonnen und seine Fähigkeiten ausgebaut hat, können Sie sich ein weiteres Detail vornehmen, das noch verbessert werden kann. Beispiel: „Versuch nach vorne zu gucken, während du läufst. Ich sage dir, wann dein Hund eine schöne Leistung zeigt, die du belohnen kannst.“ Mit dieser Korrektur machen Sie dem Tierhalter eine Angabe, was er verbessern kann. Gleichzeitig nehmen Sie ihm die Sorge, dass irgendetwas schief läuft, denn Sie haben ihm versprochen, auf ihn und seinen Hund genau zu achten. Anders sähe eine Flut an Verbesserungsvorschlägen aus, da dies den Tierhalter überfordert, etwa: „Guck beim Laufen nach vorne, lass die Leine lockerer, bleib aufrecht, geh etwas schneller.“
Erzeugung von Bildern: Versuchen Sie eine Korrektur nach Möglichkeit direkt in Form eines Verbesserungsvorschlags zu formulieren. Dann kann der Tierhalter sofort handeln. „Du könntest es so und so machen“ ist leichter umzusetzen als die reine Fehlerangabe „Das ist falsch.“ In dem oben angesprochenen Beispiel könnte der Tierhalter ggf. mit der Aussage „Die Leine ist zu kurz“ weniger anfangen. Versuchen Sie mit Ihrer Korrektur also immer schon das Bild vom richtigen Verhalten mitzuliefern. Arbeiten Sie möglichst nicht mit Verneinungen. „Du musst mit deinem Hund nicht herumbrüllen“, sagt dem Hundehalter nämlich eigentlich noch nicht, was er stattdessen machen soll. Die Korrektur „Rede leiser mit deinem Hund. Er hat ein viel besseres Gehör als wir“ enthält viel präzisere Anweisungen. Das Wörtchen „nicht“ ist für unser Gehirn eigentlich etwas sehr abstraktes. Ein kleines Beispiel: Wenn es heißt, Sie sollen jetzt bitte nicht an einen blauen Elefanten denken, haben Sie natürlich einen blauen Elefanten im Kopf! Sorgen Sie dafür, dass die Hundehalter, mit denen Sie arbeiten, immer die richtigen Bilder im Kopf haben. Denn daran können Sie sich orientieren und mit ihnen lernen.
Freundlichkeit und Höflichkeit: Tragen Sie die erforderliche Korrektur stets freundlich und in höflichen Worten vor, um eine entspannte Arbeitsatmosphäre zu schaffen bzw. zu erhalten. Es ist von unschlagbarem Wert, wenn sich der Hundehalter bei Ihnen wohlfühlen und entspannt das umsetzen kann, was Sie von ihm verlangen.
Wie Lernen funktioniert
Die Erkenntnisse der Neurophysiologie helfen uns zu verstehen, wie das Lernen funktioniert. Aus den wissenschaftlichen Laboren kommen immer mehr Hinweise darüber, wie Lernen die Struktur des Gehirnes verändert. Im Hundetraining gilt es, alle diese Erkenntnisse erfolgreich umzusetzen und so für einen schnelleren und stressfreieren Trainingserfolg zu nutzen.
Vorhandenes Wissen integrieren
Niemand kommt zu uns mit einem noch „jungfräulichen“ Gehirn, das nur darauf wartet, mit Wissen gefüllt zu werden. Vielmehr hat jeder unserer Kunden eine umfangreiche Vorgeschichte und verfügt über einiges an Wissen, bestimmte Fähigkeiten und Konzepte, die bestimmen, was für ihn in seiner Umgebung wichtig ist und wie er das letztendlich wahrnimmt und verarbeitet. Neues Wissen wird also mit vorhandenem verglichen und dementsprechend verarbeitet und gespeichert.
Ein Hundetrainer sollte sich darüber informieren, was seine Hundehalter für Wissen oder Meinungen über Hundeausbildung haben. Er sollte Wissenslücken genauso erkennen wie falsche Annahmen, die im Hundetraining weit verbreitet sind. Auf diesen Ansichten muss im Training aufgebaut werden. Wird das alles einfach ignoriert, kann das, was die Leute letztendlich lernen, sich erheblich von dem unterscheiden, was der Hundetrainer vermitteln möchte.
In seiner Fabel „Ein Fisch ist ein Fisch“ beschreibt der amerikanische Autor Lionni einen Fisch, der sehr gerne wissen möchte, wie es an Land aussieht. Leider kann er sich das nicht ansehen, weil er das Wasser nicht verlassen kann. Er gewinnt eine Kaulquappe zum Freund. Als diese später als Frosch das Wasser verlässt, bittet der Fisch den Frosch, ihm zu erzählen, was es an Land zu sehen gibt. Einige Zeit später kommt der Frosch also ins Wasser zurück und erzählt von allen möglichen Dingen wie Vögeln, Menschen und Kühen. In dem Buch werden dann Bilder gezeigt, wie der Fisch sich das alles vorstellt aus dem, was der Frosch ihm erzählt hat. Alle diese Wesen sehen prinzipiell wie Fische aus, die nach der Beschreibung des Frosches leicht verändert sind. So gehen die Menschen aufrecht auf ihren Schwanzflossen, Kühe sind Fische mit Euter und Vögel sind Fische mit Flügeln.
Diese Fabel zeigt schön, wie das Verarbeiten von neuen Informationen Chancen für sehr viel Kreativität bietet, aber auch, wie die Information sehr verzerrt oder „falsch“ verarbeitet wird.
Vielleicht sagen Sie jetzt: „Das ist ja nur eine Fabel!“ Gut, dann hier ein wissenschaftlich untersuchtes Beispiel aus unserer Wirklichkeit: Zwei Wissenschaftler machten einen Versuch mit Kindern, die annahmen, die Erde sei eine Scheibe. Diesen Kindern wurde also erzählt, dass die Erde eine Kugel ist. Anschließend sollten sie ein Bild von der Erde zeichnen. Heraus kam bei den meisten der Kinder eine Erde in der Form eines Pfannkuchens, also schon leicht gewölbt, aber doch noch sehr flach. Das Konzept der Kugel hat nicht in das Weltbild der Kinder hineingepasst. Auf einer Kugel kann man schließlich nicht so gut stehen usw.
Aufbauend
Wir müssen die Vorstellungen und Ansichten der Hundehalter im Training aufgreifen und darauf aufbauen, wenn wir wollen, dass die Hundehalter das annehmen, was wir ihnen beibringen wollen.
Beispiel aus dem Trainingsbereich: Sehr viele Menschen kommen mit der Vorstellung ins Training, der Hund müsse ihnen zuliebe alles tun, was sie von ihm verlangen. Aus dieser Vorstellung heraus ist der Einsatz von Belohnungen völlig unnötig. Wenn wir als Hundetrainer darauf nicht eingehen, werden wir wahrscheinlich Leute im Training haben, die sich das Ganze eine Weile ansehen und irgendwann nicht mehr kommen, weil sie es albern finden, Belohnungen einzusetzen.
Bei denen, die solch ein Thema offen ansprechen, ist es leicht darauf einzugehen. Aber manche Menschen tun das aus unterschiedlichen Gründen nicht. Sie bleiben einfach weg und stellen insgeheim unsere Fachkompetenz in Frage.
Sie sehen also, wie wichtig es ist, den Hundehaltern auch den theoretischen Hintergrund näher zu bringen und ihnen zu erklären, dass nur dann ein Verhalten öfter gezeigt wird, wenn es sich für den Hund lohnt.
Kundengerecht erklären
Theorie alleine reicht aber nicht immer aus, um die Vorstellung mancher Menschen zu ändern. Eine schöne Möglichkeit, sie zum Nachdenken anzuregen, ist die Frage, ob sie denn auch nur dem Chef zuliebe