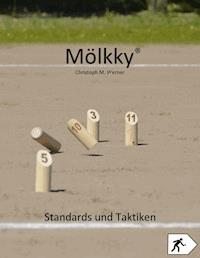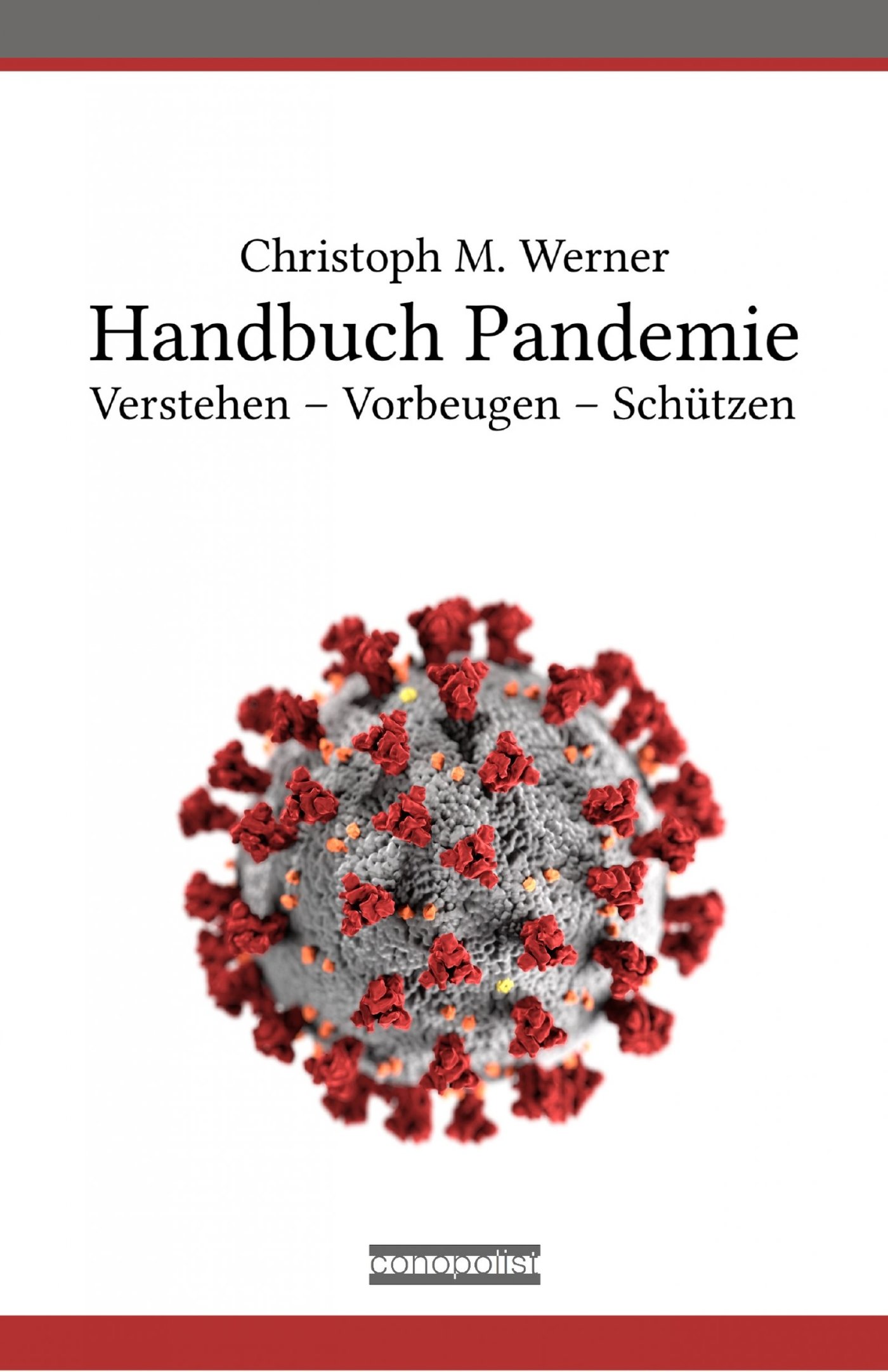
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
Infektionskrankheiten, Seuchen und Epidemien begleiten die Menschheit seit ihrer Entstehung. Dank der Entwicklung effektiver Antibiotika sind bakterielle Erkrankungen heutzutage in der Regel gut zu behandeln. Viren dagegen stellen weiterhin eine Herausforderung für die Medizin dar. In geschichtlich betrachtet regelmäßig auftretenden Abständen schaffen es einzelne Erreger, weltweit pandemische Verbreitung zu erlangen und die Weltbevölkerung in teils erheblichem Maße zu dezimieren. Das seit November 2019 entdeckte und bis April 2020 weltweit verbreitete neuartige Coronavirus (SARS-CoV-2) zeigt deutlich, dass auch die heutige Welt nicht vor umfassenden Pandemien gefeit ist. Das Buch vermittelt einen einfachen und verständlichen Einstieg in die Materie und bietet neben geschichtlichen Rückblicken auch zahlreiche Tipps, um sich im Fall der Fälle schützen zu können. Denn es ist nicht die Frage ob, sondern vielmehr wann die Menschheit von einer Pandemie globalen und schrecklichen Ausmaßes heimgesucht werden wird.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 84
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Christoph M. Werner
Handbuch Pandemie
Verstehen – Vorbeugen – Schützen
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
Begrifflichkeiten
Epidemie und Endemie
Pandemie
Herdenimmunität
Eradikation
Impfungen – aktive / passive
Die Entdeckung von Viren und Bakterien
Beispiele für Infektionskrankheiten
Kurze Geschichte der Pandemien
Pest
Pocken
Influenza
HIV
COVID-19
Vor Infektionskrankheiten schützen
Wie funktionieren Bakterien
Wie funktionieren Viren
Weitere Verursacher: Pilze, Parasiten und andere
Übertragungswege und Vorbeugung
Tröpfcheninfektion
Schmierinfektion
Über den Austausch von Körperflüssigkeiten
Infektion über blutsaugende Insekten
Übertragung durch Nahrungsmittelaufnahme
Szenarien:
Szenario 1: Epidemie
Szenario 2: Pandemie mit geringer Auswirkung
Szenario 3: Pandemie mit umfangreichen Auswirkungen
Szenario 4: Pandemie mit gesellschaftlichem Zusammenbruch
Bevorratung und Vorsorge
Die Bedeutung von Eindämmung und Verlangsamung
Gängige Mythen
Ausblick
Quellen
Einleitung
Infektionskrankheiten, Seuchen und Epidemien begleiten die Menschheit seit ihrer Entstehung und können die unterschiedlichsten Ausprägungen haben. Angefangen von den alljährlichen, in den meisten Fällen lediglich lästigen und im Grunde harmlosen Erkältungen bis hin zu bisher weitestgehend lokal auftretenden, dafür aber mit hohen Todesraten versehenen Krankheiten, wie beispielsweise Ebola.
Der menschliche Organismus ist prinzipiell gut auf den Befall durch Viren und Bakterien vorbereitet und hat im Laufe der Evolution effektive Mechanismen entwickelt, die unerwünschten Erreger zu eliminieren. Dank der Entwicklung effektiver Antibiotika – bereits 1893 wurden vom Italiener Bartolomeo Gosio die prinzipiellen Wirkungsweisen von Schimmelpilzen auf Milzbranderreger nachgewiesen – sind bakterielle Erkrankungen heutzutage in der Regel gut zu behandeln, auch wenn es hier durchaus negative Entwicklungen gibt, dazu jedoch mehr im Nachwort.
Viren dagegen stellen weiterhin eine Herausforderung für die Medizin dar. Denn auch wenn das Immunsystem des Menschen weiß, wie es mit diesem Erregertyp umzugehen hat, gibt es bei einer durch Viren verursachten Erkrankung darüber hinaus so gut wie keine1 direkten Maßnahmen, um den Patienten zu helfen. Einzig die Impfung kann als wirkungsvolle und proaktiv wirkende Maßnahme gegen Viren aufgeführt werden. Mit den Pocken wurde 1980 ein erster Virus faktisch ausgerottet: In freier Wildbahn wurde seitdem kein Pockenfall mehr bekannt. Lediglich in Forschungslaboren sind noch Bestände des Erregers vorhanden.
Aufgrund der hohen Wandelbarkeit sowie der generellen Vielfalt der Viren ist das Ausrottungsszenario der Pocken leider nicht ohne Weiteres auf andere Viren übertragbar und bei vielen verbreiteten Krankheiten gibt es auch heute noch keine umfassenden Wirkmechanismen. So rafft die Malaria weltweit jährlich um die 400.000 – 450.000 Menschen dahin2, die Influenza (gemeinhin als Grippe bezeichnet) führt jährlich zu zwischen 290.000 und 600.000 Toten3.
In geschichtlich betrachtet regelmäßig auftretenden Abständen schaffen es einzelne Erreger, weltweit pandemische Verbreitung zu erlangen und die Weltbevölkerung4 in teils erheblichem Maße zu dezimieren. Mehr dazu im folgenden Kapitel.
Die Menschheit hat sich seit 1960 – rund 3 Milliarden Menschen – mehr als verdoppelt (ca. 7,4 Milliarden 2016 und geschätzt um die 8,5 Milliarden bis 2030). Je mehr Menschen, desto mehr mögliche Wirte für Krankheitserreger und desto höher die Wahrscheinlichkeit des Entstehens neuartiger Mutationen. Dazu kommt, dass sich in der heutigen globalisieren Welt, mit einem hochgetakteten Reise- und Verkehrsverhalten, Infektionskrankheiten in einem atemberaubenden Tempo auf dem ganzen Planeten verbreiten können. Der Fall des im November 2019 in China identifizierten neuartigen Coronavirus hat deutlich gezeigt, wie schnell sich eine zuerst nur lokal auftretende Krankheit weltweit verbreiten kann. Bis April 2020 hat es das Virus weltweit verbreitet. War zu Beginn China der Hauptherd, so haben mehrere europäische Länder sowie und vor allem die USA China bei der Zahl der Infizierten und Toten weit überholt. Inwieweit sich das neuartige Coronavirus als nachhaltig wirkende Pandemie erweist, wird sich in den kommenden Wochen und Monaten zeigen.
Insgesamt ist es aber so oder so weniger die Frage ob, sondern vielmehr wann die Menschheit von einer Pandemie globalen und schrecklichen Ausmaßes heimgesucht werden wird. Ein solides Wissen um die Funktionsweise, die Verbreitungswege sowie die Vorbeugungsmaßnahmen von bzw. gegen Viren und andere Erreger sollte daher zum Grundwissen gehören und kann dazu beitragen, die Auswirkungen einer Pandemie zu dämpfen und das persönliche Risiko zu reduzieren.
Begrifflichkeiten
Epidemie und Endemie
Eine Epidemie – umgangssprachlich auch Seuche genannte – beschreibt eine lokal begrenzte, erhöhte Verbreitung einer Krankheit beim Menschen (in Abgrenzung zur Epizootie, also der Verbreitung bei Tieren).
Die Unterscheidung zwischen dem „normalen“ Auftreten von Krankheiten und einer Epidemie ergibt sich bei Infektionskrankheiten aus der Basisreproduktionszahl R0 (auch als Grundvermehrungsrate bezeichnet), die anzeigt, wie viele nicht immunisierte Menschen ein infizierter Mensch im Durchschnitt ansteckt.
Liegt R0 bei größer 1, so wird von einer Epidemie gesprochen, da in diesem Fall die Zahl der infizierten Menschen kontinuierlich steigen würde.
Bei einer Endemie liegt R0 genau bei 1, d. h. eine Krankheit tritt in einer Region kontinuierlich mit einem erhöhten, aber gleichartigen (abhängig von der Erkrankungsdauer) Niveau auf.
Um eine Infektionskrankheit erfolgreich zu stoppen, muss R0 auf unter 1 gesenkt werden, d. h. ein Infizierter steckt weniger als eine nicht infizierte Person an. Die Zahl der Erkrankten sinkt mit der Zeit.
Die Basisreproduktionszahl ist von Erreger zu Erreger teils massiv unterschiedlich. Nachfolgende Tabelle zeigt das Spektrum auf:
Krankheit
Übertragung
R0
Ebola5
Köperflüssigkeiten
1,7–2
Erkältung6
Tröpfcheninfektion, Schmierinfektion
2–3
HIV
Köperflüssigkeiten
2–5
Influenza7
Tröpfcheninfektion, Schmierinfektion
0,9–2,1
Masern8
Tröpfcheninfektion, direkter Kontakt
12–18
Mumps9
Tröpfcheninfektion, Schmierinfektion
10–12
Pocken10
Tröpfcheninfektion
3,5–6
Pandemie
Verbreitet sich eine bisher epidemisch auftretende Infektionskrankheit über Länder- und Kontinentalgrenzen hinweg, so wird von einer Pandemie gesprochen. Die Menschheit wurde und wird immer wieder von teils schweren Pandemien heimgesucht. In heutiger Zeit sind der medizinische Fortschritt, die zwischenstaatliche Zusammenarbeit – hervorgehoben soll hier vor allem die Arbeit der WHO (Weltgesundheitsorganisation) – sowie das generelle Wissen um die Wirkungsweise und die Verbreitungswege ein großes Plus im Kampf gegen Infektionskrankheiten. Die globalisierte Welt mit all Ihren Vernetzungen, insbesondere dem Flugverkehr, macht es den Erregern mitunter aber auch leicht, sich innerhalb kurzer Zeit faktisch weltweit zu verbreiten. Während es in der Antike und im Mittelalter mitunter Monate oder gar Jahre dauerte, bis sich eine Epidemie zur Pandemie auswuchs, so kann sich ein Erreger heute binnen weniger Wochen oder Monate auf der ganzen Welt verbreiten.
Ob eine Pandemie vorliegt, wird von der WHO definiert. Die Kriterien haben sich in den letzten Jahren mehrfach gewandelt. Inzwischen ist man von einem regionsbezogenen (mehr als 2 von 6 Weltregionen betroffen) hin zu einem weitestgehend qualitativen Ansatz gewechselt.
In jüngerer Geschichte waren es in erster Linie Influenza Pandemien (u. a. spanische Grippe), die die Menschheit heimgesucht haben.
Herdenimmunität
Die Herdenimmunität hat verschiedene, wenn auch im weitesten Sinne ähnliche Bedeutungen. Vereinfacht gesagt beschreibt sie Effekte, die Eintreten, wenn ein bestimmter Anteil der Bevölkerung gegen eine Infektionskrankheit immun ist. I. d. R. wird von einer Immunisierung durch Impfung ausgegangen, wobei Erstere theoretisch auch durch eine überstandene Krankheitswelle erreicht werden könnte.
Die Effekte sind von einer Vielzahl von Faktoren abhängig, u. a. der Immunisierungsrate, aber auch der Beschaffenheit des jeweiligen Erregers – wie lange ist ein Erkrankter infektiös? Wie lange hält die Immunität an? Wie mutationsfreudig ist der Erreger?
Generell schützt eine hohe Immunisierung der Bevölkerung nicht immunisierte Mitmenschen indirekt vor einer Ansteckung, da dadurch Infektionsketten unterbrochen werden können, d. h. der Krankheitserreger kommt gar nicht bzw. mit deutlich geringerer Wahrscheinlichkeit in die Nähe möglicher nicht immunisierter Wirte. Denn selbst beim Vorhandensein wirkungsvoller Impfstoffe kann medizinisch (z. B. bei verschiedenen Krebsarten oder bei einer HIV-Infektion) und/oder altersbedingt (Neugeborene) bedingt nicht jeder wirksam geimpft werden. Die „Herde“ – also die Bevölkerung – schützt durch einen hohen Grad an Immunisierung also ihre schwächeren Mitglieder.
Im Idealfall kann eine ausgeprägte Herdenimmunität dazu beitragen, eine Infektionskrankheit vollkommen auszurotten (vgl. Eradikation). Es wird hierbei je nach Infektionskrankheit von einer notwendigen Immunisierungsrate zwischen 75 % und 95 % der Bevölkerung ausgegangen11.
Eradikation
Die Eradikation beschreibt die faktische Ausrottung einer Infektionskrankheit, d. h. der Krankheitserreger kommt in der freien Wildbahn nicht mehr vor. In Forschungseinrichtungen wird der Erreger aber gegebenenfalls noch vorgehalten, begründet mit der Notwendigkeit, diesen als einzigen verfügbaren Test auf die Wirksamkeit eines Impfstoffes nutzen zu können. Bei den Menschen betreffenden Krankheiten wurden bisher lediglich die Pocken (1980) ausgerottet. Eingefrorene Bestände befinden sich aber noch im Forschungszentrum der US-Seuchenbehörde CDC in Atlanta sowie dem russisches Gegenstück Vector in Kolzowo. Die WHO ist bemüht weitere Krankheiten dauerhaft zu eliminieren, u. a. die Masern sowie Polio (Kinderlähmung), was bisher aber an nicht konsequent durchgesetzten Impfungen gescheitert ist. Bei den Masern u. a. auch in Deutschland. Bei der Onchozerkose (Flussblindheit) konnten in den letzten Jahrzehnten große Erfolge verzeichnet werden, sodass die durch parasitäre Fadenwürmer ausgelöste Krankheit als zumindest teilweise ausgerottet gilt.
Es sei auch darauf hingewiesen, dass es möglich ist, Viren im Labor „nachzubauen“ und auch ausgerottete Infektionskrankheiten wieder zum Leben zu erwecken12. Auch wenn der Aufwand und das Know-How hierfür hoch sind, wäre eine Nutzung dieser Möglichkeiten durch Bioterroristen kein völlig abwegiges Gedankenspiel. Unter diesem Blickwinkel mag das Vorhalten der eigentlich ausgerotteten Erreger in einem anderen Licht erscheinen.
Impfungen – aktive / passive
Impfungen können ein großer Hebel bei der Bekämpfung von Infektionskrankheiten sein. Verhindern sie doch mit hoher Wahrscheinlichkeit den Ausbruch einer Krankheit, in dem die geimpfte Person für einen bestimmten Zeitraum – abhängig vom Erreger und dem verwendeten Impfstoff zwischen einem Jahr (z. B. bei der Influenza) und ein Leben lang (z. B. mit hoher Wahrscheinlichkeit bei den Pocken), häufig zwischen 10–20 Jahren – immunisiert ist, d. h. das Immunsystem „kennt“ den Erreger und kann ihn dadurch schneller und besser bekämpfen und einen Ausbruch verhindern. Der gleiche Mechanismus würde auch bei einer „normal“ erworbenen Infektion greifen, nur, dass die dadurch verursachte Erkrankung erst durchgestanden werden muss, bevor eine Immunisierung eintritt.
Eine aktive Impfung betitelt, was gemeinhin unter „Impfung“ verstanden wird, also der Zufuhr von Lebend- oder Totimpfstoffen. Diese werden meistens injiziert, in wenigen Fällen auch oral eingenommen. Ein Lebendimpfstoff beinhaltet lediglich abgeschwächte Versionen des Erregers, ein Totimpfstoff nur Teile davon.
Bei einer passiven Impfung handelt es sich im Grunde nicht um eine Impfung an sich, da hier bei einer potenziell mit einem schwerwiegenden Erreger infizierten Person ohne akute Krankheitsanzeichen schlicht und einfach direkt Antikörper gegen diesen Erreger verabreicht werden. Diese werden jedoch schnell wieder abgebaut – immerhin handelt es sich ja im weitesten Sinn um Fremdkörper, die von einem anderen Menschen mit bereits gebildeten Antikörpern gewonnen werden –, sodass der dadurch erreichte Schutz nur wenige Wochen anhält. Die Gewinnung der Antikörper ist hierbei nicht trivial und auch zu Zufuhr von Material aus anderen Körpern ist ebenfalls mit Risiken verbunden. Dazu kommt, dass der erkrankte rechtzeitig merken muss, dass er sich infiziert hat. Daher wird diese Methode nur in Ausnahmefällen angewendet. Die Mutter-Kind-Immunisierung während der Schwangerschaft, stellt ebenfalls eine Form der passiven Impfung dar.