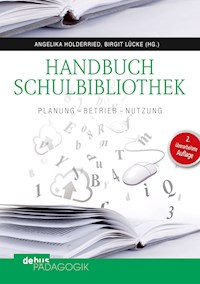
Handbuch Schulbibliothek E-Book
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Debus Pädagogik
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Selbstlernzentrum, Schulmediothek, Leseinsel oder Lernatelier – die Schulbibliothek hat viele Namen. Eines jedoch ist gewiss: Schulen brauchen heute einen Ort, an dem die Lese- und Medienkompetenz der Schüler gefördert wird. Bücher, E-Medien, Datenbanken – eine gut ausgestattete Bibliothek ist das Fundament für selbstorganisiertes Lernen. Wer eine Schulbibliothek aufbauen oder modernisieren möchte, kommt an diesem Handbuch nicht vorbei.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 332
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Cover
Titelblatt
Urheberrechte
Inhalt
Vorwort zur zweiten Auflage
Vorwort
1. Vom Nutzen der Schulbibliothek für die Schule und die Schüler
1.1 Was die Schulbibliothek alles kann
1.2 Warum Schulbibliothek? – ein Beispiel
1.3 Schulbibliothekskonzepte
1.4 Damit alle Bescheid wissen – das Leitbild der Schulbibliothek
1.5 Was die Schulbibliothek nicht kann – oder doch?
1.6 Was soll die Schulbibliothek an unserer Schule können?
2. Wo man gerne hingeht – die Schulbibliothek als Raum
2.1 Einleitung
2.2 Die Platzierung der Schulbibliothek
2.3 Die Grösse des Schulbibliotheksraumes
2.4 Bodenbelag, Licht und Beleuchtung
2.5 Funktionsbereiche der Schulbibliothek
2.6 Die Möblierung
2.7 Anmerkungen zum Planungsprozess
2.8 Beispielplanungen
2.9 Die Umplanung einer vorhandenen Schulbibliothek – Beispiel einer Neugestaltung
2.10 Ausblick
3. Passgenau ausgewählt – Grundlagen und Inhalte der Schulbibliothek
3.1 Grundlagen, Standards, Empfehlungen
3.2 Bestandsaufbau – Vorgehen und Hilfsmittel
3.3 Aktualisierung und Pflege eines bestehenden Bestandes
3.4 Finden und Präsentieren in der Schulbibliothek
3.5 E-Medien und Online-Angebote
4. Alles kein Science Fiction! Digitale und multimediale Technik in der Schulbibliothek
4.1 Ordnung muss sein: Verwaltung der Bibliothek
4.2 Was die Bibliothek zu bieten hat: der Bestand
4.3 Man muss nur wissen, wo es zu finden ist: Recherche und Beratung
4.4 Was Hänschen lernt: Lernen mit der Schulbibliothek
4.5 Die Schulbibliothek als multimediale Werkstatt: Arbeiten in der Schulbibliothek
4.6 Sich wie zuhause fühlen: Spiel und Freizeit
4.7 Fazit
5. Betriebsform, Personalmodelle und Finanzierung der Schulbibliothek
5.1 Betriebsform
5.2 Personalmodelle
5.3 Finanzierung der Schulbibliothek
5.4 Medienerwerb und Etat
5.5 Gesamtfinanzierung
5.6 Benutzungsregelungen
5.7 Berichte und Statistik
6. Aktivitäten in und mit der Schulbibliothek
6.1 Einleitung
6.2 Recherchebausteine für die Primarstufe
6.3 Leseförderung, die begeistert – Beispiele aus der sba Frankfurt
7. Selbstständig lernen durch Recherche – Fachunterricht mit der Schulbibliothek als analoger und digitaler Medienvermittler
7.1 Das Etappenmodell der thematischen Recherche in Kleingruppen
7.2 Vorwissen aktivieren und Recherche vorbereiten (Etappe 1)
7.3 Im Bibliotheksbestand nach Informationen zum Thema suchen und prüfen (Etappe 2)
7.4 Das erarbeitete Wissen strukturiert darstellen und weitergeben (Etappe 3)
7.5 Praktische Hinweise zur Realisierung
7.6 Die Rolle der Bibliothek
7.7 Recherche in analogen wie digitalen Medien
7.8 Das Beispiel Ägypten
7.9 Ausblick
8. Wie bleibt die Schulbibliothek lebendig?
8.1 Interne Kommunikation
8.2 Externe Vernetzung/Externe Kommunikation
9. Von Inseln und Netzen – Formen schulbibliothekarischer Versorgung
9.1 Schulbibliothek: Selbstständig oder Teil eines Systems?
9.2 Unterstützungsangebote und Beratungsstellen
9.3 Kooperationen mit Öffentlichen Bibliotheken
9.4 Kooperationen mit Wissenschaftlichen Bibliotheken
9.5 Kooperationsvereinbarungen und Verträge
9.6 Kommunale oder regionale Bildungsbündnisse
10. Die Rolle der Schulbibliothek in der zukünftigen Schule
10.1 Die Schulbibliothek mit pädagogischer Funktion
10.2 Strukturen für die Schulbibliothek schaffen
10.3 Die Situation der Schulbibliothek in Schweden
10.4 Auf die zukünftigen Anforderungen antworten
Glossar
Empfohlene weiterführende Literatur und Links
Autorinnen und Autoren
Bildnachweis
Register
Leiten
Cover
Inhaltsverzeichnis
Titelblatt
Seitenliste
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
Angelika Holderried, Birgit Lücke (Hg.)
Handbuch Schulbibliothek
Planung – Betrieb – Nutzung
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Das Buch wurde von den Herausgeberinnen in Zusammenarbeit mit Fachautoren des Schulbibliothekswesens und der Kommission Bibliothek und Schule des Deutschen Bibliotheksverbandes e.V. (dbv) erarbeitet.
©Debus Pädagogik VerlagFrankfurt/M. 2018
©WOCHENSCHAU VerlagDr. Kurt Debus GmbH2. überarbeitete AuflageFrankfurt/M. 2018
www.debus-paedagogik.de
Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieses Buches darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie oder einem anderen Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet werden.
Programmleitung: Peter E. KalbUmschlagentwurf: Ohl DesignGesamtherstellung: Wochenschau VerlagTitelbild: © FotolEdhar - Fotolia.com, © design-shirt-shop - Fotolia.com, © CC BY30
Gedruckt auf chlorfrei gebleichtem PapierISBN 978-3-95414-091-6 (Buch)E-Book ISBN 978-3-95414-092-3 (PDF)ISBN 978-3-95414-175-3 (EPUB)
Inhalt
Vorwort zur zweiten Auflage
Vorwort
Angelika Holderried, Birgit Lücke, Andreas Müller
1.Vom Nutzen der Schulbibliothek für die Schule und die Schüler
1.1Was die Schulbibliothek alles kann
1.2Warum Schulbibliothek? – ein Beispiel
1.3Schulbibliothekskonzepte
1.3.1Lesebibliothek und Leseecken-Konzept
1.3.2Selbstlernzentrum und Informationspool
1.3.3Schulbibliothek und Unterricht
1.4Damit alle Bescheid wissen – das Leitbild der Schulbibliothek
1.5Was die Schulbibliothek nicht kann – oder doch?
1.5.1Lesen – eine Schlüsselkompetenz auf dem Abstellgleis?
1.5.2Digital Natives und digitale Bildung – die Gnade der späten Geburt?
1.6Was soll die Schulbibliothek an unserer Schule können?
Klaus Dahm, Angelika Holderried
2.Wo man gerne hingeht – die Schulbibliothek als Raum
2.1Einleitung
2.2Die Platzierung der Schulbibliothek
2.3Die Grösse des Schulbibliotheksraumes
2.4Bodenbelag, Licht und Beleuchtung
2.5Funktionsbereiche der Schulbibliothek
2.6Die Möblierung
2.6.1Regale
2.6.2Arbeitsplätze
2.6.3Ausleihtheke
2.6.4Präsentation von Zeitschriften und Medien
2.6.5Präsentation von E-Medien
2.7Anmerkungen zum Planungsprozess
2.8Beispielplanungen
2.8.1Planung für eine Grundschule
2.8.2Planung für eine Bibliothek in der weiterführenden Schule
2.9Die Umplanung einer vorhandenen Schulbibliothek – Beispiel einer Neugestaltung
2.9.1Ausgangssituation
2.9.2Umplanung
2.10 Ausblick
Eva von Jordan-Bonin, Angelika Holderried
3.Passgenau ausgewählt – Grundlagen und Inhalte derSchulbibliothek
3.1Grundlagen, Standards, Empfehlungen
3.1.1Quantitative Aspekte des Bestandsaufbaus
3.1.2Qualitative Aspekte des Bestandsaufbaus
3.1.3Bestandsentwicklung
3.1.4Aus der Praxis der Schulbibliothekarischen Arbeitsstelle | sba der Stadtbücherei Frankfurt am Main
3.1.5Schülerzentrierter Bestandsaufbau
3.2Bestandsaufbau – Vorgehen und Hilfsmittel
3.2.1Grundlagen
3.2.2Kriterien zur Auswahl von Medien
3.2.3Bestandsaufbau leicht gemacht
3.2.4Geschenke – Fluch oder Segen?
3.3Aktualisierung und Pflege eines bestehenden Bestandes
3.3.1Umorganisation einer bestehenden Bibliothek
3.4Finden und Präsentieren in der Schulbibliothek
3.4.1Suchen muss zum Finden führen – die Systematik
3.4.2Suchen muss zum Finden führen – der Katalog
3.4.3Die Bestandspräsentation
3.5E-Medien und Online-Angebote
3.5.1E-Medien – Formen und Lizenzmodelle
3.5.2Bestandsaufbau von E-Medien – ein Interview
3.5.3Datenbanken
Kathrin Reckling-Freitag
4.Alles kein Science Fiction! Digitale und multimediale Technik in der Schulbibliothek
4.1Ordnung muss sein: Verwaltung der Bibliothek
4.2Was die Bibliothek zu bieten hat: der Bestand
4.3Man muss nur wissen, wo es zu finden ist: Recherche und Beratung
4.4Was Hänschen lernt: Lernen mit der Schulbibliothek
4.5Die Schulbibliothek als multimediale Werkstatt: Arbeiten in der Schulbibliothek
4.6Sich wie zuhause fühlen: Spiel und Freizeit
4.7Fazit
Ingrid Lange-Bohaumilitzky, Julia Rittel
5.Betriebsform, Personalmodelle und Finanzierung derSchulbibliothek
5.1Betriebsform
5.1.1Präsenzbibliothek
5.1.2Ausleihbibliothek
5.2Personalmodelle
5.2.1Aufgaben des Bibliotheksteams
5.2.2Teamleitung
5.2.3Nebenamtliches Personal
5.2.4Hauptamtliches Fachpersonal
5.2.5Werben und Qualifizieren von nichtfachlichem Personal
5.2.6Externe fachliche Unterstützung von Schulbibliotheken
5.3Finanzierung der Schulbibliothek
5.3.1Kostenfaktoren
5.3.2Personalkosten
5.3.3Sachkosten
5.4Medienerwerb und Etat
5.4.1Medienerwerb
5.4.2Medienetat
5.4.3Berechnung des Jahresetats
5.5Gesamtfinanzierung
5.5.1Drittmittel/Förderquellen im Einzelnen
5.6Benutzungsregelungen
5.7Berichte und Statistik
Hanke Sühl
6.Aktivitäten in und mit der Schulbibliothek
6.1Einleitung
6.2Recherchebausteine für die Primarstufe
6.3Leseförderung, die begeistert – Beispiele aus der sba Frankfurt
6.3.1Aktivitäten für die Primarstufe
6.3.2Aktivitäten für die Sekundarstufe I
6.3.3Routineangebote in Auswahl
Jochen Diel, Andreas Müller
7.Selbstständig lernen durch Recherche – Fachunterricht mit der Schulbibliothek als analoger und digitaler Medienvermittler
7.1Das Etappenmodell der thematischen Recherche in Kleingruppen
7.2Vorwissen aktivieren und Recherche vorbereiten (Etappe 1)
7.3Im Bibliotheksbestand nach Informationen zum Thema suchen und prüfen (Etappe 2)
7.4Das erarbeitete Wissen strukturiert darstellen und weitergeben (Etappe 3)
7.5Praktische Hinweise zur Realisierung
7.6Die Rolle der Bibliothek
7.7Recherche in analogen wie digitalen Medien
7.8Das Beispiel Ägypten
7.9Ausblick
Hanke Sühl
8.Wie bleibt die Schulbibliothek lebendig?
8.1Interne Kommunikation
8.2Externe Vernetzung/Externe Kommunikation
Birgit Lücke
9.Von Inseln und Netzen – Formen schulbibliothekarischer Versorgung
9.1Schulbibliothek: Selbstständig oder Teil eines Systems?
9.1.1Die selbstständige Schulbibliothek
9.1.2Die Schulbibliothek als Zweigstelle einer Öffentlichen Bibliothek
9.2Unterstützungsangebote und Beratungsstellen
9.2.1Schulbibliothekarische Arbeitsstellen
9.2.2Fachstellen für Öffentliche Bibliotheken/Schulbibliotheken
9.2.3Landesarbeitsgemeinschaften Schulbibliotheken
9.3Kooperationen mit Öffentlichen Bibliotheken
9.3.1Organisations- und Bestandshilfen
9.3.2Personelle Unterstützung
9.3.3Unterricht gemeinsam entwickeln
9.4Kooperationen mit Wissenschaftlichen Bibliotheken
9.5Kooperationsvereinbarungen und Verträge
9.6Kommunale oder regionale Bildungsbündnisse
Sofia Malmberg
10.Die Rolle der Schulbibliothek in der zukünftigen Schule
10.1 Die Schulbibliothek mit pädagogischer Funktion
10.1.1 Medien- und Informationskunde
10.1.2 Der Schulbibliothekar als Medienpädagoge
10.1.3 Die Kompetenz des Schulbibliothekars
10.2 Strukturen für die Schulbibliothek schaffen
10.3 Die Situation der Schulbibliothek in Schweden
10.4 Auf die zukünftigen Anforderungen antworten
10.4.1 Die Schulbibliothek politisch verankern
10.4.2 Profession und Ausbildung
Frankfurter Erklärung
Lesen und Lernen 3.0. Medienbildung in der Schulbibliothek verankern!
Glossar
Empfohlene weiterführende Literatur und Links
Autorinnen und Autoren
Bildnachweis
Register
Vorwort zur zweiten Auflage
Über die positive Aufnahme des Handbuchs Schulbibliothek in der Fachwelt und bei Schulbibliothekspraktikern1 (bzw. solchen, die es werden wollen) haben wir uns sehr gefreut. Die zweite überarbeitete Auflage des Handbuchs ist nach sechs Jahren notwendig geworden, weil sich im Bereich der elektronischen Medien einerseits und der Unterrichtskonzepte andererseits viel getan hat. Wenn sich Schule und Lernen verändern, sind auch unterstützende Einrichtungen wie die Schulbibliothek gefordert. E-Medien*, E-Learning, Datenbanken, Virtual Reality, Tablet, Smartphone und Co sind inzwischen in der Schulbibliothek angekommen, aber bei weitem noch nicht flächendeckend im Einsatz. Wer sich hier auf den Weg machen will, findet in dieser Neuauflage Anregungen und Hilfestellung. Kapitel 4 zur digitalen und multimedialen Technik in der Schulbibliothek wurde deshalb komplett neu geschrieben, die übrigen Kapitel überarbeitet, neue Entwicklungen aufgegriffen und aktuelle Literatur eingearbeitet, Links überprüft und aktualisiert.
Der Aufbau der 1. Auflage wurde beibehalten und durch ein Kapitel zur Rolle der Schulbibliothek in der zukünftigen Schule, geschrieben von einer schwedischen Schulbibliothekarin, ergänzt. Das schwedische Schulsystem unterscheidet sich ebenso vom deutschen, wie die Rahmenbedingungen für Bibliotheken in beiden Ländern verschieden sind. Aber auch in Schweden gab es nicht immer schon ein Schulbibliotheksgesetz und auch dort wird das entsprechende Gesetz von den Schulbibliothekaren als noch nicht ausreichend empfunden. Aber der Grundstein ist gelegt und von Jahr zu Jahr können sich die Rahmenbedingungen entwickeln und Schulen wie Schulbibliotheken schieben diese Prozesse gemeinsam voran. Wo liegt der Schlüssel zu diesem erfolgreich angestossenen Entwicklungsprozess? Was können wir in Deutschland daraus lernen?
Diese Aussensicht war uns wichtig, weil die Rolle des Schulbibliothekspersonals und die Frage, wie die Schulbibliothek politisch verankert werden kann, bisher in Deutschland nicht wirklich nachhaltig thematisiert werden. Die „Frankfurter Erklärung“ des Deutschen Bibliotheksverbandes (s. S. 257 dieses Handbuches) ist ein erster Ansatz dazu.
Der Zeitpunkt, diese politische Diskussion zu führen, ist im Rahmen der allgemeinen politischen Diskussionen um die Verbesserung der digitalen Kompetenzen deutscher Schüler günstig. Zeigt doch das schwedische Beispiel auch, dass andere Länder bereits auf die Idee gekommen sind digitale Bildungsstrategien in Schulen direkt mit den Schulbibliotheken zu verknüpfen.
In erster Linie soll diese Neuauflage aber auch wieder allen in Schulbibliotheken Aktiven helfen, den Alltag im Hier und Jetzt zu organisieren und zu meistern.
Unser Dank gilt einmal mehr den Autoren und Unterstützern dieses Handbuches, die mit viel Engagement und persönlichem Einsatz zum Gelingen dieser zweiten Auflage beigetragen haben.
Anmerkungen
1Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird in diesem Buch auf die gleichzeitige Verwendung männlicher und weiblicher Sprachformen verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten für beiderlei Geschlecht.
*Begriffe, die im Text mit * gekennzeichnet sind, werden im Glossar erläutert.
Vorwort
„Bibliotheken sind gefährliche Brutstätten des Geistes …“, so stand es im Jahresbericht des Generalinspekteurs für das Bibliothekswesen des preussischen Kultusministeriums schon im Jahre 1857 zu lesen. Es muss etwas dran sein, denn bis heute sind Diktaturen weltweit immer bemüht, den Zugang zu Literatur und Informationen zu behindern, wenn nicht gleich zu verhindern. Sie wissen nur allzu gut, was belesene und gut informierte Menschen anrichten können – sie sind kreativ, erfindungsreich und lassen sich nicht so leicht täuschen und für dumm verkaufen. Ob Bücherverbrennung oder Sperrung des Internetzugangs: Wissen ist und bleibt gefährlich oder, anders gewendet, Verfügbarkeit von Wissens- und Informationsmedien ist für die Erziehung zum demokratischen Handeln unverzichtbar.
Freien Zugang zu Literatur und Wissen für alle Kinder eines Jahrgangs – auch diejenigen, die im Elternhaus keine Bücher vorfinden –, das bieten öffentliche Bibliotheken und Schulbibliotheken. Mit ihrer Hilfe verbessern die Kinder ihre Lesekompetenz und lernen, alle Medien kritisch und zielführend für eigene Zwecke zu nutzen. Was mehr kann man, neben dem nötigen Grundlagenwissen, Kindern und Jugendlichen mit auf einen erfolgreichen und erfüllten Lebensweg geben? Um dieses Ziel zu erreichen, kann eine gut ausgestattete Schulbibliothek ein Schlüssel zum Erfolg sein, für Lehrer und für Schüler.
Besonders leicht gemacht wird es einem in Deutschland bislang nicht, wenn man diesen Weg beschreiten und eine Schulbibliothek aufbauen oder umgestalten will. Im Gegenteil, die Wahrscheinlichkeit, dass man mit Unterstützungsangeboten überschüttet wird, ist eher gering. Zum Glück hat es aber schon immer und auf ganz Deutschland verteilt „Überzeugungstäter“ gegeben, die sich auf den Weg gemacht haben. Viele erfolgreiche Schulbibliotheken zeugen davon. Und zum noch grösseren Glück sind in den letzten Jahren durch die Stärkung der Ganztagsschule viele neue dazugekommen.
Solche Schulen haben durch ihre besonderen Möglichkeiten der Ausgestaltung von Lernen die Chance, als Ganzes eine „Brutstätte des Geistes“ zu werden, und die Schulbibliothek kann darin als die „Keimzelle“ fungieren, deren Saat in jedem Kind aufgehen kann.
Wie man solch eine Infrastruktur aufbaut und dauerhaft am Leben hält, dazu soll dieses Buch Hilfestellungen geben. Es wendet sich an all jene, die die Neugründung einer modernen Schulbibliothek planen – möge sie nun Mediothek, Lerninsel, Selbstlernzentrum oder ganz unkonventionell „Medientanke“ heissen –, und an alle, die einen vielleicht in die Jahre gekommenen „Bücherhort“ umgestalten und zu neuem Leben erwecken wollen. Der Aufbau des Handbuches folgt dabei dem Weg von der ersten Konzepterstellung in der Schule über die Planung und Möblierung des Raumes, die Auswahl und Beschaffung der Bücher und Medien, die Organisation der Bibliothek mit EDV bis hin zu den Aktivitäten und Kooperationen, die den Erfolg der Schulbibliothek letztendlich ausmachen.
In den Texten finden sich immer wieder Querverweise, sodass es leichtfällt, einzelne Aspekte herauszugreifen und gezielt zu vertiefen. Ergänzende Hinweise bietet ein kommentiertes Literaturverzeichnis, das eine Auswahl weiterführender Literatur und Links bereithält. Grundsätzlich wurde darauf geachtet, dass jedes Kapitel für sich stehen kann, sodass man auch dann fündig wird, wenn man nur einen Aspekt der Bibliothek verbessern will bzw. gezielt nach Informationen sucht. Das Buch will alle diejenigen ermutigen, die sich auf den Weg machen. Viele Empfehlungen beziehen sich auf Stufenkonzepte immer eingedenk der Tatsache, dass wer nicht beginnt, auch keinen Erfolg haben kann. Wir wünschen uns, dass sich viele mit uns auf den Weg machen und dass die Anregungen in diesem Band den Weg leicht und erfolgreich gestalten mögen.
Die Erkenntnisse, die in die Texte dieses Buches eingeflossen sind, wurden über Jahre schulbibliothekarischen Arbeitens und Forschens gesammelt. Jeder, der ein Handbuch herausgibt, ist auf eine solche Basis angewiesen. Vielen müssten wir also danken. Besonders nennen möchten wir hier die Expertengruppe Bibliothek und Schule des Deutschen Bibliotheksverbandes, die in ihrer Besetzung von 2003 bis 2009 und mit Unterstützung des Deutschen Instituts für Internationale Pädagogische Forschung (DIPF) das Portal www.schulmediothek.de aufgebaut hat. Ausserdem sind Tipps und Veröffentlichungen vieler Praktiker aus Schulbibliotheken des In- und Auslandes eingeflossen, ohne deren
Vorarbeit dieses Buch nicht hätte entstehen können. Last but not least gilt unser Dank den Autoren der Beiträge, die uns immer wieder ermutigt haben und unsere Überarbeitungs- und Ergänzungswünsche mit Geduld und Tatkraft umgesetzt haben.
Angelika Holderried, Birgit Lücke
Anmerkung
Begriffe, die im Text mit * gekennzeichnet sind, werden im Glossar erläutert.
Aus Gründen der Lesbarkeit wird in diesem Buch auf die Verwendung männlicher und weiblicher Sprachformen verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten für beiderlei Geschlecht.
Angelika Holderried, Birgit Lücke, Andreas Müller
1. Vom Nutzen der Schulbibliothek für die Schule und die Schüler
Mittendrin. Diesen Lagevorteil hat die Schulbibliothek als Ort des Lernens für Schüler gegenüber einer räumlich getrennten Öffentlichen Bibliothek. Aber das ist kein Vorteil gegenüber anderen Räumen in der Schule. Wo kann im Vergleich die Schulbibliothek ihren Platz finden?
Der Klassenraum ist der Ort, an dem fast der gesamte Unterricht stattfindet. Man hat als Schüler seinen festen Platz, seine Nachbarn, seinen Blickwinkel auf den Lehrer, auf die Tafel, auf das zentral gesteuerte Unterrichtsgeschehen. Insofern ist der Klassenraum auch identitätsstiftend für den Einzelnen. Wenn der Lehrer mit den Schülern den Klassenraum bewusst als gemeinsamen Lernraum gestaltet, indem er zum Beispiel Schülerprodukte aus dem Projektunterricht aushängt, wird auch Klassengemeinschaft und damit Gruppenidentität dokumentiert. Der Klassenraum ist so im Idealfall ein wenig die Heimat des Schülers in der Schule.
Der Fachraum ist der Ort, an dem bestimmter Fachunterricht stattfindet: Turnhalle, Chemieraum, Physikraum, Biologieraum, Kunstraum und Musikraum, das sind die Klassiker. Der Fachraum hat die jeweils passende Ausstattung: Kletterwände und Basketballkörbe die Turnhalle, zahlreiche Wasser-, Strom- und Gasanschlüsse und Schränke mit Reagenzgläsern der Chemieraum. Der Fachraum lenkt den Blick auf die Besonderheiten des jeweiligen Fachs, der Blick geht damit auch weg vom Frontalunterricht hin zu anderen Sozial- und Arbeitsformen, zur Gruppe zum Beispiel als Mannschaft im Sport, zum Projekt zum Beispiel beim Versuch im naturwissenschaftlichen Unterricht.
Es gibt einen weiteren Unterrichtsraum in der Schule, der weder Klassennoch Fachraum ist: der Computerraum. Er wird nur punktuell für bestimmten Unterricht und deshalb von vielen verschiedenen Lerngruppen genutzt und ist insofern vom Klassenraum als „Heimat“ verschieden. Aber er kann andererseits in vielen verschiedenen Fächern gute Dienste leisten und unterscheidet sich insofern vom Fachraum. Ist also die Schulbibliothek eine Art Computerraum mit Büchern und anderen Medien als „Zugabe“? Die Frankfurter Erklärung des Deutschen Bibliotheksverbandes (Abdruck, S. 257) dreht den Spiess um, indem sie feststellt: „Die moderne Schulbibliothek ist der ideale Knotenpunkt für das Medienangebot und die Medienpädagogik der Schule. Sie führt gedruckte und digitale Angebote an einem Ort zusammen: aktuelle Bücher und Internet, Lesen und Surfen. Indem die Schulbibliothek neben Büchern die digitalen Ressourcen bündelt, ersetzt sie den wenig flexiblen konventionellen Computerraum (jenseits des Informatikunterrichts)“ (Frankfurter Erklärung 2015, 1). Die moderne Schulbibliothek ist heute also ein Ort der Medienbildung und der Leseförderung, doch was heisst das konkret?
1.1 Was die Schulbibliothek alles kann
„Eine Schulbibliothek ist ein zentral gelegener Marktplatz, ein im Herzen der Schule gelegenes Wissenszentrum. Einzeln oder in Gruppen wird hier Wissen geholt, geliefert, getauscht, gesucht und gefunden. Entweder mit Hilfe neuer Medien oder auf traditionellere Weise durch Bücher“ (G. Fischer-Kosmol 2009, 33). Bei dieser Definition der Schulbibliothek steht die Funktion der Bibliothek im Mittelpunkt und man kann sich gut vorstellen, dass es auf diesem Markplatz bunt und lebendig zugeht. Schüler und Lehrer treffen sich dort, um in Gemeinschaft oder alleine zu recherchieren, zu arbeiten und zu lernen. Wer hätte nicht gern ein solches Wissenszentrum in der Schule?
Und in der Tat ist der Gedanke an eine Bibliothek, die alle Bücher und Medien zentral sammelt, verzeichnet und für die Vor- und Nachbereitung des Unterrichts zugänglich macht, immer der erste, wenn es um die Neueinrichtung einer Schulbibliothek geht. Die traditionelle Funktion einer Bibliothek, Bücher und Non-Books bereitzuhalten, gilt unbestritten auch für Schulbibliotheken.
Die Schulbibliothek ist „… zentraler Medienraum, zentraler Informationsbereich, Ort der Leseförderung, Unterrichtsraum und Kommunikationsraum“, definiert das Fachportal www.schulmediothek.de (Abruf 28.08.2017) und erweitert damit das „Wissenszentrum“ um die Funktionen „Leseförderung“, „Unterricht“ und „Kommunikation“. Wenn man den Marktplatz ernst nimmt, ist zumindest die Kommunikation aus dem Bild nicht wegzudenken.
Grundlegend für die Schulbibliothek ist jedoch nach wie vor die Leseförderung, die vor allem in Grundschulen einhergehen muss mit Sprachförderung. „Auf der Basis bundesweiter Elternbefragungen konnte wiederholt gezeigt werden, dass knapp ein Viertel der vor der Einschulung stehenden Kinder in einem Sprachtest als förderbedürftig im Deutschen diagnostiziert wurde“ (Bildung in Deutschland 2016, 66). 21% der Kinder mit verzögerter Sprachentwicklung stammen dabei aus deutschsprachigen Haushalten (vgl. ebd., 66). Zur Leseund Sprachförderung lässt sich vorwiegend in weiterführenden Schulen noch eine Erweiterung ergänzen, die der Leitfaden der LAG Hessen auf den Punkt bringt, indem er die Schulbibliothek auch als „kulturelles Zentrum“ definiert (LAG-Bausteine für ein hessisches Schulbibliothekswesen 2006, 10). Was das tatsächlich heissen kann, ist überall dort zu besichtigen, wo Schulbibliotheken Veranstaltungen anbieten – von der klassischen Autorenlesung über den Poetry Slam bis hin zur Aufführung von Filmen der Film-AG.
Bei entsprechender Ausstattung und Betreuung kann man von Schulbibliotheken sogar „Produkte“ erwarten. „Makerspaces*“, also Bereiche, in denen die verschiedensten Dinge entwickelt und produziert werden, gibt es in Schulen schon lange: Werkraum, Physiksaal, Handarbeitsraum oder Chemielabor. Für die Schulbibliothek muss definiert werden, welche Produkte dort entstehen sollen und welche Ressourcen hierfür zur Verfügung gestellt werden. Naheliegend ist die Schulbibliothek als digitale Kreativwerkstatt. Wichtig dabei: die technische Ausstattung muss den konzeptionellen Vorgaben dienen. So hat zum Beispiel die amerikanische Big Walnut Middle School in Sunbury, Ohio, die Aktivitäten der Schulbibliothek streng auf die Unterstützung der Unterrichtsinhalte hin ausgerichtet und bietet hierfür moderne digitale Technik an vom interaktiven Touchscreen über Digitalkameras bis hin zum als Monitor nutzbaren TV-Gerät (vgl. Gonzales 2016).
Bleibt noch eine letzte Funktion, die die Schulbibliothek vor allem in der Ganztagsschule erfüllen sollte, sie kann nämlich auch ein Ort für Freizeit und Entspannung sein. Das Spielen von Spielen – traditionell oder digital –, das Hören von Hörbüchern und das Schmökern in einem Kinder- oder Jugendbuch gehören in vielen Schulbibliotheken zum Programm. Von den Schülern wird dieses Angebot gerne in Anspruch genommen, durchaus auch, weil man sich so im Schulalltag eine Auszeit nehmen, sich zurückziehen und sammeln kann. Damit einher geht oft die soziale Funktion der Schulbibliothek, in der Schüler auch jenseits von Schule und Lernen vielfach ein offenes Ohr finden. Diese Funktion ist zwar im Zeitalter von Schulpsychologen und Schulsozialarbeit nicht beabsichtigt, lässt sich aber nicht ganz ausblenden. Es bedarf einer bewussten Entscheidung, wie weit das Personal, ggf. mit entsprechender Schulung, hier gehen kann, darf und will.
Betrachtet man diese Bandbreite, so lassen sich die folgenden zentralen Funktionen der Schulbibliothek ausmachen:
• Ort der Leseförderung und der Sprachförderung
• Trainingsort für den Umgang mit neuen Medien und dem Internet
• Informationszentrum
• Lernzentrum und Unterrichtsraum
• Kommunikationsplattform und Treffpunkt
• Kulturelles Zentrum, Veranstaltungsraum
• Makerspace
• Ort für Entspannung und Rückzug, soziale Funktion
Geht es um die Verwirklichung einer Schulbibliothek, sollte man diese Möglichkeiten kennen, um dann für das eigene Konzept fundiert entscheiden zu können.
Die wichtigste Entscheidungsgrundlage ist die pädagogisch-didaktische Gesamtkonzeption der jeweiligen Schule, mit deren Hilfe zum Beispiel Aussagen zur Rolle der Schulbibliothek bei der Erreichung der Lernziele getroffen werden können. „Es muss z.B. festgestellt werden, in welchen Bereichen Lernziele ohne Schulbibliothek nicht oder nur unter erschwerten Bedingungen erreicht werden können“ (Deutsches Bibliotheksinstitut: Materialien 1994, H. 11, 2).
Ideal ist es, wenn an der inhaltlichen Definition der Schulbibliothek die Schulgemeinschaft insgesamt beteiligt werden kann, denn so erreicht man eine breite Akzeptanz der Massnahme. Schliesslich handelt es sich oft um eine beträchtliche Investition an Zeit und Geld und diese knappen Ressourcen müssen zielgerichtet eingesetzt werden. Was erwarten die Lehrer, die Schüler, die Eltern, der Träger von der Schulbibliothek? Erst wenn die Sammlung der Erwartungen vorliegt und in Beziehung gesetzt wurde zu den möglichen Funktionen der Bibliothek, können die zentralen Fragen beantwortet werden:
• Welche Aufgaben soll die Schulbibliothek in unserer Schule erfüllen?
• Welche Ressourcen (räumlich, personell, Sachmittel, Geld) können dafür zur Verfügung gestellt werden?
Je nachdem, wie die Antwort auf diese Fragen ausfällt, kann man entweder sofort in die Verwirklichung eintreten oder einen Stufenplan entwickeln. Häufig ist ein schrittweises Vorgehen erforderlich, weil die Räume, in denen die Schulbibliothek entstehen soll, zu klein sind. Je erfolgreicher die Bibliothek arbeitet, desto eher wird es gelingen, bei passender Gelegenheit (Erweiterungsbau, Umstrukturierung) zusätzliche Räume zu erhalten. Aktive Bibliotheken haben die Chance, sich zum „Standortfaktor“ für die Schule zu entwickeln.
1.2 Warum Schulbibliothek? – ein Beispiel
Wie die Gründung einer Schulbibliothek vonstatten gehen kann, verdeutlicht ein Interview mit dem Schulleiter des Fürstenberg-Gymnasiums Donaueschingen, Herrn OStD Mario Mosbacher. Das Fürstenberg-Gymnasium ist Teil einer Schullandschaft der Stadt Donaueschingen (ca. 22.000 Einwohner) und des Schwarzwald-Baar-Kreises, die alle Schularten incl. gewerbliche, kaufmännische und technische Schulen bietet. Aktuell besuchen rund 850 Schüler das Fürstenberg-Gymnasium, ein grosser Teil davon im „offenen Ganztag“. Das Interview führte Angelika Holderried.
Herr Mosbacher, Sie haben sich dazu entschlossen, die sechs kleinen Bibliotheken, die es an Ihrer Schule gab, zu einer grossen Bibliothek zusammenzuführen und ein neues Bibliothekskonzept zu verwirklichen. Was hat Sie dazu bewogen, diesen Schritt zu gehen?
In den vergangenen Jahren wurde unsere Schule von Grund auf generalsaniert, d.h. bis auf den Rohbau zurück- und dann wieder aufgebaut. Leitend und bindend bei dieser Sanierung war ein von der Schule in einem mehrmonatigen Prozess ausgearbeitetes Pädagogisches Konzept. Hier haben alle am Schulleben Beteiligten gemeinsam festgehalten, welche Anforderungen ein neues Schulgebäude für den Unterricht von heute und auch von morgen erfüllen muss. Wichtige Überlegungen in diesem Zusammenhang waren u.a.:
• in der Schule Räume für erlebnishaltiges Lernen zu schaffen,
• im Rahmen des offenen Ganztages Aufenthalts- und Freizeiträume zu schaffen,
• universitäres Lernen vorzubereiten,
• im gesamten Haus durch Licht, Farbe und Materialien eine Atmosphäre zum Wohlfühlen zu schaffen,
• innerhalb des Hauses eine klare funktionale Gliederung der Räume zu finden.
Alle diese Aspekte haben zum jetzigen Bibliothekskonzept beigetragen. Vor der Sanierung hatten wir in der Tat sechs kleinere Bibliotheken: eine für die Unterund Mittelstufe, eine für die Oberstufe, zwei Selbstlernräume in einem Nebengebäude, eine Lehrerbibliothek und eine historische Bibliothek. Die Flächen dieser Räume und auch ein Grossteil des Buchbestandes sind nun in einer grossen Bibliothek zusammengeführt. Der neue Ort gab uns gestalterisch, aber auch inhaltlich ganz neue Möglichkeiten.
Können Sie uns bitte den Entstehungsprozess schildern?
Im Rahmen der Sanierung sollte eine neue Bibliothek zentral im Mittelpunkt des Schulhauses geschaffen werden. Auf der „didacta“ 2012 traf ich nun durch Zufall auf einen Bibliotheksplaner und wir kamen ins Gespräch. Ein ausgesprochener Glücksfall, denn wir stellten beide schon bei der ersten Tasse Kaffee fest, dass wir denselben Blick auf das Thema „Schulbibliothek“ hatten. Erstens waren wir sicher, dass gerade in Zeiten der Digitalisierung Schulen und Schüler einen Ort benötigen, an dem es Begegnungen mit dem Medium Buch gibt, an dem Schüler das Lesen zum Lernen und zur Unterhaltung entdecken können, einen Ort, der in den Unterricht ausstrahlt. Wir waren uns zweitens aber auch sofort einig, dass es hierfür neuer Konzepte bedurfte, dass es also nicht genügen würde – überspitzt gesagt – einen Raum mit Buchregalen vollzustellen und zu hoffen, dass der dann genutzt würde. Und so beschlossen wir an diesem Tag, uns gemeinsam auf den Weg zu machen. Hinzu kamen dann noch der damalige Schulleiter des Fürstenberg-Gymnasiums (ich wurde erst im September 2013 Schulleiter), unsere Architekten sowie aus der Schule selbst noch der betreuende Lehrer. Wir alle zusammen haben unser Herz an die neue Bibliothek verloren und haben gemeinsam dann das entwickelt, was man heute schlussendlich gebaut sehen kann.
Wenn Sie Ihre neue Bibliothek einem Besucher vorstellen, welche Punkte heben Sie besonders hervor?
Nun, wir haben in der Tat öfter Besuchergruppen bei uns, ehemalige Abiturjahrgänge oder auch Interessenten von anderen Schulen, und ich hebe bei Führungen verschiedene Aspekte hervor:
• Architektur: Wir haben in diesen Räumen eine Architektur mit einer klaren, zeitgemässen Formensprache geschaffen, die dennoch durch die Gliederung, durch das Lichtkonzept und durch die Farbgebung eine Wohlfühlatmosphäre schafft.
• Details der Ausstattung: es gibt eine kleine Bühne, auf der Lesungen oder Kleinkunstaufführungen stattfinden – und die Bühnenakustik ist extra hierauf angepasst. Im grössten Raum der Bibliothek schaffen wir durch den gelben Boden, eine gelbe Wand und eine abgehängte gelbe Decke – die letzteren beiden aus schallabsorbierendem Material – eine Art „Höhlencharakter zum Reinkuscheln“. Es gibt eine Podestlandschaft, auf der man sich zum Lesen „hinlümmeln“ kann, selbstverständlich stehen PCs zum Arbeiten und für Recherchen zur Verfügung und nicht zuletzt trägt die Möblierung mit hochwertigen weissen Buchregalen sehr zum gelungenen Ambiente bei.
• Die Betreuung unserer Bibliothek: Beim Blick auf die Architektur fällt den Besuchern sehr schnell die zentrale Ausleihtheke auf, an der während der Öffnungszeiten der Bibliothek (täglich von 8-14 Uhr) unsere Betreuerinnen arbeiten. Dies ist eine aus meiner Sicht entscheidende Weiterentwicklung gegenüber dem früheren Konzept der von einer einzigen Lehrkraft betreuten, nur in den grossen Pausen geöffneten Schulbibliothek. Heute gibt es nach wie vor einen Lehrerkollegen, der die Bibliothek betreut – dieser arbeitet aber konzeptionell und ist nicht für die Ausleihe tätig. Zusätzlich engagieren sich noch eine hauptberufliche Bibliothekarin, welche uns für ca. einen Tag je Woche unterstützt, sowie mehrere Mütter von jetzigen oder ehemaligen Schülern. Sie alle werden durch die Schule vergütet, managen den Buchbestand, betreuen die Ausleihe, sind Ansprechpartner für Schüler und erarbeiten auch in Rücksprache mit den Lehrkräften Konzepte zur Leseförderung in der Bibliothek. Dieses Engagement ermöglicht uns eine Bibliotheksarbeit auf einem ganz anderen Niveau.
Blick in die Bibliothek des Fürstenberg-Gymnasiums Donaueschingen
Welche Funktion erfüllt die Bibliothek in Ihrer Schule und wie ist sie mit dem pädagogischen Konzept und dem Unterricht vernetzt?
Die Bibliothek erfüllt am Fürstenberg-Gymnasium ganz verschiedene Funktionen:
• Sie ist, offensichtlich, ein Ort des Buches. Hier kann man lesen, in Pausen, in Freistunden oder nach der Schule. Die Bühne ist dazu im Tagesbetrieb extra mit gemütlichen Sitzsäcken ausgestattet. Und hier kann man wie in einer öffentlichen Bibliothek auch Bücher ausleihen, der Buchbestand ist elektronisch erfasst und kann recherchiert werden. Die Schüler dürfen sich Bücher wünschen und die Favoriten werden dann angeschafft. Der Buchbestand beinhaltet dementsprechend Literatur für Jugendliche von 10 bis 18+ Jahren.
• Sie ist ein Ort zum Arbeiten. Schüler können hier Referate vorbereiten, in Büchern recherchieren, Hausaufgaben machen. Zahlreiche PCs mit Zugang zum Internet und zum schuleigenen Netz bieten hierfür das notwendige mediale Umfeld. Vor allem für die höheren Klassen beinhaltet der Buchbestand viele hochwertige Fachbücher. Die Oberstufen-Abteilung sieht schon rein optisch wie eine klassische Universitäts-Bibliothek aus, aus deren Bestand z.B. Handapparate zusammengestellt werden. Auch für die Lehrer ist die Bibliothek ein Ort zum Arbeiten. Die Fachbereiche haben einen Grossteil der Fachliteratur in den Oberstufen-Bereich eingegliedert.
• Sie ist ein Unterrichtsort. Klassen oder Kurse können die Bibliothek für Unterrichtsstunden reservieren. Das können Buchrallyes, Aufführungen kleiner Theaterstücke oder andere Vorhaben sein. Man kann auch als Klasse gemeinsam in die Bibliothek gehen, um zu einem bestimmten Thema zu recherchieren.
• Sie ist ein Ort für kleinere schulische Veranstaltungen. Diese reichen von der Durchführung von Lesewettbewerben in Deutsch oder den Fremdsprachen (wir haben übrigens auch einen guten Teil an fremdsprachiger Literatur, meist Englisch) über kleinere musikalische Aufführungen bis hin zu Veranstaltungen unserer Vortragsreihe „Campus FG“, bei der wir teils gemeinsam mit Partnern aus der Stadt zu spannenden aktuellen Themen – meist aus Politik und Forschung – Experten von auswärts einladen und bei denen auch die Einwohner Donaueschingens herzlich eingeladen sind und gerne teilnehmen.
Kurz: Die Bibliothek ist in ihren eineinhalb Jahren, in denen sie nun geöffnet ist, zu einem lebendigen Ort des Lebens und Lernens mitten in der Schule geworden und es macht uns allen Spass, diese Entwicklung, die sicher noch weitergehen wird, zu verfolgen.
Was würden Sie einem befreundeten Schulleiter raten, der sich mit dem Gedanken trägt, eine Bibliothek an seiner Schule aufzubauen?
Hier kann ich mich kurz fassen:
1) Eine Schule benötigt heute und in Zukunft eine Bibliothek als lebendigen Ort des Lernens – mit gedruckten Büchern sowie elektronischen Medien.
2) Wenn es die Möglichkeit gibt, ein solches Projekt umzusetzen, dann sollte man sich die passenden Partner suchen und es wagen.
3) Es ist ungemein hilfreich, in der Konzeptionsphase andere Schulen mit Bibliotheken zu besuchen und sich Anregungen zu holen. Wir haben das auch getan und von allen Besuchen Ideen mitgenommen.
4) Und dann … Machen!
Herr Mosbacher, ich danke Ihnen für das Gespräch.
Um die Entscheidung für ein tragfähiges Konzept zu erleichtern, sollen im Folgenden einige Möglichkeiten vorgestellt werden.
1.3 Schulbibliothekskonzepte
Die vorgestellten Konzepte sind in der Regel nicht in Reinform zu finden.
1.3.1 Lesebibliothek und Leseecken-Konzept
Vor allem in der Grundschule ist das Konzept der Lesebibliothek verbreitet. Sie unterstützt den Prozess des Lesenlernens, der Lese- und Sprachförderung. Ihr Ziel ist es, den Schülern eine gute Lesefertigkeit zu vermitteln, denn müheloses Lesen ist der erste Schritt zum „gerne Lesen“. Unbestritten ist der Wert der Lesekompetenz für alle Lebensbereiche. In der Primarstufe wird hierfür der Grundstein gelegt. Aber auch in der Unter- und Mittelstufe darf der Prozess nicht abbrechen. In weiterführenden Schulen hat die Lesebibliothek ebenfalls ihren Platz, oft verwirklicht als Teil eines Kommunikationsbereiches mit Sofas, Zeitschriftenpräsentation und Jugendbuch-Regalen.
Die kleinere Schwester der Lesebibliothek ist die Leseecke – nicht zu verwechseln mit der Klassenbibliothek. Im Unterschied zur Klassenbibliothek ist die Leseecke keine Einrichtung nur für eine Klasse, sondern sie hat die Funktion der übergreifenden Leseförderung. Sie kann Teil eines Multifunktions-, Computer- oder Pausenraumes sein und selbst im Flur lässt sich in manchen Fällen ein Plätzchen finden. Ihre Aufgabe ist es, den Schülern das „Erlebnis Buch und Medien“ nahezubringen (Dahm 2008, 4).
Entgegen landläufiger Meinung enthält die Lesebibliothek nicht nur Print-medien. Auch andere Medien wie animierte Bilderbücher, Filme und Hörspiele sind enthalten. Leseförderung mit Tablets und Apps ist eine ausgesprochen erfolgreiche Form der Leseanimation, die auch bei der Integration von Flüchtlingskindern punkten kann. Die Schulbibliothekarische Arbeitsstelle der Stadtbücherei Frankfurt a.M. hat eine eigene Broschüre mit Anregungen für Tabletprojekte herausgegeben (s. http://www.frankfurt.de/sixcms/media.php/738/ANSICHT_STB_Broschuere_iPaed_170x240_dy250416.pdf, Abruf: 11.10. 2017).
Die Lesebibliothek enthält aber nicht nur fiktionale Stoffe. Jungs lesen oft lieber Sachbücher als Romane und auch mit einem Buch über Fussball, einer Autozeitschrift oder einem Comic lässt sich lesen lernen. Lesebibliothek und Leseecke sind Orte der Leseanimation und des ausserunterrichtlichen Lesens (Dahm 2008, 9), gehen also deutlich über das hinaus, was im Unterricht an Themen behandelt wird, knüpfen an die Freizeitinteressen der Kinder und Jugendlichen an und eröffnen neue Horizonte.
Die Gestaltung des Raumes ist farbenfroh und gemütlich. Die Lesebibliothek enthält keine oder wenige Tische. Sie ist auf das Lesen – alleine oder in Gruppen – ausgerichtet. Man findet deshalb in der Lesebibliothek vorwiegend gemütliche Sofas, Sessel, Sitzsäcke, Sitzwürfel, Hocker, eine Liegelandschaft oder Sitztreppe. Ausserdem sind Hörstationen für die parallele Nutzung von Hörbuch und gedrucktem Buch, ein grosser Bildschirm oder ein Smartboard zur Vorführung von Bilderbuchkino und animierten Bilderbüchern sowie ein Tabletwagen für Tabletprojekte sinnvoll.
Mehr als andere Formen der Schulbibliothek ist die Lesebibliothek auf Aktionen in und mit der Bibliothek angewiesen. Die Ergänzung einer Bühne oder eines Podests ist deshalb zu überlegen. Dort können die oben genannten Medienprojekte stattfinden, aber auch Kamishibais* vorgeführt oder kleine Theaterstücke aufgeführt werden. Die Bibliothek aufzubauen und dann darauf zu hoffen, dass die Kinder und Jugendlichen schon kommen werden, funktioniert heute nicht mehr. „Das Lesen fördern mit allen Sinnen und allen dem Zweck dienlichen analogen und digitalen Materialien – das ist die Devise …“ (Lücke/ Holderried 2016, 202), der die Lesebibliothek folgt.
1.3.2 Selbstlernzentrum und Informationspool
Die Bibliothek als Informationszentrum findet sich in verschiedenen Ausprägungen. Meist dient sie der selbstständigen Vor- und Nachbereitung des Unterrichts oder der spontanen Benutzung während des Unterrichts, und zwar immer dann, wenn spezielle Fragen auftauchen (Deutsches Bibliotheksinstitut, Materialien 1994, H. 13, 1).
Bei der Fülle an Literatur und Medien, die der Markt bietet, ist zwangsläufig immer eine Auswahl erforderlich. Sie richtet sich nach dem Bibliotheksprofil, das durch die zu erfüllenden Aufgaben bestimmt wird. Ein umfassendes Selbstlernzentrum benötigt Literatur, Medien und Datenbanken für alle Fächer und deshalb eine ausreichend grosse Fläche für Präsentation und Nutzung.
Hat man nur begrenzte räumliche und finanzielle Ressourcen, ist die Verwirklichung von Teilfunktionen in Erwägung zu ziehen. Dann hat die Bibliothek eben kein Angebot für alle Unterrichtsthemen, was bei schlechter Finanzlage eine mangelhafte Ausstattung auf breiter Front bedeuten würde, sondern konzentriert sich auf wenige Themen, zu denen ausreichend und gezielt Bücher und Medien gekauft werden. Eine Hausaufgabenbibliothek wird beispielsweise vorwiegend Lernhilfen, Lehrbücher und PC-Plätze für Internetrecherchen bereithalten, eine Projektbibliothek orientiert sich an bestimmten Unterrichtsthemen, die bevorzugt abgedeckt werden. Hier wären zum Beispiel für die Grundschule Themen wie „Jahreszeiten“, „Ritter“, „Säugetiere“ zu nennen, für die Unterstufe kommen Themen wie „Regenwald“, „Märchen, Sagen, Fabeln“, „Leben in England“ oder Ähnliches infrage.
Es versteht sich von selbst, dass alle Teilfunktionen auf Erweiterung angelegt sind und Bestandteile eines Stufenkonzeptes sein können.
Grosser Beliebtheit in Gymnasien erfreut sich die Oberstufenbibliothek, in der Abiturhilfen, Spezialliteratur und Fachdatenbanken für die Zielgruppe der Oberstufenschüler – beispielsweise für Facharbeiten – bereitgehalten werden. Sinnvollerweise sind dort auch die oft verstreut gelagerten Fachschafts- und Lehrerbibliotheken integriert, die dann zum Wohle aller professionell erschlossen und zugänglich gemacht werden. Gegen diese Bibliotheksform ist zwar nichts zu sagen, sie lässt aber das Fundament vermissen. Wie alles andere auch, muss die Nutzung der Bibliothek eingeübt und gelernt werden, und das kann nicht erst in der Oberstufe geschehen. Bibliothekskompetenz*, Medien- und Informationskompetenz müssen „von unten“ aufgebaut werden, um in der Oberstufe als Basis vorhanden zu sein. In der Oberstufe kann man dann die Früchte der Bibliotheksarbeit, die in der Unter- und Mittelstufe geleistet wurde, ernten: Die Schüler können selbstständig und kompetent in allen Medienarten recherchieren, die gefundenen Informationen auf Verlässlichkeit prüfen, auswählen und in neuen Zusammenhängen anwenden. Die Nutzung der Schulbibliothek führt – wie zahlreiche amerikanische, britische und kanadische Studien beweisen (s. http://www.iasl-online.org/advocacy/make-a-difference.html, Abruf: 28.08.2017) – zu besseren Prüfungsergebnissen und erfolgreicheren Abschlüssen, ganz zu schweigen von der Entlastung, die die Lehrkräfte erfahren, wenn ihre Schüler medien- und informationskompetent sind.





























