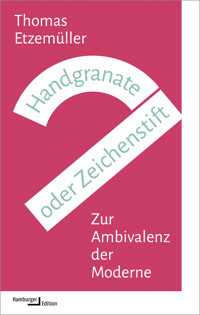
13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Hamburger Edition HIS
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Für viele Historikerinnen und Historiker ist der Begriff »Moderne« weitgehend unbestimmt. Viele Bücher konzentrieren sich auf das, was bis 1945 katastrophal verlaufen ist: kollabierende Demokratien, Kriege, Holocaust und Stalinismus. Doch einige der europäischen Demokratien, die mit Ende des Ersten Weltkrieges begründet wurden, haben sich gegen totalitäre Anfechtungen als resistent erwiesen. Schon früh haben Zygmunt Bauman oder Detlev Peukert darauf verwiesen, dass in der Rationalität der Moderne Fortschritt und Massenvernichtung zugleich angelegt sind. Thomas Etzemüller pointiert die Geschichte der Moderne als wahrhaft ambivalente Geschichte: Während die einen der Männlichkeit und dem Kampf huldigten, bauten anderswo »Sozialingenieure« Wohnungen, Schulen und Krankenhäuser. Sie wollten die Menschen anleiten, sich zu aufgeklärten, rationalen »neuen Menschen« zu erziehen. Aber auch das hatte eine andere Seite, denn rigide Exklusion ist Teil dieser Geschichte. Dieses Buch erzählt nicht nur von einer komplexen Epoche, es ist auch ein wehmütiger Kommentar zur Gegenwart: Den multiplen Krisen konnte man im 20. Jahrhundert durchaus zivilisiert beikommen; Demokratien können ausgreifende Krisen bewältigen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 152
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
ThomasEtzemüller
Handgranateoder Zeichenstift
Zur Ambivalenzder Moderne
Hamburger Edition
Hamburger Edition HIS Verlagsges. mbH
Verlag des Hamburger Instituts für Sozialforschung
Mittelweg 36
20148 Hamburg
www.hamburger-edition.de
© der E-Book-Ausgabe 2025 by Hamburger Edition
ISBN 978-3-86854-890-7
E-Book Umsetzung: Dörlemann Satz, Lemförde
© 2025 by Hamburger Edition
ISBN 978-3-86854-879-2
Umschlaggestaltung: Lisa Neuhalfen, Berlin
Inhalt
Cover
Titelei
Impressum
Inhalt
Moderne
Zwei Wege durch das »Zeitalter der Extreme«
Blutige Moderne, gescheiterte Demokratie?
Die »heroische Moderne«
»Moderne und Ambivalenz«
Die (heroische) Moderne als Epoche
»Ordnung schaffen«
Unsicherheit in der Industriegesellschaft
Ordnungsmodelle
»Gemeinschaft« und »Gesellschaft«
Der soziale Organismus
Die Biologisierung des Sozialen
Projekt Equilibrium
Die soziale Ingenieurskunst
Was ist Social Engineering?
Siedlung, Wohnung, Küche, Spüle, Nation
Brasilia und Sennestadt
Subjektivieren
Übermächtigung und Eigensinn
Techniken der Intervention
Entbergen (visualisieren)
Gestalten
Justieren/revidieren
Ambivalenzen
»Diktatur der Philanthropen«?
Ambivalenz der Experten
Finis heroische Moderne
Geschichte als nostalgischer Kommentar zur Gegenwart?
Dank
Literaturverzeichnis
Zum Autor
Extra Seite
Navigationspunkte
Inhalt
Cover
Textanfang
Impressum
Moderne
Zwei Wege durch das »Zeitalter der Extreme«
Der 30. Januar 1933 gilt als Menetekel der Moderne. Doch am selben Tag, an dem in Deutschland die Nationalsozialisten enthusiastisch die »Machtergreifung« feierten, wurde in Kopenhagen ein wegweisendes Abkommen geschlossen, die »Einigung von der Kanzlerstraße« (»Kanslergadeforliget«). Sozialdemokraten, Konservative und Liberale beschlossen ein einjähriges Verbot von Streiks und Aussperrungen, um einen sich anbahnenden Arbeitskampf zu verhindern, außerdem Maßnahmen zur Bekämpfung der Agrarkrise. Dafür akzeptierten die Konservativen die Planungen für den Aufbau eines modernen Sozialstaats. Während in Deutschland kurz darauf die Bücher brannten, wurde diese Reform durch König Christian X. in Kraft gesetzt. Das zeigt, dass es seinerzeit zwei Optionen gegeben hat, mit den unbestreitbaren Verwerfungen der Moderne umzugehen, eine destruktive, eine konstruktive.
Diesen Optionen entsprachen zwei Akteurstypen. Auf dem Gemälde »Die letzte Handgranate« von Elk Eber aus dem Jahr 1936/37 entsichert ein deutscher Stoßtruppmann entschlossen eine Stielhandgranate. Ernst Jünger hatte diesem Typus, der unbeirrt das feindliche Sperrfeuer durchschreitet und die Gräben im Nahkampf säubert, 1922 ein literarisches Denkmal gesetzt. Jünger imaginierte ihn darüber hinaus als »Neuen Menschen« der Zukunft, der die radikalen Praktiken des Krieges in die zerstörte Gesellschaft tragen werde: »Weit hinten erwarten die riesigen Städte, die Heere von Maschinen, die Reiche, deren innere Bindungen im Sturm zerrissen werden, den Neuen Menschen, den kühneren, den kampfgewohnten, den rücksichtslosen gegen sich selbst und andere. […] Der Krieg ist eine große Schule, und der neue Mensch wird von unserem Schlage sein.«1
Dagegen steht eine Zeichnung von Oswald Charles Barrett aus dem Jahr 1943: Ein Mann steht vor dem Stadtplan und über der Silhouette des alten London, die von Flammen und Rauch umhüllt zu sein scheint. Mit einem Lappen wischt er mit ruhiger Geste die verwinkelten Straßen der alten Stadt aus. In der Mitte des Bildes die »City«. Sie wurde bereits umgebaut, denn man erkennt die funktionalistische Blockbebauung, eine klare Straßenführung sowie Ring- und Ausfallstraßen.2 So würde künftig ganz London aussehen. Der Mann ist Stadtplaner. Er wird den Lappen zur Seite legen und an das Reißbrett treten, um einen neuen Stadtgrundriss zu zeichnen. Er führt, wie so viele seiner Kollegen3 in Europa, nüchtern fort, was die Flächenbombardierungen vorbereitet haben: die dysfunktionale, ungesunde, verqualmte, verwinkelte Industriestadt des 19. Jahrhunderts durch rationale, hygienische, lichte Architektur zu ersetzen.
Auch diese Bilder demonstrieren, dass es zwei Wege durch jene Epoche gegeben hat, die Eric J. Hobsbawm das »Zeitalter der Extreme« nannte. Man konnte die Krisenerfahrungen, die sich seit der Jahrhundertwende akkumulierten – Fin-de-Siècle-Stimmung, Erster Weltkrieg, Weltwirtschaftskrise –, wie in Deutschland und Italien militarisieren oder sie, wie in Skandinavien, Großbritannien, Frankreich und den USA, zivilisieren. Die einen setzten auf die disruptiven Praktiken des Grabenkrieges, um die überkommene Ordnung zu zerstören und sie irgendwann, irgendwie zu erneuern. Die anderen waren bereit, die Mühen des Aushandelns und permanenten Justierens auf sich zu nehmen, um die Vision einer sozial harmonisierten Gesellschaft zu verwirklichen. Die Handgranate gegen Wischlappen und Zeichenstift, der Soldat gegen den Planer, das sind die beiden großen Gesten, die die »heroische Moderne« (Heinz Dieter Kittsteiner) hervorgebracht hat.
Blutige Moderne, gescheiterte Demokratie?
Zahlreiche Gesamtdarstellungen der europäischen Geschichte interpretieren die Moderne vor allem als Geschichte des »Höllensturzes« (Ian Kershaw), der »Bloodlands« (Timothy Snyder), eines »Age of Extremes« (Eric J. Hobsbawm) oder als »Dark Valley« (Piers Brendon) – als düstere Epen, die auf das Versagen von Demokratie und Zivilisation im Schatten totalitärer Regimes und des Holocaust hinauslaufen. Sie marginalisieren erfolgreiche humane Versuche, die Verwerfungen der Moderne aufzufangen, vielleicht weil diese oft unspektakulären Erfolge »auf zu friedliche Weise erzielt wurden, um in die Geschichtsbücher zu kommen«.4 Fast schon obsessiv konzentrieren sie sich auf das, was in der Moderne bis 1945 katastrophal verlaufen war – kollabierende Demokratien, blutige Kriege, stalinistische Massenmorde und der Holocaust.
Allein Großbritannien und den USA wird zugebilligt, die Idee moderner westlicher Gesellschaften gehütet zu haben. Deutschland dagegen habe auf seinem »langen Weg nach Westen« (Heinrich August Winkler) erst nach dem Krieg endgültig ins Lager der Zivilisation gefunden. Frankreich? Eine instabile Republik, die 1940 beseitigt wurde. Skandinavien? Erfolgreiche Sozialstaaten, denen in der Regel jedoch bloß zwei, drei beiläufige Seiten gewidmet werden: »Nur am Nordrand des Kontinents konnte sich eine effektive parlamentarische Regierungsform halten«5 – mehr erfahren wir nicht. Oft werden Demokratien entweder gar nicht erwähnt oder als bloße Fehlschläge.6 Es sind Berichte eines kollektiven Scheiterns, in denen Europa als »verwilderter Kontinent«7 firmiert. Der britische Historiker Ian Kershaw präsentierte bloß die stalinistische Sowjetunion als damalige Alternative zu den autoritären und faschistischen Regimes, während er die Niederlande, die Schweiz, Skandinavien oder auch Belgien unerwähnt ließ. Er erklärte über Seiten hinweg, wieso Demokratien gescheitert sind, kaum aber, warum einige stabil blieben. Gerhard Besier wollte wissen, weshalb Kontinentaleuropa im 20. Jahrhundert zum »Europa der Diktaturen«8 mutierte. Und während James Sheehan fragte, wieso im Europa der Nachkriegszeit Frieden einzog, betitelte der deutsche Verlag sein Buch mit »Kontinent der Gewalt«.9
Die Politikwissenschaft dagegen fragt nach den Bedingungen, unter denen Demokratien in der Zwischenkriegszeit stabil bleiben konnten. Je nach Studie haben sich etwa 50 Prozent der westeuropäischen Demokratien, die mit Ende des Ersten Weltkrieges begründet wurden, als resistent erwiesen.10 Plötzlich sieht das Bild anders aus. Warum also machen historische Darstellungen die Diktaturen zu etwas so Schicksalhaftem?11 Leisten sie der heutigen Demokratieverdrossenheit indirekt Vorschub, wenn sie die damals funktionierenden Demokratien aus der Geschichte wischen? Nehmen sie nicht ex-post die gesamte europäische Geschichte in die Geiselhaft totalitärer Diktaturen? Charles Maier nannte das »moral narratives«,12 und der Osteuropahistoriker Stefan Plaggenborg hat gefragt: »Sind Mörderregime geschichtlich relevanter als andere, die sich nicht in Massenvernichtung von Menschenleben und Rassismus historisch manifestierten und deswegen historiographisch immer im Schatten der großen Verbrechersysteme stehen?« Seine Antwort lautete: »Um in der deutschen Geschichtswissenschaft wahrgenommen zu werden, bedarf es eines Völkermords. Sonst braucht man über das [untersuchte] Land nicht viel zu wissen.«13
Offenbar haben sich die Ergebnisse der intensiven NS- und Stalinismusforschung zu einer Chiffre verdichtet, sodass die europäische Geschichte zu oft von den Gewalterfahrungen des 20. Jahrhunderts und Ordnung zu sehr vom Terror her gedacht wird.14 Die Zeitgenossen erfuhren ihre Zeit als kontingent, und sie sahen unterschiedliche Pfade in die Zukunft. Unter dem Eindruck totalitärer Systeme reduzierten spätere Beobachter diesen grundsätzlich offenen Blick auf die Binarität von Demokratie und Diktatur. Doch wie will man die Moderne konturieren, wenn man auf Gewalt und Mord fokussiert, ohne zu fragen, warum es eben doch vergleichsweise gewaltfreie Gesellschaften und Situationen geben konnte, trotz Imperialismus, Unsicherheit und Radikalisierung? Den Gewalträumen in der Geschichte standen »Harmonieräume« gegenüber. Neben der mörderischen Entgrenzung im »Dritten Reich« muss man ebenso die Nichtentgrenzung andernorts erklären.
Die »heroische Moderne«
Der Historiker Heinz Dieter Kittsteiner hatte um die Jahrtausendwende mit einer Geschichte der Moderne begonnen, in der er drei aufeinanderfolgende »Stufen« identifizierte: die »Stabilisierungsmoderne« in der Frühen Neuzeit, die »evolutive Moderne« und die »heroische Moderne«. Die erste Phase hat er verblüffend schlicht als reine Fortschrittsgeschichte geschrieben: Vernunft siegt über Tradition, Aberglauben und Irrationalität.15 Die »evolutive Moderne« zwischen 1770 und 1880 habe sich durch Industrialisierung, Globalisierung und Beschleunigung ausgezeichnet und bald als nicht mehr steuerbar erwiesen. An diesem Punkt setzte für Kittsteiner die heroische Moderne ein mit einem unbedingten Glauben an die »Tat«, an »Dezision« sowie die Hoffnung auf einen »neuen Menschen«.16 Warum? Weil es neben dem technischen und sozialen Fortschritt im Zeitalter der Industrialisierung eine ganze Reihe von Verwerfungen und Unsicherheitserfahrungen gegeben hat: soziales Elend, die Emanzipation von Frauen, der politische Aufstieg der Arbeiterschicht, Urbanisierung, Landflucht, Säkularisierung, Individualisierung, die ersten Ansätze mechanisierter und totaler Kriege, unerklärliche Wirtschaftskrisen und das Gefühl, mit der liberalen Laisser-faire-Ideologie in eine Sackgasse geraten zu sein.17
Auf der einen Seite also ein ungeahnter Fortschritt, auf der anderen Seite schien das gesamte gesellschaftliche Gefüge instabil geworden zu sein. Insbesondere die sich verändernde Rolle von Frauen und Arbeitern verunsicherte die (männlichen) Eliten der westlichen bürgerlichen Gesellschaften. Deshalb, so Kittsteiner, hätten Protagonisten wie Oswald Spengler, Carl Schmitt oder Ernst Jünger in der Zwischenkriegszeit das Politische radikalisiert und dem Nationalsozialismus den Boden bereitet. Sie wollten die Geschichte »mit Gewalt ›sinnvoll‹« machen.18 »Antihistoristisch« nannte Kittsteiners Kollege Anselm Doering-Manteuffel diese Haltung. Weil die Entwicklung offensichtlich nicht mehr der Vernunft der Geschichte unterworfen war, wie es der Doktrin des Laisser-faire entsprochen hatte, beschworen Antihistoristen eine vermeintlich überhistorische, organische Sozialordnung, die durch die radikale, dezisionistische »Tat« immer aufs Neue geschaffen werden musste.19 Kittsteiner ließ diese Zeit in einem Bruch 1945 enden – mit Nachläufern bis in die westdeutschen 1950er Jahre, während Ostdeutschland erst 1989 vom dezisionistischen Habitus habe ablassen können. Das ist wenig überzeugend, denn in Westdeutschland fanden Antihistorismus und Dezisionismus bis in die 1960er Jahre Gehör, während sich die DDR doch eher durch eine Verapparatisierung und Bürokratisierung des Dezisionismus auszeichnete, und nicht so sehr durch die »Tat« im Sinne der Zwischenkriegszeit und des Nationalsozialismus.
Kittsteiner hat vor seinem Tod im Jahr 2008 nur den ersten Band seiner Trilogie publizieren können. Wie hätte er die Geschichte der heroischen Moderne erzählt? In seinem Nachlass habe ich einige wenige Hinweise gefunden. Er wäre Großdenkern wie Spengler, Jünger, Lukács, Heidegger, Freud und Marx gefolgt und hätte die Radikalisierung von Nietzsches Denken beschrieben. Er hätte sich auf Protagonisten konzentriert, für die die Geste der Dezision an sich zählte, weniger der Entscheidungsinhalt. »Gedacht, entschieden, gemacht«, charakterisierte der Freiburger Soziologe Wolfgang Eßbach diese Haltung spöttisch.20 Kittsteiner hätte die Vertreter der Tabula rasa, des Wegholzens der alten Gesellschaft auftreten lassen, Heroen, die sich von der Geschichte mit einem Schwerthieb befreien wollten. Nur mit Simmel plante er, einen »der wenigen Versuche […,] sich in der ›Entfremdung‹ zurechtzufinden«, zur Sprache zu bringen,21 und 1945 hätte er uns unvermittelt eine plötzlich zivilisierte Geschichte präsentiert, »die es gelernt hat, von Endlösungen aller Art Abstand zu nehmen, die darauf verzichtet, den dynamischen historischen Prozeß ›stillstellen‹ zu wollen, die aber […] Ausschau hält, wie man ihn vielleicht in jeweils erträgliche Richtungen steuern kann«.22
Es ist interessant, wie überaus deutsch und faschismuszentriert diese Erzählung offenkundig ausgefallen wäre. Die Betonung der Gewalt, die politische Radikalisierung, das reduziert, wie so viele der eingangs erwähnten Synthesen, die Geschichte der Moderne auf den deutschen Sonderfall. In den Entwürfen habe ich nichts gefunden, was auf einen transnationalen Blick schließen lässt. Europa wäre bei Kittsteiner offenbar nicht mehr vorgekommen. Freilich stand er nicht alleine mit dieser eingeschränkten Perspektive. Der Kulturwissenschaftler Helmut Lethen widmete sich in seinen »Verhaltenslehren der Kälte« der These, »daß der Mensch ›von Natur aus‹ zur Destruktion neigt und die Zivilisation einen barbarischen Kern hat«.23 Seine Protagonisten – überwiegend Schriftsteller und Publizisten – waren von der Moderne im frühen 20. Jahrhundert verunsichert, versuchten sich gegen die Umwelt zu verpanzern und Vieldeutigkeit durch klassifizierende Schemata zu bemeistern. Sie waren fasziniert von entscheidungsfreudigen, unkomplizierten Akteuren, für die die Geste der Tat zählte: der gepanzerte Tatmensch gegen die »Kreatur« als bloßen Spielball der Zeitläufte. »Ungeliebte Moderne« hat Eßbach diese Zeit genannt, ungeliebt bei Zeitgenossen, die sich an ihr abarbeiteten.24
Aber hat allein dieser Heroismus die Geschichte der Moderne geprägt? Oder missdeuteten Kittsteiner, Lethen und andere diese Zeit dank eines viel zu engen Personaltableaus? Ein Stadtplaner wie der Brite Patrick Abercrombie oder eine Sozialexpertin wie die Schwedin Alva Myrdal spielten für sie keine Rolle, und Simmel blieb nur Nebendarsteller. Dabei begriffen ein Abercrombie und eine Myrdal sich ebenfalls als Tatmenschen, als Dezisionisten, die die alte Ordnung abräumen mussten. Auch sie erkannten die Gegenwart als dysfunktional. Ihre Methoden und ihre Utopie unterschieden sich jedoch grundlegend von denen der deutschen Heroen. Sie hätten sich mit Simmel verständigen können. Sie waren nicht kalt verpanzert, sondern leidenschaftlich kühl; an anderer Stelle habe ich von der »Romantik des Reißbretts« gesprochen, der Überzeugung, die Utopie einer besseren Welt mit der technischen Rationalität der Moderne verwirklichen zu können.25 Ihre kritische Diagnose der Moderne deckte sich mit der von Kittsteiners Protagonisten, aber sie griffen beide zum Stift, nicht zur Waffe. Der eine zeichnete Pläne, die andere schrieb Memoranden und einflussreiche Bücher.
»Heroische Moderne« ist ein unscharfer Begriff, der zudem an den Nationalsozialismus erinnern mag. Vielleicht wäre es besser, von der dezisionistischen Moderne zu sprechen oder gleich die etablierten Begriffe Hoch- oder klassische Moderne zu übernehmen, selbst wenn diese nicht unbedingt präziser sind, nur genauer datiert. Kittsteiners Begriff allerdings fängt den heroischen Gestus der Zwischenkriegszeit ein, er bringt metaphorisch einzentrales Charakteristikum des europäisch-nordamerikanischen Industriezeitalters auf den Punkt: das Gefühl einer Notwendigkeit, radikal gestalten zu müssen und dies auch zu können. Er ist jedoch verengt, weil er ganz auf extreme und deutsche Tatmenschen abstellt. Wie sähe dagegen eine Geschichte dieser heroischen Moderne aus, die zivile Dezisionisten in den Blick nähme, die Myrdals und Abercrombies? Also diejenigen, die nicht aus den Schützengräben krochen und grimmig in die Städte marschierten, sondern in modernen Stadtwohnungen lebten und sich in Kommissionen, Behörden und Parlamente wählen ließen. Und wie vermiede man dabei eine Verherrlichung oder auch nur unzulässige Verfriedlichung dieser Geschichte, die durchaus ambivalent gewesen ist? Denn tatsächlich war die Geschichte der Moderne eine in Mäandern, Schleifen und Sprüngen.26
»Moderne und Ambivalenz«
Der Soziologe Zygmunt Bauman und der Historiker Detlev J. Peukert haben die Moderne als »ambivalent« beziehungsweise als »janusgesichtig« charakterisiert. Bauman wollte mit seinem Buch Dialektik der Ordnung deutlich machen, dass sowohl Fortschritt als auch Massenvernichtung zwei Seiten der industriellen Moderne waren.27 Das machte für ihn die »Ambivalenz« der Moderne aus: »Ordnung und Chaos sind moderne Zwillinge.«28 Peukert bezeichnete die Jahre zwischen 1880 und 1930 als »klassische Moderne«, die sich durch zahllose Innovationen und zugleich eine Häufung von Krisensymptomen ausgezeichnet habe. Darauf habe es zwei archetypische Antworten gegeben, den New Deal in den USA und den Nationalsozialismus in Deutschland, also eine sozialinterventionistische und eine exterminatorische Reaktion.29
Peukert und Bauman hoben auf ein grundlegendes Unsicherheitsgefühl in der Moderne ab, das, so Peukert, in Deutschland zu einer schließlich gewaltsamen Realisierung der Sehnsucht nach Ordnung geführt habe. Er verglich die Moderne mit dem römischen Gott Janus, in diesem Fall einer »Doppelgesichtigkeit technischer und gesellschaftlicher Prozesse«,30 und er kam »zu dem beklemmenden Urteil, daß Massenvernichtung und Moderne unter bestimmten krisenhaften Bedingungen wahlverwandt sind, daß die systematische Massenvernichtung nach abstrakten, verhaltensunabhängigen Selektionskriterien in einer bürokratisch-großtechnischen Selektions- und Mordapparatur eine mögliche Handlungsvariante ist, die die Krise der Moderne hervorbringen kann.«31 In Deutschland seien die »Widersprüche und die Unübersichtlichkeit der modernen Industriegesellschaft […] in solcher krisenhaften Zuspitzung erfahren [worden], daß die Nazis wie ein großer Teil der mit ihnen kooperierenden übrigen Deutschen auf eine gewaltsame ›Endlösung‹ aller Probleme der modernen Welt setzten«.32 Und er fragte, den deutschen Fall auf Europa extrapolierend, ob eine »solche Barbarei nicht ein untergründiger Bestandteil des Zivilisationsprozesses ist? […] In Deutschland oder anderswo«.33
Bauman äußerte sich ähnlich. Er warf modernen Gesellschaften vor, sie könnten jeweils nur eine einzige Ordnungsvorstellung ertragen und müssten jede Vieldeutigkeit auslöschen. »Ordnung« oder »Chaos«, das seien die beiden Optionen, die modernes Denken geprägt hätten.34 Diesen angeblichen Gegensatz hat Bauman seinerseits in eine wirkmächtige Metapher gehüllt, nämlich diejenige des Gärtners, der Unkraut jätet. Im Gartenbau würden »wertvolle, zum Leben und Gedeihen auserwählte Elemente von anderen, die schädlich und krankhaft sind und daher ausgerottet werden müssen«, getrennt.35»[K]onstruiert werden soll eine künstliche soziale Ordnung, aus der diejenigen Elemente der bestehenden Welt entfernt wurden, die dem erwünschten, perfekten Erscheinungsbild nicht angepaßt werden können.«36 Nur beiläufig sprach er von denjenigen Pflanzen, die gehegt werden sollten, und vollkommen aus dem Blick geriet ihm die Frage, welche Pflanzen eigentlich als Unkraut oder als nützlich bezeichnet werden und wie sich das auch ändern kann.
Baumans Gärtner konzentrierte sich offenbar auf das Jäten, während Peukert das Janusgesicht ausschließlich von einer »Krisenhaftigkeit der industriegesellschaftlichen Modernität« her dachte, »für die das Balancieren am Abgrund eher der Regelfall war und das Austarieren der Widersprüche eher nur im Ausnahmefall gelang«.37 So haben sich beide dank ihrer dichotomischen und zusätzlich verengten Metaphorik der Gelegenheit beraubt, die vielfältigen Möglichkeiten des Umgangs mit Vieldeutigkeit in der Moderne zu würdigen, ähnlich wie es Kittsteiner wohl mit seiner Geschichte der Moderne gemacht hätte und wie es viele Historiker in ihren Synthesen der europäischen Geschichte getan haben.
Die (heroische) Moderne als Epoche
Historische Studien mit dem Wort »Moderne« im Titel diskutieren selten, wie diese Epoche zu konzeptionalisieren sei. Zumeist ist bloß gemeint, dass nicht die Vormoderne behandelt wird, also Antike, Mittelalter oder Frühe Neuzeit. Reinhart Koselleck hat den Begriff der Sattelzeit eingeführt. Demnach begann der Übergang von der Frühen Neuzeit zur Moderne zwischen 1750 und 1850, als sich ein fundamental neues Zeitverständnis durchsetzte, das durch Bewegungsbegriffe charakterisiert war, die auf die Zukunft zielten, und nicht länger durch zyklisches Denken. Ulrich Herbert bezeichnete die Phase der Schwerindustrialisierung zwischen etwa 1880 und 1980 als »Hochmoderne«, Peukerts »klassische Moderne« zwischen 1880 und 1930 hatte ich erwähnt. Für die 1960er bis 1970er Jahre machten Soziologen und Historiker den Beginn der Post-, reflexiven oder zweiten Moderne aus, und die Idee einer weltweit universalen Moderne ist durch Shmuel N. Eisenstadts Konzept der »multiple modernities« aufgebrochen worden, das heißt, dass je nach Region und Zeitschicht »Moderne« anders aussieht.
Man müsste noch Margit Szöllösi-Janzes Konzeptionierung der Moderne als »Wissensgesellschaft«, Christof Dippers Unterscheidung von Basis- und Wahrnehmungsprozessen oder Charles S. Maiers Begriff der »Territoriality« anführen, doch möchte ich diese Überlegungen hier nicht vertiefen.38





























