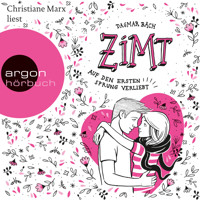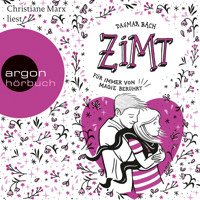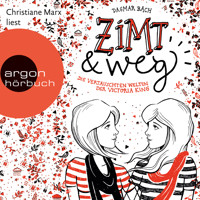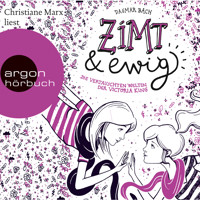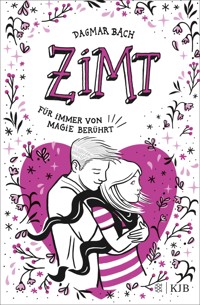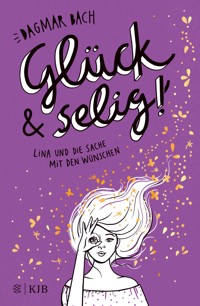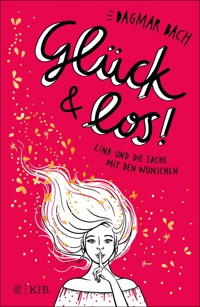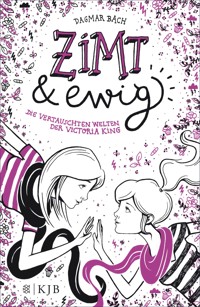12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER Kinder- und Jugend-E-Books
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Junos Bay
- Sprache: Deutsch
Der erste Band der neuen Rom-Com-Trilogie von Dagmar Bach voller Urlaubsfeeling, erster Liebe und mit ein bisschen Magie für Leser*innen ab 12 Jahren Anouk muss ihren Happy Place retten – das Strandhaus ihrer Eltern in der magischen-verträumten Junos Bay an der kalifornischen Küste. Doch leider muss das heimlich geschehen, und leider trudeln plötzlich auch noch mysteriöse Postkarten ein, die Anouk auffordern, die Liebe zu finden, und zwar schnell! Gut, dass Noah da ist, ihr allerbester Kindheitsfreund aus Junos. Wieso ist der allerdings dieses Jahr so anders? Vielleicht, weil er letztes Jahr als Serienstar über Nacht berühmt geworden ist. Und damit eigentlich perfekt geeignet für die Rolle, die Anouk für ihn geplant hat, um endlich das Kartenrätsel zu lösen. Doch was, wenn die aberwitzige Suche nach der Liebe völlig anders ausgeht als erwartet? Fünf Postkarten, die die große Liebe versprechen. Zwei Versionen einer Geschichte, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Und ein Happy Place, der alles verbindet – die neue Cozy Romance von Bestsellerautorin Dagmar Bach - Mit den Tropes Best Friends to Lovers, Fake Dating,He Falls First und Healing - Die Feel-Good-Romane von Dagmar Bach (»Zimt«-Reihe) lassen jeden Alltag leuchten! - Mit knalligem Farbschnitt (nur in der 1. Auflage!) und exklusiv gestalteten Innenklappen
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 419
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Dagmar Bach
Happy
Wo du mich findestJunos Bay Band 1
Band 1
Über dieses Buch
Komm mit nach Junos und finde deinen Happy Place!
Der erste Band der neuen Rom-Com-Trilogie von Dagmar Bach voller Urlaubsfeeling, erster Liebe und mit ein bisschen Magie
Alle Bände der Trilogie:
Happy – Wo du mich findest
Lucky – Was ich dir sagen will
(erscheint voraussichtlich im Frühjahr 2026)
Truly – Was wir uns erträumen
(erscheint voraussichtlich im Herbst 2026)
Weitere Informationen finden Sie unter www.fischer-sauerlaender.de
Biografie
Dagmar Bach, Jahrgang 1978, liebt Harmonie und heißen Tee und hat auch in ihrem Beruf als Innenarchitektin lange dafür gesorgt, dass sich die Menschen um sie rundherum wohlfühlen. Zu ihren eigenen Lieblingsorten gehören ihre Geschichten, die sie sich schon immer ausgedacht hat und seit einigen Jahren aufs Papier bringt. Ihr Debüt »Zimt und weg« rund um Vicky King, die in andere Welten springen kann, erschien 2016 und wurde auf Anhieb ein »Dein-SPIEGEL«-Bestsellererfolg. Seitdem widmet sich Dagmar Bach ganz ihren Büchern und beschert ihren Leser*innen regelmäßig wohlige, lustige und romantische Lesestunden. Die Autorin lebt mit ihrer Familie in München.
Impressum
Zu diesem Buch ist beim Argon Verlag ein Hörbuch erschienen, das als Download und bei Hörbuch-Streamingsdiensten erhältlich ist.
Erschienen bei Fischer Sauerländer E-Book
© 2025, Fischer Sauerländer GmbH,
Hedderichstraße 114, 60596 Frankfurt am Main
Covergestaltung: Petra Braun
Coverabbildung: Petra Braun
ISBN 978-3-7336-0607-7
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
[Widmung]
Prolog
Teil I
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
Teil II
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
Teil III
37. Kapitel
38. Kapitel
39. Kapitel
40. Kapitel
41. Kapitel
42. Kapitel
43. Kapitel
44. Kapitel
45. Kapitel
46. Kapitel
47. Kapitel
Epilog
Für alle, die insgeheim an ein kleines bisschen Magie in unserer Welt glauben.
Prolog
»Geh zu deinem Lieblingsort und lerne die Liebe mit mir ganz neu kennen!«
Für einen kurzen Moment starrte ich verwirrt auf die Werbepost, die ich gerade aus dem Briefkasten geholt hatte. Was war das, eine neue Datingplattform? Die sollten mal ein bisschen an ihrer Rhetorik arbeiten, mich kriegten sie so jedenfalls nicht.
Aber ich hatte für so was ohnehin keine Zeit. Schnell kritzelte ich die Abfahrtszeiten auf, die ich gerade rausgesucht hatte, und stopfte die Karte in meine Jackentasche, ehe ich loslief.
Ich hatte so viel vor.
Und niemand durfte davon erfahren …
Teil I
Anouk
1.
»MAGIC! MAGIC! MAAAGIC!!!« Mein Körper, der gerade noch so schön geschlafen hatte, sprang vor Schreck so weit nach oben, dass ich mir den Kopf an der Gepäckablage über mir anstieß. Ich dachte, mein Herz würde im nächsten Moment kollabieren, meine Hand tastete automatisch zu meinem Hals, meiner Brust – o Gott, vielleicht war mein Herz wirklich stehen geblieben –, so lange, bis Joshua sich neben mir genüsslich streckte und sagte:
»Na, der Busfahrer hat aber eine ausgeprägte Eighties-Phase, oder? Queen? Ernsthaft?«
Erst in diesem Moment dämmerte mir, dass es Freddy Mercury gewesen war, der in mein Ohr geplärrt hatte und jetzt weiter im Hintergrund A Kind of Magic sang. Mit Schweißperlen auf der Stirn ließ ich mich zurück in meinen Sitz plumpsen.
»O Mann.«
»Ja, hab ich auch lange nicht gehört. Aber hey, Anouk, endlich bist du wach. Wie lange fahren wir noch?« Mein Kumpel Josh fing an, seelenruhig in seinem Rucksack zu kramen, ohne mich auch nur einmal anzusehen. Wahrscheinlich würde es ihm wirklich nicht auffallen, wenn ich neben ihm tot umfiele.
Ich rieb mir die Augen und blickte aus dem Fenster. Die Sonne stand hoch am Himmel, ich musste Stunden geschlafen haben. Der Bus fuhr gerade an einer kleinen Ansammlung von Häusern vorbei. Ich erkannte eine Tankstelle, ein paar Wohnhäuser und ein schäbiges Lokal. Die Gebäude sahen aus wie alle hier unten an der Küste, niedrige Bauten mit weißen Sprossenfenstern und ein paar halb vertrockneten Sukkulenten und Kräuterbüschen auf dem schmalen Streifen zwischen Shop und Parkbuchten. Auf der rechten Seite lag das Dunkelgrün eines scheinbar endlos langen Kiefernwalds, und ich wusste ganz genau, wo wir waren.
»Vielleicht noch eine halbe Stunde«, sagte ich, als plötzlich die Musik verstummte, was mich irgendwie genauso erschreckte wie das Hochdrehen der Lautstärke eben.
»Hey, Leute, Zeit aufzuwachen!«, plärrte der Busfahrer ins Mikro. »Mir ist langweilig hier vorn, also dachte ich, wir bringen mal etwas Leben in diesen Bus!« Sein weißer Rauschebart wackelte, während er sprach, er sah damit aus wie ein aufgekratzter Weihnachtsmann auf dem Weg zu einem Kurzurlaub auf Hawaii. »Alle, die nach Süden wollen, machen mal ein bisschen Lääärm!«
Im nächsten Moment kreischte ein Gitarrensolo über die Anlage, das ich bis in meine Eingeweide spürte. Ich starrte wie paralysiert nach vorn. War ich aus dem Tiefschlaf direkt in einem Cluburlaub gelandet?
Es war fünf Uhr morgens gewesen, als Josh und ich in San Francisco eingestiegen waren – leider gab es keine schnelle Verbindung, sondern nur diesen einen Bus, der gefühlt alle Haltestellen in der gesamten Bay Area anfuhr. Aber ich hatte keine Wahl, und fast war ich froh, dass ich noch ein bisschen Zeit gehabt hatte, mich auf das vorzubereiten, was ich plante.
Zum ersten Mal fuhr ich statt mit dem Auto mit dem Bus zu dem kleinen versteckten Ort, in dem ich jeden einzelnen Sommer meines Lebens verbracht hatte.
Und zum ersten Mal tat ich es heimlich.
Joshua, mein bester Freund, war sofort Feuer und Flamme gewesen, als ich ihn gefragt hatte, ob er mitkommen will. Dabei war unsere Mission heikel: Wir mussten nicht weniger als meinen Lieblingsort retten.
Und vielleicht auch ein bisschen mich selbst.
Das behauptete zumindest Josh, der viele Worte und noch viel mehr Eiscreme darauf verwendet hatte, damit ich in den letzten paar Wochen nicht durchgedrehte. Dabei fand ich, dass ich sehr erwachsen reagiert hatte, als mein Ex Luca per Hashtag pünktlich zum Ferienstart mit mir Schluss gemacht hatte (#abindenurlaub #endlichwiedersingle). Also, einigermaßen erwachsen reagiert. Wenn man mal von meiner Nachricht an ihn absah, dass seine Nase mich immer schon an diesen Felsen im Yosemite National Park erinnert hatte. Und von der anderen kleinen Sache, die ich daraufhin bei seinem Social-Media-Account gemacht hatte. Ja, das war beides furchtbar kindisch gewesen, aber – ebenfalls ja – ich würde es jederzeit wieder tun.
Doch an besagten Ex wollte ich jetzt nicht denken, und Josh holte mich auch sofort wieder in die Gegenwart zurück. Sein Knie wippte schon die ganze Zeit im Takt zur Musik gegen meines, und er verrenkte den Kopf, um sich im Bus umzublicken.
»Ganz schön voll geworden«, stellte er zufrieden fest. Joshua liebte Menschenmengen. Das ganze Leben war für ihn eine einzige Party. Je mehr Leute, desto besser, egal wo, selbst in einem stinknormalen Bus.
Wobei, so normal war der eigentlich gar nicht. Der Busfahrer jedenfalls war im letzten Jahrhundert definitiv DJ gewesen, denn nun wechselte die Playlist zu einer Hip-Hop-Version des Flashdance-Soundtracks. Ein paar College-Kids in der Mitte des Busses, die offenbar wie wir auf dem Weg ans Meer waren, kreischten auf und fingen lauthals an mitzusingen.
Jetzt konnte nichts und niemand mehr Josh halten. Er sprang auf, warf mir eine Kusshand zu und bahnte sich dann einen Weg zu der Partygruppe nach hinten, die Luftgitarre fest in den Händen.
»He’s a maniac, maniac on the dancefloor«, grölte er mit, zog eine junge Frau auf die Beine und wirbelte sie durch den Gang.
Sofort waren die beiden umringt von Leuten, die klatschten und ziemlich schräg zu den Klängen aus den Lautsprechern mitjohlten.
Ich grinste, als Joshua seine Partnerin in eine hollywoodmäßige Drehung dirigierte. Durch das Schwanken im Bus sah es allerdings eher so aus, als ob die beiden versuchten, auf einem Schiff bei hohem Wellengang nicht über Bord zu gehen. Hoffentlich wurde das Mädel nicht seekrank.
Und hoffentlich verliebte sie sich nicht sofort in Joshua, wäre nicht das erste Mal.
Plötzlich tippte mir jemand auf die Schulter.
»Anouk! Sitzt du etwa schon die ganze Zeit vor mir in diesem Bus?«
Ich sah mich um und riss die Augen auf. »LaShawn?« Die raspelkurzen hell blondierten Haare, die fast schwarzen Augen und das zauberhafte Lächeln, ich hätte sie überall erkannt. »Das gibt’s doch gar nicht!«
Genau wie ich kam LaShawn Mabutte schon ihr halbes Leben in diesen kleinen versteckten Ort an der kalifornischen Küste, den die Einwohner und Urlaubsgäste als Geheimtipp hüteten wie eine Drachenmutter ihr goldenes Ei.
Nach Junos.
Ehe ich es noch richtig kapiert hatte, zog sie mich in eine herzliche Umarmung, die sich anfühlte, als ob ich mit einer voll bepackten Langhantel kuschelte.
»Du hast in der Zwischenzeit ein bisschen Sport gemacht, oder?« Ich fühlte mich sofort noch weicher als sonst schon.
LaShawn lachte ihr ansteckendes Lachen. »Das ist der Nebeneffekt eines College-Sportstipendiums, Süße.« Sie drückte mich noch mal, als sich zwei Zweimetermänner hinter ihr entfalteten und nach vorn drängten, einer strohblond, der andere mit blauschwarzem schulterlangem Haar. »Anouk! Wir wollen auch«, riefen sie und zogen mich nacheinander in ihre bärenstarke Umarmung. »Wir haben dich vermisst!«
»Kyle? Ian?«, fragte ich ungläubig. »Sagt mal, hab ich ein Memo nicht bekommen, oder warum ist die halbe Junos-Campingplatz-Clique in diesem Bus?«
LaShawn kicherte. »Eher drei Viertel. Kyle, Ian und ich kommen ja traditionell zusammen mit dem Bus, aber rate mal, wer noch am Flughafen in Oakland zugestiegen ist?«
Ich reckte den Kopf, um zu sehen, wen sie meinte. Im hinteren Teil waren viele Vorhänge vor die Fenster gezogen. Die meisten Leute fläzten sich mit Kopfhörern in den Ohren auf ihrem Sitz, einige mit geschlossenen Augen, vermutlich um Joshua und die Mädels auszublenden, während eine Mutter von drei kleinen Kindern versuchte, diese davon abzubringen, direkt zu Josh zu rennen und mitzutanzen. Mal sehen, wer diesen Kampf gewann. Auf der letzten Bank hatten sich zwei Typen ausgebreitet, die ich kaum sehen konnte, weil sie so schräg in ihren Sitzen lagen.
»Na, wenn das nicht die kleine Anouk ist.« Mit einem für ihn so typischen süffisanten Lächeln schlenderte eine schlanke Gestalt auf mich zu, den unvermeidlichen Bucket Hat tief ins Gesicht gezogen. Ich traute meinen Augen nicht.
Das war ja Jackson!
Ich knuffte ihm die Faust in die Brust. »Hey, ich bin nicht mehr klein. Vielleicht ein bisschen kurz geraten, aber ich bin fast genauso alt wie du!« Ich schaute ihn an. »Was machst du hier? Musst du nicht – keine Ahnung – gerade irgendwo in Nepal sein oder so?«
»Die Saison am Everest ist schon vorbei«, meinte er nur und zwinkerte.
Im Gegensatz zu LaShawn und mir machte Jackson keinen Urlaub in Junos, sondern war dort geboren. Sein Bruder Mo betrieb die kleine Surferbar am Strand – und war dazu einer meiner Lieblingsmenschen in diesem Ort.
»I was born to looouuuve you!!!«
Josh eskalierte zum nächsten Song im Mittelgang, und ich warf einen besorgten Blick zum Busfahrer, aber der schien höchst zufrieden, was die Stimmung anbelangte. Eine Reihe erschreckend weißer Zähne funkelte mich aus dem Spiegel an, während sein Wallebart vor Lachen wackelte. Hoffentlich konnte er sich noch ausreichend auf die Straße konzentrieren, die jetzt deutlich kurviger war, seit wir den Freeway hinter uns gelassen hatten.
»Wer ist denn eigentlich das Goldkehlchen, das du mitgebracht hast?«, fragte LaShawn und sah an mir vorbei nach hinten zur tanzenden Meute. »Dein Freund?«
Ich schüttelte den Kopf. »Joshua ist ein Freund.«
Passenderweise grölte Josh jetzt in meine Richtung: »I was born to take care of you, honey, every single day of my liiiiffffffeeeee!«
Er winkte mir, und ich winkte zurück wie eine Mutter einem Kind, das auf dem Spielplatz richtig Gas gab. Was so ungefähr die exakte Beschreibung dieser Situation war.
»Midpines Trailhead!«, plärrte der Fahrer plötzlich so laut in sein Mikro, dass es eine Rückkopplung gab und ein Pfeifen durch den ganzen Bus schrillte.
Ich erhob mich von meinem Sitz und schnappte mir Rucksack und Jacke aus der Gepäckablage über mir, während auch Kyle, Ian und LaShawn ihren Kram zusammensuchten. Von hier aus starteten einige der bekanntesten Hiking-Trails der Gegend, aber es gab auch einen versteckten Pfad durch den Kiefernwald hinunter ans Meer. Er endete in Junos, wo meine Eltern ein Ferienhaus besaßen.
Und genau wegen dieses Hauses war ich hier.
»Hey, Anouk, gehört der dir?« Kyle bückte sich und griff nach einem Zettel, der mir aus der Jacke gefallen war.
Ich nahm ihn entgegen. »Geh zu deinem Lieblingsort und lerne die Liebe mit mir ganz neu kennen!« Der Spruch war immer noch total bescheuert, vor allem als Werbeslogan, aber ich hatte die Karte wegen der Busfahrzeiten für die Rückfahrt aufgehoben. Ich hatte Josh nämlich eine wichtige Sache verschwiegen: Junos war so abgelegen, dass die Internetverbindung manchmal nicht so ganz stabil war. Das hätte ihm ein bisschen die Vorfreude genommen.
Der Bus bremste ab, und ich winkte Joshua.
»Müssen wir schon raus?« Joshua sah bestürzt aus. Der Busfahrer und die Mädels im Gang schienen nicht weniger erschrocken. Vermutlich hätten sie Joshua am liebsten an einen der Badeorte in den Süden mitgenommen, wohin sie vermutlich unterwegs waren.
Fast taten sie mir leid.
»Ich bin ungern die Spaßbremse, aber wir sind da. Wir haben eine Mission. Außerdem gibt es weiter südlich diese fiese Squirrelart, die einem ständig an den Zehen knabbern will.«
Joshua verzog das Gesicht und hatte seine Sachen so schnell zusammengerafft, dass ich lachen musste. Ich hatte keine Ahnung, was er an den niedlichen Tierchen so gruselig fand.
»Los geht’s, Anouk, auf ins Abenteuer!«
Das ließ ich mir nicht zweimal sagen.
2.
Joshua kam schnaufend neben mir zum Stehen. Kurz nach der Bushaltestelle hatten wir die Hauptwege des Hikingnetzes hinter uns gelassen und den Trampelpfad durch den Wald genommen, der genau wie der Ort selbst so geheim wie möglich gehalten wurde. Ein schmaler, staubiger Trail schlängelte sich unter den Bäumen und zwischen Büschen von wildem Rosmarin und Salbei hindurch, und es duftete nach Kräutern und Sommer und schon ein bisschen nach Salz und Meer. An den Stellen, an denen der Weg den Schatten verließ, brannte die kalifornische Sonne auf unsere Haut, aber der leichte Wind machte das mehr als erträglich.
Ich war die Erste an der Bustür gewesen, und kaum hatte sie sich zischend geöffnet, war ich schon losgeschossen. Plötzlich hatte ich es nicht mehr erwarten können, endlich nach Junos zu kommen.
»Du hast nicht gesagt, dass wir noch meilenweit laufen müssen«, keuchte mein bester Freund hinter mir und stöhnte theatralisch auf.
Ich drehte mich zu ihm um und ging ein paar Schritte rückwärts. »Es gibt keine Bushaltestelle in Junos. Die Straßen unten im Ort sind so schmal, dass der Bus nur schlecht wenden könnte. Die Leute kommen gerade so mit ihren eigenen Autos dorthin.« Wenn auch nicht überallhin.
Er verzog das Gesicht und wischte sich mit dem Ärmel seines T-Shirts den Schweiß von der Stirn. »Und das verrätst du mir jetzt erst?«
»Sorry.«
War allerdings volle Absicht gewesen. In manchen Dingen war Joshua nämlich eine kleine Diva. Er konnte den ganzen Tag tanzen und rennen und springen, aber wenn es an die schnöde Fortbewegung von A nach B ging, wurde er plötzlich zum fußkranken Greis.
»Über die Zufahrtsstraße wäre es gut zwei Meilen länger gewesen«, sagte ich betont fröhlich.
Er gab einen schnorchelnden Laut von sich. »Und wie weit ist es jetzt noch?«
»Zehn Minuten!«, schmetterte LaShawn, die gerade mitsamt ihrem Board aus dem Wald brach. »Komm mit, Goldkehlchen, gemeinsam schaffen wir das!«
Während sie, Kyle, Jackson, Ian und Joshua johlend den Fußweg bergab liefen, blieb ich einen kurzen Moment stehen, schloss die Augen und sog noch einmal die Luft tief in meine Lungen. Der Geruch, der mich umhüllte, ließ beinahe meine Knie schwach werden. Er war würzig, salzig und voller Verheißung. Der heiße Wind zerzauste die Haare, die sich seit heute Morgen aus meinem Haarknoten gelöst hatten, und wirbelte den trockenen Staub auf dem Weg vor mir auf. In einiger Entfernung krächzte eine Möwe, doch sonst war es bis auf die verklingenden Stimmen ganz ruhig, als ob wir an einem Ort gelandet wären, der fernab jeglicher Zivilisation lag. Das stimmte zwar nicht, aber wer in Junos war, der fühlte sich oft so, als ob er in einer anderen Welt gelandet wäre. In einer besseren Welt.
Und erst in diesem Moment wurde mir die Wichtigkeit meiner Mission klar. Auch wenn meine Mutter Junos von der Landkarte gestrichen hatte, seit mein Dad hier seine große Liebe kennengelernt und damit unsere Familie zerstört hatte, blieb es mein Lieblingsort. Und auch wenn ich jetzt heimlich herkommen und meiner Familie einen Haufen Lügen auftischen musste, hatte ich die richtige Entscheidung getroffen.
Ich ging ein paar Schritte weiter zu dem Ortsschild aus dunklem Holz, das, halb verborgen unter einem herabhängenden Zweig, den Ortsanfang markierte.
Willkommen in Junos. 327 Einwohner, stand da in weißen Lettern.
Darunter war ein zweites, schmaleres Schild, das nicht ganz so verwittert war und nicht zu dem restlichen Aufsteller passte.
Vorsicht, dieser Ort ist magisch!, war dort in ungelenken Buchstaben eingeritzt, die unregelmäßigen Furchen mit blauer Farbe nachgemalt.
Ich trat einen Schritt nach vorn und fuhr jeden einzelnen Buchstaben mit dem Finger nach, ein Ritual, das ich, seit ich denken konnte, bei jedem meiner Besuche hier gemacht hatte. Ich war immer der festen Überzeugung gewesen, dass es mir Glück brachte.
»Kind of magic«, hörte ich eine dunkle Stimme hinter mir, in der ein Lachen schwang. »Dank Santa Claus hab ich die nächsten Tage ganz sicher einen Ohrwurm.«
Ich wirbelte herum. »Was zum …?«
Die Worte steckten in meinem Hals fest wie die staubtrockenen Kekse vorhin, die Joshua am Anfang unserer Reise aus seinem Rucksack gezogen hatte.
Eine Sekunde verging, dann noch eine. Und noch eine.
Schließlich beugte sich mein Gegenüber wie ich eben zum Schild und hob den Zeigefinger, um ebenfalls die Worte nachzuziehen. Wir beiden hatten es gemeinsam gemalt, da waren wir sieben oder acht gewesen. »Ich dachte schon, ich komme zu spät für unser Ritual«, sagte er leise.
Noah. Da stand wirklich Noah vor mir.
Doch sein Blick, sogar sein Tonfall war fast vorsichtig. Abwartend.
Verblüfft sah ich den schmalen Waldweg entlang Richtung Straße und Bushaltestelle, von dem wir gerade gekommen waren, dann wieder zurück zu ihm, aber ich brachte immer noch kein Wort heraus.
Jetzt funkelten seine grünen Augen vor Belustigung. »Anouk, muss ich mir Sorgen machen? Ich kenne dich mein ganzes Leben. Seit wann weißt du nicht, was du sagen sollst?«
Doch! Das wusste ich! Ich wollte so viel sagen. Allerdings kam in diesem Moment nichts wirklich Schlaues heraus. »Wer saß eigentlich noch alles in diesem Bus?«, sprudelte ich los. »Vielleicht meine Mum? Oder der alte Alvaro? Oder dein noch älterer Wellensittich?«
»Der ist leider vor ein paar Monaten gestorben«, sagte er todernst. »Aber der Rest – du meinst außer Jackson, LaShawn, Kyle, Ian und mir?« Er lächelte wieder dieses besondere Lächeln, das ich noch nie an jemand anders gesehen hatte. Er tat dabei das Ding mit seinen Mundwinkeln, sie kräuselten sich auf eine Weise, dass Grübchen entstanden und man fast gar nicht anders konnte, als mitzulächeln. Früher hatte ich geglaubt, er machte das nur bei mir. Heute kannte dieses Lächeln allerdings die ganze Welt.
»Tja, nicht umsonst sagt man, dass Junos magisch ist, oder?«
Endlich lösten sich die Spannung und Verkrampfung in mir. Ich ließ meinen Rucksack wieder auf den staubigen Weg neben mich fallen und tat das Einzige, was in dieser Situation angemessen war: Ich ging die letzten Schritte hinüber zu ihm, schlang meine Arme um seine Taille und drückte ihn so fest an mich, dass er leise ächzte.
»Hallo, Noah.«
Er zögerte einen Moment, doch schließlich legten sich seine Arme auch um mich.
»Hey, Anouk«, flüsterte er an meinen Haaren, und ich schloss die Augen, weil mich eine Welle von Glück durchflutete.
Noah war hier! Mein bester, allerbester Freund aus Kindheitstagen. Der Noah, mit dem ich bisher jeden Sommer in Junos verbracht hatte, weil seinen Eltern das Ferienhaus neben unserem gehörte. Der Noah, der als Einziger wusste, dass ich als Elfjährige einen Crush auf meinen damaligen Kunstlehrer Mr Santos gehabt hatte. Der wusste, dass ich Kaffee liebte, Vanilla-Creamer und Rice-Krispies-Treats. Der meine Leidenschaft fürs Surfen teilte. Der Noah, der immer so gut roch, sodass ich heimlich seine Waschmittelmarke kaufte, die dann trotzdem an ihm noch besser roch. Und der leider dabei gewesen war, als ich beim letzten Laternenfest mit dieser peinlichen Sommerentgleisung namens Dustin herumgemacht hatte, was mich im Nachhinein beinahe vor Scham im Boden versinken ließ. Der Noah, dessen Welt sich im letzten Jahr von jetzt auf gleich total verändert hatte. Noch sehr viel mehr als meine.
Ich ließ ihn los, und wir standen uns wieder gegenüber.
»Du siehst … anders aus«, sagte ich, und er blickte an sich herunter, aber natürlich meinte ich nicht seine Klamotten, die so ziemlich die waren, die ich von ihm kannte: Shorts, dunkles T-Shirt, Sneakers. Auch sein Aussehen war es nicht, obwohl er noch größer war, als ich ihn in Erinnerung hatte. Sein Rücken war breiter und seine Arme muskulöser. Bartstoppeln verdunkelten sein Kinn, und seine dunkelbraunen Haare waren länger als sonst. Wenigstens fielen sie ihm auch ständig ins Gesicht wie bei uns Normalsterblichen. Wenn auch ziemlich elegant.
Aber all das meinte ich nicht.
Es war der Ausdruck in seinen Augen. Da war etwas, das früher nie da gewesen war. Das ich überhaupt nicht einordnen konnte. Nur traute ich mich nicht, dazu etwas zu sagen, weil ich nicht wusste, ob es zwischen uns noch so war wie früher.
»Was tust du ausgerechnet jetzt in Junos?«, fragte ich stattdessen betont fröhlich. Ich konnte mir vorstellen, dass bei ihm gerade die Hölle los war.
Er lächelte. »Ich flüchte. Vor jemandem, der meinen Sommer ruinieren will.« Seine Mundwinkel sanken für einen winzigen Moment, um sich gleich wieder zu heben. »Und du?«
»Ich flüchte auch«, sagte ich mit einem Schulterzucken. »Vor jemandem, der meinen Sommer schon ruiniert hat.«
Noah stutzte einen Moment. »So schlimm?«
Ich hätte mich ohrfeigen können, dass ich davon angefangen hatte, denn eigentlich wollte ich ja gar nicht über meinen Ex reden. Nicht mal daran denken. »Nein, eigentlich bin ich hier, um mich um das Haus zu kümmern.« Dann griff ich nach seiner Hand und zog ihn mit. »Komm, wir müssen schauen, ob Junos noch da ist.«
»Wo sollte es denn hin sein?«, fragte er zurück, ließ mich aber nicht mehr los. Mit den freien Händen nahmen wir unsere Rucksäcke und überquerten im Laufschritt erst die Straße und dann die alte Brücke, die über ein ausgetrocknetes Flussbett führte. Keuchend und voller Erwartung blieben wir schließlich an der Stelle zwischen den Pinien stehen, von der man den ersten Blick auf Junos hatte.
»Schau!«, presste ich andächtig hervor. Er sah mich an, plötzlich auch ernst geworden, und da konnte ich gar nicht anders, ich drückte ihn noch mal kurz an mich, denn ich war in Junos, und Noah war hier, und egal, was zu Hause wegen der Scheidung passierte, und egal, dass ich meine Eltern von vorn bis hinten anlog, indem ich behauptete, zu Hause mit Josh abzuhängen, dieser Sommer konnte ab jetzt nur gut werden. Es war, als ob sich im Moment meiner Ankunft das verflixte zurückliegende Jahr mitsamt seiner vielen Tiefpunkte und blöden Verwindungen in Luft aufgelöst hätte. Denn dieser Bus hatte auf wirklich magische Art und Weise all die Menschen hierhertransportiert, die mir wichtig waren.
Und so standen wir Seite an Seite da und schauten hinunter. Die kleine Ortschaft mit ihrem kunterbunten Sammelsurium aus Häusern zwischen dem vielen Grün lag friedlich im Sonnenschein. Vor ihr breitete sich halbmondförmig die Bucht mit dem traumhaft weißen Strand aus, gesäumt von glatten silbergrauen Felsen. Mein Blick wanderte von der vertrauten Fassade des Hauses auf der südlichsten Klippe, wo der alte Alvaro wohnte, hinüber zur Zufahrtsstraße. Sie schlängelte sich an dem schnuckeligen Minizentrum mit der Handvoll Läden vorbei bis zum Fußweg oberhalb des Strandes, um schließlich am nördlichen Ende der Bucht vor den letzten drei Häusern des Ortes zu enden – gebaut auf einem hohen Felsvorsprung, jedes mit einer eigenen Treppe zum Strand.
Und vor all dem: das Meer.
Das endlos weite Meer.
Noah seufzte tief neben mir auf, und ich hörte alles in dem Seufzer, was ich auch fühlte. Glück, Zufriedenheit und die unbestimmte Sehnsucht, die man immer hatte, wenn man hier war. Dass man niemals wieder gehen wollte. Dass man die Zeit anhalten wollte. Dass man nicht wollte, dass sich überhaupt noch irgendetwas änderte im Leben.
Geh zu deinem Lieblingsort … kam mir plötzlich der Werbepostkartenspruch wieder in den Sinn. Die passte jetzt aber so was von. Und noch vor einer Woche hätte ich im Traum nicht daran gedacht hierherzukommen. Was für eine lustige Fügung.
Ich tastete nach Noahs Hand und drückte sie fest. »Die Musikauswahl im Bus war eben echt gewöhnungsbedürftig«, sagte ich mit einem tiefen Ausatmen. »Aber mit A Kind of Magic hat der Busfahrer absolut richtiggelegen.«
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, in meiner allerersten Podcastfolge verrate ich euch gleich zwei Geheimnisse. Das erste ist eigentlich keins, denn – Trommelwirbel – heute habe ich hier bei mir einen Gast im Studio, und zwar: Noah Evans, Singer und Songwriter und mein Schauspielkollege aus Rising Star. Und das zweite ist: Eigentlich wollte ich einen Podcast starten mit dem Titel Rich & Famous. Das war mein Plan, und diese erste Folge passt eigentlich so super dazu, denn Noah und ich sind beide reich und berühmt, und das noch nicht mal so lange. Okay, Noah, du bist vielleicht noch ein bisschen reicher und berühmter als ich, viel reicher und berühmter, weil du die Hauptrolle in unserer Serie hast, aber ich bin auch nicht so schlecht, immerhin habe ich von Fans schon sieben Heiratsanträge bekommen, von denen mindestens zwei ernst gemeint waren. Hast du schon Heiratsanträge bekommen seit dem Serienstart? Nicht flunkern, ich merk das.
Ich –
Nein, sag nichts! Du wirst gerade total rot, das sagt schon alles: Leute, was ihr nicht sehen könnt, der große Noah Evans errötet wie ein Zwölfjähriger, wenn er solche Fragen bekommt. Doch nicht so ein Bad Boy wie auf der Leinwand, oder?
Hab ich nie behauptet. Aber du bist auch nicht so eine brave, zurückhaltende beste Freundin wie auf der Leinwand.
Hach, tja, ich hätte gerne ein bisschen mehr Biss, das muss ich schon sagen. Aber irgendjemand muss in Rising Stardie Gute sein. Und Cyrils Gewissen spielen, wenn er selbst schon keines hat.
Mach dir mal um Cyrils Gewissen keine Sorge!
Egal, worauf ich hinauswill, ist eigentlich: Dieses Rich & Famous-Thema langweilt mich eigentlich, denn es gibt etwas viel Spannenderes. Etwas, das ich gerade im Vorgespräch mit Noah herausgefunden habe. Passt auf: Ihr alle kennt ja diese True-Crime-Podcasts, oder? Ich werde nie verstehen, warum die Leute sich freiwillig so was reinziehen, das wäre mir alles viel zu gruselig, aber genau das ist das Ding: Von Noah habe ich ein paar Geschichten gehört, Legenden um ein Dorf, dessen Namen ich hier nicht nenne und schon gar nicht, wo es sich befindet. Denn es gibt Orte auf der Welt, die etwas ganz Besonderes sind. Orte, an denen es eventuell nicht mit rechten Dingen zugeht. Orte, an denen fast zauberhafte Sachen passieren. Wie dieser eine Ort eben, den Noah kennt. Und ich wäre nicht Bailey Harris, wenn ich diesen Dingen nicht auf den Grund gehen wollte! Deshalb dachte ich – Noah, mach bitte nicht so ein Gesicht –, deshalb dachte ich, dass ich meinen Podcast direkt in der ersten Folge umbenenne in: True Magic – Der Magie auf der Spur. Kling super, oder? Und in der ersten Staffel geht es natürlich um Noahs Legendenort. Und was dieser Legendenort damit zu tun hatte, dass aus Noah Evans DER Noah Evans wurde, den die halbe Welt liebt. Also, ihr dürft gespannt sein. Du auch, Noah, auch wenn du gerade aussiehst, als ob dir eine Wurzelbehandlung bevorsteht.
3.
»Wen genau habt ihr eigentlich umgebracht, um an dieses Grundstück zu kommen? Muss ich da was wissen? Bist du vielleicht in irgendeinem Zeugenschutzprogramm?« Joshua wartete mit strahlendem Gesicht vor unserem Haus, das als mittleres in einem Ensemble aus drei Häusern das nördliche Ende von Junos bildete.
Noah und ich hatten einen kleinen Junos-Begrüßungsrundgang absolviert, bevor er im Ortszentrum abgebogen war, wo die einzigen drei Geschäfte von Junos lagen. Er hatte nachsehen wollen, ob Camilles Laden offen hatte, der Gute. Offenbar war er immer noch ein Optimist.
Ich dagegen war zwischen den Grundstücken den kürzeren Fußweg heruntergekommen, der zwischen Zypressen, Küsteneichen und wilden Hecken direkt zum äußersten Rand der Bucht führte. Ich war immer schneller und schneller geworden, denn die Vorfreude war mit jedem Schritt und mit jedem Blick auf das tiefblaue Meer, das sich unter mir ausbreitete, größer geworden.
Und jetzt, jetzt war ich hier.
Von weiter vorn am Strand, wo die Strandbar und der Campingplatz lagen, drangen leise Musikfetzen und entfernte Stimmen zu uns herauf, aber hier am anderen Ende der Bucht herrschten Stille und Frieden.
Alles sah exakt so aus wie immer. Das graue Schindeldach mit den kleinen Giebelfenstern, darunter die hellgraue Holzfassade mit den weißen Sprossenfenstern, deren Farbe immer wegen der salzigen Luft abblätterte, egal, wie oft man sie strich. Den Natursteinweg rund ums Haus, der jedes Jahr von wilden Büschen überwuchert wurde. Und die große Terrasse nach hinten, direkt über dem Meer. Ich fühlte, wie die Wärme des Hauses mich sogar hier draußen umfing.
Ich atmete tief durch. Mein Lieblingsort. Mein Happy Place.
Und jetzt musste ich sehen, wie genau ich ihn retten konnte. Möglichst unauffällig.
»Erde an Anouk?« Josh wedelte mit den Händen vor meinem Gesicht herum, um mich aus meinem tranceartigen Zustand zurückzuholen.
Ich warf ihm eine Kusshand zu, kramte in meiner Tasche nach dem Schlüssel und schloss auf. Ich habe keine Ahnung, was genau ich erwartet hatte, als ich die Haustür aufstieß. Aber sicher nicht, dass uns eine Luft wie in einem Palmenhaus eines botanischen Gartens entgegenschlug. Fast rechnete ich damit, dass sich an den Lampen kleine Äffchen entlangschwangen und Papageien von den Vorhangstangen kreischten. Die Luft war zum Schneiden dick, feucht und warm, aber wenigstens nicht extrem muffig.
Dafür war der helle Holzboden vor uns nicht eben, sondern wellig wie das Meer bei Windstärke drei, mindestens. Durch die Wellen waren die Fugen aufgeworfen, und sogar die Fußleisten hatte es stellenweise von der Wand gesprengt.
Ich ging ein paar vorsichtige Schritte ins Halbdunkel des Hauses hinein. In der Mitte des Eingangsbereichs lag ein schmaler Kelimteppich, der schmatzende Geräusche von sich gab, als ich mit meinen Sneakern darüber ging.
»Was zur Hölle?«, murmelte Joshua, und ich hörte das dumpfe Aufschlagen seines Rucksacks auf den Boden.
Genau wie ich starrte er in den Wohnbereich, der vor uns lag. Vor den Fensterfronten, die auf die rechtwinklige Terrasse herausgingen, waren Klappläden angebracht, die kaum Licht hineinließen. Aber es genügte, um das Ausmaß des riesigen Lochs im Boden zu erkennen, das sich quer von den Sofas hinüber zur Kochinsel zog. Die schönen Holzdielenbretter waren einfach herausgerissen, genau wie die Trägerplatten des Holzbodens darunter, als ob jemand mit der Axt hineingedroschen hätte. Oder Thor mit seinem Superhammer.
Der restliche Boden war noch welliger als im Eingangsbereich, ich wurde allein vom Hinsehen fast seekrank. Es war ein einziges Schlachtfeld.
Camille, die sich um das Haus kümmerte, wenn wir nicht da waren, hatte von einem klitzekleinen Wasserschaden gesprochen, als ich vor einer Woche zufällig an Mums Handy gegangen war und die Hiobsbotschaft abgefangen hatte. Ich hatte nur ganz kurz gezögert, ehe mein Entschluss feststand, dass ich meinen Eltern nichts von dem Anruf erzählen würde. Eigentlich war ich der Typ brave Tochter und sah nicht oft die Notwendigkeit, meine Eltern anzulügen, aber seitdem Mum und Dad in ihren Rosenkrieg verwickelt waren, merkte ich, dass es manchmal nicht anders ging. Um ihretwillen. Und ein bisschen auch um meinetwillen.
Camille hatte sofort kapiert, was Sache war, nachdem ich ihr eröffnet hatte, dass meine Mum lieber das Haus verkaufen würde, als hierher zurückzukehren, geschweige denn sich um Wasserrohrbrüche zu kümmern, die vermutlich die Hälfte aller Mieteinnahmen aus dem letzten Jahr verschlingen würden. Wir hatten einen Plan ausgeheckt, der darin bestand, dass ich mich allein um die Baustelle kümmern würde, während meine Mum auf einer Konferenz in Europa war. Camille hatte mir hoch und heilig geschworen, dass sie mich decken würde.
Nur hatte sie dummerweise vergessen zu erwähnen, dass das hier kein harmloser Wasserrohrbruch war, sondern eher so aussah, als ob die Gasflasche des Grills mitten in der Küche explodiert war.
In diesem Moment meldete sich mein Handy. Erleichtert zog ich es aus meiner Hosentasche. Das war sicher Camille, die mir das hier alles erklären konnte. Und die Bescheid sagen wollte, dass gleich morgen früh Handwerker vorbeikämen, die alle Schäden in null Komma nichts beheben würden, ohne Geld dafür zu verlangen. Nun, man durfte ja ein bisschen träumen.
Stattdessen prangte eine Nachricht meiner Mum auf dem Display. Ich sprang vor Schreck fast einen Meter in die Höhe und prallte dabei beinahe mit Joshua zusammen.
»O Gott, sie spürt, wo ich bin!«
»Blödsinn!« Joshua nahm mir das Handy aus der Hand und warf einen Blick auf die Nachricht. »Da, bitte, es ist eine ihrer ganz normalen Mir geht’s gut, wie geht’s dir-Nachrichten. Du folgst jetzt einfach unserem Plan.«
Ich nickte und versuchte, meine Atmung etwas zu beruhigen. Der Plan. Okay, ich wusste, was ich zu tun hatte. Ich nahm Josh das Gerät aus der Hand und öffnete die App. Tatsächlich fragte Mum nur, wie es mir ging. Sie war noch für zwei Tage in New York, wo sie einige Businessmeetings hatte. Danach würde sie mit ein paar Kolleginnen weiter zu einer Investmentkonferenz nach Kopenhagen fliegen.
Ich machte mich sofort daran, eine kurze Antwort zu tippen. Zum Glück hatte Joshua die grandiose Idee gehabt, vor unserer Abreise noch einen ganzen Schwung alberner Selfies aufzunehmen – damit hatte ich genug Material, um Mum vorzugaukeln, dass ich zu Hause in San Francisco abhing.
Mein schlechtes Gewissen tanzte Samba in meinem Kopf, als ich Mum ein Bild von mir und Josh in der üblichen Warteschlange vor Phils Coffee schickte, aber Josh hatte vollkommen recht, ich erntete nur einen Daumen hoch und wurde im nächsten Moment schon wieder abgelenkt, als ich aus Richtung Haustür einen Schrei hörte.
»Anouk, Schatz!«
Schlagartig breitete sich ein warmes Gefühl in mir aus, als ich mich umwandte. »Camille!«
Ich konnte gerade noch ein Stück vom Kraterabgrund zurücktreten, da war sie schon über mir. Ehe ich etwas sagen konnte, fand ich mich in einer alles umschließenden Umarmung wieder, die nach Vanille, Räucherstäbchen und unerschütterlicher Freundschaft roch. Reflexartig schlang ich ebenfalls meine Arme um sie und drückte mein Gesicht an ihre Schulter.
»Camille«, murmelte ich. »Meine Camille.«
Sie wiegte mich so schwungvoll hin und her, dass ich beinahe den Boden unter den Füßen verlor. »Ich weiß, du willst es nicht hören, aber – ich glaube, das Universum hat dieses Wasserrohr platzen lassen, damit du an diesen Ort zurückkehrst. Und in das Haus. Es hat dich vermisst.« Sie gab mir einen Kuss auf die Wange. »Und ich auch.«
O Gott, sie hatte ja so recht. »Ich hab dich noch viel mehr vermisst«, quetschte ich heraus und drückte Camille fest. Sie murmelte irgendwelches unverständliches Zeug in mein Ohr, ehe wir uns voneinander lösten und Camille wieder einen Schritt zurücktrat. Sie sah genauso aus wie im letzten Jahr. Die Braids reichten ihr bis zur Hüfte, und ihr strahlendes Lächeln erhellte selbst die muffige Düsternis hier drin. Heute trug sie eine neonpink bedruckte Tunika über schwarzen Leggins und eine Kette aus riesigen bunten Pappkugeln.
Dann entdeckte Camille Joshua, und dem fielen fast die Augen aus dem Kopf, als sie die Hände in die Hüften stemmte und uns beide musterte.
»Und du bist?«, fragte sie mit einem Blick auf meinen Freund.
»Joshua«, beeilte der sich zu sagen, und fast ehrfürchtig streckte er ihr seine Hand entgegen. Als Camille sie schüttelte, klimperte eine ganze Armada an Armreifen.
»Und, Joshua, du bist ein guter Freund und lieb zu meiner Anouk?«
»Natürlich!« Trotzdem warf er mir einen schnellen Seitenblick zu, als ob er vor Camilles Naturgewalt ein bisschen Angst hätte, für den Fall, dass ich das Gegenteil behauptete. Ich konnte nur sagen: Die Angst war völlig berechtigt.
»Er ist lieb zu mir, keine Sorge«, sagte ich, was Camille ein zufriedenes Nicken entlockte. Ich musste mir ein Lachen verkneifen, als ich Joshuas ehrfürchtige Miene sah.
Ich hatte Camille immer schon bewundert. Sie war die große Schwester, die ich mir als Einzelkind immer gewünscht hatte. Eine, die Ratschläge für jede Lebenslage hatte, die niemals nur vernünftig war, jeden Fehler als Chance sah und die im Gegensatz zu meiner Mutter niemals lachen würde bei der Frage, ob das Licht im Kühlschrank wirklich aus ist, wenn er geschlossen ist.
»Hast du da … Wie viele Telefone hast du?«, fragte Joshua und sah Camille bewundernd an.
Camille hatte tatsächlich mehrere. Sie trug alle in diesen Umhängehüllen mit bunten Kordeln, und über ihrem Oberkörper allein kreuzten sich vier verschiedene Farben, während sie um die Hüfte noch so etwas wie eine Gürteltasche trug, aus der sie jetzt das fünfte Gerät nahm.
»So viele, wie ich eben brauche. Für jeden Job, den ich habe, eins. Eins für den Laden, eins für die Häuserverwaltung, eins für Tinder und so weiter.« Sie zwinkerte mir zu und schob sich den Ärmel ihrer Bluse zurück, sodass die vielen Armreifen wieder lustig klingelten. »Kommt, lasst uns mal kurz gemeinsam die Lage checken. Es ist alles halb so schlimm.«
Das sah ich irgendwie anders, aber sie hob die Hand, als ob sie genau wüsste, was ich sagen würde. Schnell klappte ich den Mund wieder zu.
Camille schritt weit im offenen Wohnraum aus und bewegte sich erstaunlich grazil dafür, dass der aufgequollene Holzboden hier und da unter ihr nachgab und sie sogar mit einem Fuß einkrachte an einer Stelle, die besonders durchweicht war.
Also nicht nur ein Krater.
Doch sie zog ihren Fuß samt Espadrille elegant wieder aus der Holzkuhle, als ob es das Natürlichste der Welt wäre.
»Devon bringt dir den neuen Boden vorbei, und das alte Zeug hier hast du im Nullkommanichts raus. Vertrau mir.«
»Aber das ist … mehr, als ich gedacht hatte.«
Camille lächelte. »Ja, ich hab mich beim ersten Aufmessen ein bisschen vertan.«
»Wie viel mehr? Wie groß ist der Schaden wirklich?«
»Etwa fünfzig Quadratmeter«, antwortete sie. »Sechzig. Na gut, siebzig.«
Ich zwang mich, normal weiterzuatmen. Ich hatte schon mit sechzehn Jahren angefangen, bei Olive auszuhelfen, einer Schreinerin, mit der mein Architektenvater oft zusammenarbeitete. Meine Freunde beneideten mich glühend um den Job, weil der Stundenlohn abartig gut war. Doch selbst mit meiner Übung war das hier eine Hausnummer, die ich kaum schaffen konnte.
Joshua fiel als Hilfe leider aus und würde lediglich die Aufgabe erfüllen können, meine psychische Stütze zu sein. Seit er mal beinahe einen Finger verloren hatte, weil er bei Baumschneidearbeiten im Garten von ein paar vorbeikommenden Kumpels abgelenkt worden war, ließ ich ihn nur sehr ungern in die Nähe von Kappsägen und Gehrungsschneidern.
»Ich hatte mir das nach unserem Telefonat leicht anders vorgestellt«, sagte ich schwach. »Hier sieht es so aus, als ob jemand mit einer Abrissbirne hantiert hätte.«
»Papperlapapp. Ein paar Tage hier, und alles ist wieder in Ordnung.« In diesem Augenblick fingen zwei von Camilles Smartphones gleichzeitig an zu läuten. Sie tänzelte zur Tür und winkte uns noch einmal zu, ehe sie nach draußen verschwand.
»Die Frau ist echt krass«, meinte Joshua, als wir hörten, dass sie tatsächlich beide Gespräche gleichzeitig angenommen hatte und abwechselnd sprach, während sie sich vom Haus in Richtung ihres Ladens entfernte.
»Camille ist toll. Der Ort wäre ohne sie überhaupt nicht denkbar.«
Ich wendete meinen Blick vom Krater. Okay, Prioritäten, die zählten jetzt. Das Wichtigste zuerst.
Ich ging durch den Wohnbereich Richtung Fensterfronten, wobei ich doch noch fast in das Loch gefallen wäre. Von innen öffnete ich einen Klappladen nach dem anderen, ehe ich die Terrassentür beiseiteschob und nach draußen auf die Veranda trat, die hoch über den Strand ragte.
In einem tiefen Türkisblau erstreckte sich das Meer vor uns, so weit das Auge reichte. Die endlos langen Wellen, jetzt im auffrischenden Abendwind mit weißen Schaumkrönchen, wogten ohne Unterlass an den Strand heran, wo sie sich brachen, um gleich darauf von der nächsten Welle überrollt zu werden. Das ewige Auf und Ab, der einmalige Sound von Junos.
Ganz automatisch verzog sich mein Mund zu einem breiten Lächeln.
»Ernsthaft?«, hörte ich Joshuas Stimme hinter mir. Er lief bis zur niedrigen Mauer, die das Ende der Terrasse bildete, und breitete seine Arme aus. »Innenräume sind völlig überschätzt. Das hier ist das verdammte Paradies.«
4.
»Anouk?« Die Panik in Joshuas Stimme schreckte mich beim Auspacken auf, und ich lief schnell die Holztreppe nach unten. Angesichts des Chaos im Haus hatte ich mich dafür entschieden, zuerst meinen Kram in mein Schlafzimmer zu packen, das als einziges im oberen Stockwerk lag.
Ich fand Josh in der offenen Küche, die mein Dad, der das Haus selbst entworfen hatte, als Herz des Gebäudes geplant hatte. Hier gab es nicht nur eine, sondern gleich zwei gepolsterte Panoramafensternischen – zwei absolute Lieblingsplätze, in denen man sich fühlte, als ob man hoch über dem Strand in der Luft schwebte. Aber auch sonst hatte man fast überall das Meer vor Augen.
»Sag nicht, dass du in deinem Zimmer ein Squirrel entdeckt hast«, murmelte ich, als ich einen Blick auf Joshuas Gesicht warf.
»Schlimmer. Hier gibt es nichts zu essen!«
Er stand vor den aufgerissenen Schränken, und man sah förmlich, wie die Angst in ihm hochkroch. Was er gefunden hatte, war recht übersichtlich: Kaffeebohnen, eine angebrochene Packung Speisestärke, ein altes Marmeladenglas, in dem noch ein Rest klumpig gewordener Zucker klebte, und eine Packung Blasen- und Nierentee.
»Hier ist nichts!« Seine Stimme war schrill, und er warf mir einen nervösen Blick zu. »Wir müssen sofort etwas unternehmen.« Er versuchte, mich möglichst unauffällig abzuscannen, was ihm natürlich gründlich misslang.
Ich musste lachen, obwohl mir klar war, worauf er hinauswollte. Und insgeheim war ich selbst ein bisschen beunruhigt. Mein Dad, der bei uns für das Kochen zuständig war, hatte früher immer dafür gesorgt, dass die Vorratsschränke im Junos-Haus gut gefüllt waren, mit Konserven, getrockneter Pasta, Fertigreisgerichten, haltbarer Milch und so weiter. Wieso hatte ich einfach automatisch angenommen, dass es immer noch so wäre? Ich wusste doch, dass sich alles in unserem Leben geändert hatte.
»Keine Sorge, ich fühl mich noch ganz gut.«
Josh war übervorsichtig, seit er im Frühjahr einmal bei einem meiner Zusammenbrüche dabei gewesen war. Wir waren zum Wandern im Blue Oak Valley gewesen, und ich hatte zu spät gemerkt, dass wir den Rucksack mit Proviant im Auto vergessen hatten, nachdem wir zwei Meilen bergauf gegangen waren, mein Blutzuckerspiegel aber im Tal geblieben war.
Meine Mutter behauptete immer, den Ausdruck hangry – die Mischung aus hungry und angry – hätte jemand erfunden, nachdem er mich in einem nicht so günstigen Moment kennengelernt hatte. Vermutlich war sie es selbst gewesen.
»Okay«, sagte Joshua und zückte sein Smartphone. »Pizza oder Sushi?«
Ich schüttelte den Kopf. »Vergiss es. Es gibt hier keinen Lieferdienst im Umkreis von fünfzig Meilen.«
Ich meinte zu sehen, dass Joshua einen winzigen Moment blass wurde um sein sonnengebräuntes Näschen. Es war sehr rührend zu sehen, wie er sich um mich sorgte.
Man musste dazu wissen, dass ich eigentlich nur sehr kurz übellaunig war, denn gleich danach kam immer der totale Zusammenbruch, in schlimmen Ausnahmefällen sogar mit Tränen. Jeder, der mich kannte, wusste, dass ich ein total ausgeglichener Mensch war, außer ich war hungrig. Normalerweise hatte ich auch nicht nah am Wasser gebaut, ich hatte nicht mal geweint, als ich damals keine Konzertkarten für Taylor Swifts Eras-Tour ergattert hatte.
Im Moment allerdings sah Joshua eher so aus, als ob er gleich weinen wollte, und ich erlöste ihn von seinem Leid.
»Es gibt keinen Lieferdienst, aber ich hab eine andere Idee. Komm mit!«
Joshua sah mich nur fragend an, doch ich marschierte entschlossenen Schrittes aus dem Haus heraus, wendete mich auf der kleinen Sackgasse, die das Ende der Bucht markierte, nach links und ging direkt zum Haus nebenan, während Josh hinter mir herdackelte.
»Anouk, wohin willst du? Wer wohnt da?«
»Jemand, der uns hoffentlich aus unserer Misere befreien kann.«
Ich klopfte an. Das Geräusch war noch nicht verhallt, als auch schon die Haustür aufgerissen wurde.
»Ja?«
Ich wollte gerade loslegen und Noah unmissverständlich klarmachen, dass wir dringend seine Einkäufe anzapfen mussten, die er vorhin hoffentlich noch bei Camille hatte tätigen können, beziehungsweise die Vorräte seiner Eltern plündern. Doch meine Worte blieben mir im Hals stecken, als mein Blick in das Gesicht eines Typen wanderte, den ich noch nie zuvor in meinem Leben gesehen hatte.
»Oh. Hi. Ist, äh … ist Noah vielleicht da?«
Der Kerl verschränkte sofort die Arme vor der Brust, wodurch er fast die komplette Breite des Türrahmens einnahm.
Überhaupt war er ziemlich groß und ziemlich … finster. Kurze, dunkle Haare, noch dunklere Augen. Irgendwie erinnerte er mich an einen düsteren, einsamen Superhelden, der gerade freihatte und trotzdem nicht entspannen konnte.
»Hier gibt es keinen Noah.«
Ich runzelte die Stirn.
»Aber das ist doch das Haus der Evans, ich bin mir ganz sicher, dass er hier wohnt, ich hab ihn vorhin getroffen, und er –«
»Nein, tut mir leid.«
Er schickte sich an, uns die Tür vor der Nase zuzuschlagen, als ich schnell sagte: »Richte ihm aus, Anouk ist da, und es ist sehr, sehr wichtig. Lebenswichtig, sozusagen.«
»Anouk?«
Der Gesichtsausdruck des Typen hatte sich von einer Sekunde auf die andere verändert, doch ehe er etwas erwidern konnte, wurde er von hinten zur Seite geschoben.
Und dann stand plötzlich Noah vor mir.
»Anouk! Ist etwas passiert?«, fragte er, und seine Augen sprangen über meinen Körper, als ob er auf der Suche nach Blut wäre oder so.
Doch ich konnte ihn nur anstarren.
Er sah schon wieder anders aus. Irgendwie noch größer und vor allem – nackter. Er trug zumindest weiterhin Shorts, aber seine Haare waren nass, vermutlich hatte er nach der Busfahrt eben fix geduscht.
Ich starrte auf seinen Sixpack. So ausgeprägt war der im letzten Jahr noch nicht gewesen. Aber klar, in seinem neuen Beruf musste man vermutlich acht Stunden am Tag Krafttraining machen.
Mir wurde kurz schwindelig, und schnell sah ich auf meine Füße. Immer dieser Blutzucker. Aber wenigstens hatte er ein T-Shirt in der Hand, das er sich jetzt in einer fließenden Bewegung über den Kopf zog.
Ich hörte, wie sich Joshua hinter mir räusperte.
Ach ja, den gab es ja auch noch. Ich riss mich zusammen.
»Noah, das ist mein Kumpel Joshua, Joshua, das ist unsere Hoffnung auf Vorräte.«
»Oh. Oh!« Noah riss erschrocken die Tür noch weiter auf und bedeutete uns reinzukommen. »Wie schlimm ist es?«
»Kurz vor schlimm.«
Der dunkle Bodyguard stand weiterhin im Flur, sodass Joshua und ich uns an ihm vorbeiquetschen mussten wie an dem Zollhund am Flughafen, der sich mir in den Weg gestellt hatte, als ich vor zwei Jahren Mum auf eine Geschäftsreise nach Amsterdam begleitet hatte.
»Das ist übrigens Will«, sagte Noah und ging voraus in die Küche. Will nickte kaum merklich und sah Josh und mich abwechselnd an, als ob er überlegte, wie er uns so schnell wie möglich wieder loswurde. Vielleicht hätte ich ein bisschen Angst vor ihm gehabt, wäre ich nicht so hungrig gewesen.
»So sieht übrigens ein Ferienhaus ohne Wasserschaden aus«, sagte ich zu Josh über meine Schulter, doch der blickte sich nur ehrfürchtig um, als ob er bei irgendwelchen Royals zu Besuch wäre. »Noah, bei uns ist nichts – rein gar nichts – zu essen im Haus. Du weißt, was das bedeutet.« Ich hievte mich mit letzter Kraft auf einen der lederbezogenen Barhocker am Küchentresen. Sofort spürte ich, wie sich meine nackten Oberschenkel daran festsaugten. »Sag mir bitte, dass du vorhin noch Camille erwischt hast.«
Ein Blick auf Noah verriet mir, dass das leider nicht der Fall gewesen war.
Camilles Ladenöffnungszeiten waren im besten Fall abenteuerlich zu nennen. Mal machte sie am Sonntag um sieben Uhr morgens auf, mal am Mittwoch zwischen zwölf und vierzehn Uhr. Bei ihr einzukaufen, war wie ein Lotteriespiel. Das betraf auch die Lebensmittel, die man ergattern konnte. Es konnte vorkommen, dass sie stilvoll etliche Rollen von Wattepads auf dem Brotregal drapierte, um es nicht so leer wirken zu lassen, und ein paarmal hatte sie mir schon Gouachefarben statt Obst angeboten. Überhaupt gab es manche Dinge nur an geraden oder ungeraden Tagen, und ich hatte mir noch nie merken können, was das genau war.
»Okay, okay«, sagte Noah, der zum Glück endlich wieder sein T-Shirt trug. »Ich schaue mal, was wir haben.« Er riss hektisch zwei Küchenoberschränke auf. »Wir hätten« – Noah zog die Augenbraue hoch – »einen Rest Maisgrieß, der vor einem Jahr abgelaufen ist, Backpulver, Meersalz und … fünf Dosen Corned Beef.«
Erschöpft ließ ich meinen Kopf auf die Arbeitsplatte sinken.
»Das Corned Beef sieht doch noch gut aus«, sagte jetzt Will, der eine ähnlich tiefe Stimme wie Noah hatte. Und die sich gar nicht so unangenehm anhörte, wenn man nicht wusste, was für ein Gesicht er dazu machte.
»Anouk isst kein Fleisch«, erklärte Noah, und ich seufzte tief, als ich mich wieder aufrappelte.
»Und hier habe ich nur noch …« Noah drehte sich um und öffnete einen dritten Schrank. In den Fächern standen drei große Dosen mit Schraubdeckel.
»Eiweißpulver? Das ist keine echte Mahlzeit«, sagte ich. »Obwohl dein Oberkörper vermutlich anderer Meinung ist.«
Noah blickte über seine Schulter. »Mein – Oberkörper?«