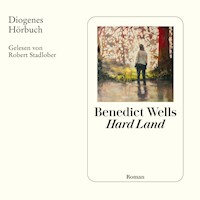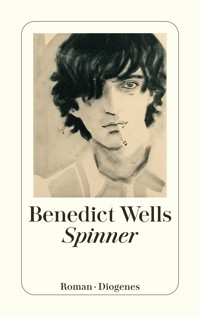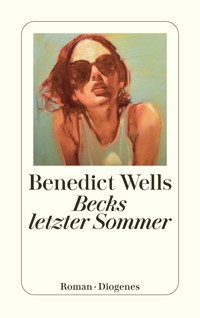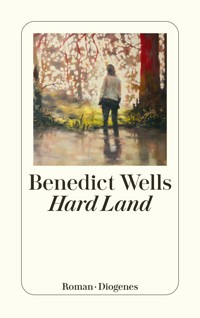
11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes Verlag AG
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Missouri, 1985: Um vor den Problemen zu Hause zu fliehen, nimmt der fünfzehnjährige Sam einen Ferienjob in einem alten Kino an. Und einen magischen Sommer lang ist alles auf den Kopf gestellt. Er findet Freunde, verliebt sich und entdeckt die Geheimnisse seiner Heimatstadt. Zum ersten Mal ist er kein unscheinbarer Außenseiter mehr. Bis etwas passiert, das ihn zwingt, erwachsen zu werden. Eine Hommage an 80’s Coming-of-Age-Filme wie ›The Breakfast Club‹ und ›Stand By Me‹ – die Geschichte eines Sommers, den man nie mehr vergisst. Ausgezeichnet mit dem Deutschen Jugendliteraturpreis 2022.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 385
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Benedict Wells
Hard Land
Roman
Diogenes
Für Leonie und Lukas
»Life moves pretty fast.
If you don’t stop and look around once in a while,
you could miss it.«
Ferris Bueller
Die Wellen
Nummer 1
In diesem Sommer verliebte ich mich, und meine Mutter starb.
Das alles ist jetzt schon mehr als ein Jahr her, aber für mich wird es immer »dieser« Sommer bleiben. Komischerweise denke ich oft daran, wie ich damals hinter dem Haus stand und mit einem Schlauch den Garten besprengte. Es war der Anfang der Sommerferien, und von dem Berg an Langeweile, der vor mir aufragte, hatte ich noch nicht mal die Spitze abgetragen.
Ich starrte auf die Felder in der Ferne. Die Luft stand still, und je länger ich auf diese idyllische Landschaft blickte, desto unschärfer wurde sie an den Rändern. Bis ich dahinter wieder die Angst spürte, die ich aus meiner Kindheit kannte: Dass der Moment gleich kippen und etwas Schlimmes geschehen würde … Aber wie immer betrog mich dieses Gefühl. Weil, danach passierte natürlich wieder gar nichts.
Bis mich meine Eltern ins Wohnzimmer riefen.
In diesen Ferien hatten sich ein paar Dinge fast über Nacht geändert, wie wenn man überrascht feststellt, dass man ein Stück gewachsen ist. Mich überkam öfter aus dem Nichts eine seltsame Wut, und ich stellte mir Fragen, die ich mir früher nie gestellt hatte. Zum Beispiel, wieso die meisten Erwachsenen so scharf darauf waren, zu arbeiten und Kinder in die Welt zu setzen, wenn am Ende sowieso der Tod kam und alles wegfegte. Und ob meine Mom überhaupt glücklich mit meinem Vater sein konnte, so wie ihr Leben mit ihm verlaufen war.
Jedenfalls, die beiden saßen also auf der Wohnzimmercouch und verkündeten, dass sie tolle Nachrichten für mich hätten.
»Wir haben mit Tante Eileen gesprochen«, sagte Mom, »du kannst sie für ein paar Wochen besuchen. Jimmy und Doug würden sich freuen.«
Ich hatte Mühe, meine Atmung zu kontrollieren. Jimmy und Doug waren meine Cousins aus Kansas, sie wogen zusammen so viel wie ein Pferd und hatten mir schon einige Abreibungen verpasst. Ich konnte mir vorstellen, dass sie sich auf mich freuten. Bei meinem letzten Besuch hatte ich mich vor ihnen auf der Mülldeponie versteckt und den ganzen Tag Steine auf ein rostiges Schild geworfen.
»Das könnt ihr nicht machen … Im Ernst, niemals fahre ich da noch mal hin.«
Dad sagte streng wie immer: »Doch, das tut dir gut! Du bist die letzten Tage wieder nur in deinem Zimmer gehockt. Du musst mal raus und unter Leute.«
Und Mom sagte: »Schatz, ich weiß, dass die Situation mit mir … schwierig für dich ist. Aber gerade deshalb ist es gut, wenn du nicht so allein bist. Vielleicht findest du in Wichita ja auch ein paar Freunde.«
Das war’s also, diese Freundesache war schon seit Monaten ihr großes Thema. Ich war fast sechzehn, und sie behandelten mich wie ein Kind.
»Stevie war mein Freund!« Ich starrte sie an. »Wenn er noch hier wäre, würden wir diese bescheuerte Unterhaltung gar nicht führen.«
Mom kam mit ihren Tippelschritten zu mir. Obwohl sie so zerbrechlich wirkte, presste sie mich an sich, und für einen Moment schimmerte etwas Ernsteres durch dieses Gespräch. Doch damals wollte ich es nicht sehen.
»Ich will nicht zu Tante Eileen«, sagte ich nur, mit dem traurigsten Blick, den ich draufhatte. Meine letzte Chance, aus der Nummer noch mal rauszukommen.
Aber nicht mit Mom. »Tut mir leid, Schatz, da musst du durch.«
Ich stellte mir mein Ferienprogramm in Kansas vor. Tagsüber: Spaß und Spannung auf der Mülldeponie. Abends: Die besten Schwitzkastengriffe mit Jimmy und Doug.
Na schön, es war also an der Zeit, meinen Eltern auf sachliche Weise klarzumachen, wieso ich dafür nicht in Frage kam. Ich würde sie mit meinen überlegenen Argumenten überzeugen, und danach würden sie ein für alle Mal wissen, dass ich jetzt alt genug war und fortan mein eigenes Ding machte.
»Ihr könnt mich mal!«, rief ich und stapfte nach oben.
Am Nachmittag streckte ich den Kopf aus dem Zimmer und lauschte: Mom war wieder in ihren Buchladen gegangen. Wie immer, wenn sie nicht da war, hatte sich die Atmosphäre im Haus verändert. Ich spürte sofort: Er war noch da. Es gab zwei Sorten von Stille; die neutrale Sorte, und dann noch die Stille meines Vaters. Ein brütendes Schweigen, das ich selbst von hier oben hören konnte. Ich schlich mich runter. Dad hing antriebslos vor der Glotze im Wohnzimmer. Er schaute eine Wiederholung von Ein Colt für alle Fälle und hatte tatsächlich den Ton abgestellt. Wir waren uns nie sehr nahe gewesen, und in diesem Jahr redeten wir fast gar nicht mehr miteinander. Ich wusste nicht, ob wegen Moms Krankheit, weil er keinen Job fand oder weil er mit mir einfach nichts anfangen konnte. Ich wusste nur: Elf Wochen Ferien mit ihm zu Hause würde ich nicht durchstehen.
Bis zum Abend streifte ich allein durch den Ort. Da ich kein Geld hatte, ging ich ins Replay Arcade, eine Spielhölle in der Mall, und schaute, ob jemand den Rekord bei Defender geknackt hatte. Und fast hätte ich mich auch zum ersten Mal ins Larry’s getraut – bis ich durch die Scheibe Chuck Bannister sah. Das Larry’s war die Institution in Grady; das Diner, in das alle älteren Jugendlichen gingen. Es gab ein paar ungeschriebene Gesetze. Zum Beispiel, dass man mit fünfzehn dort nichts zu suchen hatte. Und dass man schon gar nicht reinging, wenn ein Psychopath wie Chuck Bannister drinnen saß, der es auf einen abgesehen hatte.
Stattdessen hockte ich mich auf einen Mauersims. Eine Weile betrachtete ich die vorbeifahrenden Autos, dann hatte ich plötzlich wieder die Bilder mit meiner Mom vor Augen. Damals dachte ich ständig daran, in den unmöglichsten Momenten. Es war wie ein dunkles Summen in meinem Kopf. Manchmal war es um mich herum laut genug, dass ich es nicht hörte. Aber weg war es nie.
Auf dem Nachhauseweg kam ich an dem einzigen Kino vorbei, das es in unserem Kaff gab: das Metropolis. Im benachbarten Hudsonville, das vor allem für sein riesiges Gefängnis bekannt war, gab es ein Multiplex, das alle neuen Blockbuster zeigte. Unser Kino dagegen war ein uraltes Kabuff für Rentner, das Ende des Jahres dichtmachen sollte. Im Schaufenster hing schon seit Wochen ein Zettel aus:
METROPOLIS
Aushilfe gesucht!
Daneben ein Plakat mit irgendeinem französischen Schwarzweißfilm; kein Wunder, dass der Laden bald schließen musste.
Ich wollte gerade weiter, da hörte ich Stimmen aus dem Foyer und linste hinein: An der Kinokasse standen zwei Jungen und ein blondes Mädchen in Angestellten-Shirts, alle älter als ich. Das Mädchen war mir nicht ganz unbekannt. Beim Reden lehnte sie sich vor, als erzählte sie das Spannendste der Welt, dann lachte sie über eine Bemerkung der Jungen. Kurz darauf verschwanden alle drei in einem Saal. Ich schaute noch mal hoch zu dem weißen Schild mit den roten Lettern M-E-T-R-O-P-O-L-/-S (das »I« hing herunter, als wäre es gestolpert) und ging nach Hause.
Meine Eltern spielten in der Küche Scrabble. Wie immer schien Dad zu gewinnen. Ideenlos und systematisch versuchte er zu verhindern, dass Mom Punkte machte, während sie lieber schöne, aber nutzlose Worte wie »Verblendung« und »Schurwolle« legte. Auch sonst hätten sie nicht unterschiedlicher sein können: Mom klein und zierlich, mit Brille, bunter Bluse und selbstgeknüpften Bändern an den Handgelenken. Sie war süchtig nach Büchern, und wenn sie sich verabschiedete, empfahl sie fast immer noch einen Roman. Dad dagegen sah man den ehemaligen Sportler an. Ein leicht ergrauter, kräftiger Bär, wie meistens trug er Jeans und T-Shirt. Und außer der Zeitung las er kaum etwas.
Vor dem Abendessen sagten meine Eltern, dass wir in den nächsten Tagen noch mal »ohne Drama« über Kansas reden würden – dann gab es meine Lieblingspizza. Vermutlich glaubten sie, dass sie mich mit einem derart billigen Trick besänftigen konnten und, na ja, so war’s auch. Trotzdem weiß ich noch, dass ich später nicht schlafen konnte. Ich lag im Bett und dachte: Vielleicht wären ein paar Freunde doch ganz gut. Und ich dachte: Wieso bin ich nur so verflucht still?
Meine Schwester Jean zum Beispiel: Die kam auf die Welt, war sofort selbstbewusst und traute sich alles, während ich mich wirklich vor jedem Mist fürchtete. Früher musste ich mit meinen Angststörungen sogar zur Schulpsychologin. Mal hatte ich die stickige Sporthalle nicht mehr betreten können, mal im Unterricht Panikattacken bekommen. Dann war es jedes Mal, als wäre mein Verstand eine Lagerhalle mit unzähligen Lichtern, und plötzlich fiel ein Licht nach dem anderen aus, bis ich in vollkommener Dunkelheit stand. Das fühlte sich immer an wie Sterben.
Ich schätze, damals war ich auch noch ein ziemlicher Freak. So hatten mich zumindest ein paar Mitschüler genannt. Doch im Laufe der Jahre war ich dann so harmlos geworden, dass sie mich nicht mal mehr für die Mathe-Einsen hassten. Seit Stevies Umzug im Herbst saß ich in der Cafeteria allein am Tisch. Selten hockte sich ein anderer Außenseiter dazu, aber nie für lange. Und manchmal kam mir der Verdacht, mein ganzes Leben war wie dieser Tisch.
Als ich nach Mitternacht noch wach war, ging ich in das Zimmer meiner Schwester. Jean war viel älter als ich und schon vor Jahren an die Westküste gezogen, und meine Eltern hatten alles unberührt gelassen, falls sie mal zu Besuch kam. Nur tat sie das fast nie. Eine Weile saß ich auf ihrem Bett und hörte mir ihre alten Musikkassetten an. Und da vermisste ich sie wirklich sehr, dabei hatten wir früher fast nie etwas zusammen gemacht. Aber vielleicht ja gerade deshalb.
Schließlich zog ich meine Jacke an und ging auf den Friedhof. Wobei das jetzt wieder klingt, als wäre ich gestört oder so. In Wahrheit wohnten wir einfach direkt daneben, in dem weißen Schindelholzhäuschen, in dem vor uns ein Förster mit seiner Frau gelebt hatte. Der Friedhof lag auf einem Hügel außerhalb der Stadt, und manchmal reagierten die Leute geschockt, wenn ich sagte, dass ich von meinem Fenster auf einen Haufen Gräber schauen konnte. Aber das Haus war billig, und wir waren nicht gerade reich. Und ich fand das mit dem Friedhof auch nie schlimm. Ganz im Ernst, ich mochte die Stille sogar. Damals war ich oft dort, wegen Mom und diesem dunklen Summton in meinem Kopf. Dann stellte ich mir vor, wie eines Tages die Beerdigung wäre und wie ich danach herkommen würde. Schon komisch: In meinem Zimmer war der Gedanke an den Tod oft nicht auszuhalten. Und ausgerechnet auf dem Friedhof beruhigte ich mich dann wieder.
Für eine Sommernacht war es kühl, der Himmel wuchtig und voller Sterne. Doch der Anblick bedeutete mir nichts. Ich musste nur daran denken, wie Mom vor ein paar Jahren zweimal mit dem Fahrrad gestürzt war. Sie hatte es auf ihre Sehprobleme geschoben und sich eine neue Brille machen lassen, aber es wurde nicht besser. Und dann kamen noch der Schwindel und die Kopfschmerzen.
So hatte alles angefangen: mit zwei harmlosen Stürzen.
Ich schlenderte über den Friedhof und schaute auf den Grabsteinen nach etwas Besonderem: MARTHA F. SUDEROW, 24. APRIL1876 – 1. MÄRZ1979; hundertzwei Jahre! Am liebsten dachte ich mir kurze Lebensläufe für die Toten aus: CARL ROTHENSTEINER, 12. APRIL1901–21. FEBRUAR1973: Solider Handwerker, viele Krisen überstanden, nie darüber geklagt. Schlechter Pokerspieler, St. Louis-Rams-Fanatiker, wortkarg, manchmal im Kino geweint. Plötzlicher Herzinfarkttod, wenige Tage zuvor noch eine Aussprache mit seinem Sohn nach zwölf Jahren Streit …
Als ich gerade zum nächsten Grab kam, hörte ich den Kies knirschen.
Im Dunkeln blitzte ein blonder Haarschopf auf. Ich kniff die Augen zusammen und sah, dass es das Mädchen aus dem Kino war. Damals wusste ich nur, dass sie Christie oder Kirstie hieß und auf meine Highschool ging. Natürlich hatte ich sie schon öfter gesehen, sogar hier auf dem Friedhof, doch erst seit kurzem nahm ich sie richtig wahr. Wie ein Wort, das man neu gelernt hatte und das prompt überall auftauchte.
Ich wagte nicht, mich zu bewegen. Sie bemerkte mich nicht und huschte geisterhaft zu einem Grab neben dem Eingang. Es zischte. Für einen Moment war ihr Profil vom Feuer erhellt, dann sah man im Dunkeln nur noch das Glimmen, wenn sie zog.
Auf einmal fuhr sie herum – und blickte direkt zu mir.
Ich zuckte zusammen, als hätte mir jemand einen Eiswürfel ins T-Shirt gesteckt.
Sie schien nicht überrascht, dass ich da war. Sie rauchte nur und betrachtete mich eine Weile. Dann trat sie durch die Pforte und ging.
Der Nachtwind wehte vom Wald herüber. Noch immer stand ich im Dunkeln und sah ihr nach, die ganze Zeit, auch, als sie schon längst verschwunden war. Und mehr gibt’s nicht zu sagen, bevor ich am nächsten Tag im Kino anfing und der schönste und schrecklichste Sommer meines Lebens begann.
Nummer 2
Der 4. Juni 1985 war ein Tag, der einen daran erinnerte, wie gut ein Tag sein kann: Der Himmel endlos blau, die Sonne ergoss sich über Missouri, der Sommer hing schwer in der Luft. Gegen Mittag sollte ich mich im Metropolis vorstellen. Mom war von meiner Idee mit dem Ferienjob übertrieben begeistert gewesen und hatte gleich dort angerufen. Ich selbst war nicht gerade scharf darauf, den Sommer über Tickets und Snacks an Rentner zu verkaufen, aber es gab fünf Gründe dafür:
Um nicht zu meinen Cousins nach Kansas zu müssen.
Um endlich etwas zu erleben und vielleicht Freundschaften zu schließen.
Um meinem Vater und seinen Blicken auszuweichen.
Um auch was zur Haushaltskasse beizusteuern (wegen Moms hohen Versicherungskosten und Dads Arbeitslosigkeit hatten wir seinen Wagen verkaufen müssen.)
Um das blonde Mädchen vom Friedhof näher kennenzulernen (vielleicht).
Und so ging ich den Hügel hinab in das verschlafene Siebzehntausend-Einwohner-Kaff mit den roten Backsteinhäusern, Ahornbäumen und altmodischen Läden auf der Main Street. Als würde man eine Postkarte aus den Fünfzigern betreten.
Grady liegt in der Nähe des Missouri River, umgeben von einem Wald, dem Lake Virgin (heißt wirklich so) und unzähligen Weizen- und Roggenfeldern. Am Stadtrand steht seit Ewigkeiten ein Schild: Entdecke die 49 Geheimnisse von Grady. Wieso nicht fünfzig oder nur zehn, wusste keiner so genau. Zum ersten Mal tauchte der Spruch in einem Gedicht von Morris auf, in dem der Held von »neunundvierzig Geheimnissen« sprach, die es hier angeblich gab. William J. Morris war Gradys berühmtester Dichter. »Ein Nachahmer von Walt Whitman«, sagte Mom immer. Doch vor Ewigkeiten hatte er mal einen Kulturpreis oder so gewonnen. Und damit war er der Einzige aus diesem Nest, der je irgendetwas gewonnen hatte.
Ansonsten war Grady nur für eine Sache gut: zum Weglaufen. Hier kannte jeder jeden, und wenn die Frau von Barry, dem das Rasenmähergeschäft gehörte, etwas mit einem Typen aus St. Louis anfing, wurde sofort darüber getratscht. Keimzelle aller Gerüchte war das Good Folks mit seinen Stammtischen: der Jagdverein, die Veteranen, die Republikaner, die Strickrunde und unsere fünf Kirchengemeinden: die Katholiken, Baptisten, Methodisten, Pfingstler und Presbyterianer. Die ganze Gegend war erzkonservativ. Noch immer standen Der Fänger im Roggen und alles, wo es nur entfernt um Sex ging, auf dem Schulindex, und das beste Argument, das die Leute hier kannten, war: »Ja, mag sein, aber das haben wir schon immer so gemacht!«
Vor dem Eingang des Kinos zögerte ich. Neue Situationen machten mir seit jeher Angst, vermutlich war meine Komfortzone (Lieblingswort der Schulpsychologin) so klein wie ein Penny. Ich übte, mich lässig vorzustellen, und murmelte immer wieder wie ein Verrückter vor mich hin: »Hi, ich bin Sam … Hey, Sam mein Name!« Mit einem mulmigen Gefühl öffnete ich die Glastür.
Drinnen war es kühl. Der rote Teppich im Foyer hatte Löcher, an der Decke hing ein uralter Kronleuchter, an den Wänden Plakate von Filmklassikern und Autogrammkarten berühmter Schauspieler. Es roch nach Öl und Zucker und irgendwie nach zu Staub zerfallener Nostalgie.
»Bin schon da!« Mr. Andretti, der Besitzer, kam pfeifend aus dem Büro. Er war kaum größer als ich, drahtig, braungebrannt und so gutgelaunt wie Tony, der Tiger aus der Frosties-Werbung. Neben dem Kino gehörten ihm noch das Eiscafé in der Mall und die Werkstatt Andretti’s Cars. Es hieß, er sei über ein paar Ecken mit den Rennfahrern Mario und Michael Andretti verwandt.
Er erklärte mir, dass der Job bis Ende des Jahres ging; ich sollte die bisherigen Mitarbeiter ablösen, die gerade den Highschool-Abschluss gemacht hatten.
Eigentlich wollte ich nur die Ferien hier arbeiten, doch Mr. Andretti packte meine Hände mit seinen behaarten Pranken und fragte: »Du bist also bereit, in die magische Welt der Filme einzutauchen?«
Und da nickte ich nur. Weil, was sollte man da auch antworten.
»Wunderbar. Den Rest erklären dir dann die anderen.«
Die anderen … Auf einmal schämte ich mich, dass ich in diesen bescheuerten Kinderklamotten herumlief, weil wir kein Geld für neue hatten (und weil ich leider auch noch nicht ganz aus ihnen herausgewachsen war). Auf meinem T-Shirt war eine grinsende Banane mit Sonnenbrille, dazu eine Sprechblase: »COOL BANANA!« … Am liebsten wäre ich nach Hause gerannt.
Mr. Andretti schob mich in Saal 1. »Das hier ist Sam, seid nett.« Er klopfte mir auf die Schulter, dann ließ er uns allein.
Was mir sofort auffiel: Das blonde Mädchen war gar nicht da. Nur die zwei älteren Jungen, die mich anstarrten. Vor Nervosität wurde ich zappelig. Vor allem, als ich begriff, dass der eine – ein durchtrainierter Typ mit Oberlippenbart – wirklich der Brandon Jameson war; Wide Receiver bei den Grady Hornets, dem Footballteam unserer Schule. Seine ältesten Freunde sagten Brand, der Rest nannte ihn ehrfurchtsvoll Hightower. Er war schwarz und beeindruckend groß. Selbst im Winter trug er kurzärmlige Hemden, vor allem aber schaute er immer grimmig, und es gab einige beängstigende Geschichten über ihn. Angeblich hatte er vor einem Spiel sogar mal wie Ozzy Osbourne einer Fledermaus den Kopf abgebissen, weil es das Maskottchen des gegnerischen Teams war.
Hightower nickte mir zu und murmelte: »Hey!«
Ansonsten redete nur der andere Junge; Cameron Leithauser. Er war ebenfalls groß und hatte ein sympathisch-schiefes Gesicht wie eine Comicfigur. Seine langen dunklen Haare waren über der Stirn kurzgeschnitten. »Also, alter Knabe, dann führen wir dich mal im Paradies herum.« Er nahm mich beim Arm. »Das hier ist Saal 1, da zeigen wir die aktuellen Blockbuster. Diese profane Aufgabe übernehmen meistens die anderen, ich für meinen Teil kümmere mich lieber um die Klassiker in Saal 2. Wie’s aussieht, bin ich hier nämlich der Einzige mit Geschmack.«
»Fick dich«, sagte Hightower.
Sie grinsten und holten mir ein verwaschenes Angestellten-T-Shirt aus dem Büro. Dann zeigten sie mir, wie man Filme in den Projektor einlegte, die Kasse bediente und mit der Popcornmaschine umging, ohne sich die Finger zu verbrennen. Kurz darauf war auch schon Einlass. Es kamen genau fünf Leute.
»Völlig normal bei den 14-Uhr-30-Vorstellungen.« Cameron schob sich eine Zigarette in den Mund. »Abends um acht ist der Laden aber brechend voll, dann kommen meist sechs oder sieben Leute. Weiß gar nicht, wieso der alte Andretti diese Goldgrube schließen will.«
In der nächsten Stunde stand ich allein an der Kasse, die beiden reparierten die Eismaschine. Sie schienen ziemliche Filmfreaks zu sein und redeten ewig über eine »kontextabhängige Gitarre« in einem Antonioni-Film oder so; ich weiß bis heute nicht, was sie damit meinten. Als ich ihnen so zuhörte, fiel mir Stevies letzter Abend ein. Wir hatten am Missouri River gegrillt und über Mitschüler und Mädchen gequatscht. Und als wir in den Schlafsäcken lagen, hatte ich erzählt, dass ich die Szenen mit Mom in der Klinik einfach nicht aus dem Kopf bekam. Und Stevie hatte mir anvertraut, dass er Schiss hatte, nach Toronto zu ziehen. Wir hatten auf die Fabrik geschimpft, die unsere Väter entlassen hatte, und uns versprochen, »für immer« Freunde zu bleiben. Inzwischen wusste ich, wie kindisch das alles gewesen war. Auf meine letzten drei Briefe hatte er nicht mehr geantwortet.
Überhaupt hatte ich das Gefühl, ein Paar neue Augen verpasst bekommen zu haben. Weil, ich musste die Jahre davor ja blind gewesen sein. Natürlich hatte ich gewusst, dass Mütter sterben und Freundschaften zerbrechen, aber ich hatte diese Dinge nie richtig gesehen. Nun sah ich die Selbstzweifel meines Dads, wenn er Stellenanzeigen durchging. Und ich sah die Angst meiner Mom, wenn sie mich mit einem Lächeln trösten wollte. Und keine Ahnung, ob das wirklich besser war.
In der Nachmittagspause saß ich auf den Stufen vor dem Kino. Ich hatte ein Mixtape meiner Schwester im Walkman (eine krude Mischung aus Patti Smith, Punk und heimlich gehörten Balladen von OMD) und aß ein Softeis, als das blonde Friedhof-Mädchen auf Rollschuhen die Straße entlanggefahren kam. Sie trug Sonnenbrille und kam an einer unebenen Stelle fast ins Stolpern, bremste jedoch vor dem Eingang gekonnt ab und sagte etwas. Zu mir.
Ich setzte die Kopfhörer ab. »Was?«
Sie grinste. »Ich sagte: Hat mein Dad also endlich ein neues Opfer gefunden?«
Bisher hatte ich immer gedacht, Zahnspangen wären etwas Schlimmes, aber ihre mochte ich wirklich sofort. Sie trug sie offenbar wegen der kleinen Lücke zwischen ihren Vorderzähnen. Ich starrte darauf und schleckte dabei noch mal stumm an meinem Eis, was vermutlich ziemlich gestört aussah.
»Und, macht’s dir Spaß?« Sie zog die Rollschuhe aus und drückte sie mir in die Hand, »Halt mal«, dann schlüpfte sie in Flipflops.
Gebannt schaute ich zu ihr. Ich finde es übrigens immer bescheuert, wenn Leute in Büchern oder Filmen sagen, wie für sie in solchen Momenten die »Zeit stillsteht«. Das Problem ist ja, dass sie das gerade nicht tut – und dass es deshalb umso peinlicher ist, wenn es einem ewig lang die Sprache verschlägt.
»Äh … ja, glaub schon«, sagte ich schließlich und gab ihr die Rollschuhe zurück.
Um es kurz zu machen: Mit Mädchen war bei mir noch nicht viel gelaufen. Und mit nicht viel meine ich: gar nichts. In der Elementary School hatte ich mal eine Freundin gehabt, Wendy Stohler. Allerdings nur für zwei Tage, ich glaube, wir haben nicht mal Händchen gehalten. Wenn die First Base Küssen war und der Home Run Sex, dann saß ich noch in der Umkleidekabine und band meine Schuhe.
Immerhin stand ich nun von den Stufen auf – ich war ein bisschen kleiner als sie – und streckte meine Hand aus. »Sam Turner.«
»Ich weiß.« Sie griff danach. »Deine Mom ist mein Dealer.«
Ich starrte sie fragend an und betrachtete dabei verstohlen ihre Haare, die zu einem Bob geschnitten waren und ihr bis zum Kinn reichten.
»Lesestoff …«, versuchte sie es. »Bücher, diese viereckigen Dinger aus Papier?«
Sie erzählte, wie sie schon als Kind ins Best Books gekommen sei, als meine Mom jeden Samstag in ihrem Buchladen Geschichten vorlas. Und dass sie froh sei, dass es ihr bessergehe. Ich nickte, aber meine Gedanken flipperten umher. Ich dachte: Okay, dieses hübsche Mädchen redet wirklich mit dir. Ich dachte: Stell dich gerade hin, damit du größer wirkst. Ich dachte: Wenigstens hast du nicht das Bananen-T-Shirt an. Dabei hielt ich noch immer ihre Hand. Als sie es bemerkte, blitzte ihre kleine Zahnlücke auf.
»Kirstie Andretti«, sagte sie kaugummikauend und drückte zu. Ziemlich fest.
Ich ließ los und beobachtete, wie sie mit den Rollschuhen in der Hand ins Kino ging. Und zum ersten Mal seit Ewigkeiten war das dunkle Summen in mir verschwunden.
Nummer 3
Na ja, und dann war die erste Woche im Kino zum Vergessen. Dauernd nahm ich mir vor, mehr »aus mir herauszugehen«, denn das hatte schon die Schulpsychologin oft von mir gefordert. Nur, wenn man darüber nachdenkt, ist es ja eine Bankrotterklärung an das eigene Ich, wenn man besser dran ist, da rauszuschlüpfen und es wie eine kaputte Hülle zurückzulassen. Doch das hatte die Schulpsychologin nicht lustig gefunden. Und vielleicht war es auch nicht lustig, sondern die Wahrheit. Weil, im Metropolis stand ich ja wieder nur stumm herum.
Wenn viel los war, halfen mir die anderen, sonst blieben sie unter sich. Obwohl sie nicht mehr richtig im Kino arbeiteten, schien das Büro weiter ihr Treffpunkt zu sein, um die Zeit totzuschlagen und den Abend zu planen. Die drei wirkten wie ein verschworener Haufen. In den Pausen sah ich oft, wie sie zum See oder ins Larry’s aufbrachen, und wenn mich einer gefragt hätte, wäre ich sofort mitgekommen. Mich fragte aber keiner.
Der Einzige, der richtig mit mir redete, war Cameron. Hightower ignorierte mich, und Kirstie war so etwas wie der Inbegriff von süßsalzigem Popcorn. Sie konnte nett sein, aber in der Gruppe zog sie mich oft auf. Als ich den Saal für einen Horrorfilm herrichten wollte, sagte sie spöttisch zu den anderen: »Können wir den Kleinen da überhaupt ohne seine Eltern reinlassen?«
Keine Ahnung, wieso sie das immer mit mir machte. Und noch mehr ärgerte mich, dass ich trotzdem ständig zu ihr schaute. Ich dachte an ihre Augenbrauen, die ich insgeheim am liebsten mochte, und die im Gegensatz zu ihren blonden Haaren dunkel waren und an ihren Dad erinnerten. Und ich dachte an ein Gespräch, das ich im Replay Arcade mitgekriegt hatte. Zwei Jungs aus meinem Mathekurs hatten wie die letzten Idioten über Mädchen gequatscht. Irgendwann kam die Sprache auch auf Kirstie Andretti, und einer hatte behauptet, sie habe ein »heißes Höschen«. Mir war nur unklar, was das bedeutete. Dass sie schon mit vielen Jungen etwas gehabt hatte? Oder dass sie von vielen Jungen etwas wollte?
Es war jedenfalls etwas, das einen schon mal zum Nachdenken brachte.
Nach der Abendschicht ging ich nicht nach Hause. Stattdessen stand ich noch ewig hinter der Kasse. Ich kämpfte mit den Bildern in meinem Kopf und dachte an Mom, der es am Morgen nicht gutgegangen war. Und als ich wieder die Stimmen und das Gelächter der anderen hörte, nahm ich meinen Mut zusammen – und dann ging ich einfach zu ihnen ins Büro!
Drinnen war es übel verraucht. Kirstie, Hightower und Cameron saßen auf einer rissigen Ledercouch und blickten mich fragend an.
Sekundenlang stand ich an der Tür wie ein abgestellter Besen und brachte keine Silbe heraus. Aber als auch keiner der anderen etwas sagte, setzte ich mich einfach auf einen Stuhl zu ihnen. Und keine Ahnung, ob »ich« da endlich mal aus »mir« herausgegangen war. Oder ob wir nun beide hier hockten.
Die anderen schauten auf dem alten Minifernseher neben der Spüle MTV. Sie kommentierten die Videos und redeten von mir unbekannten Leuten und den Colleges, auf die sie nach dem Sommer alle gehen würden.
»Wisst ihr, was cool wäre?« Cameron rollte einen Joint. »Wenn alle Menschen wie Katzen schnurren würden, wenn sie was gut finden. Selbst wenn sie’s nicht wollen. Ein Pärchen hat zum Beispiel sein erstes Date, beide total schüchtern. Und plötzlich fängt der Junge an zu schnurren. Er versucht, es zu überspielen: ›Äh, weißt du schon, was du bestellst?‹ Auch das Mädchen tut, als hätte sie nichts gehört, und schaut verlegen in die Karte. Doch das Schnurren wird immer lauter …«
Die anderen sahen ihn an, als stünde er vor der Zwangseinweisung oder so, aber ich fand es lustig. Und es war irgendwie schön, wie sie über solche Sachen redeten und Witze übereinander machten. Weil, es erinnerte mich an Stevie und mich. Cameron und Hightower kannten sich sogar seit der Kindheit und wirkten wie ungleiche Brüder. Und Kirstie konnte derbere Sprüche machen als jeder Junge und sagte auch eigenartige Sätze wie: »Tja, Wahrheit hat eben scharfe Kanten.« Oder: »Da war ich noch tot« statt: »Da war ich noch nicht geboren.« Und sie schien alles Mögliche in dieser Gruppe zu sein. Nur nicht das stille Mädchen vom Friedhof.
Ich selbst sagte gar nichts, doch das war okay. Denn eigentlich dachte ich auch da nur daran, dass Mom mich über die Ferien nach Kansas schicken wollte – weg von ihr. Und ich weiß nicht, ob das jemand versteht; aber es war wirklich gut, an dem Abend nicht zu Hause zu sein, sondern mit den anderen im Büro.
Als sie später noch zu einer Party aufbrachen, lief ich einfach hinterher. Wir standen schon draußen vor dem Wagen, als Kirstie mich beiseitenahm. »Hey, Sam?«
Ich schaute sie an. Und da wusste ich, was kommen würde, noch bevor sie es sagte.
»Hör mal. Ist jetzt nicht böse gemeint, aber wir drei …«, Cameron und Hightower blickten verlegen zu uns, »wir kennen uns schon ewig und haben nur noch ein paar Wochen zusammen. Wir würden gern unter uns bleiben und …«
Ich nickte mehrmals. Ich glaube, ich hörte gar nicht mehr auf damit.
»Sicher«, sagte ich. »Viel Spaß auf der Party!«
Auf dem Heimweg schien jemand einen Aschenbecher über Grady ausgeschüttet zu haben, und auch als ich die Haustür öffnete: alles dunkel und grau. Bis ich merkte, dass im Flur wirklich kein Licht brannte. Dann hörte ich von oben aus dem Bad Dads gedämpfte Stimme – und wie Mom sich übergab.
Genau wie schon am Morgen.
Es war, wie wenn man im Halbschlaf noch hofft, dass etwas nur ein Alptraum war. Und dann kapiert man, dass es genau andersherum ist: Dass es immer die Wirklichkeit war, die wie ein Gewicht schon die ganze Zeit am Traum hing.
Ich bekam kaum noch Luft und taumelte hoch in mein Zimmer. Mom mit Glatze und Schläuchen auf dem Bett … Ihr leerer Blick …
Eine Weile stand ich regungslos da. Dann schlug ich auf mein Kopfkissen ein und brüllte hinein. Ich dachte: Es ändert sich nie, nie, nie etwas in diesem Scheißleben, und da schrie ich noch mehr. Der Summton in meinem Kopf schwoll an. Und es machte mir Angst, wie wütend ich nun auf mich selbst wurde, dabei konnte ich nicht mal genau sagen, wieso. Die Wut fing da an, wo meine Gedanken aufhörten.
Ich griff nach meiner Gitarre und übte so laut ich konnte. Mom hatte in ihrer Jugend mehrere Instrumente beherrscht und uns empfohlen (freundlich gesagt), auch eines zu lernen. Während meine Schwester damals Klavierunterricht erhielt und so gut wurde, dass sie sogar bei den Gottesdiensten Orgel spielen durfte, hatte ich Moms Gibson-Akustikgitarre bekommen.
Ich spielte und spielte, bis mein Kopf leer war und ich nichts mehr mitbekam. Irgendwann stand sie in meinem Zimmer. Sie trug ihren Morgenmantel und setzte sich zu mir aufs Bett, die Haare strähnig. »Stör ich dich?«
Ich schüttelte den Kopf und hörte auf.
»Hast du mich vorhin gehört?«
Ich antwortete nicht.
»Es ist nichts Schlimmes, nur wieder die Nebenwirkung der Medikamente, okay?«
Ich spürte Moms Hand auf meinem Arm und nickte erleichtert. Ihre Augen waren verquollen, ihr Gesicht erschöpft. Für einen Augenblick schien sie aus ihrer Rolle gefallen und selbst nicht zu wissen, was sie sagen wollte.
Dann lächelte sie und deutete auf die Gibson. »Spielst du etwas für mich?«
»Was denn?«, fragte ich leise.
»Was du möchtest … Halt, nein. Was von Billy Idol!«
Ich rollte mit den Augen. Sie war wirklich verrückt nach ihm. Manchmal sagte sie im Scherz, Billy Idol wäre jemand, »für den man so manches Gesetz brechen könnte«.
Ich konnte nur White Wedding. Mom lobte mich, auch wenn das Stück nicht schwer war. Auf der Highschool war sie die »kleine Stille mit Brille und Pferdeschwanz« gewesen (O-Ton Mom), am College hatte sie jedoch selbst in einer Rockband gespielt. Angeblich existierten davon sogar noch Fotos.
»Ich kann mir das bei dir nie vorstellen. Du hast doch nur Bücher gelesen und …«
»Ja, aber genauso hab ich eben Blues und Rock geliebt«, sagte sie. »Mein Held war damals Chuck Berry, deshalb haben wir uns ja die Wild Berrys genannt.«
Auf meinen Wunsch erzählte sie mir zum x-ten Mal, wie sie damals in der Mensa den Zettel entdeckt hatte, dass eine neue Rock ’n’ Roll-Band noch eine Sängerin suchte. Wie sie aus Angst erst kneifen wollte und sich dann überwunden hatte. Weil ja am College niemand wusste, dass sie eigentlich eher schüchtern war. »Außer mir … aber was, wenn ich mich da zufällig irrte? Also hab ich mich geschminkt, eine Elvis-Tolle frisiert und mich in diesem Aufzug beworben.«
»Zeigst du mir mal die Fotos von deiner Band?«
»Wenn du älter bist und dir einen guten Therapeuten leisten kannst.«
»Bitte!«, bettelte ich, doch Mom waren die Fotos aus irgendeinem Grund peinlich. Und so sagte sie das, was jeder in Grady sagte, wenn er etwas für sich behalten wollte: »Tut mir leid, Schatz, die bleiben eines der neunundvierzig Geheimnisse!«
Eine Weile war es still, dann kuschelte ich mich an sie. Ich wusste, dass ich zu alt dafür war, trotzdem war es schön. Denn so sehr es nervte, wenn Mom mich wie einen kleinen Jungen behandelte – in den vergangenen Jahren hatte es nicht gerade viele »behütete Kindheit«-Momente gegeben. Wenn ich einen entdeckte, stürzte ich mich darauf und gab ihn um nichts in der Welt wieder her.
Mom erkundigte sich, wie es im Kino lief. In meiner Erzählung wirkte es so, als hätte ich viel mit den anderen zu tun, und ich schämte mich für diese Lüge.
»Glaubst du, man kann sich wirklich ändern«, fragte ich irgendwann. »Also mutiger werden und nicht immer so still oder schüchtern sein?«
Das Gute an Gesprächen mit Mom war, dass man sie alles fragen konnte. Nichts wirkte in ihrer Nähe seltsam oder peinlich, nicht mal damals, wenn sie mich wegen meiner Angstticks von der Schule abholen musste. Ich glaube, das kam, weil in ihrem Leben selbst vieles anders gelaufen war als geplant. Zum Beispiel wollte meine Mom immer Psychologin werden. Und dann war sie schon mit zwanzig ungeplant mit Jean schwanger geworden und hatte das College abbrechen müssen. Meine Schwester sagte zwar oft, weil es mit ihrer Praxis nichts geworden war, würde Mom zur Strafe eben ständig uns beide therapieren – doch ich mochte es.
»Ich weiß es nicht«, sagte sie nachdenklich.
»Aber du hast dich doch geändert. Du hast deine Haare gefärbt und in einer richtigen Band gespielt.«
»Nur für eine kurze Zeit.« Sie kräuselte ihre Oberlippe. »Ich glaube nicht, dass man sich komplett ändern kann, aber ich würde schon sagen, dass ich jetzt offener und entspannter bin als in deinem Alter, beides hatte ich mir immer gewünscht. Und du hast wiederum bestimmt jemanden in dir, der mutiger ist oder weniger schüchtern. Aber daneben wird es auch immer noch den Sam von jetzt geben, und das ist gut so.« Sie stand auf. »Denn den hab ich lieb.«
Ich nickte nur. Und als sie es sah, hielt sie mir wortlos die Hand hin.
Gegen meinen Willen grinste ich, dann hakten wir unsere kleinen Finger ineinander. Unser uraltes Geheimzeichen. Das hatten wir früher oft gemacht, wenn ich mich als Kind vor etwas gefürchtet hatte und sie mir sagen wollte, dass alles gut würde.
Als sie gegangen war, löschte ich das Licht und trat ans offene Fenster. Es hatte geregnet, feuchte Nachtluft strömte herein. Meine Augen gewöhnten sich an die Dunkelheit. Eine Weile starrte ich auf den Wald in der Ferne. Und da bekam ich so viel Sehnsucht danach, ein anderer zu sein und alles hinter mir zu lassen, dass es mich fast zerriss. Vor mir der stille, nur von ein paar Grablichtern beleuchtete Friedhof. Für eine Sekunde sah ich dort in meiner Vorstellung Kirstie Andretti stehen und rauchen, dann war sie verschwunden. Ich schüttelte den Kopf.
Nummer 4
Am Morgen klebte ein Zettel am Kühlschrank: »Hallo Sam, bitte schau im Laden vorbei«. Die Schrift meines Vaters. Ich begriff sofort, was das bedeutete. Wie in Trance ging ich in die Garage, die ohne die beiden Autos seltsam nackt wirkte, dann schnappte ich mir mein Rad und fuhr los.
Vier Jahre zuvor hatten meine Eltern mich zu sich gerufen, um »etwas Wichtiges« zu besprechen. Damals hatte man auf Moms linker Hirnseite einen Tumor entdeckt. Ich würde gern sagen, dass ich total geschockt war oder so. Aber ich war erst elf gewesen und hatte noch nicht richtig kapiert, was das bedeutete.
Mom hatte jedenfalls eine Radiotherapie bekommen und war sofort operiert worden, drei Jahre danach dann noch mal. Obwohl der Tumor bösartig war, war sie davongekommen. Allerdings mit einer schlechten Prognose, wie die Ärzte sagten. Es war unwahrscheinlich, dass Mom die Krankheit ganz besiegte, sie konnte jederzeit zurückkehren. Meine Eltern hatten mir nur wenig erzählt, aber einmal hatte ich gehört, wie ein Pfleger sagte: »Siebzig Prozent der Patienten überleben keine fünf Jahre.«
Keine – fünf – Jahre!
Anfangs waren wir alle wie gelähmt gewesen. Ich glaube, ich redete mit niemandem außer mit Stevie darüber, ansonsten saß ich nur im Zimmer und spielte Gitarre. Doch so komisch es klingt: Irgendwann hatten wir uns an die ungewisse Situation gewöhnt. Und zumindest nach außen schien alles normal.
Mom war vielleicht nicht mehr so schwungvoll wie früher und durch die Medikamente öfter müde. Dennoch arbeitete sie wieder, wir lachten wie immer, stritten wie immer, schauten fern wie immer. Innerlich aber warteten wir alle nur auf neue schlechte Nachrichten. Denn der Tod saß die ganze Zeit bei uns am Küchentisch, trank seinen Kaffee, blickte stumm auf die Uhr.
Die Heartland Plaza Mall lag ein Stück außerhalb der Stadt. Sie war in den Fünfzigern gebaut worden, Gradys große Zeit, als die Textilfabrik noch blühte und ständig neue Leute brauchte.
Inzwischen war die Mall heruntergekommen, aber immer noch der Ort, wenn man Zeit totschlagen wollte. Von der Rolltreppe aus sah ich Mitschüler in den Cafés und Restaurants sitzen. Aus den Lautsprechern schallte das unvermeidliche Don’t You der Simple Minds.
Moms Buchladen hieß wie schon bei den Voreigentümern Best Books und war in der obersten Etage, gleich neben Mr. Andrettis Eiscafé Palermo. Und wie befürchtet war nicht sie da, sondern nur mein Vater, der Bücher aus einer Kiste in die Regale sortierte. Anders als Mom, die im Laden oft chaotisch war und bei jeder verlorenen Bestellung vor einem Nervenzusammenbruch stand, wirkte er wie immer stoisch und ruhig und so solide wie ein alter Briefbeschwerer aus Messing.
»Gut, dass du hier bist«, murmelte er. »Wir müssen reden.«
»Ist was mit Mom? … Wo ist sie?«
»Sie lässt sich heute im Krankenhaus in Jefferson untersuchen …«
Ich wartete, dass da noch etwas kam. Aber mein Vater sah mich bloß an und schien in meinem Gesicht nach etwas zu suchen. Wie immer, wenn er mich so betrachtete, kaute er auf diese nervige Art auf seiner Zunge herum. Unablässig. Am liebsten hätte ich geschrien: »Hör endlich auf mit dem Kauen!«
Er wandte sich wieder dem Karton zu. Lange hatte ich gehofft, mein Vater würde mal irgendetwas Nettes zu mir sagen oder mich sogar anbrüllen. Hauptsache, er nahm mich richtig wahr. Doch zwischen uns war einfach diese unsichtbare Mauer, und egal, wie viel ich davon abbaute, über Nacht hatte er’s wieder draufgeschichtet. Am meisten störte mich, dass er nur mit mir so war. Wenn ich früher gehört hatte, wie Dad mit Jean redete oder sogar lachte, hatte ich mir oft gewünscht, mehr wie meine Schwester zu sein. Und manchmal hatte ich mir gewünscht, keine Schwester zu haben.
»Ist es so schlimm?«, fragte ich. »Ist die Krankheit zurück?«
»Kann man noch nicht sagen. Morgen hole ich sie ab, dann wissen wir mehr.«
Ich nickte nur. Nie hatte ich Moms stabiler Phase getraut, nie! Die gute Zeit war wie eine Tapete, die man einfach abriss. Nun würde alles wieder werden wie in den Jahren davor, als wir ohnmächtig zu Hause oder in der Klinik saßen, den Geruch von Tod und Desinfektionsmittel in der Nase … Immerhin: Mom war eine Kämpferin. Nach der zweiten OP hatten die Ärzte gesagt, sie wäre ein »bemerkenswert zäher Knochen«. Und darauf war sie stolz, denn sie wollte noch mindestens die beiden Jahre bis zu meinem Highschool-Abschluss durchhalten.
»Also eigentlich genau wie du, Sam«, hatte sie mal zu mir gesagt und gelächelt.
Dad ging auf mich zu. Kurz glaubte ich, er würde mich in den Arm nehmen oder so, aber er griff nur nach dem leeren Karton hinter mir und räumte ihn ins Lager.
Ich stand noch immer an derselben Stelle, neben den Liebesromanen. Auf einmal begann es überall in mir zu kribbeln. Die Lichter in meinem Kopf flackerten, und ich hatte Angst, dass mich wie in meiner Kindheit eine Panikattacke überkam. Ich atmete mehrmals durch und las zur Ablenkung immer wieder die Titel der Bücher neben mir. Und irgendwann war tatsächlich alles wieder okay.
Im Kino hockte ich stumpf hinter der Kasse. Vor ihrer zweiten OP hatte Mom Sprachprobleme und Blackouts gehabt. Einmal hatte sie in der Küche Zuckungen bekommen. Ich wollte ihr helfen, da hatte sie mich plötzlich beleidigt und dann Spülmittel getrunken. Spülmittel! Allerdings hatte ich es erst richtig begriffen, als sie stöhnend vor mir zusammenbrach und sich übergab … Weitere Erinnerungen kamen nach, ein dunkler Bilderstrudel in meinem Kopf. Und die ganze Zeit fragte ich mich, was sein würde, falls sie starb. Ob ich dann allein mit Dad leben musste. Es machte mich ziemlich fertig, doch die anderen nahmen es gar nicht wahr.
»Immer deine bescheuerten Fragen«, hörte ich die tiefe Stimme von Hightower, als sie alle aus dem Büro kamen. »Lass dich mal von einem Psychiater durchchecken.«
»Das ist überhaupt keine bescheuerte Frage«, sagte Cameron. Er wandte sich an Kirstie. »Hey, Kay, was ist mit dir: Würdest du dir für fünf Millionen ein Monokel übers linke Auge tätowieren lassen? Und nein, du darfst es später nicht weglasern.«
»Klar«, sagte sie. »Wieso nicht?«
»Überleg’s dir gut«, sagte Cameron. »Du hast dann zwar die fünf Millionen, musst dafür aber auch auf ewig die Story mit der Monokel-Wette erzählen. Selbst in zwanzig Jahren noch, wenn du einen Job anfängst oder wenn du nach einer Scheidung jemand Neuen kennenlernst … Ist dir das echt fünf Millionen wert?«
»Du Arsch, wieso sollte ich mich scheiden lassen?« Sie lachte, dann deutete sie auf mich: »Frag mal den Kleinen, ich wette, der tut’s auch für die Hälfte.«
Und in diesem Moment machte etwas in mir klick. Ich verließ meinen Platz hinter der Kasse und ging einfach zum Ausgang.
»Hey, was wird denn das?«, fragte Cameron. »Blaumachen nur nach Absprache.«
»Ihr könnt mich mal, ICH KÜNDIGE!«, rief ich und knallte die Tür hinter mir zu.
Auf der Straße lief Kirstie mir nach. »Alles okay, Sam? Ich wollte dich nicht …«
»Verpiss dich einfach und lass mich in Ruhe!«
Ich beschleunigte meine Schritte, bis von ihr nichts mehr zu hören war. Was für ein scheiß Job, dachte ich. Was für eine scheiß Stadt! Entdecke die verdammten Geheimnisse von Grady? Ohne mich!
Ich überquerte die Eisenbahngleise und schaute mich erst nach Minuten um: über mir ein wolkenlos blauer Himmel, um mich herum Weizenfelder. Ein Gefühl ewiger Aussichtslosigkeit drückte mich nieder. Ich fuhr mir durchs glühend heiße Haar und dachte wieder an Mom. Es war alles ihre Schuld. Wieso hatte sie mich angelogen, dass es nichts Schlimmes war? Warum musste sie diese beschissene Krankheit haben?
Ich griff in den Boden und verrieb die trockene Erde zwischen meinen Fingern.
»AHHHHHHHHHH!«, brüllte ich. Ich ballte die Faust. »AHHHHHHHHHHHHHHH!«
Es tat überraschend gut. Und da schloss ich mit mir eine Wette: Wenn ich’s jetzt schaffe, zwölf Minuten am Stück zu rennen, dann bleibt meine Mutter noch jahrelang stabil. Ohne groß nachzudenken, sprintete ich durch die Weizenfelder. Da ich nie Sport machte, bekam ich schnell Seitenstechen und mir wurde übel, doch ich lief keuchend weiter, um mein Leben, um ihr Leben. Bis ich einfach nicht mehr konnte und Angst und Frust sich in Schweiß verwandelt hatten und von meinem Körper tropften. Erst dann blieb ich endlich stehen. Ich blickte auf die Uhr: neuneinhalb Minuten.
Nummer 5
Als ich heimkam, war es Nacht. Es brannte noch Licht. Ich stand vor dem Haus, in dem ich aufgewachsen war, und betrachtete es wie einen Feind. Es war für mich nur noch der Ort, der mich daran erinnerte, dass meine Schwester vor Jahren nach L.A. gezogen war, um diese Serie zu schreiben, und sich kaum noch blicken ließ. Und dass vielleicht auch Mom bald nicht mehr da war. Nach dem Tag in der Sommerhitze war ich zum Umfallen müde. Aber ich fürchtete, dass mein Vater noch wach war und mich anschnauzen würde, wo ich nur gewesen sei.
Ich setzte mich auf die Bank beim Friedhof, neben der Kirche. Wie gern hätte ich geglaubt, was sie dort jede Woche predigten. So wie früher als Kind. Bloß konnte ich diese Bibelgeschichten einfach nicht mehr glauben, nicht mit meinen neuen Augen. Und es brachte nichts, sich blind zu stellen, wenn man es einmal gesehen hatte.
Dafür entdeckte ich etwas Silbernes, das die Straße heraufkam: Kirstie auf einem Fahrrad. Wie so oft trug sie ein Baseballcap der St. Louis Cardinals.
»Dachte mir, dass du hier sein könntest.« Sie lehnte ihr Rad gegen den Zaun.
Ich schaute demonstrativ weg.
»Dein Vater hat vorhin meinen Vater angerufen, weil er sich Sorgen machte.«
Ich starrte auf unser Haus, dann ließ ich den Kopf hängen. Sagte noch immer nichts.
Kirstie setzte sich trotzdem neben mich. »Tut mir leid, wenn ich heute blöd zu dir war. Ich wollte dich nicht verletzen.«
Anders als im Kino, wo man ständig ihre laute Stimme hörte, wirkte sie zurückhaltend und nachdenklich. Eine Weile blickten wir stumm in die Nacht. Das war gut, schweigen konnte ich. In der Ferne schimmerte der Missouri River im Mondschein, dahinter die winzigen Lichtpunkte einer Siedlung.
»Dir ist schon klar, dass ich nicht gehe, bevor du mir nicht erzählt hast, was los ist«, murmelte sie irgendwann, ohne mich anzusehen.
Ich nickte. Und dann erzählte ich ihr von Moms Krankheit. Dass ich wegen ihrer Untersuchung innerlich sofort aufgestöhnt hatte: »Nicht schon wieder«, und mich dafür schämte. Dass ich es aber einfach nicht mehr aushielt: diese ständige, abgrundtiefe, gottverdammte Angst bei jedem Kopfschmerz und Schwindel von ihr. Am Ende erzählte ich Kirstie sogar, was das Allerschlimmste war. Das Allerschlimmste waren nämlich nicht die Unsicherheit oder die Kontrollen und Operationen. Nein, das Allerschlimmste war das jahrelange Warten: auf einen Rückfall … auf eine wundersame Heilung … auf das Ende.
»Ich hab deine Mom neulich in ihrem Laden gesehen, ich dachte, es ist alles wieder gut und …« Kirstie musterte mich von der Seite. »Was ist mit deinen Freunden? Hast du jemanden, mit dem du über das alles reden kannst?«
Ich überlegte mir eine ausweichende Antwort. Schließlich schüttelte ich den Kopf.
Es war mir unangenehm. Kirstie holte eine Schachtel Zigaretten heraus und steckte sich eine in den Mund. »Das alles muss so beschissen für dich sein.«
Ich wollte antworten, dass ich mich daran gewöhnt hätte. Dann spürte ich wieder dieses vertraute Gefühl von Beklemmung und Angst, das so groß war, dass es fast schon eine physische Form in mir hatte, wie eine dritte Niere oder so. Und auf einmal kamen mir die Tränen. Nicht vor ihr, dachte ich, du Idiot! Doch schon trug es mich fort, wie es mich in den letzten Jahren oft fortgetragen hatte, auf dem Schulhof und zu Hause, und alles in mir wurde wieder schwarz, und dann …