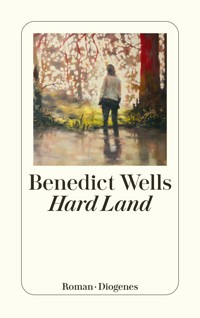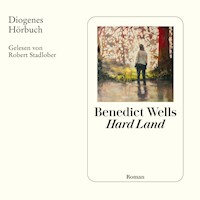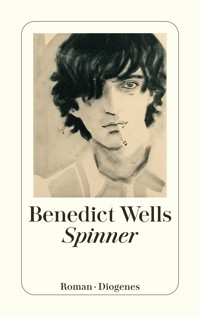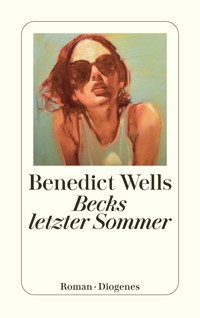10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes Verlag AG
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Jules und seine beiden Geschwister wachsen behütet auf, bis ihre Eltern bei einem Unfall ums Leben kommen. Als Erwachsene glauben sie, diesen Schicksalsschlag überwunden zu haben. Doch dann holt sie die Vergangenheit wieder ein. Ein berührender Roman über das Überwinden von Verlust und Einsamkeit und über die Frage, was in einem Menschen unveränderlich ist. Und vor allem: eine große Liebesgeschichte.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 372
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Benedict Wells
Vom Ende der Einsamkeit
Roman
Diogenes
Für meine Schwester
Rück mit dem Stuhl heran
Bis an den Rand des Abgrunds
Dann erzähl ich dir meine Geschichte
F. Scott Fitzgerald
ERSTER TEIL
Ich kenne den Tod schon lange, doch jetzt kennt der Tod auch mich.
Vorsichtig öffne ich die Augen, blinzle ein paarmal. Langsam weicht die Dunkelheit. Ein kahler Raum, erhellt nur vom grün- und rotleuchtenden Glimmen kleiner Apparate und dem Lichtstrahl, der durch die angelehnte Tür fällt. Die nächtliche Stille eines Krankenhauses.
Es kommt mir vor, als wäre ich aus einem tagelangen Traum erwacht. Ein dumpfer, warmer Schmerz in meinem rechten Bein, meinem Bauch, meiner Brust. In meinem Kopf ein leises Dröhnen, das stärker wird. Allmählich ahne ich, was geschehen sein muss.
Ich habe überlebt.
Bilder tauchen auf. Wie ich mit dem Motorrad aus der Stadt fahre, beschleunige, vor mir die Kurve. Wie die Räder auf der Landstraße nicht mehr greifen, ich den Baum auf mich zukommen sehe, vergeblich versuche auszuweichen, die Augen schließe …
Was hat mich gerettet?
Ich schiele an mir hinunter. Eine Halskrause, das rechte Bein fixiert, vermutlich Gips, das Schlüsselbein bandagiert. Vor dem Unfall bin ich gut in Form gewesen, für mein Alter sogar sehr gut. Vielleicht hat mir das geholfen.
Vor dem Unfall … War da nicht noch etwas ganz anderes? Doch ich will mich nicht daran erinnern, denke lieber an den Tag, als ich den Kindern beigebracht habe, einen Stein übers Wasser hüpfen zu lassen. An die gestikulierenden Hände meines Bruders, wenn er mit mir diskutierte. An den Italientrip mit meiner Frau und wie wir am frühen Morgen eine Bucht an der Amalfiküste entlangspazierten, während es um uns herum aufhellte und das Meer sanft gegen die Felsen schäumte …
Ich döse weg. Im Traum stehen wir auf dem Balkon. Sie sieht mir eindringlich in die Augen, als habe sie mich durchschaut. Mit dem Kinn deutet sie zum Innenhof, wo unsere Kinder gerade mit den Nachbarsjungen spielen. Während unsere Tochter mutig auf eine Mauer klettert, hält unser Sohn sich zurück und beobachtet die anderen nur.
»Das hat er von dir«, sagt sie.
Ich höre sie lachen und greife nach ihrer Hand …
Es piept mehrmals. Ein Pfleger befestigt einen neuen Infusionsbeutel. Es ist noch immer mitten in der Nacht. September 2014 steht auf einem Wandkalender. Ich versuche, mich aufzurichten.
»Welcher Tag ist heute?« Meine Stimme klingt fremd.
»Mittwoch«, sagt der Pfleger. »Sie waren zwei Tage im Koma.«
Es ist, als spräche er von einem anderen.
»Wie fühlen Sie sich?«
Ich lehne mich wieder zurück. »Mir ist etwas schwindlig.«
»Das ist völlig normal.«
»Wann kann ich meine Kinder sehen?«
»Ich werde Ihrer Familie sofort morgen früh Bescheid sagen.« Der Pfleger geht zur Tür, bleibt dort kurz stehen. »Wenn etwas ist, läuten Sie. Die Oberärztin sieht gleich noch mal nach Ihnen.«
Als ich nicht antworte, verlässt er den Raum.
Was sorgt dafür, dass ein Leben wird, wie es wird?
In der Stille höre ich jeden Gedanken, und auf einmal bin ich hellwach. Beginne einzelne Etappen meiner Vergangenheit abzugehen. Vergessen geglaubte Gesichter kommen mir entgegen, ich sehe mich als Jugendlichen auf dem Sportplatz des Internats und das rote Licht meiner Dunkelkammer in Hamburg. Erst sind die Erinnerungen nur unscharf, doch während der nächsten Stunden werden sie präziser. Meine Gedanken irren immer weiter in der Zeit zurück, ehe sie schließlich bei der Katastrophe landen, die meine Kindheit überschattet hat.
Strömungen
(1980)
Als ich sieben war, machte meine Familie Urlaub in Südfrankreich. Mein Vater, Stéphane Moreau, stammte aus Berdillac, einem Dorf bei Montpellier. Tausendachthundert Einwohner, eine Boulangerie, eine Brasserie, zwei Weingüter, eine Schreinerei und eine Fußballmannschaft. Wir besuchten unsere Oma, die den Ort in den letzten Jahren nicht mehr verlassen hatte.
Wie auf allen längeren Autofahrten trug unser Vater eine alte, hellbraune Lederjacke, im Mundwinkel seine Pfeife. Unsere Mutter, die den Großteil der Fahrt über gedöst hatte, legte eine Kassette mit Beatles-Songs ein. Sie drehte sich zu mir um.
»Für dich, Jules.«
Paperback Writer, damals mein Lieblingslied. Ich saß hinter ihr und summte mit. Die Musik wurde von meinen Geschwistern übertönt. Meine Schwester hatte meinen Bruder ins Ohr gekniffen. Martin, von uns nur »Marty« genannt, schrie auf und beschwerte sich bei unseren Eltern.
»Du blöde Petze.« Liz zwickte ihn wieder ins Ohr.
Sie stritten heftiger, bis unsere Mutter sich umdrehte und beide ansah. Ihr Blick war ein Meisterwerk. Er zeigte sowohl Verständnis für Marty angesichts seiner gemeinen Schwester wie auch für Liz angesichts ihres nervigen Bruders, vor allem aber zeigte er, dass jeglicher Streit total sinnlos war, und darüber hinaus deutete er sogar noch an, dass es für brave Kinder an der nächsten Tankstelle ein Eis geben könnte. Meine Geschwister ließen sofort voneinander ab.
»Wieso müssen wir eigentlich jedes Jahr zu Oma fahren?«, fragte Marty. »Wieso können wir nicht mal nach Italien?«
»Weil es sich so gehört. Und weil eure mamie sich über euren Besuch freut«, sagte unser Vater auf Französisch, ohne den Blick von der Straße zu nehmen.
»Stimmt nicht. Sie mag uns gar nicht.«
»Außerdem riecht sie so komisch«, sagte Liz. »Nach alten Polstermöbeln.«
»Nein, sie riecht nach einem modrigen Keller«, sagte mein Bruder.
»Sagt nicht immer solche Sachen über eure mamie!« Unser Vater lotste den Wagen durch einen Kreisverkehr.
Ich sah aus dem Fenster. In der Ferne erstreckten sich Thymiansträucher, Garigue und Krüppeleichen. Die Luft roch würziger in Südfrankreich, die Farben waren intensiver als zu Hause. Ich griff in meine Tasche und spielte mit den silbernen Franc-Münzen, die vom vorigen Jahr übriggeblieben waren.
Gegen Abend erreichten wir Berdillac. Der Ort kam mir im Rückblick immer wie ein mürrischer, aber im Grunde liebenswerter Greis vor, der den ganzen Tag vor sich hin döst. Wie in vielen Gegenden im Languedoc waren die Häuser aus Sandstein gebaut, sie hatten schlichte Fensterläden und rötliche, verwitterte Ziegeldächer, von der tiefstehenden Sonne in weiches Licht getaucht.
Der Kies knirschte unter den Rädern, als der Kombi vor dem Haus am Ende der Rue Le Goff zum Halten kam. Etwas Unheimliches ging von dem Gebäude aus, die Außenfassade war von Efeu überwachsen, das Dach marode. Es roch nach Vergangenheit.
Unser Vater stieg zuerst aus und eilte mit federnden Schritten zur Tür. Es müssen damals »seine« Jahre gewesen sein, wie man so sagt. Mit Mitte dreißig hatte er noch sein dichtes, schwarzes Haar und begegnete jedem mit liebenswürdiger Höflichkeit. Oft sah ich, wie Nachbarn und Kollegen um ihn standen und gebannt zuhörten, wenn er sprach. Das Geheimnis war seine Stimme: sanft, nicht zu tief, nicht zu hoch, sein Akzent nur angedeutet, wie ein unsichtbares Lasso legte sie sich um seine Zuhörer und zog sie näher zu sich heran. In seinem Job als Wirtschaftsprüfer war er sehr geschätzt, doch für ihn zählte nur seine Familie. Jeden Sonntag kochte er für uns alle, er hatte immer Zeit für uns Kinder, und mit seinem jungenhaften Lächeln wirkte er optimistisch. Wenn ich später Bilder von ihm ansah, erkannte ich allerdings, dass schon damals etwas nicht stimmte. Seine Augen. Ein Funke Schmerz lag in ihnen, vielleicht auch Angst.
Unsere Großmutter erschien in der Tür. Sie hatte einen schiefen Mund, und ihren Sohn sah sie kaum an, als schäme sie sich für etwas. Beide umarmten einander.
Wir Kinder beobachteten die Szene vom Wagen aus. Es hieß, unsere Großmutter sei in ihrer Jugend eine hervorragende Schwimmerin gewesen und im ganzen Dorf beliebt. Das musste hundert Jahre her sein. Ihre Arme wirkten zerbrechlich, sie hatte einen runzligen Schildkrötenkopf, und den Lärm, den ihre Enkel machten, schien sie kaum noch zu ertragen. Wir Kinder fürchteten uns vor ihr und vor dem karg eingerichteten Haus mit den altmodischen Tapeten und Eisenbetten. Ein Rätsel, wieso unser Vater jeden Sommer hierherkommen wollte. »Es war, als müsse er Jahr für Jahr an den Ort seiner größten Demütigungen zurückkehren«, hatte Marty später einmal gesagt.
Doch es gab auch: Kaffeeduft am Morgen. Sonnenstrahlen auf dem gefliesten Boden des Salons. Zartes Scheppern aus der Küche, wenn meine Geschwister das Besteck für das Frühstück holten. Mein Vater in seine Zeitung vertieft, meine Mutter Pläne für den Tag schmiedend. Danach Höhlenwanderungen, Fahrradtouren oder eine Partie Pétanque im Park.
Ende August schließlich das alljährliche Weinfest von Berdillac. Abends spielte die Kapelle, die Häuser waren mit Lampions und Girlanden geschmückt, und der Geruch von gegrilltem Fleisch durchzog die Straßen. Meine Geschwister und ich saßen auf der großen Treppe vor dem Rathaus und sahen zu, wie die Erwachsenen auf dem Dorfplatz tanzten. In meiner Hand die Kamera, die mir mein Vater anvertraut hatte. Eine schwere und teure Mamiya; ich hatte den Auftrag bekommen, Fotos vom Fest zu schießen. Das empfand ich als Ehre, unser Vater überließ sonst keinem seine Kameras. Stolz machte ich ein paar Bilder, während er unsere Mutter elegant über die Tanzfläche führte.
»Papa ist ein guter Tänzer«, sagte Liz sachverständig.
Meine Schwester war elf, ein großes Mädchen mit blonden Locken. Schon damals hatte sie das, was mein Bruder und ich die »Theaterkrankheit« nannten; Liz benahm sich zu jeder Zeit, als stünde sie auf einer Bühne. Sie strahlte, als wären mehrere Scheinwerfer auf sie gerichtet, und sprach so laut und klar, dass selbst die Menschen in den hintersten Reihen sie problemlos hörten. Vor Fremden gab sie gern die Frühreife, doch in Wahrheit hatte sie ihre Prinzessinnenphase gerade erst überwunden. Meine Schwester zeichnete und sang, sie spielte gern draußen mit den Nachbarskindern, duschte sich oft tagelang nicht, wollte mal eine Erfinderin werden, träumte dann wieder davon, eine Elfe zu sein, und in ihrem Kopf schienen tausend Dinge gleichzeitig zu geschehen.
Damals machten sich die meisten Mädchen über Liz lustig. Oft sah ich, wie meine Mutter bei ihr im Zimmer saß und beruhigend auf sie einredete, wenn ihre Mitschülerinnen sie wieder geärgert oder ihren Schulranzen versteckt hatten. Danach durfte auch ich in Liz’ Zimmer. Dann schlang sie wild ihre Arme um mich, ich spürte ihren heißen Atem auf meiner Haut, und sie erzählte mir noch einmal alles, was sie unserer Mutter erzählt hatte, und vermutlich noch mehr. Ich liebte meine Schwester wie nur irgendwas, und das änderte sich auch nicht, als sie mich Jahre später im Stich ließ.
Nach Mitternacht lag noch immer eine feuchte Schwüle über dem Dorf. Die Männer und Frauen, die noch auf der Tanzfläche waren – unsere Eltern gehörten dazu –, wechselten nach jedem Lied den Partner. Ich machte wieder ein Foto, obwohl ich die Mamiya kaum mehr halten konnte.
»Gib mal die Kamera«, sagte mein Bruder.
»Nein, Papa hat sie mir gegeben. Ich soll darauf aufpassen.«
»Nur kurz, ich will bloß ein Bild machen. Du kannst das eh nicht.«
Marty entriss mir die Kamera.
»Sei nicht so fies zu ihm«, sagte Liz. »Er hat sich so gefreut, dass er sie haben darf.«
»Ja, aber seine Fotos sind Mist, er kann das mit der Belichtung nicht.«
»Du bist so ein Klugscheißer, kein Wunder, dass du keine Freunde hast.«
Marty schoss ein paar Fotos. Er war das mittlere Kind. Zehn Jahre alt, Brille, dunkle Haare, blasses, unauffälliges Gesicht. Während in Liz und mir deutlich unsere Eltern wiederzufinden waren, hatte er äußerlich nichts mit ihnen gemein. Marty schien aus irgendeinem Nirgendwo gekommen zu sein, ein Fremdling, der zwischen uns Platz genommen hatte. Ich mochte ihn kein bisschen. In den Filmen, die ich sah, waren ältere Brüder immer heldenhafte Jungen, die sich für ihre kleineren Geschwister einsetzten. Mein Bruder dagegen war ein Einzelgänger, der den ganzen Tag in seinem Zimmer hockte, um mit seiner Ameisenkolonie zu spielen oder Blutproben von sezierten Salamandern und Mäusen zu untersuchen – sein Vorrat an toten Kleintieren schien unerschöpflich. Liz hatte ihn vor kurzem einen »widerlichen Freak« genannt, und damit hatte sie ziemlich ins Schwarze getroffen.
Von jenem Urlaub in Frankreich sind mir neben dem dramatischen Vorfall am Ende nur ein paar Bruchstücke geblieben. Allerdings weiß ich noch gut, wie wir Geschwister auf dem Fest die französischen Kinder betrachteten, die auf dem Dorfplatz Fußball spielten, und wie uns dabei ein Gefühl des Fremdseins überkam. Wir waren alle drei in München geboren und fühlten uns als Deutsche. Bei uns gab es außer speziellen Speisen kaum etwas, das auf unsere französischen Wurzeln verwies, und nur selten sprachen wir Französisch. Dabei hatten sich unsere Eltern in Montpellier kennengelernt. Mein Vater war nach der Schule dorthin gezogen, weil er vor seiner Familie fliehen wollte. Meine Mutter war dorthin gezogen, weil sie Frankreich liebte. (Und weil sie vor ihrer Familie fliehen wollte.) Wenn unsere Eltern von damals erzählten, dann von Abenden, an denen sie im Kino gewesen waren und an denen unsere Mutter auf der Gitarre gespielt hatte, von der ersten Begegnung auf der Studentenfete eines gemeinsamen Freundes oder wie die beiden – da war sie bereits schwanger – zusammen nach München gegangen waren. Nach solchen Erzählungen hatten meine Geschwister und ich stets das Gefühl gehabt, unsere Eltern zu kennen. Und später, als sie weg waren, hatten wir feststellen müssen, dass wir nichts von ihnen wussten, gar nichts.
Wir machten einen Spaziergang, doch beim Aufbruch verriet unser Vater nicht, wohin wir gingen, und auch unterwegs sprach er kaum ein Wort. Zu fünft wanderten wir eine Anhöhe hinauf und kamen zu einem Waldstück. Vor einer gewaltigen Eiche auf dem Hügel blieb mein Vater stehen.
»Seht ihr, was da eingeritzt ist?«, fragte er, doch er wirkte abwesend.
»L’arbre d’Eric«, las Liz. »Erics Baum.«
Wir betrachteten die Eiche. »Da hat jemand einen Ast abgehackt.« Marty deutete auf die runde, wulstige Stelle am Baum.
»Ja, tatsächlich«, murmelte unser Vater.
Meine Geschwister und ich hatten unseren Onkel Eric nie kennengelernt, es hieß, er sei schon vor vielen Jahren umgekommen.
»Wieso heißt denn der Baum so?«, fragte Liz.
Die Miene unseres Vaters hellte sich auf. »Weil mein Bruder an diesem Baum seine Mädchen verführt hat. Er hat sie hierhergeführt, sie haben sich auf die Bank gesetzt, runter ins Tal gesehen, er hat ihnen Gedichte vorgetragen, und dann hat er sie geküsst.«
»Gedichte?«, fragte Marty. »Und das hat geklappt?«
»Jedes Mal. Und deshalb hat dann irgendein Scherzbold mit einem Messer die Worte in die Rinde geritzt.«
Er blickte in das morgenkühle Blau des Himmels, unsere Mutter lehnte sich an ihn. Ich sah zum Baum und wiederholte im Stillen: L’arbre d’Eric.
Und dann kam das Ende der Ferien, noch ein letzter Ausflug. In der Nacht hatte es wieder geregnet, dicke Tautropfen hingen an den Blättern, die Morgenluft legte sich frisch auf meine Haut. Wie immer, wenn ich früh aufstand, hatte ich das herrliche Gefühl, der Tag gehöre mir. Ich hatte vor ein paar Tagen ein Mädchen aus dem Ort kennengelernt, Ludivine, und erzählte meiner Mutter von ihr. Mein Vater war wie jedes Mal am Ende des Frankreichurlaubs erleichtert, das Ganze für ein Jahr hinter sich gebracht zu haben. Er blieb manchmal stehen, um zu fotografieren, dabei pfiff er unablässig vor sich hin. Liz wanderte voraus, Marty trottete als Letzter hinterher, fast immer mussten wir auf ihn warten.
Im Wald stießen wir auf einen Fluss voller Geröll, über den ein Baumstamm führte. Da wir ohnehin auf die andere Seite mussten, fragten meine Geschwister und ich, ob wir darüberbalancieren dürften.
Unser Vater stieg auf das Holz und prüfte es. »Könnte gefährlich sein«, sagte er. »Also ich gehe da bestimmt nicht rüber.«
Auch wir sprangen auf den Baumstamm. Erst jetzt begriffen wir, wie tief es hinunterging, wie glitschig die Rinde war und wie steinig und breit der Fluss. Knapp zehn Meter lang war der Weg, und wer da ausrutschte und runterfiel, würde sich mit Sicherheit verletzen.
»Da hinten kommt eh eine Brücke«, sagte Liz. Obwohl sie sonst alles ausprobierte – diesmal kniff sie und ging weiter, mein Bruder folgte ihr. Nur ich blieb stehen. Angst war mir damals fremd, erst vor wenigen Monaten hatte ich mich als Einziger aus meiner Klasse getraut, einen steilen Abhang mit dem Fahrrad hinunterzufahren. Nach einigen Metern hatte ich die Kontrolle verloren, mich überschlagen und mir den Arm gebrochen. Doch kaum war ich den Gips los und der Bruch verheilt, suchte ich schon nach dem nächsten gefährlichen Abenteuer.
Ich starrte noch immer auf den Baumstamm vor mir, und ohne groß darüber nachzudenken, setzte ich einen Schritt vor den anderen.
»Du bist verrückt«, rief Marty, doch ich hörte nicht hin. Einmal rutschte ich fast aus, beim Blick auf den steinigen Fluss unter mir wurde mir schwindlig, doch da hatte ich bereits die Hälfte erreicht. Mein Herz schlug schneller, ich rannte die letzten zwei Meter und kam glücklich auf der anderen Seite an. Vor Erleichterung riss ich die Arme hoch. Bis zur Brücke ging meine Familie links den Fluss entlang, ich allein rechts, ab und zu sah ich zu ihnen und grinste. So stolz war ich noch nie zuvor gewesen.
Der Fluss führte aus dem Wald hinaus. Er wurde breiter, die Strömung schneller, der Regen der vergangenen Tage hatte den Pegel ansteigen lassen. Das Ufer war schlammig und aufgeweicht, ein Schild warnte Spaziergänger davor, zu nahe zu treten.
»Wer da reinfällt, ertrinkt.« Marty blickte auf das tosende Wasser.
»Hoffentlich plumpst du rein, dann sind wir dich endlich los«, sagte Liz.
Er trat nach ihr, doch sie wich geschickt aus und hakte sich bei unserer Mutter auf eine so selbstverständliche und lässige Weise unter, wie nur sie es konnte.
»Bist du wieder frech gewesen?«, fragte unsere Mutter. »Wie es aussieht, werden wir dich wohl hier bei Oma zurücklassen müssen.«
»Nein«, sagte Liz in halb gespieltem, halb echtem Entsetzen. »Bitte nicht.«
»Du lässt mir leider keine Wahl. Oma wird gut auf dich aufpassen.« Sie machte den tadelnden Blick unserer Großmutter nach, und Liz lachte.
Unsere Mutter war eindeutig der Star der Familie, jedenfalls für uns Kinder. Sie war attraktiv und grazil, hatte in ganz München Freunde und gab Dinnerpartys, zu denen auch Künstler, Musiker oder Theaterschauspieler kamen, die sie Gott weiß wo kennengelernt hatte. Übrigens untertreibe ich gewaltig, wenn ich sie als »attraktiv« oder »grazil« beschreibe. Das sind klägliche Worte, die nicht ansatzweise unser Gefühl wiedergeben können, dass wir zufällig eine Mischung aus Grace Kelly und Ingrid Bergman als Mutter hatten. Es schien mir als Kind unbegreiflich, dass sie kein Leben als berühmte Schauspielerin führte, sondern einfach nur eine Lehrerin war. Sie selbst nahm ihre Pflichten zu Hause oft mit einem belustigten und zugleich liebevollen Lächeln hin, und erst später wurde mir bewusst, wie eingeengt sie sich gefühlt haben musste.
Auf einer Wiese am Flussufer rasteten wir. Unser Vater stopfte seine Pfeife, wir aßen die mitgebrachten Schinkenbaguettes. Später spielte unsere Mutter auf der Gitarre ein paar Chansons von Gilbert Bécaud.
Als unsere Eltern dazu sangen, verdrehte Marty die Augen. »Bitte hört auf. Das ist so peinlich.«
»Aber es ist doch niemand hier«, sagte unsere Mutter.
»Doch, die da!«
Mein Bruder deutete auf das gegenüberliegende Flussufer, wo sich gerade eine andere Familie niedergelassen hatte. Die Kinder waren in unserem Alter, sie hatten einen jungen Mischlingshund dabei, der zwischen ihnen herumtobte.
Es wurde Mittag, die Sonne stand hoch am Himmel. In der Hitze zogen Marty und ich unsere T-Shirts aus und legten uns auf eine Decke. Liz kritzelte in einen Block; kleine Zeichnungen und immer wieder ihren Namen. Damals probierte sie oft aus, in welcher Schrift er am schönsten aussah, und schrieb ihn überall hin, auf Papier, auf den Tisch, in Ordner oder auf Servietten. Liz, Liz, Liz.
Unsere Eltern machten einen Spaziergang und verschwanden aneinandergeschmiegt in der Ferne, wir Geschwister blieben auf der Wiese zurück. Die Landschaft war von der Sonne gesättigt. Marty und Liz spielten Karten, ich zupfte auf der Gitarre herum und beobachtete die Familie auf der anderen Flussseite. Immer wieder hörte ich ihr Gelächter, durchdrungen von Hundegebell. Ein Junge warf ab und zu einen Stock, den der Mischling sofort holte, bis es dem Jungen offenbar zu langweilig wurde und er den Stock unter einer Decke versteckte. Der Hund jedoch wollte weiterspielen, er rannte immer wieder zu den einzelnen Familienmitgliedern und schließlich etwas weiter flussabwärts. Ein größerer Ast hatte sich in einem Gestrüpp am Ufer verfangen. Der Hund versuchte, ihn mit dem Maul wegzuzerren, doch es gelang ihm nicht. Die Strömung des Flusses war an dieser Stelle reißend und stark. Ich beobachtete die Szene als Einziger und spürte, wie sich mir die Nackenhaare aufstellten.
Der junge Hund zerrte am Ast und kam in seinem Übermut dem rauschenden Wasser immer näher. Ich wollte gerade die Familie von gegenüber darauf aufmerksam machen, da hörte ich ein Jaulen. Ein Stück des Ufers war einfach weggebrochen und der Hund ins Wasser gefallen. Nur mit seinen Vorderpfoten und den Zähnen krallte er sich weiter am Ast fest. Er winselte und versuchte, sich wieder ans bröckelnde Ufer zurückzukämpfen, doch die Strömung war zu stark. Sein Winseln wurde lauter.
»O mein Gott«, sagte Liz.
»Er schafft es nicht«, sagte Marty. Er klang so bestimmt, als wäre er der Richter über diese Szene.
Die Familie auf der anderen Seite rannte zum Hund. Sie hatte ihn gerade erreicht, da löste sich der Ast vom Gestrüpp und wurde mitsamt dem Mischling fortgespült.
Eine Weile hielt er sich noch über Wasser, dann verschwand er im Fluss. Während die Kinder von gegenüber schrien und weinten, wandte ich mich ab und sah in die Gesichter meiner Geschwister. Ihre Blicke habe ich nie mehr vergessen.
Abends im Bett hörte ich noch immer das Jaulen des Hundes. Liz war den ganzen Tag bedrückt gewesen, Marty sagte kaum etwas. Am seltsamsten war jedoch, dass unsere Eltern nicht da gewesen waren, als es geschah. Natürlich hatten sie nach ihrer Rückkehr versucht, uns zu trösten, aber es änderte nichts daran, dass meine Geschwister und ich etwas erlebt hatten, was nur uns allein erschütterte.
Damals wälzte ich mich die halbe Nacht im Bett. Wie das unbeschwerte Glück der Familie von der anderen Uferseite binnen Sekunden zerstört worden war, ließ mich nicht los. Mir fiel wieder mein Onkel Eric ein und wie man uns einmal gesagt hatte, er sei »umgekommen«. Bis jetzt war mein Leben behütet verlaufen, aber offenbar gab es unsichtbare Kräfte und Strömungen, die alles schlagartig verändern konnten. Denn es schien Familien zu geben, die vom Schicksal verschont blieben, und andere, die das Unglück auf sich zogen, und in dieser Nacht fragte ich mich, ob meine Familie auch so eine war.
An der Weiche
(1983–1984)
Dreieinhalb Jahre später, im Dezember 1983: das letzte Weihnachtsfest mit meinen Eltern. Am frühen Abend stand ich am Fenster meines Kinderzimmers, während die anderen das Wohnzimmer herrichteten. Wie jedes Jahr riefen sie mich erst, wenn alles fertig geschmückt war, doch wie lange dauerte es noch? Ich hörte draußen meinen Bruder maulen, das helle, versöhnliche Lachen meiner Mutter. Hörte, wie meine Schwester und mein Vater diskutierten, welche Tischdecke sie nehmen sollten. Um mich abzulenken, sah ich in den Innenhof, auf die winterlich kahlen Bäume, die Schaukel und das Baumhaus. Vieles hatte sich in den letzten Jahren verändert, aber nie der Blick in den geliebten Hof.
Es klopfte an der Tür. Mein Vater trat ein, er trug einen marineblauen Kaschmirpullover und kaute auf seiner Pfeife. Inzwischen ging er auf die vierzig zu. Die schwarzen Haare waren vorne gelichtet, das jungenhafte Lächeln verschwunden. Was war mit ihm geschehen? Vor Jahren hatte er noch fröhlich und zuversichtlich gewirkt, und nun stand diese geduckte Gestalt im Zimmer.
Er und meine Mutter machten nur noch selten etwas zu zweit, dafür verschwand mein Vater oft stundenlang, um zu fotografieren. Seine Fotos zeigte er uns jedoch nie, und selbst wenn ich mit Freunden spielte, konnte ich ihn und seine missmutigen Blicke in meinem Rücken spüren. Aus seinen Augen betrachtet, war die Welt ein Ort ständiger Gefahren. Etwa beim Autofahren, wenn meine Mutter am Steuer saß. (»Das ist viel zu schnell, Lena, du bringst uns noch alle um.«) Oder wenn ich wie jeden Sommer den Fluss bei Berdillac überqueren wollte und über den Baumstamm lief. (»Jules, ich kann das wirklich nicht mehr mit ansehen, wenn du da runterfällst, brichst du dir das Genick!«) Oder wenn Liz mit Schulfreundinnen auf ein Konzert gehen wollte. (»Das verbiete ich dir, wer weiß, was da für Leute rumlaufen!«) Hätte mein Vater einen Ratgeber geschrieben, wäre der Titel vermutlich »Lass es lieber« gewesen.
Nur wenn er mit Freunden im Park kickte, war er gelöst, und dann bewunderte ich ihn dafür, wie er mit dem Ball am Fuß über den Platz schwebte und seine Gegenspieler ins Leere laufen ließ. Als Jugendlicher in Frankreich hatte er im Verein gespielt, und noch immer besaß er ein untrügliches Gefühl für den Raum, konnte die Zuspiele des Gegners erahnen und preschte im richtigen Moment in die Lücken. Als wäre er der Einzige, der das Spiel wirklich verstand.
Mein Vater stellte sich zu mir ans Fenster. Er roch nach Tabak und seinem herben, moosigen Rasierwasser. »Freust du dich aufs Fest, Jules?«
Als ich nickte, tätschelte er mir die Schulter. Früher waren wir, wenn er abends von der Arbeit gekommen war, oft durch Schwabing spaziert. Es gab noch die alten Eckkneipen und Stehcafés, verdreckte gelbe Telefonzellen und Kramläden, in denen Schokolade, Wollstrümpfe oder – mein Favorit – zertifizierte Grundstücke auf dem Mond angeboten wurden. Das Viertel wirkte wie ein zu groß geratenes Dorf, in dem die Zeit etwas langsamer verging. Manchmal hatten wir noch in einem Park ein Eis gegessen, und mein Vater hatte mir erzählt, wie er als junger Mann ein halbes Jahr in Southampton am Hafen gearbeitet hatte, um sich sein Studium zu finanzieren und Englisch zu lernen, oder von den Streichen seines Bruders Eric in ihrer Kindheit, und diese Geschichten mochte ich am meisten.
In besonderer Erinnerung ist mir jedoch der Ratschlag geblieben, den er mir bei unserem letzten Spaziergang gegeben hatte. Anfangs hatte ich mit seinen Worten nicht viel anfangen können, doch im Laufe der Jahre waren sie für mich zu einer Art Vermächtnis geworden.
Mein Vater hatte damals gesagt: »Am wichtigsten ist, dass du deinen wahren Freund findest, Jules.« Er hatte gemerkt, dass ich nicht verstand, und mich eindringlich angesehen. »Dein wahrer Freund ist jemand, der immer da ist, der dein ganzes Leben an deiner Seite geht. Du musst ihn finden, das ist wichtiger als alles, auch als die Liebe. Denn die Liebe kann vergehen.« Er fasste mich an der Schulter. »Hörst du zu?«
Ich hatte mit einem Stock gespielt, den ich auf dem Boden gefunden hatte, und warf ihn weg. »Wer ist dein wahrer Freund?«, fragte ich.
Mein Vater hatte nur den Kopf geschüttelt. »Ich habe ihn verloren«, die Pfeife zwischen den Lippen, »ist das nicht seltsam? Einfach so verloren.«
Ich hatte nicht gewusst, was ich mit alldem anfangen sollte, und vielleicht ahnte ich auch, dass aus diesen wohlmeinenden Worten seine eigene Enttäuschung sprach. Nichtsdestotrotz hatte ich mir seinen Ratschlag eingeprägt. Ich wünschte, ich hätte es nicht getan.
»Hab gehört, du kriegst nachher ein richtig tolles Geschenk«, sagte mein Vater auf Französisch, als er das Zimmer wieder verließ.
»Wirklich? Was denn?«
Er lächelte. »Die paar Minuten musst du dich noch gedulden.«
Es fiel mir schwer. Von draußen hörte ich bereits Klaviermusik – Stille Nacht und A la venue de Noël. Und dann, endlich, kamen Liz und Marty den Flur entlanggerannt und rissen die Tür auf.
»Los, komm!«
Der bis zur Decke reichende Baum im Wohnzimmer war mit bunten Kugeln, Holzfiguren und Kerzen geschmückt, darunter stapelten sich die Geschenke, es duftete nach Wachs und Tannenzweigen. Auf dem Tisch standen ein großer Truthahn, dazu Kartoffelgratin, Lammragout, Roastbeef, Preiselbeermarmelade, Buttercremekuchen und Pasteten. Es war immer zu viel, so dass man die Reste in den folgenden Tagen als kalte Snacks aus dem Kühlschrank aß, was ich besonders liebte.
Nach dem Essen sangen wir Weihnachtslieder, dann folgte das letzte Ritual vor dem großen Geschenkeauspacken: Unsere Mutter spielte auf der Gitarre Moon River. Sie kostete diesen Moment jedes Mal aus.
»Wollt ihr das Lied wirklich hören?«, fragte sie.
»Ja«, riefen wir alle.
»Ach, ich weiß nicht. Ich glaube, ihr seid nur höflich.«
»Doch, wir wollen es hören!«, riefen wir, lauter als zuvor.
»Gebt mir ein neues Publikum«, seufzte unsere Mutter enttäuscht. »Dieses hier ist satt und will mich nicht mehr.«
Wir brüllten immer lauter, bis sie doch noch die Gitarre nahm.
Unsere Mutter war für uns noch immer der Mittelpunkt der Familie. War sie in der Nähe, wurden aus den Streitereien meiner Geschwister alberne Wortgefechte, über die man lachte, und Krisen in der Schule verwandelten sich in kleinere Rückschläge, die man problemlos bewältigte. Sie stand Liz Modell für ihre Zeichnungen oder ließ sich von Marty seine Forschungsergebnisse mit dem Mikroskop zeigen. Mir brachte sie das Kochen bei und verriet mir sogar das Geheimrezept für ihren »unwiderstehlichen Kuchen«, eine klebrige Schokoladenpampe, nach der man sofort süchtig wurde. Und obwohl sie etwas faul war – klassische Szene: Unsere Mutter lag auf der Couch und dirigierte uns zum Kühlschrank, um ihr etwas zu bringen – und heimlich rauchte, wollten wir alle so sein wie sie.
Endlich fing sie an zu spielen, ihre Stimme erfüllte den Raum.
Moon River, wider than a mile,
I’m crossing you in style some day.
Oh, dream maker, you heart breaker,
wherever you’re going I’m going your way.
Es war der Moment im Jahr, in dem alles stimmte. Liz hörte mit offenem Mund zu, mein Bruder nestelte gerührt an seiner Brille, und mein Vater lauschte mit traurigen Augen, aber verzücktem Gesicht. Neben ihm saß Tante Helene, die ältere Schwester unserer Mutter, eine heitere, voluminöse Frau, die allein in ihrer Wohnung im Glockenbachviertel lebte und uns jedes Mal riesige Geschenke machte. Abgesehen von unserer weit entfernten Großmutter in Frankreich war das alles an Familie, was wir noch hatten: ein dünner Ast am Moreau-Stammbaum.
Bei der Bescherung schnappte ich mir als Erstes das Geschenk meines Vaters, es war klobig und groß. Ich riss die Verpackung auf: eine alte Mamiya. Mein Vater sah mich erwartungsvoll an. Die Kamera kam mir bekannt vor, doch seit dem Fest in Berdillac hatte ich nicht mehr fotografiert. Dazu war die Mamiya schon gebraucht und voller Kratzer, die Linse wirkte wie das überdimensionale Auge eines Zyklopen, die Knöpfe knackten beim Verstellen. Enttäuscht legte ich sie weg und öffnete die anderen Geschenke.
Von meiner Mutter hatte ich ein rotes Notizbuch aus Leder und drei Romane geschenkt bekommen: Tom Sawyer, Der kleine Prinz und Krabat. Noch immer las sie mir abends vor, immer öfter ließ sie aber auch mich vorlesen und lobte mich, wenn ich es gut gemacht hatte. Vor kurzem hatte ich zum ersten Mal selbst eine Geschichte geschrieben, über einen verzauberten Hund. Meiner Mutter hatte sie sehr gefallen. Ich nahm das rote Notizbuch in die Hand, und später, als die anderen Brettspiele spielten, schrieb ich meine Gedanken hinein.
Kurz vor Neujahr sahen wir unseren Vater das erste und letzte Mal weinen. Ich lag an diesem Nachmittag auf dem Bett und schrieb an einer neuen Kurzgeschichte. Sie handelte von einer Bibliothek, in der die Bücher nachts heimlich miteinander sprachen, voreinander mit ihrem Verfasser prahlten oder sich über ihren schlechten Platz in einem der hinteren Regale beschwerten.
Ohne anzuklopfen kam meine Schwester ins Zimmer. Sie grinste verschwörerisch und machte die Tür hinter sich zu.
»Was ist?«
Eigentlich konnte ich ihre Antwort eingrenzen. Liz war inzwischen vierzehn, und es gab genau drei Dinge, die sie interessierten: Zeichnen, kitschige Liebesfilme und Jungs. Sie war jetzt das hübscheste Mädchen ihrer Klasse; blondgelockt, mit einer tiefen Stimme und einem Lächeln, mit dem sie jeden um den Finger wickeln konnte. Auf dem Pausenhof sah man sie oft mit einer Entourage von Mädchen, denen sie erzählte, welchen Jungen sie wo geküsst hatte und wie langweilig oder bestenfalls mittelmäßig das gewesen sei. Es war nie gut, und es waren immer ältere Jungs aus der Stadt, die Jungen aus ihrer Klasse dagegen hatten keine Chance. Manchmal versuchten sie trotzdem ihr Glück, aber Liz schenkte ihnen keine Beachtung.
Sie setzte sich auf mein Bett und stieß mich an. »Du Verräter.«
Ich schrieb noch immer an meiner Geschichte und hörte kaum zu. »Wieso?«
»Du hast ein Mädchen geküsst.«
Meine Wangen glühten. »Woher weißt du das?«
»Eine Freundin von mir hat dich gesehen. Sie meinte, es wäre direkt hier vor der Haustür gewesen und du hättest dem Mädchen die Zunge in den Hals gesteckt. Wie zwei Labradore, hat sie gesagt.«
Liz lachte, im selben Moment nahm sie mir das Notizbuch aus der Hand und begann Figuren hineinzukritzeln, dazu überall ihren Namen. Liz, Liz, Liz.
Das mit dem Kuss stimmte. Ich konnte mit Mädchen so reden, als wären sie Jungs, und bekam hin und wieder Liebesbriefe unter der Bank zugeschoben. Das Leben schien voll solcher Verheißungen zu sein, und meine Selbstsicherheit wuchs. Obwohl ich Klassensprecher war, redete ich im Unterricht häufig dazwischen oder legte mit einem lässigen Grinsen meine Füße auf den Tisch, bis der Lehrer mich ermahnte. Später empfand ich mein Verhalten als arrogant, aber damals gefiel es mir, vor meinen Freunden den Ton anzugeben und im Mittelpunkt zu stehen. Ich fing an, mit älteren Jungen herumzuhängen, und prügelte mich oft. Wenn etwa jemand aus der neuen Gruppe einen Spruch über mich machte, stürzte ich mich sofort auf ihn. Es war nie ganz ernst gemeint, aber auch nie nur Spaß. Ein paar der älteren Jungen kifften schon und tranken Alkohol, doch noch zögerte ich, wenn sie mir etwas anboten, und ich erzählte ihnen auch nicht, dass ich gern las oder mir Geschichten ausdachte. Ich wusste, dass sie mich dafür ausgelacht hätten und dass ich diese Seite von mir gut verstecken musste.
»Wie war das Küssen denn so?« Liz warf mir das Notizbuch in den Schoß.
»Geht dich nichts an.«
»Jetzt sag schon. Sonst erzählen wir uns doch auch alles.«
»Ja, aber jetzt will ich eben nicht.«
Ich stand auf und ging in das immer leicht nach Aktenstaub und altem Papier muffelnde Arbeitszimmer unseres Vaters. Als ich hörte, dass meine Schwester mir folgte, tat ich beschäftigt und stöberte in den Schubladen des Schreibtischs herum. In den meisten fanden sich nur Brillenetuis, Tintenfässer und vergilbte Notizblätter. In der untersten stieß ich jedoch auf eine Leica. Das Gehäuse schwarz, das Objektiv silbern. Sie lag in ihrer Originalverpackung, ich hatte meinen Vater nie damit fotografieren sehen. In der Schublade war noch ein Brief, auf Französisch geschrieben, die Handschrift war mir unbekannt.
Lieber Stéphane, diese Kamera ist für dich. Sie soll dich daran erinnern, wer du bist, und an das, was nie vom Leben kaputtgemacht werden darf. Bitte versuche, mich zu verstehen.
Von wem war dieser Brief? Ich legte ihn in die Schublade zurück und untersuchte die Kamera, öffnete den Verschluss für den Film und schraubte am Objektiv herum. Staub tanzte im Licht, das durch das Fenster einfiel.
Liz hatte sich gerade in einem kleinen Spiegel entdeckt. Hocherfreut über diesen Anblick betrachtete sie sich von allen Seiten, dann wandte sie sich wieder mir zu.
»Und wenn ich noch nie jemanden geküsst habe?«
»Was?«
Meine Schwester kaute auf ihrer Unterlippe und schwieg.
»Aber du erzählst uns doch die ganze Zeit, mit wem du alles rumgemacht hast.« Die Kamera baumelte an meiner Hand. »Du redest von nichts anderem.«
»Mein erster Kuss soll was Besonderes sein, ich …«
Es knarzte. Unser Bruder, der ein sicheres Gespür hatte, wann und wo in der Wohnung Geheimnisse ausgetauscht wurden, tauchte in der Tür auf. Sein teuflisches Grinsen ließ erahnen, dass er uns belauscht hatte.
Marty war damals dreizehn, ein einzelgängerischer Streber mit Nickelbrille, bleich und dünn wie ein Stück Kreide. Ein Kind, das Kinder hasste, das sich an Erwachsene hängte und ansonsten bewusst allein blieb. Immer hatte er im Schatten seiner Schwester gestanden, die ihn provozierte, wo sie nur konnte, ihn in der Schule nie beachtete und sich über ihn lustig machte, da er kaum Freunde hatte. Und nun waren ihm – ein Geschenk des Himmels – Geheiminformationen in die Hände gefallen, die den Ruf unserer Schwester an der Schule in Sekunden ruinieren konnten.
»Interessant«, sagte er. »Lässt du deshalb immer alle Jungs abblitzen, weil du Schiss hast? Weil du ein kleines Kind bist, das lieber kitschiges Zeug zeichnet und mit Mama kuschelt?«
Liz brauchte einen Moment, um sich zu fassen.
»Wenn du das jemandem erzählst, dann …«
»Was dann?« Marty lachte und machte übertriebene Kussgeräusche.
Liz stürzte sich auf ihn. Sie rissen sich gegenseitig an den Haaren und traten sich. Ich versuchte, meine Geschwister zu trennen, und sah nicht, wer mir die Kamera aus der Hand schlug, nur noch, wie sie durchs Zimmer flog und mit dem Objektiv voran auf dem … – Mist.
Sofort war es still. Ich hob die Leica auf, das Objektiv war gesprungen.
Wir beratschlagten eine Weile, was zu tun sei.
»Legen wir sie einfach wieder in die Schublade zurück«, sagte Liz. »Vielleicht fällt es ihm gar nicht auf.«
Und wie immer hatte unsere Schwester das letzte Wort.
An diesem Tag kam unser Vater erstaunlich früh nach Hause. Er wirkte aufgewühlt und verschwand sofort in seinem Arbeitszimmer.
»Kommt mit!«, befahl Liz.
Zu dritt konnten wir durch den Türspalt beobachten, wie unser Vater eine Weile rastlos durch den Raum lief und sich immer wieder durchs Haar fuhr. Dann nahm er den Hörer des grünen Drehscheibentelefons und wählte.
»Ich bin’s noch mal«, sagte er mit seinem weichen Akzent, »Stéphane. Ich wollte Ihnen sagen, dass Sie einen Fehler machen. Sie können nicht einfach …«
Sein Gesprächspartner schien ihn sofort abzuwimmeln, unser Vater knickte spürbar ein. Immer wieder streute er ein »Aber Sie …« oder »Doch, das ist …« in die Unterhaltung ein, einmal sogar ein flehendes »Bitte«, aber er kam kaum noch zu Wort.
»Sie hätten wenigstens eine Andeutung machen können«, sagte unser Vater schließlich. »Nach zwölf Jahren. Ich kann mich doch …«
Wieder wurde er abgewürgt. Dann legte er einfach auf.
Er ging zur Mitte des Raums und blieb dort sekundenlang regungslos stehen, als hätte ihm jemand den Stecker gezogen. Gespenstisch.
Endlich kam wieder Leben in ihn. Er trat an den Schreibtisch, und ich wusste sofort, welche Schublade er herausziehen würde. Zuerst las er den Brief, dann holte er die Leica aus der Verpackung. Als unser Vater das kaputte Objektiv bemerkte, zuckte er kurz zusammen. Er legte Kamera und Brief zurück in die Schublade und trat ans Fenster. Und dann weinte er. Es war für uns nicht auszumachen, ob wegen des Telefonats oder wegen der Leica oder vielleicht wegen der Schwere, die ihn in den letzten Jahren überkommen hatte. Wir wussten nur, dass wir das nicht sehen wollten, und stumm gingen wir auf unsere Zimmer.
Nach Neujahr wollten unsere Eltern übers Wochenende wegfahren. Eine spontane Reise, die mit der Entlassung unseres Vaters zusammenzuhängen schien, doch unsere Mutter erzählte uns nur, dass sie Freunde in Montpellier besuchen würden und wir nicht mitfahren könnten. Unsere Tante würde auf uns aufpassen.
»Wir brauchen aber keinen Babysitter«, sagte Liz. »Ich bin schon vierzehn.«
Unsere Mutter gab ihr einen Kuss auf die Stirn. »Es ist ja auch mehr für deine männlichen Kollegen.«
»Danke, das hab ich gehört«, sagte Marty, ohne von seiner Zeitung aufzublicken.
In unserem Haus in München lebten noch neun andere Mieter, darunter Marleen Jacobi, eine junge, außergewöhnlich hübsche Witwe, die nur dunkle Kleider trug. Man traf sie immer allein an, und es war mir unbegreiflich, wie man so einsam leben konnte. Liz dagegen bewunderte sie sehr und war jedes Mal aufgeregt, wenn sie ihr im Treppenhaus oder auf der Straße begegnete, sie zwickte mich dann in den Arm oder stieß mich an.
»Sie ist einfach so schön!«, sagte sie atemlos.
Ihre Faszination führte dazu, dass Marty und ich begannen, unsere Schwester aufzuziehen. »Die Jacobi war gerade da«, sagten wir an jenem Nachmittag zu ihr. »Du hast sie nur um wenige Sekunden verpasst. Sie sah so schön aus wie noch nie.«
»Ach was«, sagte Liz, übertrieben gelangweilt. »Ich glaub euch kein Wort.«
»Doch, sie hat nach dir gefragt«, sagten wir. »Sie will dich heiraten.«
»Ihr seid kindische Idioten«, antwortete Liz und fläzte sich zu unserer Mutter auf die Wohnzimmercouch. »Mama«, sagte sie, mich angrinsend, »rat mal, wer neulich zum ersten Mal ein Mädchen geküsst hat?«
Meine Mutter blickte sofort zu mir. »Ist das wahr?«, fragte sie, und ich glaube, sie sagte es anerkennend.
Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, was wir danach gesprochen haben, aber ich weiß noch, wie meine Mutter mit einem Mal von der Couch aufstand und ein Lied auflegte. Via Con Me von Paolo Conte. Sie streckte ihre Hand nach mir aus.
»Jules, pass auf«, sagte sie, als wir tanzten. »Wenn du ein Mädchen kriegen willst, dann tanz mit ihr zu diesem Lied. Mit diesem Lied bekommst du sie ganz sicher.«
Meine Mutter lachte. Erst Jahre später wurde mir bewusst, dass es das einzige Mal war, dass sie mit mir auf Augenhöhe gesprochen hatte.
Kurz bevor meine Eltern abends aufbrachen, hatte ich noch einen kleinen Disput mit meinem Vater, und am besten erzähle ich ihn so, wie ich ihn selbst lange in Erinnerung hatte:
Ich lief damals zufällig am Schlafzimmer vorbei, in dem mein Vater gerade packte. Er machte einen gestressten Eindruck.
»Gut, dass du kommst«, sagte er. »Ich muss mit dir reden.«
Ich blieb gegen die Tür gelehnt stehen. »Was gibt’s?«
Er rückte nicht gleich damit heraus, sondern schob seine ewigen Bedenken vor, dass meine älteren Freunde ihm nicht gefallen würden, dass ich »schlechten Umgang« hätte. Dann kam er jedoch auf sein Weihnachtsgeschenk zu sprechen, die Kamera.
»Sie liegt noch immer in der Ecke. Du hast nicht ein Mal mit ihr fotografiert, stimmt’s? Nicht mal richtig angeschaut hast du sie.«
Auf einmal tat mir mein Vater leid, ich sah weg.
»Sie ist wirklich wertvoll. In deinem Alter hätte ich mich sehr darüber gefreut.«
»Ich weiß nicht, wie ich mit ihr fotografieren soll. Sie ist so schwer und alt.«
Da richtete sich mein Vater auf und kam auf mich zu. Ein erstaunlich großer, schlaksiger Mann. »Sie ist ein Klassiker, verstehst du?« Für einen Augenblick hatte sein Gesicht wieder etwas Jungenhaftes. »Besser als die neuen Kameras. Sie hat eine Seele. Wenn wir zurück sind, zeige ich dir, wie man mit ihr Fotos macht und sie entwickelt. Abgemacht?«
Ich nickte zögerlich.
»Du hast ein gutes Auge, Jules. Ich würde mich freuen, wenn du später mal fotografierst«, sagte mein Vater, und auch diese Worte vergaß ich nie mehr.
Woran erinnere ich mich noch von jenem Abend? Auf jeden Fall daran, wie meine Mutter mir zum Abschied einen Kuss auf die Stirn gab. Ich habe in meinem Leben bestimmt tausendmal an diesen letzten Kuss und die letzte Umarmung mit ihr gedacht, an ihren Geruch und an ihre beruhigende Stimme. Ich habe so oft daran gedacht, dass ich nicht mehr sicher bin, ob es wahr ist.
Meine Geschwister und ich verbrachten das Wochenende zu Hause. Mit unserer Tante spielten wir Malefiz (wie immer war es Liz’ einziges Ziel, Marty mit den kleinen weißen Steinen einzumauern), und abends machte ich für alle Omeletts mit Pilzen, nach einem Rezept, das meine Mutter mir beigebracht hatte.
Am Samstag waren Liz und ich im Kino, und so war nur Marty da, als unser Vater von unterwegs anrief. Unsere Eltern wollten überraschend doch noch ein paar Tage dranhängen. Sie hatten einen Wagen gemietet, um einen Abstecher nach Berdillac zu machen.
Ich hatte nichts dagegen und freute mich vor allem auf die kleinen Geschenke und den Käse, den sie aus Südfrankreich mitbringen würden.
Und dann kam der 8. Januar, ein Sonntag. In den Jahren danach habe ich oft versucht, mir eine dumpfe Vorahnung anzudichten, aber das war vermutlich Unsinn. Gegen Abend läutete das Telefon. Als meine Tante den Hörer abnahm, spürte ich sofort die Veränderung in der Atmosphäre und setzte mich. Auch Marty blieb augenblicklich stehen. Alle anderen Details sind mir dagegen entfallen. Ich weiß nicht, was ich am Morgen gemacht habe, was ich nach dem Anruf tat oder weshalb meine Schwester an dem Abend nicht da war.
Was mir von diesem Tag blieb, ist einzig eine allerletzte Erinnerung, an deren Bedeutung ich allerdings erst viel später glaubte.
An jenem Nachmittag lief ich aufgedreht ins Wohnzimmer. Liz zeichnete gerade eine Bildergeschichte, mein Bruder saß neben ihr und schrieb in seiner krakeligen Mäuseschrift an Gunnar Nordahl. Das war sein Brieffreund in Norwegen, aber Liz und ich sagten immer, dass es Gunnar Nordahl gar nicht gebe und Marty ihn sich nur ausgedacht habe.
Ich baute mich vor meinem Bruder in Boxerpose auf. Ich war in meiner Muhammed-Ali-Phase und hielt mich für einen ausgezeichneten Imitator, vor allem die großmäuligen Kampfansagen hatten es mir angetan.
»Hey«, sagte ich zu Marty. »Heute bist du fällig, du Ratte. Du bist nur ein Onkel Tom.«
»Jules, du nervst. Außerdem weißt du gar nicht, was Onkel Tom bedeutet.«
Ich gab ihm einen Klaps auf die Schulter. Als er nicht reagierte, noch einen. Mein Bruder schlug nach mir, aber ich sprang zurück und machte Schattenboxen. »Schweben wie ein Schmetterling, stechen wie eine Biene.«
Ich war wohl kein ausgezeichneter Ali-Imitator, aber den Ali-Shuffle, das schnelle Tänzeln auf der Stelle, beherrschte ich recht gut.
Liz schaute uns beiden gespannt zu.
Wieder gab ich Marty einen Klaps. »In der zweiten Runde bist du dran«, brüllte ich mit weit aufgerissenen Augen. »Ich habe mit einem Alligator gerungen, dem Blitz Handschellen angelegt und den Donner eingekerkert. Letzte Woche hab ich einen Felsen ermordet, einen Stein verletzt und einen Ziegel krankenhausreif geprügelt. Du dagegen bist so hässlich, dass ich dich beim Kämpfen nicht ansehen werde.«
»Stör mich nicht.«
»Genau, stör ihn nicht«, sagte Liz spöttisch. »Er schreibt wieder seinem imaginären norwegischen Freund.«
»Ach, ihr langweilt mich«, sagte Marty.