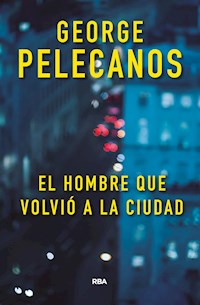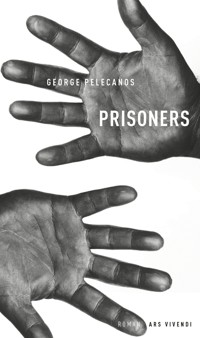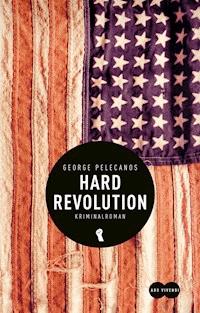
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: ars vivendi Verlag
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Washington, D. C., 1968: Der junge schwarze Polizist Derek Strange fährt bei der Metropolitan Police mit seinem weißen Partner Streife, während sich die Atmosphäre in der Stadt immer weiter aufheizt: die Bürgerrechtsbewegung und der Marsch der Armen, die traumatisierten Rückkehrer aus Vietnam, Sex, Soul, Drogen, Morde, Unruhen und Rassismus. Inmitten dieser explosiven Gemengelage entspinnt sich ein tödliches Drama: Drei Weiße planen einen Banküberfall und ermorden einen Schwarzen, auch Dereks Bruder Dennis wird umgebracht – und in Memphis wird ein Attentat auf Martin Luther King verübt. Für Derek Strange, seine Freunde und seine Feinde ist nichts wie zuvor. Wer ist gut, wer böse – und wem kann man noch vertrauen? Die alten Kategorien gelten nicht mehr, die Welt ist komplex geworden. Und die Revolution hat gerade erst begonnen ...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 554
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
GEORGE PELECANOS
HARD REVOLUTION
KRIMINALROMAN
Aus dem amerikanischen Englisch von Gottfried Röckelein
Für Sloan
Die Originalausgabe erschien 2004 unter dem Titel Hard Revolution beiLittle, Brown and Company.Copyright © 2004 by George PelecanosThis edition published by arrangement with Little, Brown and Company, NewYork, New York, USA. All rights reserved.
Deutsche Originalausgabe1. Auflage Juni 2017© 2017 by ars vivendi verlagGmbH & Co. KG, Bauhof 1,90556 CadolzburgAlle Rechte vorbehaltenwww.arsvivendi.com
eISBN 978-3-86913-829-9
Inhalt
ERSTER TEIL Frühjahr 1959
EINS
ZWEI
DREI
VIER
FÜNF
SECHS
SIEBEN
Zweiter Teil Frühjahr 1968
ACHT
NEUN
ZEHN
ELF
ZWÖLF
DREIZEHN
VIERZEHN
FÜNFZEHN
SECHZEHN
SIEBZEHN
ACHTZEHN
NEUNZEHN
ZWANZIG
EINUNDZWANZIG
ZWEIUNDZWANZIG
DREIUNDZWANZIG
VIERUNDZWANZIG
FÜNFUNDZWANZIG
SECHSUNDZWANZIG
SIEBENUNDZWANZIG
ACHTUNDZWANZIG
NEUNUNDZWANZIG
DREISSIG
EINUNDDREISSIG
ZWEIUNDDREISSIG
DREIUNDDREISSIG
VIERUNDDREISSIG
DANKSAGUNG
»You inherit the sins, you inherit the flames.«Bruce Springsteen, Adam Raised a Cain
ERSTER TEIL
Frühjahr 1959
EINS
DEREK STRANGE BEUGTE sich vor und ging in den Dreipunktstand, eine Hand auf dem Boden, Beine in Sprintposition. Er atmete gleichmäßig, wie es ihm sein Vater beigebracht hatte, und roch den intensiven Duft des April. Überall in der Stadt blühten Magnolien, Hartriegel und Kirschbäume. Der Wohlgeruch ihrer Blüten und die markante Note eines nahen Fliederstrauchs am Zaun einer Wohnanlage schwängerten die Luft.
»Den Rücken hältst du gerade«, sagte Derek, »wie wenn er ein Esstisch wär. Aber bloß den Arsch in die Luft strecken ist nicht drin. Das ist deine Startposition. Dann rast du einfach los und schmeißt dich irgendwie in die Lücke. Und brichst durch.«
Derek und sein samstäglicher Spielkamerad Billy Georgelakos waren in der Gasse, die hinter dem Three-Star Diner am östlichen Rand von Northwest Washington entlang eines Wohnblocks an der Kennedy Street mit einstelliger Nummer verlief. Die beiden Jungen waren zwölf.
»So wie dein Lieblingsspieler«, sagte Billy, der auf einem Milchkasten saß und einen straff zusammengerollten Our Army at War-Comic in seiner fleischigen Hand hielt.
»Yeah«, sagte Derek. »Jetzt wirste nämlich gleich Jim Brown in Aktion erleben.«
Derek kam aus seiner Ausgangsposition hoch und explodierte nach vorn, eine Handfläche schwebte über der anderen, beide dicht vor seinem Brustkorb. Während er ein paar Schritte rannte, übernahm er einen imaginären Ball, wechselte abrupt die Laufrichtung, wurde langsamer, machte kehrt und ging zurück zu Billy.
Derek hatte eine besondere Art, sich zu bewegen. Selbstbewusst, aber nicht großspurig; die Schultern gestrafft, eine gewisse Lockerheit in den Hüften. Er hatte sich den Gang von seinem älteren Bruder Dennis abgeschaut. Derek hatte die für sein Alter normale Größe, doch wie alle Jungen und die meisten Männer wünschte er sich, größer zu sein. Neuerdings hatte er, wenn er nachts im Bett lag, das Gefühl, spüren zu können, wie er wuchs. Der Spiegel über der Frisierkommode seiner Mutter sagte ihm, dass auch sein Oberkörper an Umfang zunahm.
Billy war trotz seiner breiten Schultern und seines enormen Brustkorbs kein Sportler. Er hielt sich zwar über die Leistungen der lokalen Mannschaften auf dem Laufenden, aber sein Herz schlug für andere Dinge. Flipperautomaten, Spielzeugpistolen und Comichefte hatten es ihm angetan.
»Und so hat Brown seine zwölf Yards in elf Läufen gegen die Skins geschafft?«, fragte Billy.
»M-m, Billy, fang jetzt nicht davon an.«
»Don Bosseler hat in dem Spiel mehr geschafft als Brown.«
»In dem Spiel. Aber die meiste Zeit ist der so lahmarschig, dass er nicht mal Jimmys Laufschuhe von hier nach da bringen würde. Und zwei Wochen davor, in Griffith? Da ist Jim Brown einhundertzweiundfünfzig Yards gelaufen. In dem Spiel hat mein Mann den Allzeitrekord für Rushs aufgestellt, Billy. Und Don Bosseler? Kannste vergessen.«
»Na schön«, sagte Billy, und ein Lächeln erschien in seinem breiten Gesicht. »Dein Mann ist gut.«
Derek wusste, dass Billy ihn nur ärgern wollte; dennoch konnte er nicht anders, als sich aufzuregen. Nicht, dass Derek kein Redskins-Fan gewesen wäre. Er hörte sich jedes Spiel im Radio an. Er las die Kolumnen von Shirley Povich und Bob Addie in der Post, kaum dass sie erschienen. Er verfolgte die Statistiken von Quarterback Eddie LeBaron, Middle Linebacker Chuck Drazenovich, Halfback Eddie Sutton und anderen. Sogar Bosselers Yards-per-carry-Quote behielt er im Auge. Eigentlich drückte er nur zweimal jährlich den Gegnern der Skins die Daumen – und dann mit schlechtem Gewissen –: wenn sie gegen Cleveland spielten.
Derek hatte ein Zeitungsfoto von Brown an die Wand des Zimmers geklebt, das er sich mit seinem Bruder teilte. Abgesehen von seinem Vater, gab es für ihn keinen größeren Helden als Brown. Dieser war für ihn eine starke Persönlichkeit, die Respekt verlangte, nicht nur von seinen eigenen Leuten, sondern von Menschen jeglicher Hautfarbe. Der Mann war echt gut.
»Don Bosseler«, sagte Derek und lachte in sich hinein. Er legte eine große, langfingrige Hand auf seinen fast kahl rasierten Kopf und massierte sich den Schädel. Das war etwas, das sein Bruder Dennis immer machte, wenn er sich mit Freunden unterhielt und sie dabei veräppelte. Derek hatte diese Geste, ebenso wie seinen Gang, von Dennis übernommen.
»Ich will dich doch bloß ärgern, Derek.« Billy stand von der Milchkiste auf und legte sein Comicheft auf die hinteren Stufen des Diners. »Komm, gehen wir.«
»Wohin?«
»In mein Viertel. Vielleicht geht in Fort Stevens ein Spiel zusammen.«
»Okay«, sagte Derek. Billys Viertel war zwei Meilen vom Diner entfernt und noch weiter von Dereks Zuhause. Die meisten Kinder dort waren weiß. Doch Derek machte das nichts aus. In Wahrheit stellte es für ihn einen kleinen Nervenkitzel dar, sich außerhalb seines angestammten Reviers aufzuhalten.
An den meisten Samstagen verbrachten Derek und Billy ihre Zeit in der City, während ihre Väter im Diner arbeiteten. Sie waren Jungen, für die es als völlig normal angesehen wurde, dass sie einfach loszogen und Abenteuer und sogar kleinere Konflikte suchten. Zwar gab es in gewissen Teilen des District Gewalt, aber die wurde von Erwachsenen begangen und fand üblicherweise unter Kriminellen statt, und das zumeist bei Nacht. Kinder und Jugendliche blieben im Allgemeinen unbehelligt.
Auf der Hauptstraße bemerkte Derek, dass das Kino des Viertels, das Kennedy, noch immer Buchanan Rides Alone mit Randolph Scott zeigte. Derek hatte den Film schon zusammen mit seinem Dad gesehen. Sein Vater hatte ihm versprochen, mit ihm unten in der U Street in Rio Bravo zu gehen, den neuen John-Wayne-Film, über den die ganze Stadt sprach. Der Film lief im Republic. Wie die anderen District-Kinos an der U Street, das Lincoln und das Booker T, war das Republic hauptsächlich für Farbige, und Derek fühlte sich dort wohl. Sein Vater Darius liebte Western, und Derek liebte sie inzwischen auch.
Derek und Billy gingen die Geschäftsstraße in Richtung Osten. Sie kamen an zwei Jungen vorbei, die Derek aus der Kirche kannte, und einer von ihnen sagte: »Was treibst du dich mit dem weißen Kerl da herum?«, und Derek sagte: »Was geht das dich an?« Er fixierte den anderen so lange, bis der begriff, dass Derek es ernst meinte, und alle gingen ihrer Wege.
Billy war Dereks erster und einziger weißer Spielkamerad. Die Arbeit ihrer Väter hatte sie zusammengebracht. Sonst hätten sie nie zueinandergefunden, weil farbige und weiße Jungs zumeist nicht miteinander verkehrten, abgesehen von Sportveranstaltungen oder wenn sie zum ersten Mal einen Job annahmen. Nicht dass der Umgang miteinander etwas Unrechtes gewesen wäre, aber es schien natürlicher zu sein, sich mit seinesgleichen zu umgeben. Mit Billy herumzuhängen brachte Derek gelegentlich in eine unangenehme Lage; man wurde auf der Straße angepöbelt, wenn die eigenen Kumpel sahen, dass man mit einem Weißen durch die Gegend zog. Aber aus Dereks Sicht musste man zu jemandem stehen, es sei denn, der Betreffende gab Anlass, es nicht zu tun, und er war der Meinung, dass man bei Konflikten den Mund aufmachen musste. Es wäre nicht richtig gewesen, dem anderen diese Frage durchgehen zu lassen. Klar, Billy sagte oft die falschen Dinge, und manchmal war es auch verletzend, doch das lag daran, dass er es nicht besser wusste. Er war ungehobelt, aber nicht mit Absicht.
Sie wandten sich nach Nordwesten, gingen durch Manor Park und die Grünanlage von Fort Slocum und waren bald auf der Georgia Avenue, die viele für die Hauptstraße des District of Columbia hielten. Sie war die längste im District und schon immer die wichtigste Verkehrsstraße nach Washington hinein gewesen, auch früher schon, als sie noch 7th Street Pike geheißen hatte. Alle Arten von Läden und Geschäften säumten ihren Weg, und auf den Gehsteigen waren Tag und Nacht Passanten unterwegs. Die Avenue war immer voller Leben.
Die Straße bestand aus hellem Beton und wurde von Straßenbahnschienen durchzogen. Mancherorts gab es noch Bahnsteige aus Holz, von denen aus die wartenden Fahrgäste einst in die Waggons gestiegen waren, doch inzwischen waren die Busse der D.C. Transit das Hauptbeförderungsmittel des öffentlichen Nahverkehrs. Ein paar vereinzelte Stahltröge, ehemalige Tränken für die Pferde, welche die Karren der Trödler, Altwaren-, Obst- und Gemüsehändler zogen, waren auf der Avenue verblieben, doch binnen Kurzem würden auch sie den Weg jener fahrenden Händler gehen. Es hieß, man wolle die Straße bald mit einem Asphaltbelag versehen, und Gleise, Bahnsteige und Tröge würden verschwinden.
Billys Viertel Brightwood setzte sich größtenteils aus einer weißen Arbeiter- und Mittelschicht und den verschiedensten Volksgruppen zusammen: aus Griechen, Italienern, katholischen Iren und Juden aller Glaubensrichtungen. Diese Familien waren von Petworth, 7th Street, Columbia Heights, der H Street-Passage in Northeast sowie aus Chinatown hergezogen und hatten sich nach Norden vorangearbeitet, als sie in den Boomjahren nach dem Zweiten Weltkrieg besser verdienten. Sie waren auf der Suche nach schöneren Wohnungen, nach Spielplätzen für ihre Kinder und Auffahrten für ihre Autos. Gleichzeitig zogen sie von den Farbigen weg, deren Anzahl und Präsenz in der Innenstadt im Gefolge der Reurbanisierung und erzwungenen Aufhebung der Rassentrennung rapide gestiegen war.
Doch auch diese Umzüge würden nur eine Zwischenstation sein. Gerissene Immobilienmakler hatten in Brightwood begonnen, farbige Familien in weißen Straßen mit der Absicht anzusiedeln, deren Anwohner dazu zu bringen, aus Angst vor Wertverlust ihre Häuser billig zu verkaufen. Die nächste Station für Weiße aus dem oberen Northwest und von östlich des Parks würden die Vorstädte in Maryland sein. Niemand wusste, dass die Ereignisse der nächsten neun Jahre diesen endgültigen Wegzug beschleunigen würden, obwohl durchaus allgemein die Vorahnung herrschte, dass irgendein Wandel bevorstand und kommen musste – ein unausgesprochenes Gefühl für das Unvermeidliche. Dennoch gab es Menschen, die sich dieser Empfindung genauso heftig verweigerten wie sie vor der Endlichkeit ihres Daseins die Augen verschlossen.
Derek lebte in Park View, südlich von Petworth, das inzwischen größtenteils farbig war, auch wenn dort einige Weiße aus der Unterschicht wohnten. Er besuchte die Backus Junior High und würde an der Roosevelt High School weitermachen. Billy ging auf die Paul Junior High und war für die Coolidge High vorgesehen, an der es einige Farbige gab, von denen die meisten Sportler waren. Viele Coolidge-Schüler gingen anschließend aufs College; von der Roosevelt waren es weitaus weniger. Dort gab es Gangs, an der Coolidge Studentenverbindungen. Derek und Billy lebten zwar nur wenige Meilen auseinander, aber die Unterschiede in ihrem jeweiligen Alltag und bei ihren Zukunftsaussichten waren gravierend.
Sie gingen die Georgia auf der östlichen Seite entlang; auf Höhe des 6200er-Wohnblocks kamen sie an der offenen Tür der Textilreinigung Arrow vorbei, einem Geschäft, das es hier schon seit 1929 gab; Bill Caludis war der Besitzer und Betreiber. Sie schauten kurz hinein, um Caludis’ Sohn Billy Hallo zu sagen, den Billy Georgelakos von der Kirche her kannte. An der Ecke lagen Clark’s Men’s Shop und nahebei Marinoff-Pritt and Katz, der jüdische Markt, wo mehrere Metzger KZ-Nummern auf ihren Unterarmen tätowiert hatten. Nicht weit entfernt war das Sheridan Theater, in dem gerade ein weiterer Film mit Randolph Scott lief: Decision at Sundown. Derek hatte ihn mit seinem Vater gesehen.
Sie überquerten die Georgia. Auf der anderen Straßenseite gingen sie an Vince’s Agnes Flower Shop vorbei, wo Billy stehen blieb, um ein paar Worte mit einer hübschen jungen Angestellten namens Margie zu wechseln, und am Sheridan Waffle Shop, auch als John’s Lunch bekannt, einem Diner, das John Deoudes gehörte. Danach kamen eine Kneipe, die sich Sue’s 6210 nannte, eine chinesische Wäscherei, ein Friseursalon und an der Ecke noch die Gartenwirtschaft 6200. Stagger Lee ertönte gerade aus deren Musikbox, und man konnte die Rhythmen durch die offene Tür hören.
Auf dem Gehsteig vor der Kneipe waren drei junge weiße Teenager damit beschäftigt, abwechselnd zu reden, Zigaretten zu rauchen oder sich mit dem Kamm durchs Haar zu fahren. Einer von ihnen zog seinen Kumpel auf und fragte ihn, ob sein blaues Auge und das geschwollene Gesicht von seiner Freundin stammten. »Nee«, sagte der Junge mit dem Veilchen, »ein ganzer Haufen Nigger ist unten am Griffith Stadium über mich hergefallen«, und er fügte hinzu, er werde die Kerle ausfindig machen und es ihnen »heimzahlen«. Die Gruppe verstummte, als Derek und Billy vorbeikamen. Es fielen keine Worte, es gab keine finsteren Blicke und keinerlei Probleme. Derek besah sich den Schwächling mit der großen Klappe und dachte: Wahrscheinlich gab’s den »ganzen Haufen Nigger« gar nicht, weil ein einziger genügt hätte.
An der Ecke Georgia und Rittenhouse deutete Billy aufgeregt auf einen Mann, der einen Hut mit breiter Krempe trug und gerade die Straße Richtung Osten überquerte. Bei ihm war eine junge Frau, deren Gesicht sie nicht sehen konnten, deren Hintern sich aber auf gefällige Weise bewegte.
»Das ist Bo Diddley«, sagte Billy.
»Ich dachte, der wohnt drüben an der Rhode Island Avenue.«
»Das sagen alle. Aber in letzter Zeit sehen wir ihn immer hier in der Gegend. Es heißt, er hätte einen Club hier in der Rittenhouse.«
»Bo Diddley ist ein Revolverheld«, sagte Derek, und in seinen Oberschenkeln stieg eine Wärme auf, während er den prallen Hintern der Frau studierte.
Sie wandten sich nach Süden zur Quackenbos Street und überquerten den Parkplatz der Nativity School, eines katholischen Konvents, auf dessen Gelände es eine schöne Sporthalle gab, aus der die Nonnen Billy und seine Freunde regelmäßig verjagten. Jenseits des Parkplatzes lag Fort Stevens, von wo aus im Juli 1864 die Streitkräfte der Konföderierten von den Kanonen und Musketen der Unionssoldaten zurückgeschlagen wurden. Das Fort hatte man nachgebaut und erhalten, es wurde aber nur von wenigen Touristen besucht.
»Kein Mensch da«, sagte Derek und ließ den Blick über das verwilderte Feld schweifen, auf dem an einem weißen Mast die amerikanische Fahne flatterte und wellenförmige Schatten auf den Rasen warf.
»Ich geh mal ein paar porichia für meine Mom pflücken«, sagte Billy.
»Du willst was?«
Derek und Billy stiegen den steilen Wall bis zum Plateau hinauf, auf dem mehrere Geschütze in ihren jeweiligen Feuerstellungen nebeneinander standen. Der Wall fiel zu einem tiefen Graben hin ab, der längs der nördlichen Begrenzung des Forts verlief. Neben einer der Kanonen wuchsen an verschiedenen Stellen spindeldürre Pflanzen mit harten Stängeln. Billy zog ein paar aus dem Boden und schüttelte die Erde aus den Wurzeln.
»Ich dachte, deine Mama mag dieses Löwenzahnkraut.«
»Das heißt rodichia. Die Stängel hier sind auch gut. Man muss sie aber verwenden, bevor sie blühen, weil sie danach zu bitter sind. Los, bringen wir sie ihr und lassen uns was zu trinken geben.«
Billy wohnte in einem mit Schieferplatten gedeckten und mit Dachrinnen aus Kupfer bestückten Bau im Kolonialstil in Somerset Place 1300, ein paar Wohnblocks westlich des Parks. Im Gegensatz zu den Reihenhäusern von Park View und Petworth waren die Häuser hier frei stehend und hatten ein planiertes, gepflegtes Stück Rasen vor dem Haus. In den Straßen wimmelte es von Italienern und Griechen. Die Familie Deoudes lebte in Somerset Place, ebenso die Familie Vondas, und droben in der Underwood Street wohnte ein drahtiger Junge namens Bobby Boukas, dessen Eltern einen Blumenladen besaßen. Alle gehörten sie zu Billys Kirchengemeinde St. Sophia. In der Tuckerman Street stand das Haus, in dem der kleinwüchsige Schauspieler Johnny Puleo, der in dem Lancaster-Curtis-Zirkusfilm Trapeze mitgespielt hatte, einen großen Teil des Jahres wohnte. Puleo fuhr einen nach seinen Bedürfnissen ausgestatteten Dodge mit auf Gas- und Bremspedal befestigten Holzklötzen.
Auf dem Weg zum Haus der Georgelakos hielt Derek kurz an, um einen muskulösen hellbraunen Boxer zu streicheln, der üblicherweise vor dem Wohnhaus der Deoudes angekettet war. Der Name des Hundes war Greco. Greco begleitete manchmal die nächtlichen Fußstreifen der Polizei und war als schnell, anhänglich und zäh bekannt.
Derek ging in die Hocke und ließ Greco an seiner Hand riechen. Der Hund stieß die Schnauze in Dereks Finger, und Derek tätschelte seinen Bauch und kraulte ihn hinter den Ohren.
»Irre«, sagte Billy.
»Was?«
»Normalerweise lässt er sich das nicht gefallen und bleckt die Zähne.«
»Bei farbigen Jungs, stimmt’s?«
»Na ja, yeah.«
»Mich mag er.« Dereks Blick wurde weich, während er den Hund bewunderte. »Eines Tages besorg ich mir auch einen, genau so einen wie den hier.«
ZWEI
NACHDEM SIE DIEporichia bei Billys Mutter abgeliefert hatten, kehrten die Jungen nach Fort Stevens zurück. Dort sahen sie zwei Brüder, Dominic und Angelo Martini, die in der Mitte des Feldes standen.
»Sollen wir weitergehen?«, fragte Billy. Beim letzten Zusammentreffen mit den beiden war Derek von Dominic Martini ziemlich gepiesackt worden.
»M-m«, sagte Derek. »Ist schon okay.«
Sie näherten sich den Martinis. Dem sechzehnjährigen Dominic fehlten nur noch ein paar Zentimeter zu einer Größe von eins achtzig, und er hatte die Statur eines Mannes von mehr als zwanzig Jahren. Sein Teint war ebenso dunkel wie das Haar seines perfekten Pompadourschnitts. Seine schwarzen Augen waren ausdruckslos. Er hatte die Coolidge an seinem letzten Geburtstag geschmissen und arbeitete jetzt als Zapfsäulenboy an der Esso-Tankstelle südlich der Kreuzung Georgia Avenue und Piney Branch Road. Sein vierzehnjähriger Bruder Angelo hatte eine ähnliche Hautfarbe, aber nicht Dominics Größe und dessen gutes Aussehen und Selbstbewusstsein. Seine lasche Körperhaltung verriet, dass er sich des Unterschieds bewusst war.
»Billy«, sagte Dominic. »Ich sehe, du hast heute deinen Schatten mitgebracht.«
»Er heißt Derek«, sagte Billy mit bemühtem Nachdruck in der Stimme.
»Entspann dich, Billyboy.« Dominic lächelte, zog an seiner Zigarette und musterte Derek flüchtig von Kopf bis Fuß. »Wie wär’s mit nem Kampf?«
Derek hatte die Herausforderung erwartet. Bei ihrem ersten Zusammentreffen hatte er gesehen, wie Martini auf diese Weise einen anderen Jungen provozierte, der gerade selbstvergessen den Park durchquerte. Dominic, so vermutete er, benutzte diese Frage gern als Ansage, um jedem gleich von vornherein klarzumachen, dass er die Situation kontrollierte. Damit verunsicherte er sein Gegenüber, eine Taktik, um sofort die Oberhand zu gewinnen.
»Heute nicht«, sagte Derek.
»Dann willst du vielleicht lieber zu deiner Mama laufen.«
Dominics Erwähnung von Dereks Mutter und seine Imitation eines farbigen Akzents brachten Derek dazu, dass er unfreiwillig die Fäuste ballte. Er atmete durch und öffnete seine Hände wieder.
»Na, schau mal: Ich mein doch nicht, dass du dich mit mir anlegen sollst«, sagte Dominic. »Das wär ja nicht fair. Ich guck mir doch keinen aus, der kleiner ist als ich, okay?«
So viel größer als ich bist du auch nicht, dachte Derek.
»Ich dachte eher an dich und Angie«, sagte Dominic, und kaum waren die Worte gefallen, blickte Angelo schon zu Boden.
»Ich habe keinen Zoff mit deinem Bruder«, sagte Derek.
»Hör auf damit, Dom«, sagte Angelo.
»Ich rede mit Derek«, sagte Dominic.
Derek wusste, dass er es mit Angelo aufnehmen konnte. Zu blöd, dass dem Jungen bereits das Kinn auf die Brust gesunken, dass er schon jetzt geschlagen war. Derek glaubte, dass Angelo wie viele weiße Jungs Angst vor farbigen Jungs hatte. Und diese Angst würde den Ausschlag geben. Doch Derek stand nicht der Sinn danach, Angelo zu verdreschen. Der hätte sowieso keine Chance zu gewinnen.
»Habt ihr eure Handschuhe dabei?«, fragte Derek.
»Yeah, haben wir«, sagte Dominic. »Und?«
»Ich und Billy«, sagte Derek, »wir treten stattdessen im Baseball gegen euch an. Wie wär’s damit?«
»Prima«, sagte Dominic. »Aber zuerst sagst du, dass du nicht kämpfst.«
»Dominic«, sagte Angelo flehentlich.
»Ich hab keinen Grund zu kämpfen«, sagte Derek.
»Das ist nicht dasselbe. Sag, was ich dir gesagt habe, dass du sagen sollst, oder geh zu meinem Bruder hin und heb die Hände hoch.«
»Na gut«, sagte Derek. »Ich kämpfe nicht.« Es machte ihm nichts aus, das laut zu sagen. Er war weder einen Schritt gewichen, noch hatte er die Arme verschränkt oder weggeschaut. Seine Körpersprache drückte aus, dass er keine Angst hatte. Dominic sah es und wusste es.
»In Ordnung«, sagte Dominic. Eine Sekunde lang erkannte Derek einen menschlichen Zug in Martinis Augen. »Spielen wir Baseball.«
Die beiden Martinis hatten ein Schlagholz, einen Hardball und zwei Baseballhandschuhe in dem Munitionsbunker verstaut, der in den Fuß des Hügels gebaut worden war, auf dem das Fort stand. Eigentlich spielten sie Stickball, nur ohne Wand oder Mauer. Base Hits wurden nach Messpunkten wie dem Fahnenmast, der Gedenktafel des Forts et cetera gezählt, wobei die Hügelkuppe als die ultimative Zielmarke galt. Ein »über die Mauer« der Festungslinie geschlagener Ball galt als Homerun.
Derek hatte den weitaus kräftigeren Schlag, und sogar Billy war ein besserer Spieler als die beiden Martinis. Binnen Kurzem wurde offenbar, dass der Wettkampf so gut wie entschieden war. Als Derek seinen dritten Homerun hinausdrosch, sagte Dominic, dass ihn das Ganze langweile, und brach das Spiel ab. Nachdem sie die Utensilien zurück in den Bunker gebracht hatten, wandte sich Dominic an Derek.
»Sachma, Mann, haste schon mal ne Alte geknüppelt?«
»Klar doch«, sagte Derek, was eine Lüge war. Er hatte ein bisschen – und nur über dem Hemd – die Titten dieses älteren Mädchens aus seinem Viertel gestreichelt, das dafür bekannt war, dass es die kleineren Jungs anmachte, aber das war alles.
»Aber klar hast du das«, sagte Dominic, lachte kurz und zündete sich eine Zigarette an. »Ich – ich mach das dauernd.«
Er erzählte Derek vom Fort Club, den er und seine Freunde kürzlich gegründet hätten, und dass sie sich Freitagabends zum Biertrinken und Rudelbumsen mit Mädchen im Bunker treffen würden. Derek brachte ein kurzes Achselzucken zuwege, das ausreichte, um einen neuen Konflikt abzuwenden, aber nicht, um Dominic zu suggerieren, dass ihn das sehr wohl interessierte. Das war nicht die Reaktion, die Dominic beabsichtigt hatte. Er holte etwas aus der Tasche und hielt es Derek hin.
»Du weißt, was das ist?«
»Das ist eine cherry bomb.«
»Soll ich sie hochgehen lassen?«
»Nur zu.«
Martini entzündete die Zündschnur an seiner Zigarette und warf den Kracher gleichmütig in die Mündung einer der Kanonen. Der Kracher explodierte, und der Knall war überraschend stark. Ein Kirchendiener tauchte auf, brüllte irgendetwas in Richtung der Jungen und kam auf sie zu. Angelo und Billy trabten hinüber zur 13th Street. Derek und Dominic folgten den beiden gemächlichen Schrittes zum Parkausgang.
»Du und ich«, sagte Dominic, »wir laufen vor nichts davon, richtig?«
Derek hatte das Gefühl, dass dieser Nachmittag ungut enden würde, so wie es ein Junge immer spürt, wenn der Verlauf eines Tages eine neue Wendung nimmt. Es war, als ginge er mit voller Absicht von der sonnenhellen Seite der Straße zu der, die im dunklen Schatten lag. Er war mit einem klaren Verständnis des Unterschieds zwischen Gut und Böse erzogen worden und wusste, dass er genau jetzt mit Billy zurück zum Diner hätte gehen sollen. Trotzdem wurde er von dieser dunklen Seite angezogen. Weshalb Derek nichts dagegen einzuwenden hatte, als Dominic vorschlug, »rüber zum Sechsten« zu gehen, um einfach »ein bisschen rumzugammeln«.
DAS SECHSTE REVIER befand sich an der Nicholson Street, links von der Brightwood Elementary School. Das Gebäude sah mit seiner Backsteinfassade und den Säulen selbst wie ein kleines Schulhaus aus. Neben der hufeisenförmigen Betonzufahrt auf der Rückseite der Polizeistation gab es einen Goldfischteich. Die Jungen näherten sich von der rechten Seite, sammelten sich unter einer großen Eiche und musterten den Bau durch einen Maschendrahtzaun.
»Dort drüben ist der Zellentrakt«, sagte Dominic und zeigte zur rechten Seite des Gebäudes. »Die haben da zum Schlafen nur alte Feldbetten.«
»Woher willst denn du das wissen?«, fragte Billy provozierend, doch insgeheim beeindruckt.
»Hat uns unser alter Herr erzählt«, sagte Angelo. Ihr Vater hatte im vergangenen Jahr dort mehrmals seinen Rausch ausgeschlafen.
»Nicht bloß deshalb«, sagte Dominic gereizt. »Ich bin schon selbst drin gewesen.« Er hatte dort nie eine Nacht in Haft verbracht, obwohl er die Idee durchaus reizvoll fand. Dominic war dort lediglich aktenkundig vernommen worden, weil er einen Stein durch ein Fenster der Grundschule geworfen hatte, doch war der Vorfall den Beamten noch nicht einmal ein Beweisaufnahmeprotokoll wert gewesen.
Die Garage auf der Rückseite des Hauptgebäudes beherbergte mehrere Harleys für die Motorradpatrouillen. Einer der drei Funkstreifenwagen, ein PS-starker Ford, stand neben einem schwarzen Zivilfahrzeug, ebenfalls ein Ford, auf dem Parkplatz. Die Jungen aus Brightwood kannten die Nummern der Funkstreifenwagen – 61 bis 63 –, die auf den Seiten der Karosserien aufgemalt waren. Sie kannten auch die Namen der Wachleiter und der Mordermittler und der Fußstreifencops. Unter diesen gab es einen irischen Polizisten, der Legendenstatus genoss, nachdem er eine .45er-Kugel in den Unterleib abgekriegt hatte. Zum Sechsten gehörten außerdem ein uniformierter farbiger Cop, William Davis, sowie der verhasste Officer Pappas, ein Grieche, der gegen Kinder und Jugendliche besonders unbarmherzig vorging. Er sah seine Hauptaufgabe darin, jene Väter und Söhne – einige davon griechische Landsleute – einzubuchten, die illegale Lotterien betrieben und sich in ihren Geschäften entlang der Avenue gelegentlich auch als Hehler betätigten. Pappas hatte einen bleistiftdünnen Oberlippenbart, was ihm nach Meinung der Jungen ein französisches Aussehen verlieh, das ans Weibische grenzte. Sie hatten ihm den Spitznamen Jacques verpasst. Wenn er zu Fuß auf Streife unterwegs war, verspotteten sie ihn von Hausdächern und aus den Gassen, indem sie ihm mit Fistelstimmen hinterherriefen: »Jaaacques, oh, Jaaacques.«
Officer Davis kam aus dem Vordereingang des Gebäudes und ging zum Streifenwagen Nummer 62. Davis war groß und schlank, seine Uniform war perfekt gebügelt, sein Dienstrevolver steckte im Holster. Derek fragte sich, was man tun musste, um Polizeibeamter zu werden. Der Beruf hatte definitiv etwas an sich, was diese Art des Gehens bewirkte, die Davis pflegte: das Kinn hochgenommen, fast schon überheblich. Er machte den Eindruck eines Mannes, der seinen Stolz hatte.
Dominic Martini hob einen Stein auf. Derek packte ihn am Handgelenk.
»Nicht«, sagte er.
Dereks Eingreifen überraschte sie beide so sehr, dass Dominic sich nicht widersetzte. Er ließ den Stein fallen, schüttelte seine Hand frei und heftete den Blick auf Davis.
»Schaut euch den an«, sagte Martini voller Verachtung. »Der glaubt tatsächlich, er wär was Besonderes.«
Das ist er auch, dachte Derek Strange und beobachtete den Polizeibeamten genau, wie er in den Ford stieg. So sieht ein richtiger Mann aus.
BUZZ STEWART FÜLLTE Benzin in den Tank eines 57er DeSoto Fireflite, einer Limousine in rot-weißer Zweitonlackierung mit Weißwandreifen und Kotflügelschürzen. Eine Zigarette baumelte von Stewarts Lippen, während er die Pumpe betätigte. Zwar sollte er nicht in der Nähe der Tanks rauchen, aber in der ganzen Tankstelle gab es niemanden – den Chef eingeschlossen –, der genug Autorität besessen hätte, es ihm zu verbieten. Während er den Pumpenschwengel in die Ausgangsstellung zurückbrachte und von dem Opa hinterm Steuer das Geld entgegennahm, schnippte er mit dem Daumen die Asche von seiner Marlboro und steckte sich den Glimmstängel wieder in den schmallippigen Mund.
»Hey, Buzz«, sagte Dominic Martini, der mit einer Flasche Coca Cola in der Hand vorbeischlenderte.
»Hey«, murmelte Stewart.
Stewart sah zu, wie sich Martini, ein italienischer Jugendlicher, der am Wochenende Nachtdienst schob, einer Gruppe Jungs am Rand des Parkplatzes der Esso-Tankstelle anschloss. Einer von ihnen war Martinis Waschlappen von einem Bruder. Der andere war irgendein Fettsack, den Stewart für einen weiteren Spaghettifresser hielt. Der dritte war ein Nigger. Frage: Warum lief Martini freiwillig mit einem farbigen Jungen herum? Wenn sie das nächste Mal miteinander sprachen, würde er Dom deswegen gehörig anscheißen müssen.
Stewart schritt quer über den Parkplatz und tätschelte dabei sein pomadisiertes blondes Haar. Er bewunderte seine Adern, die sich auf den Innenseiten seiner Unterarme wie Wurzelstränge abzeichneten und an seinen Bizepsen deutlich hervortraten. Er fühlte sich stark. Er war eins achtundachtzig groß und neunzig Kilo schwer, ohne ein überflüssiges Gramm Fett. Es gab Typen, die glaubten, ihn provozieren zu können, und dauernd diesen Hochmut-kommt-vor-dem-Fall-Quatsch vor sich hin beteten, weil sie selbst von kleinerer Statur waren. Stewart wusste um seine Körperkräfte und hatte es nicht nötig, sich von irgendjemandem dazu drängen zu lassen, sie unter Beweis zu stellen.
Er ging ins Innere der Tankstelle. Der Chef, einst muskulös, jetzt dick, saß gerade hinter seinem Schreibtisch und beschäftigte sich wie immer mit einem Haufen Nichtigkeiten. Aus dem Radio drang Party Doll. Zuerst Buddy Knox mit seinem kieksenden Stottergesang, danach dieser wunderbare Gitarrenpart mit dem Walking Bass im Hintergrund. Stewart mochte diesen Song. Nicht gerade Link Wray, doch das hier war auch ganz ordentlich.
»Können wir reden?«, fragte Stewart.
»Schieß los«, sagte der Chef, ohne Stewart anzusehen.
»Wann darf ich denn bei den Mechanikern in der Servicebucht arbeiten?«
»Wenn du den Kurs machst.«
»Ich kann einen Motor mit geschlossenen Augen auseinandernehmen und wieder zusammensetzen.«
»Damit können sie dich vielleicht beim Zirkus gebrauchen«, sagte der Chef. »Aber auf dem Schild da draußen steht: ›Zertifizierte Automechaniker‹. Willst du dazugehören, verlangt die Konzerngesellschaft, dass du den Kurs machst.«
Scheiß auf Kurse, dachte Stewart. Den letzten Kurs habe ich an der Montgomery Blair besucht, als ich sechzehn war. Ich habe damals keine Kurse gebraucht und einen High-School-Abschluss schon gleich dreimal nicht. Man muss doch nicht in einem Klassenzimmer sitzen, um zu wissen, wie man Autos repariert.
»Vielleicht später mal«, sagte Stewart und zeigte mit dem Daumen auf die Wanduhr. »Ich bin weg.« Er zog die Rolle Geldscheine aus der Tasche, nahm den Gürtel mit dem Wechselgeldspender ab, den er um die Hüfte trug, und legte beides dem Chef auf den Tisch.
»Warte, bis ich nachgezählt habe«, sagte der Chef.
»Wenn’s nicht stimmt, werden Sie’s mich schon wissen lassen.«
»Hast du’s eilig?«
»Yeah«, sagte Stewart. »Ich muss dahin und dorthin und diesen und jenen treffen. Das heißt: Ich bin schon gar nicht mehr hier.«
Stewart marschierte hinaus.
»Angeber«, sagte der Chef, aber erst, nachdem Stewart das Büro verlassen hatte.
Buzz Stewart stieg in seinen frisierten 50er Ford: Auspuffanlage mit Fächerrohren, Chassis maximal tiefergelegt. Die Lackierung – eine lila Karosserie zu einer blauen Innenausstattung – hatte er so in Auftrag gegeben. Stewart und seine Kumpels verliehen ihren Autos Namen und beschrifteten den vorderen rechten Kotflügel damit. Auf seinem stand »Lavender Blue«, sowohl wegen der Farbgebung als auch mit Bezug auf diesen Sammy-Turner-Song. Er war stolz auf den Namen. Er hatte sich das ganz allein ausgedacht.
Stewart startete den Motor und verließ den District of Columbia in Richtung Silver Spring, wo seine Eltern lebten.
Ein kleines Stück hinter der District-Grenze fuhr er unter der B&O-Brücke hindurch und an der Canada-Dry-Abfüllanlage zu seiner Linken vorbei. Er und seine Kameraden hatten die Anlage immer samstags überfallen, wenn nur ein einziger Wachmann Dienst hatte, und so viele Kisten Ginger Ale gestohlen, wie sie transportieren konnten. In einem Waldgebiet in der Nähe schütteten sie die Limonade weg und gaben die leeren Flaschen gegen Pfandgeld an lokale Einzelhändler zurück. Auf diese Weise konnte man ein paar Dollar machen, aber vor einigen Jahren hatte das Ganze ein Ende gefunden, als er und seine Gruppe von einem grauhaarigen Wachmann ertappt wurden. Zum Glück stand Shorty Hess, Stewarts bester Kumpel, hinter dem Wachmann und schlug ihm mit einem Eisenrohr, das er immer in seinen Jeans versteckt hatte, auf den Schädel und damit k. o. Zuerst befürchteten sie, dass Shorty ihn umgebracht hätte, aber in den Zeitungen oder sonst wo wurde nichts berichtet, weshalb sie davon ausgingen, dass der Alte noch lebte. Seitdem hatten sich er und seine Buddys an größere Sachen wie Einbrüche gemacht. Um Spaß zu haben, veranstalteten sie gern Autorennen, tranken Bier und Schnaps, scheuchten Farbige von den Gehsteigen und vögelten Mädchen. Und sie prügelten sich gern.
Stewart fuhr nach Hause. Er und seine Eltern wohnten in einem frei stehenden Haus an der Mississippi Avenue zwischen der Sligo Avenue und der Piney Branch Road. Das Gebäude, ein Backsteinquader mit einer Holzveranda an der Vorderfront, stand auf einem Grundstück von fast zweitausend Quadratmetern. Dahinter befand sich eine Garage mit Werkstatt, in der Stewart an diversen Fahrzeugen herumschraubte. Daneben erstreckte sich eine ausgedehnte Gartenparzelle, wo seine Mutter Gemüse anzubauen pflegte: Mais, Tomaten, Paprika und dergleichen. Stewart hatte kürzlich für sie den Boden umgegraben, da sie demnächst mit der Pflanzung für den Sommer beginnen wollte.
Im Haus fand er seinen Vater Albert in seinem Polstersessel im Wohnzimmer vor; er trank Old German Lager und rauchte eine Camel ohne Filter. Al kaufte sein Bier für $2,50 pro Kiste und und trank eine in zwei Tagen leer. Er sah sich gerade im Fernsehen eine Wiederholung von Cisco Kid an. Albert hatte die gleiche Statur wie sein Sohn und war beinahe kahl. Wie sein Sohn war er weder gut aussehend noch hässlich, hatte keine hervorstechenden oder bemerkenswerten Kennzeichen und war ein farbloser, stets mürrischer Mensch, schmallippig, kleinäugig, schnell aufgebracht und kritikfreudig.
»Was machst du denn da?«, fragte Al, ohne den Kopf zu wenden.
»Nix«, sagte Buzz und starrte offenen Mundes auf den Fernseher.
»Haste Lohn gekriegt?«
»Gestern.«
»Du bist jetzt achtzehn, Sohnemann. Zeit, dass du anfängst, Miete zu zahlen.«
»Weiß ich.«
»Dann bezahl sie.«
»Mach ich.«
»Wann?«
Stewart ging an der Küche vorbei, in der seine Mutter Pat an einem Resopaltisch saß und eine Zigarette rauchte. Sie trug ein Hauskleid mit einem Blumendruckmuster, eines von zwei Kleidern, die sie vor Jahren bei Montgomery Ward gekauft hatte und im täglichen Wechsel anzog. Ihr graues Haar hatte sie zu einem Dutt zurückgesteckt. Um den Mund herum hatte sie noch immer die Falten aus der Zeit, als es für sie noch etwas zu lachen gab. Ihre Augenfarbe war ein ausgewaschenes Blau. Einige ihrer Verwandten behaupteten, sie sei früher einmal hübsch gewesen.
»Carlton«, sagte sie und benutzte den Taufnamen ihres Sohnes.
»Yeah, Ma.«
»Bleibst du zum Abendessen?«
»Nee, ich geh aus. Aber ich nehm ein Sandwich oder so was.«
»Glaubst du, das hier ist ein Restaurant?«, rief Al aus dem Wohnzimmer.
»Yeah«, sagte Stewart und erhob die Stimme. »Kann ich ein Steak haben? Medium, bitte sehr. Und von dem edlen Gebräu, das du da trinkst, nehm ich auch eins.«
»Blödes Arschloch.«
Buzz Stewart ging nach unten in sein Zimmer.
DREI
VOM STATIONSGEBÄUDE DES Sechsten Reviers schlenderten die Jungen zurück zur Avenue. Dominic Martini kaufte eine Flasche Coke aus einem roten Kühlautomaten an der Esso-Tankstelle und versprach seinem Chef, rechtzeitig zur Spätschicht da zu sein. Auf dem Rückweg zu seinen Jungs sagte er »Hey, Buzz« zu einem großen Kerl, der die Ärmel hochgekrempelt hatte, um seine Bizepse zur Schau zu stellen, und gerade Benzin pumpte.
Dominic reichte die Flasche an seinen Bruder weiter, der sie dann ohne nachzudenken an Derek weitergab. Derek nahm einen Schluck aus der Flasche und gab sie an Dominic zurück. Dominic wischte sie ab, bevor er sie an die Lippen setzte, und sah dabei unverwandt Derek an.
Schließlich machten sie sich auf den Weg zu Ida’s, dem Kaufhaus an der östlichen Ecke von Georgia und Quackenbos. Dort gab es nicht nur Haushaltswaren zu kaufen, das Geschäft kleidete auch die meisten Kids der Gegend ein, farbige und weiße gleichermaßen. Die PF Flyers an Dereks Füßen stammten genauso von Ida’s wie die alte Pfadfinderuniform in Billy Georgelakos’ Schrank. Ida’s war das Up-town-Gegenstück zu Morton’s in Downtown.
Die Jungen betraten das Kaufhaus, drängten in einen der Gänge und gingen nach hinten durch. Die Angestellten waren mit Kunden beschäftigt, und niemand hatte bislang von der Gruppe Notiz genommen. Es gab eigentlich keinen vernünftigen Grund für ihre Anwesenheit hier, weil keiner von ihnen Geld dabeihatte; doch Derek hatte eine ziemlich klare Vorstellung, was der Plan war. Trotzdem ging er mit. Und schon sah er, wie Dominic einen Ace-Kamm aus einem Behälter nahm und ihn in einer einzigen fließenden Bewegung in seine Gesäßtasche steckte. Angelo, dem der Schweiß auf der Oberlippe stand, tat es ihm gleich.
»Los, Derek, hauen wir ab«, sagte Billy.
»Yeah, verpisst euch, ihr Schlappschwänze«, sagte Dominic.
»Wer soll hier der Schlappschwanz sein?«, fragte Derek und bereute seine Worte, kaum dass sie ihm herausgerutscht waren.
»Dann mach mal was«, sagte Dominic. »Zeig, dass du Eier in der Hose hast, Derek.«
»Werd ich schon«, sagte Derek Strange.
Dominic grinste. »Wir treffen uns auf der Straße wieder.«
Derek ging tiefer ins Innere des Kaufhauses und wechselte in einen anderen Gang, während die Martini-Brüder verschwanden. Billy blieb bei Derek. Derek gelangte in die Abteilung für Werkzeuge und Eisenwaren, sah ein Vorhängeschloss und dachte, sein Vater könnte es für irgendetwas gebrauchen. Er musste eine volle Minute davorgestanden und das Schloss betrachtet haben. Er blickte sich um, entdeckte niemanden im Gang und ließ es in der rechten Vordertasche seiner Bluejeans verschwinden. Er ging los in Richtung Haupteingang, Billy folgte dichtauf.
Als sie bei den Türen angelangt waren, spürte er, wie ihn eine Hand am Oberarm packte. Er versuchte sie abzuschütteln und davonzurennen, aber die Person, die ihn festhielt, hielt ihn ziemlich fest.
»Hiergeblieben«, sagte eine Männerstimme. »Du läufst nirgendwohin, mein Sohn.«
Derek gab seinen Widerstand auf. Er war geschnappt worden, und irgendwo ganz tief drinnen wusste er, dass ihm das recht geschah. Er verwünschte sich zuerst im Stillen und dann lautstark.
»So was Blödes«, sagte Derek.
»Ganz recht«, sagte der Mann, ein stämmiger Weißer mit breiten Schultern. Er trug eine Wollweste und ein Hemd mit offenem Kragen, und in den schwarzen Haaren auf seinem Kopf thronte eine Brille. Strange las, was auf dem Namensschild an seiner Brust stand: »Harold Fein«.
»Hast du irgendwas in deinen Taschen, mein Sohn?«, sagte Fein an Billy gewandt.
»Nein«, sagte Billy.
»Dann verschwinde von hier, sofort.«
»Kann ich nicht auf meinen Freund warten?«
Derek spürte, wie ihm warm ums Herz wurde, weil Billy ihn seinen »Freund« genannt hatte. Bislang war Billy nur ein Junge gewesen, mit dem er eher zufällig Bekanntschaft geschlossen hatte.
»Wenn du warten willst«, sagte Fein und hielt Dereks Arm weiterhin fest, »dann wartest du draußen. Damit du Bescheid weißt: Ich kenne dich, auch deine Mutter. Lass dich nie wieder von mir bei so was wie eben erwischen.«
Billy sagte: »Das werden Sie nicht«, aber das sprach er bereits zu ihren Rücken, da Derek schon von Fein in den hinteren Teil des Ladens geführt wurde. Sie gingen durch eine schmale Öffnung in einen Lagerraum mit niedriger Decke.
Fein hieß Derek, sich zu setzen. Hinter einem mit Papieren übersäten Schreibtisch stand ein gepolsterter Stuhl, neben dem Schreibtisch ein ungepolsterter. Derek konnte sich denken, dass der gepolsterte der von Mr Fein war. Er setzte sich auf den ungepolsterten. Auf der Tischplatte befand sich ein dreieckiger Holzblock mit einem Messingschild. Darauf stand »Lagerleiter«. Des Weiteren waren auf dem Tisch gerahmte Fotografien von einem kleinen Mädchen und von einem vermutlich zweijährigen Jungen.
»Wie heißt du?«, fragte Fein, der weiterhin stand.
»Derek Strange.«
»Wo wohnst du?«
Derek sagte ihm, dass er in Park View wohnte, in Princeton Place.
»Ich muss erst das Ladungsverzeichnis eines Lkw kontrollieren«, sagte Fein. »Du bleibst hier sitzen. Leg das Schloss auf den Tisch, damit ich es nicht vergesse. Und lass dir nicht einfallen davonzulaufen, weil ich jetzt weiß, wo ich dich finde, kapiert?«
»Yessir.«
Es dauerte eine Weile, bis Fein zurückkam. Dreißig Minuten vielleicht, aber Derek kamen sie wie Stunden vor. Er fühlte sich elend, wenn er daran dachte, was seine Mutter und sein Vater sagen würden, nachdem sie den Anruf entgegengenommen hatten. Und er war auch wütend, weil er sich von Dominic Martini hatte ködern lassen, von einem Jungen, den er noch nicht einmal respektierte. Warum er geglaubt hatte, sich gegenüber Martini beweisen zu müssen, wusste er selbst nicht. Derek hatte verschiedentlich schon das eine oder andere angestellt und wusste, dass er auch in Zukunft noch so manches anstellen würde, doch er schwor sich, nie wieder und ganz ohne Grund etwas so Blödes anzustellen. So war er nicht erzogen worden.
Fein kam also zurück und setzte sich auf seinen Stuhl. Er schob die Papiere auf dem Tisch hin und her und sortierte sie nach irgendeinem Schema. Dann faltete er die Hände, legte sie in den Schoß und wandte seine Aufmerksamkeit Derek zu.
»Was du heute getan hast, war unrecht.«
»Ich weiß.«
»Ach ja?«
»Ja, Sir.«
Fein atmete langsam aus. »Ich habe beobachtet, wie die anderen Jungen die Kämme gestohlen haben. Das war ganz einfach, weil wir Spiegel in den oberen Ecken unseres Geschäfts haben. Weißt du, warum ich mir die nicht als Erstes gegriffen habe?«
»Nein, Sir.«
»Weil ihnen das nichts geholfen hätte. Ich habe die hier schon öfter gesehen. Vor allem der Ältere ist … Also, der ist auf einer ganz bestimmten Bahn. Ich werde den Lauf der Dinge für ihn nicht beschleunigen, wenn du weißt, was ich meine.«
Derek wusste es nicht genau. Später einmal würde er sich an diesen Tag erinnern und es verstehen.
»Und du wirst dich jetzt fragen: Warum ich?«, sagte Fein. »Deshalb, weil du nicht so bist wie dieser andere Junge. Ich habe dich und deinen Freund in dem Gang beobachtet. Du hast gezögert, weil du den Unterschied zwischen Recht und Unrecht, zwischen Richtig und Falsch kennst. Dann hast du die falsche Entscheidung getroffen. Aber hör zu: Deswegen geht die Welt nicht unter, solange du weißt, dass du die falsche Entscheidung getroffen hast.«
Derek nickte und sah dem Mann in die Augen. Dessen Blick war etwas weicher geworden seit ihrem ersten Aufeinandertreffen.
»Derek, stimmt’s?«
»Ja.«
»Weißt du schon, was du mal werden willst, wenn du groß bist?«
»Polizist«, sagte Derek, ohne nachdenken zu müssen.
»Na bitte. Dann musst du allmählich damit anfangen, dir Gedanken zu machen, was für ein Leben du führen möchtest, und zwar jetzt. Alles, was du als junger Mann tust, kann Einfluss darauf haben, was du später einmal wirst oder nicht wirst.«
Derek nickte. Es war ihm nicht klar, worauf der Mann mit alldem hinauswollte. Aber es klang sinnvoll und vernünftig.
»Du kannst gehen«, sagte Fein.
»Wie bitte?«
»Geh nach Hause. Ich werde weder deine Eltern noch die Polizei anrufen. Denk über das nach, was ich dir heute gesagt habe.« Fein tippte sich mit einem dicken Finger gegen die Schläfe. »Denk nach.«
»Vielen Dank, Sir«, sagte Derek und erhob sich, als stünde er unter Schock.
Harold Fein nahm die Brille aus den Haaren und setzte sie sich auf den Nasenrücken. Er widmete sich wieder der Arbeit, die auf seinem Schreibtisch wartete.
Billy saß auf dem Bordstein vor dem Kaufhaus. Als Derek herauskam, stand er auf und ging auf ihn zu.
»Kriegst du Schwierigkeiten?«, fragte Billy.
»M-m«, sagte Derek, »alles in Ordnung. Wo sind die Martinis hin?«
»Sind fortgegangen.«
»Dacht ich mir schon.«
»Wir machen uns besser auf den Weg zurück zum Diner, Derek, es ist schon spät.«
Derek legte eine Hand auf Billys Schulter. »Danke, Mann.«
»Wofür?«
»Dass du auf mich gewartet hast«, sagte Derek. Billy zog den Kopf ein und grinste.
Sie gingen auf der Missouri Avenue nach Südosten in Richtung Kennedy Street. Die Schatten des Spätnachmittags wurden immer länger, und die beiden beschleunigten ihren Schritt. Drunten in Manor Park fuhr ein Wagen an ihnen vorbei, dessen Radio You’re So Fine von The Falcons spielte, die Band mit diesem Sänger, den Dereks Vater so mochte. Der Sound des Songs und der Anblick der farbigen Männer in dem Wagen ließen Derek lächeln. Er fühlte sich so rein und makellos, als käme er direkt aus der Kirche. Als hätte er gerade gebeichtet.
NACH EINSCHÄTZUNG DER meisten Leute hatte es Frank Vaughn ziemlich gut erwischt. Er hatte einen Einsatz in Okinawa überlebt, ein Mädchen mit hübschen Beinen geheiratet, einen Sohn gezeugt, ein Haus in einem weißen Viertel gekauft und ein schönes Einkommen samt einer Beamtenpension am Ende seines Berufslebens. Männer machten einen weiten Bogen um ihn, die Frauen schenkten ihm noch immer Beachtung, wenn er die Straße entlangschritt. Er ging auf die vierzig zu und war dort angekommen, wo die meisten Männer angeblich hinwollten.
Vaughn nahm einen Schluck Kaffee, zog an seiner Zigarette und legte sie sorgfältig in der zinnenartigen Aussparung des Plastikaschenbechers ab, den ihm sein Sohn bei Kresge’s zum Vatertag gekauft hatte. Man stelle sich das vor: Ein kleiner Junge kauft seinem alten Herrn einen Aschenbecher. Er hätte ebenso gut eine Karte dazulegen können mit dem Text: »Bitte schön, Dad, hoffentlich kratzt du ab.« Doch für so etwas war der Junge nicht clever genug. Der Aschenbecher musste Olgas Kopf entsprungen sein und ihrer Vorstellung von einem Scherz. Dabei würde sie nicht einmal eine Woche lang überleben, wenn es ihn nicht mehr gäbe. Womit würde sie ihren Lebensunterhalt verdienen? Kein Mensch bezahlt einen dafür, dass man shoppen geht, fernsieht oder am Telefon mit den Freundinnen plaudert. Wenigstens nicht, soweit er informiert war.
Vaughn holte sich die Sportseite aus den Teilen der Zeitung, die sich zu seinen Füßen stapelten. Redskins-Präsident George Marshall handelte gerade mit Calvin Griffith eine Erneuerung des Pachtvertrags aus und drohte, ein neues Stadion auf dem Armory-Gelände zu bauen, sollten seine Bedingungen nicht erfüllt werden. Der frühere Weltergewichts-Champion Johnny Saxton hatte versucht, sich in einer Gefängniszelle zu erhängen, nachdem er bei einem Raubüberfall auf einen Ramschladen festgenommen worden war. Saxton, der Kid Gavilan, Carmen Basilio und Tony DeMarco bezwungen hatte, bevor es mit ihm abwärtsging, war bereits zuvor wegen versuchten Diebstahls eines Pelzcapes und einer Packung Zigaretten festgenommen worden. Jim Piersall, früher Center Fielder bei den Washington Senators und ebenfalls ein Kandidat für die Klapsmühle, sagte, er sei »unglücklich«, weil man ihn von Boston nach Cleveland verkauft hatte. Wann genau war dieser Piersall überhaupt jemals glücklich gewesen?, fragte sich Vaughn. Audacious und Negro Minstrel waren die Long Shots der Daily Double Picks auf dem Turf in Laurel Park. Und die Nats hatten die Orioles zwei zu eins geschlagen, da Killebrew im achten Inning ein Double gelungen war.
Vaughn ließ die Zeitung zu Boden fallen und gähnte. Für ihn gab es im normalen Alltag nichts, was ihn wirklich reizte. Abwechslung und Nervenkitzel fand er derzeit erst, wenn er durch seine Haustür hinaus in sein anderes Leben auf der Straße trat.
Er lehnte sich in seinem Stuhl zurück und widmete sich dem Anblick Olgas, die auf der Arbeitsplatte neben der Spüle Sandwiches belegte. Sie trug schwarze Caprihosen, die sie bei Kann’s gefunden hatte, ein Top von Lansburgh’s drüben in Langley Park und an den Füßen ein neues Paar Schuhe. Die Sachen hatte sie alle seiner Central Charge Card zu verdanken. Seine Einstellung dazu war: Die Kreditkarte machte sie glücklich und hielt sie ihm gleichzeitig vom Leib, also was soll’s.
Olga ging zu ihrem Mann und brachte ihm sein Sandwich. Sie hatte ein unattraktives Gesicht, das im Lauf der Jahre hart geworden war. Der dicke Lidschatten, den sie trug, die mit Haarspray fixierte Helmfrisur, das teigige Make-up und der knallrote Lippenstift ließen sie keineswegs lebendiger erscheinen, sondern erinnerten Vaughn eher an eine Leiche. Wenigstens hatte sie sich ihre Figur erhalten, obgleich sie in der Gesäßpartie etwas flacher geworden war. Schöne Beine hatte sie noch immer.
»Hier bitte, mein Schatz«, sagte sie und setzte den Teller vor ihm ab.
»Danke, mein Püppchen«, sagte er.
Olga hob einen Fuß und wackelte damit herum. »Capezios. Gefallen sie dir? Ich hab sie drüben bei Hahn’s gekauft.«
»Sie sind okay«, sagte er missmutig. Er war keineswegs verärgert, weil sie sie gekauft hatte. Das war ihm so was von egal. Aber sie erwartete, dass er so reagierte. Und nun würde sie den Kauf rechtfertigen.
»Ich hab ein neues Paar gebraucht«, sagte sie. »Und ich habe sonst gespart, wo es nur ging. Schatz, ich hab jetzt ein volles Heft mit S&H-Rabattmarken …«
Den Rest blendete er aus. Ihre Stimme erinnerte ihn an Fliegen, die um seinen Kopf surrten. Lästig, aber harmlos. Er knurrte nahezu unhörbar und überlegte, welchen Anblick er wohl bieten mochte: wie er so dasaß, tat, als hörte er zu, in Wahrheit aber überhaupt nicht zuhörte, ihr sein hündisches Grinsen offerierte, unter schweren Lidern amüsiert hervorblickte und dazu langsam mit dem Kopf nickte.
Als sie schließlich mit ihrem Geplapper am Ende war, sagte er: »Na komm, Olga, essen wir.«
Er nahm einen letzten Zug von seiner Zigarette, während sie zur Treppe im Hausflur ging und ihren Sohn rief. Er hörte, wie sie hinzufügte: »Und geh nach unten und sag Alethea, sie soll auch raufkommen.«
Während Olga den Tisch fertig deckte und die Getränke brachte, kam Ricky ins Zimmer und setzte sich auf einen Stuhl. Er war zwölf Jahre alt und hatte ein affektiertes, locker-flockiges Gehabe, das Vaughn befürchten ließ, sein Sohn könnte sich zu einer Tunte entwickeln. Er war oben in seinem Zimmer gewesen und höchstwahrscheinlich vor dem Spiegel gestanden, hatte Twist geübt oder irgendeinen anderen verrückten Tanz, den er sich von diesem Dick Clark abgeguckt hatte. Es war noch nicht so lange her, dass Ricky auf diesen TV-Cowboy Pick Temple gesponnen hatte, doch jetzt verlagerte sich sein Interesse hin zu Pullover tragenden Mädchen. Hoffte Vaughn jedenfalls. Er liebte seinen Jungen, hatte ihn aber noch nie verstanden. Er hätte versuchen sollen, ihm näherzukommen, besonders als Ricky noch kleiner gewesen war, aber er hatte nicht gewusst wie. Niemand drückte einem einen Leitfaden in die Hand, wie man ein guter Vater wird. Er stippte Asche ab und dachte: Du kannst nicht mehr tun, als dein Bestes zu geben.
Alethea kam in die Küche und trug eines ihrer alten, weißen und formlosen Dienstkleider, die ihre Figur nicht verbergen konnten. Vaughn sah ihr nach, wie sie zum Tisch ging, und hoffte, einen Blick auf ihre Beine erhaschen zu können, sobald das Licht der Sonne vom Küchenfenster durch ihr Kleid schien. Sie hielt den Kopf erhoben und die Schultern straff, während sie den Raum durchquerte und sich hinsetzte. Sie war ungeschminkt, und ihr Haar verbarg sie unter einer Art gemustertem Kopftuch, das sie immer umband, wenn sie in diesem Haus arbeitete.
Vaughn schätzte sie auf etwa vierzig. Sie war nicht jung, aber sie war eine richtige Frau. Er fragte sich, was sie mit ihrem Mann anstellte, sobald das Licht gelöscht wurde. Er dachte oft darüber nach. Manchmal dachte er darüber nach, während er mit seiner Frau schlief.
Man konnte Alethea nicht als schön bezeichnen, auch nicht als annähernd schön. Ihre Haut war dunkel, und sie hatte jene hervorstechenden Merkmale der Farbigen, auf die Vaughn gar nicht stand. Kein Mensch würde sie mit Lena Horne verwechseln. Aber ihre Augen hatten es ihm angetan. Dunkelbraun, glänzend und wissend. Wenn es etwas Besonderes an ihr gab, dann waren das eindeutig ihre Augen.
Olga setzte sich an den Küchentisch. Alethea schloss die Augen, faltete die Hände und bewegte lautlos ihre Lippen. Die Vaughns selbst waren nicht religiös, aber sie saßen still, während Alethea ihr Tischgebet sagte. Als sie damit fertig war, begannen sie zu essen.
»Wie geht’s heute mit der Arbeit, Alethea?«, fragte Olga.
»Ich liege gut in der Zeit. Als Nächstes gehe ich zu dieser Wäscherei.«
»Und dir geht’s gut?«
»Bestens.«
»Was macht die Familie?«
»Denen geht’s gut. Allen geht’s gut.«
Immer wieder die gleiche Konversation, dachte Vaughn. Olga – beeinflusst von ihren Freundinnen in der Nachbarschaft, die herumhockten und über Rassentrennung und Bürgerrechte sprachen, wenn sie nicht gerade über ihre Nägel redeten oder Mah-Jongg-Ziegel herumschoben. Olga – mit ihrem Schuldgefühl, weil sie Alethea »nur« zehn Dollar pro Tag zahlte, wo doch das der Lohn war, den Alethea selbst vom ersten Tag an verlangt hatte. Olga – die Alethea noch immer das Gefühl geben wollte, dass sie zur Familie gehörte. Alethea – höflich, aber ohne sich anzubiedern. Warum sollte sie auch? Schließlich war sie die Hausangestellte, Herr im Himmel. Sie kommt, macht ihre Arbeit, verdient ihr Geld und geht wieder zurück in ihr Viertel zu ihren Leuten. Vaughn verstand das, aber Olga, die sich nicht draußen in der Wirklichkeit aufhielt, konnte es nicht verstehen. Okay, da gab es also Leute, die unbedingt Gleichheit wollten, und Vaughn hatte damit kein Problem. Aber wenn man es auf den Punkt brachte, wollte keine Seite mit der anderen verkehren. Jeder wollte bei seinesgleichen bleiben.
»Olga«, sagte Vaughn, »bring mir doch noch ein paar Chips oder Essiggurken oder so was, ja, Schatz? Das hier ist … mit so einem Sandwich würde ja ein Vogel glatt verhungern.«
Bloß damit Olga endlich die Klappe hielt. Aber als sie mit einem Töpfchen süßem Relish zurück an den Tisch kam, versuchte sie es erneut.
»Alethea, ist das nicht entsetzlich mit diesem Jungen unten in Mississippi?«
»Ja«, sagte Alethea, »allerdings.«
»Sie haben den Jungen gelyncht!«
»So steht es in der Zeitung.« Aletheas Tonfall war emotionslos. Sie sah Olga nicht an, als sie antwortete.
»Wie sie diese Neger unten im Süden behandeln«, sagte Olga und schüttelte den Kopf. »Wann glaubst du, wird das ein Ende haben?«
»Ich weiß es nicht«, sagte Alethea.
»Glaubst du, es wird bald mal besser für eure Leute?«
Alethea hob die Schultern und sagte: »Ich weiß es einfach nicht.«
Nach dem Essen räumte Olga den Tisch ab. Vaughn beobachtete sie, wie sie Aletheas Teller und Glas vom restlichen Geschirr trennte, das sie ins Spülbecken gegeben hatte. Später würde Olga die Sachen von Alethea gründlicher reinigen als den Rest. Vaughn registrierte, dass Alethea zusah, wie Olga den Abwasch sortierte.
Alethea kehrte zum Tisch zurück und sah Vaughn ganz kurz in die Augen.
VIER
UNTEN IN SEINEM Zimmer schaltete Buzz Stewart den Philco mit dem Vierzehn-Zoll-Bildschirm ein, der auf seiner Kommode stand, und stellte Channel 5 ein. Die Samstagsausgabe der Milt Grant Show lief noch. Die lokale Band Terry and the Pirates war auf der Bühne, und die Teenies auf der Tanzfläche gerieten immer mehr außer Rand und Band.
Die Milt Grant Show lief täglich von Montag bis Samstag auf WTTG. Am Samstag konkurrierte sie mit der landesweit ausgestrahlten Sendung American Bandstand. Alle wussten, dass Milt als Erster dieses Showkonzept entwickelt hatte, aber die popperhaften Privatschulkids und diejenigen, deren Eltern Bürojobs hatten, waren zu Dick Clark übergelaufen. Die Jugendlichen bei Bandstand sahen für Stewart allesamt aus wie verzogene Tussen und hohle Angeber. Die Jugendlichen von derberem Zuschnitt und mit ruppigerem Geschmack, Halbstarke und dergleichen, auch diejenigen, die unverfälschten und harten Rock and Roll liebten, waren bei Milt Grant geblieben. Und Teufel auch, Link Wray war Frontmann von Grants Hausband. Das allein reichte aus, dass Stewart auf ihn abfuhr.
Viele der legendären Tanzveranstaltungen Milt Grants, die Record Hops, fanden im Silver Spring Armory statt, nicht weit von Stewarts Zuhause entfernt. Bei diesen Events war der Saal dicht gepackt mit Teenagern der örtlichen Highschools, und Stewart erlebte Auftritte wie die der Everly Brothers, von Fats Domino und diesem wilden jungen Typen namens Little Richard. Stewart war kein großer Tänzer. Bei den Hops lehnte er sich immer an eine Wand, hatte die Ärmel hochgekrempelt, um seine Arme zu zeigen, und beobachtete die Mädchen. Manchmal allerdings, besonders wenn farbige Künstler auf der Bühne waren und richtig loslegten, wünschte er sich, er hätte ein paar Schritte gelernt.
Als die Milt Grant Show beendet war, ging Stewart unter die Dusche. Danach kehrte er in sein Zimmer zurück, wo ihm seine Mutter ein Truthahnsandwich und eine Flasche RC Cola auf den Nachttisch gestellt hatte. Er spielte ein paar Singles auf seinem Cavalier-Plattenspieler, aß dabei und zog sich an. Die erste war Bip Bop Bip von Don Covay vom lokalen Plattenlabel Colt 45. Anschließend ein Song von den Flamingos und Annie Had a Baby von Hank Ballard and The Midnighters. Das Finale seines Rituals zur Einstimmung auf den Samstagabend war, bevor er zur Tür hinausging, Rumble von Link Wray. Alles von den Raymen törnte ihn gehörig an.
Er verabschiedete sich von seiner Mutter, die am Tisch saß und ihre nächste Zigarette rauchte. Sie wünschte ihm viel Spaß, und er sagte, den werde er haben. Drüben im Wohnzimmer wurde er von seinem inzwischen halb beduselten Vater von Kopf bis Fuß gemustert. Stewart trug schwarze Levi’s Peg Legs, Slipper mit dicken Sohlen, die »Bombers« genannt wurden, und ein leuchtend orangenes Button-down-Hemd unter schwarzem Leder. Seine Frisur thronte, dank des großzügigen Einsatzes von Brylcreem, steil und steif auf seinem Kopf.
»Wo hast n das Hemd her?«, fragte Albert.
»Was stimmt damit nicht?«
»Du siehst aus wie ein Nigger.«
Buzz Stewart verließ das Haus.
IM SOUTERRAIN VON Vaughns Haus legte Alethea die Kleidungsstücke der Familie, die noch warm vom Trockner waren, auf einem Bügelbrett zusammen, das unter einer nackten Glühbirne stand. Sie teilte sich ihr Tagespensum so ein, dass sie diese vergleichsweise leichte Arbeit nach dem Lunch erledigen konnte, wenn sie häufig müde wurde. Mit all dem Essen, das einem im Magen lag, besonders nach diesen einfallslosen und faden Speisen, die Olga Vaughn zubereitete, wollte man nichts weiter, als sich hinzulegen und die Augen zu schließen.
Es war ruhig hier unten, angenehm und kühl. Was da im Untergeschoss alles an Spielzeug herumlag: Dinge, die Ricky nicht mehr benutzte und wahrscheinlich nie viel benutzt hatte und die nur noch als Staubfänger dienten. Nach Aletheas Ansicht hatten die Eltern den Jungen verzogen, was bei einem Einzelkind nicht ungewöhnlich war, wo doch jedes Kind in Wirklichkeit nicht mehr brauchte als Liebe, Nahrung und Geborgenheit – und gute Vorbilder dafür, wie erwachsene Männer und Frauen ihr Leben führen sollten.
Olga war nach Rickys Geburt unfruchtbar geworden, vermutete Alethea, was für den Jungen ziemlich schade war. Kinder brauchen Geschwister zum Spielen und auch, um sich ihnen in schwierigen Situationen anvertrauen zu können. Frank Vaughn gehörte nicht zu der Sorte Mann, die einen Weg fanden, dem eigenen Sohn sowohl Vater als auch Freund zu sein. Für Frank hätte das zu viel Anstrengung und Nachdenken bedeutet. Trotzdem hätte er mehr Zeit mit Ricky verbringen sollen, auch wenn ihm das nicht so lag, denn aus dem Kind war so etwas wie ein Muttersöhnchen geworden. Aus solchen Jungen wurden normalerweise Liebhaber und Nichtstuer, Männer, die sich viel zu sehr auf ihre Frauen verließen. Doch Ricky war aufgeweckt und ein lieber Kerl. Höchstwahrscheinlich würde er trotz alldem, was er in seinem Elternhaus nicht bekam, seinen Weg finden.
Alethea unterbrach kurz ihre Arbeit, um ihren schmerzenden Rücken zu strecken. Vielleicht handelte es sich bei diesen Beschwerden um etwas Psychisches, weil sie zu oft an die Tatsache dachte, dass sie vor zwei Jahren vierzig geworden war. Aber morgens kam sie jetzt ganz eindeutig immer langsamer aus dem Bett, und es waren weder die Einbildung noch das Datum auf ihrer Geburtsurkunde, die ihr diese Schmerzen zufügten. Denn wenn man sechs Tage die Woche, jahraus, jahrein solche Arbeiten verrichtete: Was sollte man da anderes erwarten? Sie nahm sich vor, nicht allzu viel darüber nachzudenken, denn diese ganzen Grübeleien brachten niemals etwas.
Der Herr würde ihr den rechten Weg weisen.
Es wäre zwar vermutlich angebracht, wegen ihres Rückens einen Arzt aufzusuchen, überlegte sie, aber das Geld war knapp, so wie es immer knapp gewesen war. Zehn, zwölf Dollar mehr pro Woche wären hilfreich, und sie war sich sicher, dass sie sie – von den sechs Haushalten ihrer Stammkundschaft zusammengerechnet – auch bekäme. Keine einzige dieser Familien könnte mit dem Argument kommen, dass sie eine Lohnerhöhung um zwei Dollar nicht verdiente. Doch dann würde sie mit zweiundsiebzig pro Woche mehr verdienen als ihr Mann, der in seinem Job fünfundsechzig machte, und somit gäbe es ein neues Problem. Mehr zu verdienen als der Gatte – das kam überhaupt nicht infrage. Eine solche Situation könnte dem Löwen im eigenen Ehemann den Garaus machen.
Alethea legte ein paar von Olga Vaughns weißen Höschen zusammen.
»Guter Gott«, sagte sie und lachte bei dem Gedanken in sich hinein, wie Olga beim Lunch immer versuchte, Konversation zu machen.
Der Lunch hätte eigentlich Aletheas Mittagspause sein sollen; bei den Vaughns war das aber in Wahrheit der anstrengendste Teil des Tages für sie. Olga bestand darauf, dass sie zusammen mit der Familie aß, wo sich Alethea doch nichts weiter wünschte als eine halbe Stunde Ruhe und Frieden. Sie akzeptierte es, wie man das meiste akzeptieren musste, das Vorgesetzte von einem verlangten, aber es war eine lästige Pflicht, mehr eine Arbeit und wie wenn man gezwungen wird, in einem Theaterstück eine Rolle zu übernehmen. Wenn Olga mit einem sprach, dann war sie sich demonstrativ bewusst, dass sie mit einem sprach: Sieh her, Welt, ich spreche mit einer »Negerin«. Das war ihre Art, sich selbst und höchstwahrscheinlich auch ihren Freundinnen einzureden, dass sie reinen Herzens war und somit besser als diese Leute »unten im Süden«. Aber sie war kein bisschen besser. Eigentlich war sie sogar schlimmer, denn bei einem Rassisten, egal aus welchem Teil des Landes, wusste man wenigstens, wie man dran war. Wenn Olga so reinen Herzens war: Warum trennte sie dann in der Spüle Aletheas Geschirr vom Rest?
Man will ja schließlich nicht, dass von diesen Farbigen etwas auf einen abfärbt, oder, Mädchen?
»Vergiss es«, sagte sie laut, verabscheute ihr Ressentiment, denn sie wusste, dass es ein Zug war, der im Widerspruch zu ihrer christlichen Erziehung stand. Im Stillen sprach sie ein kleines Gebet und bat um Vergebung.