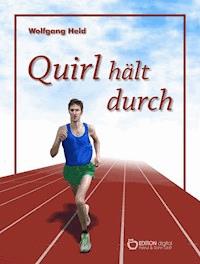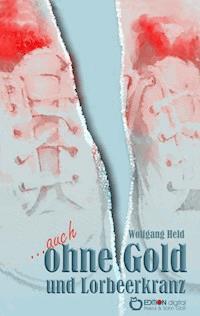7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: EDITION digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der Zufall hat sechs junge Menschen für länger als ein Jahr zusammengeführt. Unter ihnen den Baumaschinisten Andreas, den Oberschüler Egon und Heinz, der bisher in einer Melkerbrigade gearbeitet hat. Alle tragen die Uniform der NVA, gehören einem mot. Schützenregiment an und wohnen auf derselben Stube. Ihre Dienstzeit hat eben erst begonnen. Mancher steht noch mit einem Bein im Zivilleben, und jeder hat seine eigenen Probleme. Andreas zum Beispiel mit seiner Frau. Doris erwartet ein Kind und möchte ihren Mann lieber heute als morgen wieder bei sich haben. Doch der trägt sich mit dem Gedanken, länger als achtzehn Monate bei der Fahne zu bleiben. Unaufhaltsam steuert die junge Ehe in eine Krise. Andreas muss unbedingt vierundzwanzig Stunden nach Hause fahren, um Doris vor einem nie wieder gutzumachenden Schritt zu bewahren. Gerade will er um Urlaub bitten, da heult in den Kasernen die Alarmsirene. Das Regiment rückt zu einer Übung aus, die das Letzte von den Soldaten fordert. Andreas steht zwischen militärischer Pflichterfüllung und persönlichem Zwang. Wie soll er sich verhalten? Der Fünfundzwanzigkilometermarsch wird für ihn und seine Stubenkameraden zu einer nicht enden wollenden Bewährungsprobe. Das wegen der spannenden Wiedergabe der Probleme junger Leute auch heute interessante Buch wurde 1978 vom Fernsehen der DDR verfilmt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 336
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Impressum
Wolfgang Held
Härtetest
ISBN 978-3-86394-948-8 (E-Book)
Die Druckausgabe erschien erstmals 1978 beim Militärverlag der Deutschen Demokratischen Republik.
Gestaltung des Titelbildes: Ernst Franta
© 2013 EDITION digital®
Pekrul & Sohn GbR
Alte Dorfstraße 2 b
19065 Godern
Tel.: 03860-505 788
E-Mail: [email protected]
Internet: http://www.ddrautoren.de
Mittwoch, 25. Juni, 16.25 Uhr
Die junge Frau muss sich beherrschen. Die Lust, dem Dicken gegen das Schienbein zu treten, wächst von Haltestelle zu Haltestelle. Die Straßenbahn ist voll. Feierabendvoll. Der Dicke hängt an einer Halteschlaufe, eingezwängt zwischen ein paar jungen, langhaarigen Burschen mit Aktentaschen und Plastikbeuteln. Er starrt scheinheilig über den Kopf der vor ihm Sitzenden aus dem Fenster und drückt gleichzeitig seinen Schenkel gegen ihre runden, festgeschlossenen Knie. Sie schaut zu ihm hoch, funkelt feindselig, doch sein Blick streift sie nur gleichgültig, schwenkt wieder hinaus zu den vorbeieilenden Fassaden. Der Druck seines Schenkels wird stärker.
Wenn der Kerl nicht aufhört, trete ich zu, denkt die junge Frau. Ich kann dabei auch so ein Gesicht machen, als ginge mich das Ganze nichts an. Gleich wird er es erleben, der Mops!
«Juri-Gagarin-Platz!», schnarrt der Lautsprecher.
Der Wagen hält. Drei Fahrgäste fliehen erleichtert dem Gedränge, fünf andere quetschen sich herein. Ein Leutnant mit einem verhangenen Vogelbauer ist dabei und ein junger Vater, das Töchterchen auf dem Arm, den Sohnemann an der Hand. Die Bahn ruckt wieder an. Stimmen übertönen das Rumpeln und Poltern der Räder.
«Das müssen Sie sich mal vorstellen: Spargel! Am helllichten Tag! Schöner, gelber Spargel!»
«Aber nirgends Zahnpasta!»
«Ohne Kurbjuweit sehn die hinten doch steinalt aus, sage ich!»
«Uchchchch!», ächzt der Dicke plötzlich durch die Zähne und schrumpft einige Zentimeter, aber er wendet nicht den Kopf. In seinen Schmerz mischt sich Triumph. Sein Bein steht nun doch zwischen den bloßen, warmen Knien der jungen Frau.
Doris Jungmann, Verkäuferin und seit knapp vier Wochen zwanzig, ist keine Zimperliese. Sie weiß, was sie will. Sie weiß auch, dass eigener Wille nur durchzusetzen ist, wenn man nicht lockerlässt. Und auf einen groben Klotz gehört ein grober Keil. Ein Tritt gegen das Schienbein reicht da nicht aus. «He,Sie!» Der Dicke schaut sie an, grinst ein bisschen. Sie lächelt, dann haut sie ihm blitzschnell eine runter. Er bewegt die Lippen und bringt keine Silbe hervor. Unsicher schaut er nach rechts und links in die neugierigen Gesichter. Die Langhaarigen recken die Hälse.
«Na?», fragt Doris Jungmann. Sie lächelt immer noch.
«Unverschämtheit!», faucht der Dicke und weicht zurück.
Die Langhaarigen haben mitbekommen, worum es geht, und reagieren sofort. Der Ring um den Dicken wird enger.
«Aua!», stöhnt der Mann eine halbe Minute später und verzieht das Gesicht. Er faucht einen der jungen Männer an: «Können Sie denn nicht aufpassen, Sie Flegel!»
«Immer!», sagt der Bursche. Er trägt eine Loreleyfrisur und zwinkert der jungen Frau zu. Der Lautsprecher kündigt die nächste Haltestelle an. Einer von den Langhaarigen wendet sich an den Dicken. «Du bist am Ziel, Schweinsbacke! Vergiss das Aussteigen nicht!»
Der Dicke schaut sich Hilfe suchend um. «Aber ... Aber wieso denn ... Ich ...» Es ist, als wäre er gar nicht da. Keiner der Fahrgäste nimmt von ihm Notiz.
«Glaub's nur, du bist da», sagt einer von den anderen Burschen. Der Dicke steigt aus, schimpft über die heutige Jugend und darüber, dass die viel zitierte Liebe unter den Menschen im Bedarfsfall keinen Pfifferling wert ist.
An der nächsten Haltestelle verlässt auch die Mähnenmeute den Wagen. Einer wirft der jungen Frau eine Kusshand zu. Sie lacht zurück. Der Jüngling zögert, doch die anderen ziehen ihn weiter. «Haste nicht gesehen, Mensch: verheiratet!» Gegenüber von Doris Jungmann hat der Vater mit seinen Sprösslingen Platz gefunden. Auch der Leutnant sitzt und hält den Vogelbauer auf dem Schoß. Er neigt den Kopf ein wenig und lauscht, ob sich unter der Stoffhülle etwas rührt.
Er ist noch sehr jung, überlegt Doris Jungmann. Fünfundzwanzig, sechsundzwanzig, bestimmt nicht älter. Ihr Blick sucht seine rechte Hand. Der Offizier ist verheiratet. Und fährt in die Kaserne. Und nimmt einen Vogelbauer mit. Ob seine Frau hier in der Stadt wohnt? Oder hundertzweiundzwanzig Kilometer weit weg, wie ich? Oder noch weiter?
Doris denkt an den Tag, an dem Andreas gehen musste. Alles ist so deutlich, als wäre es erst gestern gewesen. Es vergeht kaum ein Tag, an dem sie sich nicht an die Stunde der Trennung erinnert. An jede Minute, an jeden Augenblick. Und immer wieder tut es weh. Und immer von Neuem nimmt sie den Schmerz hin wie etwas, das sein muss, das unerlässlich ist, das wachhält gegen Gewöhnung und Resignation ...
Auf dem Tisch im Wohnzimmer das gute Porzellan wie zu Weihnachten. Draußen im Korridor ein kleiner, halb leerer Koffer griffbereit. Bratenduft überall in der Wohnung. Vater, dessen linker Unterarm mit der Prothese neben dem Teller liegt, löffelt Suppe und versucht nach jedem Schluck, ein bisschen Heiterkeit in die graue Stunde zu säen. «Wenn ich an die Kesselerbsen in der Kaserne denke - einmalig! Du wirst sehen, Andy, so kriegt sie nicht mal Mutter hin ...»
Da fällt Doris der Löffel aus der Hand, weil sie es einfach nicht mehr aushält. Sie springt auf. Ein Glas kippt, roter Wein färbt Mutters bestes Tafeltuch. «Mädel!», ruft die Mutter erschrocken wie damals, als der Tochter über Nacht Windpocken auf der Haut blühten. Doris rennt aus dem Zimmer, und Andreas sagt, dass die Eltern sie lassen sollten, denn das wäre seine Sache. Er geht in ihr Zimmer, wo sie schon vor der Hochzeit zusammen gewohnt haben, setzt sich zu ihr aufs Bett und streicht behutsam über ihr Haar. Sie weint leise. Ihre Schultern zucken. Seine Hand tut gut, sie ist sanft und warm.
«Ich bin doch nicht aus der Welt», sagt er leise.
«Doch», sagt sie. «Doch!» Es klingt verzweifelt.
«Du kannst mich besuchen», sagt er. «Und es gibt Urlaub ...»
Endlich sieht sie ihn an. Ihre Augen sind gerötet, als hätte sie stundenlang geheult. Der Gedanke an die bevorstehenden achtzehn Monate, in denen sie ganz allein sein wird, macht ihr das Atmen schwer. «Du darfst nie vergessen, dass ich hier auf dich warte», sagt sie. Es klingt wie eine Warnung. «Jeden Tag, Andy. Vom Wachwerden bis zum Einschlafen. Und jede Stunde ohne dich wird mir wehtun.»
«Doris.» Er legt zärtlich den Arm um ihre Schulter, doch sie weicht vor ihm zurück.
«Du sollst mich jetzt nicht küssen», sagt sie. «Denk immer daran, dass mich ab heute jeder Tag quälen wird. Achtzehn Monate lang. Du musst kommen, sooft du kannst, Andy. Versprichst du mir das?»
«Ehrenwort!», sagt er und lächelt ein bisschen, weil er ihr Mut machen will. Sie zieht die Nase hoch, hält ihm die Hand hin. «Hast du ein Taschentuch?»
Mutter ist ihren Braten nicht losgeworden an diesem Mittag. Sie hatte sich so viel Mühe gegeben mit dem Essen, aber stören wollte sie den Abschied der beiden auch nicht. Sie musste die ganze Zeit an den Tag denken, an dem ihr Mann in den Krieg gezogen war. Sie wusste natürlich, dass dieser Vergleich hinkte wie jeder Vergleich. Es gab keine Front und keine Bombenangriffe und keine Listen mit den Namen der Gefallenen. Alles war anders. Soldaten des Friedens, so stand es in den Zeitungen, aber an ihren Gefühlen änderte das nichts. Ich habe geweint damals, dachte sie, als mein Mann den Soldatenrock anzog, und meine Tochter weint heute auch, das allein zählt, jedenfalls für mich.
Der Lautsprecher reißt Doris Jungmann aus der Erinnerung an die Stunden, die jetzt mehr als acht Wochen zurückliegen. Noch zwei Haltestellen bis zur Endstation am Stadtrand. Die Straßenbahn hat nun viele freie Sitzplätze. Der Knirps zupft seinen Vater am Ärmel und zeigt auf den Leutnant. «Vati, hör mal: Bei dem piept's.»
Doris Jungmann lächelt.
«Das ist, weil er 'n Vogel hat!», erklärt der Vater seinem Sprössling und wird ganz verlegen, als er merkt, dass seine Worte missverständlich sind. «Im Bauer natürlich», fügt er schnell hinzu.
Auch der Leutnant schmunzelt. Er winkt den Knirps heran, lüftet die Stoffhülle. «Nicht nur einen», sagt er freundlich. «Zwei! Ein Pärchen! - Serinus canarius!»
Im Käfig flattern zwei zitronengelbe Harzer Roller.
«Wache! Stillgestanden!» kommandiert ein Hauptmann, der eine rote Binde am Oberarm trägt. Vor ihm stehen ein Leutnant, zwei Unteroffiziere und achtzehn Soldaten. Der Offizier und die beiden Unteroffiziere tragen Pistolen, die Soldaten sind mit Maschinenpistolen bewaffnet. Jeder hat für seine Waffe zwei gefüllte Magazine bei sich. Die Miene des Hauptmanns ist streng, beinahe frostig. Seine Stimme zwingt die Gedanken der Männer in eine gemeinsame Richtung, hämmert ihnen jedes Wort ins Bewusstsein: «OvD vom fünfundzwanzigsten zum sechsundzwanzigsten Juni Hauptmann Koch, Stabsgebäude, Zimmer vierundzwanzig.» Er macht eine Pause und lässt, ohne den Kopf nach rechts oder links zu bewegen, den Blick noch einmal über die Angetretenen schweifen, bevor er befiehlt: «Vergatterung!» Mit diesem Kommando werden einundzwanzig Uniformierte des mot. Schützenregiments «Scharnhorst» aus dem normalen Dienstbetrieb herausgelöst. Sie erhalten einen Auftrag, der von jedem einzelnen besondere Disziplin, Mut, Ausdauer und höchste Wachsamkeit verlangt.
Wachdienst - das ist eine Gefechtsaufgabe. Für vierundzwanzig Stunden wird diesen Soldaten die Verantwortung für den Schutz der Dienststelle, das Leben der Genossen und die Sicherheit der Ausrüstung und Bewaffnung anvertraut. Ihre Pistolen und Maschinenpistolen werden mit scharfer Munition geladen sein. Jeder von ihnen erhält das Recht und die Pflicht, seine Waffe auf Befehl oder auf eigenen Entschluss zu gebrauchen, wenn die Erfüllung der übernommenen Aufgabe dies erfordert.
Eine halbe Minute Stille gibt der besonderen Bedeutung des Kommandos Gewicht. Dann befiehlt der OvD den Wachhabenden zu sich und übergibt ihm einen Umschlag, der das alte und das neue Kennwort enthält.
«Wachhabender eintreten. Wache übernehmen und zur Ablösung abrücken!», kommandiert der Hauptmann. Er schaut der kleinen in Richtung Haupteingang davonmarschierenden Einheit nach, und seine Miene verliert jenen Zug von Strenge, die ihn eben noch unnahbar erscheinen ließ.
Die Unterkünfte, Versorgungsgebäude und Fahrzeughallen des motorisierten Schützenregiments «Scharnhorst» liegen, von der Endhaltestelle der Straßenbahn eine reichliche Viertelstunde entfernt, auf einer Anhöhe hinter vierzig Jahre alten Pappeln. Ein Kulturgebäude gehört dazu, eine Sporthalle und seit zwei Jahren auch ein neues modernes Heizhaus. Umschlossen wird das fast drei Hektar große Gelände von einem hohen Zaun, der nach der Straße hin aus schmiedeeisernen Stäben und an den Seiten aus festem Maschengeflecht mit einem Saum aus siebenzeilig gespanntem Stacheldraht besteht. Von fünf Postentürmen herab ist jeder Meter der nachts von Lampen erhellten Umzäunung überschaubar.
Die Wachablösung findet täglich zur gleichen Stunde statt. Pünktlich wie vorm Leninmausoleum, so formuliert es mit Vorliebe der Regimentskommandeur, Oberstleutnant Senkbaum, für den das Wachablösungszeremoniell auf dem Roten Platz in Moskau, Repins «Saporosher Kosaken» im Russischen Museum in Leningrad und Kognak «Weißer Storch» aus der Moldaurepublik zu den unvergesslichsten Eindrücken seines Aufenthalts in der Sowjetunion zählen. Nicht nur deswegen, sondern auch aufgrund seiner Körperlänge von 1,89 m nennen ihn die Soldaten seines Regiments, die Offiziere in den übergeordneten Stäben bis hinauf ins Ministerium und nicht zuletzt seine Frau ebenso wie sein Sohn und seine zwei Töchter hinter seinem Rücken nur den «Spasski-Turm».
Oberstleutnant Senkbaum ist überzeugt, dass die Präzision einer militärischen Wachablösung auf untrügliche Weise Disziplin und Kampfmoral einer Truppe offenbart. Nicht zuletzt deshalb hat er sein Arbeitszimmer im Stabsgebäude so gewählt, dass er vom Fenster aus das tägliche Zeremoniell am Haupttor, sooft es ihm die Zeit erlaubt, beobachten kann. Auch heute haben der alte und der neue Wachhabende die Hünengestalt am offenen Fenster längst bemerkt.
Während der Ablösung ist der Haupteingang für den Personenverkehr kurze Zeit geschlossen. Fahrzeuge müssen warten, bis der neue Torposten seinen Dienst angetreten hat. Vor der Gittertür stehen ein paar Leute. Leutnant Winter mit dem Vogelbauer ist dabei. Er hält Ausschau nach der jungen Frau aus der Straßenbahn, kann sie aber nicht entdecken. Auf dem steilen Fußweg hinauf zur Dienststelle hat er sie eingeholt und gefragt, ob sie irgendwen in der Kaserne besuchen wolle. Es hat ihm gefallen, wie sie sich in der Straßenbahn verhalten hat. Und weil er weiß, wie lange es zuweilen dauert, bis ein Genosse im Objekt erfährt, dass im Besucherzimmer jemand auf ihn wartet, wäre er ihr gern behilflich gewesen. Aber sie ließ sich nicht auf einen Wortwechsel ein. Nur ein kurzer, abweisender Blick, als hätte er ihr Tabakrauch ins Gesicht geblasen. He, ich bin nicht verwandt mit dem Dicken, hat er gedacht und ist weitergegangen, hoffend, mit seinen Vögeln noch vor der Ablösung am Tor zu sein. Nun muss er doch warten, aber die junge Frau kommt nicht. Wo mag sie nur abgeblieben sein, fragt er sich. Außer der Dienststelle gibt es hier nur Kartoffelfelder, ein paar Hochspannungsmasten und das städtische Wasserreservoir. Oder ist sie umgekehrt?
Kommandos hallen bis zu den Pappeln. Wenig später trägt Leutnant Winter seinen verhangenen Vogelbauer am Torposten vorbei ins Objekt.
Zwei Unteroffiziere, der Aufführende der abzulösenden und der Aufführende der ablösenden Wache, sind zur ersten Postenablösung unterwegs. Alles klappt reibungslos. Nur beim Postenturm III an der entlegenen Südwestecke des Objekts gibt es einen winzigen, von den Aufführenden kaum bemerkten Vorgang ungewöhnlicher Art. Zwischen dem «Postenbereich übergeben!» und dem «Postenbereich übernommen!» flüstert der Abgelöste dem Neuen hastig einen Satz zu. Er bewegt dabei nur unmerklich die Lippen. «Mach nachher keinen Quatsch, die gehört zu einem vom zweiten Zug!»
Von der Plattform des Turmes aus entdeckt der neue Posten die junge Frau sofort. Sie schlendert auf dem schmalen Wiesenstreifen zwischen Acker und Zaun dahin, sieht auf die Uhr, bleibt stehen, blickt ungeduldig hinüber zu den Kasernenblocks, schlendert weiter. Der Posten überlegt. Wenn er das Stelldichein am Maschendraht ignoriert, verstößt er gegen die Dienstvorschrift. Doch falls die beiden sich beeilen ... Na bitte, Mädchen, dort kommt ja schon dein Angebeteter. Ihr habt mit mir auf dem Turm wirklich mächtiges Glück. Kathedralisch! Nur mal angenommen, der Plinzmann aus meiner Stube stünde jetzt hier, der würde doch sofort ein Fass aufmachen. Keine Angst, bei mir nicht. Ich beiße nur Klassenfeinde und Leute, die Bier verschütten. Aber dafür bist du mir ein Geschäumtes schuldig, Genosse Soldat! Die gehn ganz schön ran, die beiden. Besucherraum passt da beim besten Willen nicht. Dort ist nur ein Platz, wo Mutti ihr Kuchenpaket übergeben kann oder Vati mal großzügig ins Portemonnaie greifen darf: Hier, mein Junge, schließlich war ich auch mal bei der Fahne und weiß Bescheid! Ein Musketier läuft nur mit Bier! Und am Tisch nebenan hockt womöglich so ein alter Kämpfer über dreißig, der durch seine Reservedienstzeit robbt und sich vom Frauchen den familiären Lagebericht geben lässt. Die lieben Kinderchen, die Einkellerungskartoffeln, der Köter, den sich die in der Nachbarwohnung angeschafft haben. Zehn Jahre gemeinsames Schlafzimmer. Küsschen zur Begrüßung, Küsschen zum Abschied, alles vor versammeltem Publikum. Nee, dann schon lieber gebremsten Dauerbrenner durch den Maschenzaun. Macht nur nicht so lange, ihr zwei da unten. Ganz schön heiße Öfen. Passt bloß auf, dass der Draht nicht wegschmilzt ... Mann, da kann ich gar nicht länger zugucken!
Ein Kuss. Der Zaun schneidet ihr und ihm Waffelmuster ins Gesicht, aber sie spüren es nicht. Das zärtliche Spiel ihrer Hände ersetzt die Umarmung. Endlich löst sich Doris aus dem roten Nebel, in dem jeder Gedanke versinkt. Es fällt ihr schwer. Sie ist benommen und außer Atem.
«Ich ... Ich verstehe dich nicht, Andy», sagt sie stockend.
Er berührt mit seinen Lippen sanft ihre Finger. «Dreiundfünfzig Tage», sagt er. «Du, das war schwer ohne dich.»
«Hör doch mal zu! Du darfst nicht unterschreiben, verstehst du?»
«Ich liebe dich, Doris!»
«Geh hin und sag ihnen, dass es voreilig war, dass du es dir anders überlegt hast. Sag ihnen, was du willst, aber tu es nicht!»
«Sei doch vernünftig, Doris ...»
«Du, Andy, du musst jetzt vernünftig sein!» Sie umklammert seine Hände in den Drahtmaschen. Die Zärtlichkeit ist versickert. Ihre Erregung sitzt tief. Sie fürchtet sich und verrät es mit jeder Silbe. «Soldat auf Zeit, als ob das unbedingt nötig ist. Heutzutage! Die ganze Welt spricht von Frieden, von Abrüstung, und du ... Und ich? Was du vorhast, das heißt doch für mich so viel wie immer allein sein, und das für Jahre!»
«Bitte, Doris», sagt Andreas so behutsam, wie er nur kann. Vom Lesen ihres Briefes, der vor zwei Tagen gekommen ist, bis zu diesem Augenblick hat er die ganze Zeit gehofft, dass sie sich ihren hitzigen Einspruch gegen seinen Entschluss noch einmal überlegt. Aber nun ist alles noch viel schlimmer als vorher. Dabei haben wir doch schon über das Längerdienen gesprochen, denkt er, es ist noch gar nicht so lange her. Aber anscheinend hat sie es nicht ernst genommen.
«Ich werde hier gebraucht, Doris», sagt er. «Leutnant Winter ist ziemlich sicher, dass ich alle Voraussetzungen mitbringe, die für den Soldatenberuf nötig sind. Und die Genossen in meiner Parteigruppe haben mir ebenfalls Mut gemacht.»
«Warum ausgerechnet du?», fragt sie und schaut ihn an. Ihre graugrünen Katzenaugen mit dem Goldstaubflimmer können kalt sein wie Kiesel im Gletscherwasser. «Du hast eine Frau, hast deinen Beruf als Baumaschinist und einen Platz, auf dem du gebraucht wirst. - Gibt's nicht genug Ledige für die Armee?»
Weshalb begreift sie mich nicht, denkt Andreas und fühlt sich auf einmal müde wie nach einer schlaflosen Nacht. Er sieht hinüber zu den Kasernenblocks. «Von den Unteroffizieren und Offizieren da drüben sind die meisten verheiratet», sagt er. «Sie haben Frauen und Kinder und sicher auch einen Zivilberuf, wenn sie nicht gleich nach dem Abi ...»
«Verstehst du nicht, dass du alles kaputtmachen würdest?», unterbricht ihn Doris erneut. Sie beherrscht sich jetzt, ist nicht mehr so heftig wie vorhin. «Schau dich doch um, Andy. Lange Trennung ist Gift für Ehen. Ohne Ausnahme. Die Beckers - geschieden! Evi und Gerd - geschieden! Und bei deinem Bruder ist es auch bald so weit, wenn er nicht schnell mit der Außenmontage aufhört. »
«Aber Mädchen, es gibt doch Hunderte von Gegenbeispielen. Tausende!»
«Ja», sagt Doris ruhig, «deine Eltern zum Beispiel oder meine. Zwanzig Jahre und mehr verheiratet. Glücklich! Aber weißt du auch, weshalb? Weil sie beieinander sind! Den Tag für die Arbeit, doch die Abende, die Wochenenden, die Feiertage gehören ihnen. Die lassen sie sich nicht wegnehmen. Das sind die Stunden, in denen eine Ehe zusammenwächst.»
«Aber Doris ...»
«Glück gedeiht nur gemeinsam, da kannst du sagen, was du willst!»
«Aber ich will doch nicht zur Wega fliegen.»
«Jedenfalls für mich ist Glück nicht anders denkbar.»
«Gegen Sehnsucht und Trennung gibt es immer noch Fahrkarten. Andere müssen auch warten.»
«Und ziemlich lange, wenn Männer wie du, die neue Häuser bauen sollen, für Jahre zur Armee gehn!»
Jetzt wird sie mir gleich erzählen, denkt Andreas Jungmann, dass zu Hause in der Südstadt abends der Kran stillsteht, weil sie in der zweiten Schicht für meinen Platz oben in der Kanzel noch keinen anderen haben. Jetzt wird sie sagen, dass bewaffneter Schutz und Frieden große Worte sind für Leute, die immer noch zwischen abrissreifen Mauern hausen müssen oder zu viert in einer Hinterhauswohnung ohne fließendes Wasser und das Klo auf dem Hof. Baustellen für Wohnungen, wird sie sagen, das sind Kampfabschnitte, und der Platz dort ist mindestens ebenso wichtig wie der in einem Panzer, hinter einem Maschinengewehr oder in einer MiG. Und ich kann ihr nicht einmal widersprechen. Ich habe nur Worte. Große Worte, gewichtig wie Granitblöcke: Verantwortung. Pflicht. Notwendigkeit ...
«Das ist doch Stabüstunde», sagt Doris Jungmann, genau wie er es erwartet hat. Um den in ihrem schmalen Gesicht ein wenig zu groß wirkenden Mund breitet sich ein Zug von Bitterkeit aus. «Sprüche sind das!»
«Und du bist unsachlich, Doris!», fährt Andreas sie verärgert an. Im nächsten Moment blickt er besorgt zum Postenturm hinauf, aber dort bleibt es still. Eine Weile stehen sie einander stumm diesseits und jenseits des Zaunes gegenüber. Ihre Hände sind von den Drahtmaschen geglitten. Doris bricht endlich das Schweigen, Ihre Stimme klingt überraschend sanft und zärtlich.
«Du hast recht, Andy», sagt sie. «Wir müssen sachlich sein. Du und ich. - Du willst den Frieden schützen. Die Heimat, die Zukunft, die Wiesen und die Felder. Ich weiß, dass es dir damit ernst ist, aber wenn unser Baby im Zahnfieber schreit - du wirst nicht da sein! Wenn es die ersten Schritte macht - du wirst es nicht halten! Und wenn es erst sprechen kann, wird es immer am ersten Urlaubstag Angst vor dir haben und Onkel zu dir sagen.»
Andreas Jungmann traut seinen Ohren nicht. Er will ihr begreiflich machen, dass er sie missverstanden hat. Doch er schluckt nur und bringt keine Silbe über die Lippen. Doris beobachtet ihn. Ihre Augen glitzern. Sie spürt, dass ihr die Überraschung gelungen ist, «Du siehst nicht gerade aus wie einer, der sich freut, Vater zu werden», sagt sie.
«Vater, das ist doch ...» Er begreift die Neuigkeit nur allmählich. Dann zieht ein großes, glückliches Staunen über sein Gesicht. «Mensch, Doris! Ein Kind?»
Sie nickt und lächelt. «Ein Kind, das dich braucht, Andy. Deshalb musst du mir versprechen, dass du dir das mit dem Längerdienen noch einmal überlegst. Gib mir dein Wort darauf, bitte. Jetzt gleich!»
Andreas kann es immer noch nicht fassen. «Mädchen, ein Kind! Wissen sie es zu Haus schon?»
«Dein Ehrenwort, Andy, sonst wird das Kind nicht geboren.»
«Was soll das heißen?»
«Du verstehst mich ganz richtig.»
Stille. Andreas starrt seine Frau an. Sie weicht seinem Blick nicht aus. «Ich bin angemeldet», erklärt sie. In ihrer Stimme ist nicht die kleinste Unsicherheit. Nichts deutet ihre Furcht vor der Stunde an, in der diese Entscheidung unwiderruflich werden könnte. «Übermorgen um acht Uhr im Kreiskrankenhaus. Der Arzt sagt, nächste Woche kann ich schon wieder arbeiten.»
«Das darfst du nicht machen!» Andreas erkennt, dass Doris genau weiß, was sie sagt. Seine Stimme klingt unsicher. «Dazu hast du kein Recht, Doris.»
«Wer sonst?»
«Es ist mein Kind genauso wie dein Kind!»
Doris schüttelt den Kopf. «Eben nicht, Andy. Jedenfalls nicht, wenn du das wahr machst mit dem Längerdienen.»
«Bitte, Doris, das ist doch ...»
«Eine nüchterne Tatsache. Dein Kind wäre es nur an ein paar Wochenenden im Jahr oder während des Urlaubs. Ein richtiger Vater ist jeden Tag da. Oder wenigstens fast jeden Tag.»
So geht das nicht, denkt Andreas. Mit einem Zaun zwischen uns und einem Posten, der eine Menge Ärger kriegen kann, wenn wir nicht bald aus seinem Bereich verschwinden. Ich brauche Zeit und einen Platz, an dem wir in Ruhe reden können, jetzt geht es gar nicht darum, ob sie mit dem Längerdienen einverstanden ist. Jetzt ist erst einmal das Kind wichtig.
«Am Sonnabend kriege ich Ausgang», sagt er. «Wir müssen das alles besprechen. Gründlich und vernünftig, nicht zwischen Zaun und Posten. Ich hole dich vom Mittagszug ab.»
Doris schluckt. Sie will jetzt hart und kalt bleiben, und das gelingt ihr auch, aber in ihrer Brust krampft sich etwas zusammen und schmerzt wie eine Wunde.
«Gib mir dein Ehrenwort, dass du keinen Tag länger als achtzehn Monate bleibst, und ich werde am Sonnabend mit dem Mittagszug kommen. Oder ich liege im Krankenhaus.»
«Mach doch keinen Unsinn, Mädchen. Lass uns erst einmal miteinander reden ...»
Sie fällt ihm ins Wort: «Reden! Du willst nicht reden, Andreas, du willst mich rumkriegen.» Sie merkt, wie ihr das Weinen hochsteigt. Aber er soll keine Tränen sehen. Nicht noch einmal wie damals in der Abschiedsstunde. - Mit einem Kind ist alles anders, denkt sie. So ein Kind lebt und wächst und bindet, es braucht beide, die Mutter genauso wie den Vater. Erst ein Kind macht aus einem Ehepaar eine Familie ... Eine Familie!
«Du musst wissen, was dir mehr wert ist», sagt sie. «Eine Familie oder das dort drüben.» Sie tritt zurück und deutet flüchtig zu den Kasernen hin. «Du kannst mich ja anrufen. Im Kaufhaus. Bis morgen Abend. Ich muss jetzt gehen.»
«Warte noch, Doris, ich lasse dich so nicht weg!»
«Tschüs, Andy!» Sie schaut ihn an und hebt die Hand. «Ich wünsche mir sehr, dass du anrufst, Andreas ... Sehr!» Sie schwenkt die Hand ein wenig, wendet sich um und geht. Andreas krallt die Finger in die Maschen.
«Doris!», ruft er laut. «Doris, hör doch! Am Sonnabend! Ich warte am Bahnhof! Ich warte!»
Doris blickt sich nicht um. Sie hat Angst, dass sie dann umkehren und alles zurücknehmen könnte. Sie geht schneller. Das dichte, schulterlange Haar weht ihr ins Gesicht.
«Nun ist aber Sense, Mensch!», schreit der Posten vom Turm herab Andreas an. «Weg da vom Zaun!»
Andreas Jungmann beachtet die Aufforderung nicht gleich. Er schaut seiner Frau nach, bis sie hinter dem Ackerhügel verschwunden ist, erst dann dreht er sich um und geht auf die Kasernenblocks zu.
«Scheißspiel!», brummt der Posten, der auf seinem Turm die junge Frau noch sehen kann und das weiße Tuch, das sie sich jetzt vor das Gesicht hält.
«Waffenreinigen» steht auf dem Dienstplan.
Der Unterrichtsraum, in dem der 2. Zug arbeitet, befindet sich im zweiten Stockwerk des Kasernenblocks. Die Soldaten stehen an langen Tischen. Über ihnen sind weiß strahlende Neonröhren eingeschaltet. Vor den Männern liegen in Einzelteile zerlegte Maschinenpistolen vom Typ KM, von Freunden liebevoll nach dem sowjetischen Konstrukteur «Kalaschnikow» genannt. Gasdrucklader mit Drehverschluss. Bei kurzen Feuerstößen 100 Schuss in der Minute, bei Einzelfeuer 40 Schuss. Günstigste Schussentfernung 400 bis 800 Meter. - In der Gruppe Brettschneider ist keiner, der diese und ein Dutzend andere Angaben über die MPi KM nicht schon im Schlaf hersagen kann.
Die Genossen der Stube 3 belegen einen der Tische. Sie sind nur zu viert: Egon Schornberger, der blonde Abiturient mit der großen Klappe, der verfressene Hüne Michael Koschenz, der gottesfürchtige Bruno Preller und Jochen Nickel, der Dauerschnarcher. Zwei weitere Stubenbewohner fehlen. Es sind Andreas Jungmann und Heinz Körner. Die MPis der beiden werden von Koschenz und Preller mit gereinigt.
«Zivil nutzt dir gar nichts», behauptet Egon Schornberger. Sein Nachbar ist der bärenstarke Koschenz, in dessen Pranken die Waffe wie ein Kinderspielzeug aussieht. Wenn Schornberger mit ihm ins Gespräch kommt, gibt es immer nur ein Thema: Mädchen!
«Ich habe die Klamotten im <Roten Hirsch> bei der Toilettenfrau deponiert. Paradejeans, urige Pullis ... Glatter Schuss in den Ofen! Die Weiber merken's dir trotzdem an. Deswegen!» Schornberger fächelt mit der flachen Hand über seinen Bürstenhaarschnitt. «Igel bleiben ungeküsst!»
Michael Koschenz zieht zum dritten Mal den Reinigungsdocht durch den MPi-Lauf. Er grient, «'ne clevere Schwester musst du haben, das isses», meint er überlegen. Schornberger begreift nicht, was der Hüne damit sagen will.
«Wozu?», fragtet.
«Abitur machen, studieren wollen auf meine Kosten, aber keine Einfälle haben», brummt Koschenz, der gelernter Maschinenstricker ist und deshalb angeblich jede Masche kennt. Er äugt durch den Lauf, den er gegen die Neonröhre hält. Kein Fleckchen, kein Stäubchen. Er nickt zufrieden. «Nachher zeige ich dir was, da kannste was lernen. Geschenk von meiner Schwester.»
«Seine Schwester schickt ihm nämlich immer die Pillen, die sie am Monatsende übrig hat», witzelt Jochen Nickel von der anderen Seite des Tisches her. Er lacht laut, doch seine Heiterkeit findet nur ein schwaches Echo. Erst als Bruno Preller ahnungslos fragt, was für Pillen gemeint sind und wieso Koschenz welche braucht, platzt Gelächter los.
Der Lärm ruft Unteroffizier Brettschneider herbei. Hager, fast dürr, dunkeläugig und mit einem Wettergesicht wie ein Schäfer, steht er plötzlich in der Tür. Sofort wird es still. Wenn es um Disziplin geht, hört bei Brettschneider jede Gemütlichkeit auf. Seit vierzehn Monaten beste Gruppe der Kompanie, das lässt er sich nicht kaputtmachen. Dreimal musste Jochen Nickel am vergangenen Wochenende sein Spind aus- und einräumen, bevor Brettschneider die Ausgangskarte herausgab. Nun wird an den Tischen geölt und poliert und gepinselt, dass keine Zeit mehr für ein Witzchen bleibt. Am Sonnabend ist wieder Ausgangstag, und nur jeder Dritte wird eine der begehrten Karten erhalten.
Unteroffizier Brettschneider geht an den Tischen entlang, prüft hier und dort den Zustand und die Vollständigkeit der Waffenteile, findet nur wenig auszusetzen und denkt daran, endlich die Zigarette zu rauchen, die er sich schon länger als eine Stunde verkniffen hat. Da fällt sein Blick auf Michael Koschenz und dessen zwei zerlegte MPis, und er schaut zur Uhr. Wegen des Besuchs hat er Andreas Jungmann für dreißig Minuten vom Dienst freigestellt. Die Zeit ist abgelaufen. Es wäre das erste Mal, dass Jungmann, der sogar schon für vorbildliche militärische Pflichterfüllung vom Zugführer belobigt worden ist, unangenehm auffällt. Das schaffen nicht viele in den ersten zwei Monaten ihrer Dienstzeit. Insgeheim beschließt Brettschneider, den Weg zum Besucherzimmer und zurück nicht mit in die halbe Stunde einzubeziehen, und gesteht weitere zehn Minuten zu. Er hofft, dass ihn Jungmann nicht enttäuscht. Jetzt braucht er eine Zigarette. Tadeln und Bestrafen macht ihm keinen Spaß, es hängt ihm vielmehr oft tagelang an und verdirbt ihm den Appetit nicht allein beim Essen, sondern bis nach Hause ins Schlafzimmer. Wenn es einen wie Jungmann treffen muss, ist es besonders schlimm. Trotzdem ist der Unteroffizier fest entschlossen, eine Zeitüberschreitung von mehr als zehn Minuten disziplinarisch zu ahnden. Sein Grundsatz, dass es im weiten Feld der militärischen Disziplin keine «Kleinigkeiten» gibt, über die ein Vorgesetzter hinwegsehen darf, gilt auch für Jungmann, der damit gerade noch acht Minuten hat, wenn er am kommenden Wochenende mit auf der Ausgangsliste stehen will.
Unteroffizier Brettschneider sieht nicht, wie hinter ihm der Soldat Schornberger eine Grimasse schneidet. Der Gruppenführer verlässt den Raum, geht durch den Korridor zum Treppenhaus und stellt sich ans Fenster. Dort zückt er seinen Tabakbeutel. Den Versuch, sich das Rauchen abzugewöhnen, hat er aufgegeben, als er merkte, dass die dabei erlittenen Fehlschläge seinem Selbstbewusstsein schadeten. Seitdem er sich jedoch Tabak und Zigarettenpapier kauft, ist er von den dreißig Stück am Tag herunter bis auf zehn, höchstens fünfzehn. Allerdings ist diese Anzahl in jüngster Zeit wieder ein wenig gestiegen, denn seine Fertigkeit im Drehen von Glimmstängeln wächst von Woche zu Woche. Er bringt es bereits fast fabrikmäßig zuwege, wenn der Tabak nicht allzu krümelig ist.
Durch das stille Treppenhaus klingt eine heiter-besinnliche Melodie, die einen seltsam unwirklichen Kontrast zur strengen Sachlichkeit der Umgebung schafft. Die Klänge kommen aus dem Kellergeschoss, jemand spielt dort auf einer Oboe. Unteroffizier Brettschneider bläst den Rauch durch das offene Fenster und lauscht. Er hat noch nie in seinem Leben ein Konzert besucht, aber diese Musik gefällt ihm. Sie war auch der Grund dafür, dass er seine Frau Ruth am letzten Zahltag mit einer Tschaikowski-Langspielplatte überrascht hat. Konzert für Klavier und Orchester Nr. 1 in b-Moll. Den Tipp gab ihm der Oboespieler. Bis dahin standen im Schrank der Brettschneiders nur Schlager-, Komiker- und Märchenplatten. - Nächsten Monat kaufe ich Haydn, nimmt sich der Gruppenführer vor. Er bewegt den Kopf im Takt der Melodie.
Andreas Jungmann stürmt die Treppe hinauf. Er entdeckt den Unteroffizier spät, verharrt jäh, nimmt vorschriftsmäßig Haltung an und meldet: «Soldat Jungmann ...» Weiter kommt er nicht. Brettschneider winkt energisch ab.
«In Ordnung», zischt er. Sein Blick gebietet Stille. «Hören Sie?»
«Körner», flüstert Andreas Jungmann.
«Haydn», belehrt ihn Brettschneider. «Hat Körner mir jedenfalls gesagt. - Einwandfrei!» Seine Begeisterung ist echt. Sie lauschen beide, doch Andreas' Gedanken gehen andere Wege. Ich müsste gleich morgen früh mit Leutnant Winter sprechen, überlegt er. Wenn ich einen Tag Urlaub bekäme, das würde reichen. Von morgen nach Dienst bis übermorgen. Vierundzwanzig Stunden. Dann könnte ich in aller Ruhe mit Doris reden. Telefonieren hat keinen Zweck. In einer Telefonleitung klingt alles fremd und kalt. Nein, ich will ihr Gesicht vor mir sehen, möchte ihren Blick bei jedem Wort spüren. Solange ich bei ihr bin, geht sie in kein Krankenhaus. Und wenn ich wieder in den Zug steige, muss ich ganz sicher sein, dass sie vernünftig ist. Ich brauche nur einen Tag und eine Nacht, das genügt völlig. Zuerst werde ich Lappen-Kalle fragen, wie er meine Chancen für einen Kurzurlaub sieht. Mit Lappen-Kalle ist Karl-Heinz Brettschneider gemeint.
Oben im Treppenhaus wird es laut. Pendeltüren krachen. Schritte schlurfen, Stimmen johlen durcheinander.
«Blödkopp, Mann, pass doch auf!»
«Nur aus der zweiten Reihe!»
«Viel zu wenig Training, sag' ich ...»
«Wat denn, Europameester genücht uns doch, oda?»
Gelächter.
Gepolter.
Brettschneider wird steif. Andreas Jungmann kommt nicht dazu, seine Frage zu stellen. Kurz angebunden schickt ihn der Unteroffizier zum Waffenreinigen, versteckt die glimmende Zigarette hinter dem Rücken und blickt der Meute entgegen, die in Trainingsanzügen treppab stürmt. Zwei Genossen tragen Lederbälle unter dem Arm: Soldaten aus dem dritten Zug, die zum Handballtraining wollen.
Der Unteroffizier stellt sich ihnen in den Weg. Die ersten Sportler sind nur noch drei Treppenstufen von ihm entfernt, als er die Bauchmuskeln spannt. Er holt tief Luft und brüllt: «Geht das nicht noch lauter? Wo sind wir denn?»
Die Horde stockt, blickt verdutzt. Plötzlich ist es wieder ganz still im Treppenhaus des Kasernenblocks. Die Oboe tiriliert hell und fröhlich wie zu einer Dorfkirmes. Streng mustert Brettschneider die verblüfften Gesichter. Gewichtig winkt er mit dem Daumen in Richtung Kellergeschoss.
«Hört ihr das?», fragt er leise, beinah feierlich. Dann erklärt er mit ernster Miene: «Kunst, Genossen ... Klar?» Noch ein, zwei Sekunden zwingt er die Handballspieler zum Zuhören, ehe er die Treppe freigibt. Auf weichen Turnschuhsohlen setzen die Sportler ihren Weg fort. Brettschneider tritt zum Fenster. Er zieht an seiner Zigarette. Draußen vorm Haus wird die Gruppe wieder laut
«Kunst, Genossen ... Klar?», kräht einer, trifft dabei täuschend echt den Tonfall des Unteroffiziers und erntet Heiterkeit.
Brettschneider schüttelt den Kopf und - grinst.
Im Unterrichtsraum winkt Koschenz ab, als Andreas Jungmann ihm danken will. Die MPi-Teile sind gereinigt und fertig zum Zusammenbauen. Bruno Preller hat noch mit seinen zwei Waffen zu tun. Jochen Nickel wirft ihm einen mitleidigen Blick zu. «Dafür, dass ein Kumpel ein bisschen an seiner Süßen fummeln kann, das verstehe ich ja noch. Da muss man schon mal Mensch sein und so», sinniert er laut. «Aber ganz ehrlich: Nur dafür, dass jemand inzwischen auf 'ner Flöte rumzwitschern darf ... Nee!»
«Ich sehe das anders», meint Bruno Preller, ohne seine Arbeit zu unterbrechen.
Jochen Nickel versteht ihn falsch. «Ach so, wenn du natürlich den Fetten dabei machst. Was lässt Körner denn springen? Was zum Schlucken?»
«Quatsch doch nicht», sagt Bruno Preller. «Du hältst doch weiß Gott auch nicht für jeden Gefallen die Hand auf. Außerdem ...»
Jochen Nickel lässt ihn nicht ausreden. Er hebt Gehäuse und Kolben über den Kopf und posaunt: «Wer macht meine MPi mit? Ich hab' 'ne Mundharmonika zu Hause, da bin ich ein Viech drauf!»
Die spärlich aufflackernde Heiterkeit erstickt gleich wieder, denn Brettschneider erscheint erneut. Einige Genossen haben die Arbeit an ihrer Waffe beendet. Der Unteroffizier kontrolliert gründlich. Gespräche werden jetzt nur noch im Flüsterton geführt. Schornberger mustert Jungmann, der seine MPi zusammensetzt, neugierig von der Seite.
«Ärger gehabt?»
Andreas zuckt mit den Schultern, will jetzt nicht reden. Auch Koschenz hat die Frage gehört und merkt, dass mit dem Stubenältesten etwas nicht stimmt.
«Heiraten, bevor du die Fahne hinter dir hast, ist eben Blödsinn», murmelt der Hüne. «Lieber ledig mit Zwillingen, sagt meine Schwester.»
«Der ganze Zirkus hier ist Blödsinn», flüstert Egon Schornberger und schielt zu Brettschneider hinüber. Jochen Nickel folgt dem Blick. «Das kannst du ruhig laut sagen!», trompetet er und lässt den Unteroffizier nicht aus den Augen.
Der Gruppenführer kommt näher. «Worum geht's hier?», fragt er und mustert die Waffen.
Hinter seinem Rücken schüttelt Michael Koschenz den Kopf und sieht seine Stubengenossen vorwurfsvoll an. Er ahnt, was passiert, und will es abwenden. «Es dreht sich um Durst, Genosse Unteroffizier», antwortet er eilig. «Eine trockene Luft ist das hier ...»
Brettschneider nimmt die MPi, prüft, ob sie sauber ist, und nickt zufrieden. Er sieht nicht, wie Schornberger dem Hünen zublinzelt.
«Ich habe eine Frage, Genosse Unteroffizier», wendet sich der Abiturient an den Gruppenführer und schlüpft für Augenblicke überzeugend in die Rolle eines lernbeflissenen und fügsamen Schülers. Karl-Heinz Brettschneider spürt sofort ein Jucken unter der Kinnspitze. Es signalisiert kritische Situationen und versetzt sein körperliches und geistiges Abwehrsystem in Alarmbereitschaft.
«Und?», fragt er gespannt. Es wäre nicht das erste Mal, dass Schornberger mit unschuldiger Miene versucht, seinen Gruppenführer aufs Kreuz zu legen. Brettschneider denkt an die ihm unverständlichen Lateinsprüche, mit denen der Abiturient im Unterricht bei jeder Gelegenheit bemüht ist, seinen überlegenen Bildungsgrad auszuspielen. Der Unteroffizier hat Erfahrungen mit jungen Springern, er ist geübt darin, himmelwärts gereckte Nasen zurechtzubiegen, doch er ahnt, dass es ihm diesmal mehr Mühe und Kopfzerbrechen bereiten wird als sonst.
«Es handelt sich um die Schließfeder», erklärt Schornberger scheinheilig. «Da macht man sich doch Gedanken. Zum Beispiel über die Federkraft.»
Was hast du dir nun wieder ausgedacht, überlegt Brettschneider blitzschnell. Das Gefecht ist schon halb gewonnen, wenn ich den feindlichen Angriff gar nicht erst zur Entfaltung kommen lasse. Und dann Gegenstoß.
«Geben Sie mal her», sagt er und zeigt auf Schornbergers bereits zusammengesetzte Waffe. «Den Lauf!» Das bedeutet erneutes Auseinandernehmen, und Brettschneider ist fest entschlossen, irgendetwas zu entdecken. Unter allen Umständen. Den Typ Schornberger darf ein Gruppenführer gar nicht erst aus der Deckung kommen lassen.
Seelenruhig nimmt Schornberger den Reinigungsstock ab, drückt die Deckelsperre nach innen, löst den Gehäusedeckel. Kein Zögern, kein Suchen. Jeder Handgriff sitzt. «Sie kennen doch bestimmt die Formel, mit der das berechnet wird», bohrt er weiter. Jetzt lässt er sich den Spaß nicht mehr verderben. Schwitzen soll er, der Genosse Unteroffizier. «Das möchte ich auch gerne wissen!»
«Was?», fragt Brettschneider.
Keiner aus der Gruppe hantiert noch mit Docht oder Bürste. Alle schauen zu Schornberger und dem Unteroffizier.
«Federkraft!», erklärt der Abiturient und blickt seinen Gruppenführer treuherzig an. «Ein Unteroffizier kennt sich da haargenau aus, hab' ich den Genossen vorhin gesagt. Sachen, die zu seinem Beruf gehören, da macht dem so schnell keiner was vor, hab' ich gesagt. - Oder kennen Sie die Formel vielleicht gar nicht?»
Er übergibt den Lauf. Brettschneider hebt ihn gegen das Licht, schaut hindurch und dreht ihn dabei um die Längsachse. Er kann das Atmen der Männer hören.
«Hier ist kein Quiz, Genosse Soldat, hier ist Waffenreinigen!»
Der Unteroffizier gibt den Lauf zurück. «Und das ist ein MPi-Lauf, keine Ölleitung. Noch mal mit dem Docht durchziehen!»
«Durchziehen!», wiederholt Schornberger. Er hat sich verrechnet. Keiner lacht, und der Unteroffizier bleibt gelassen, als wäre er nur mal eben nach der Uhrzeit gefragt worden. Er prüft am anderen Tisch noch zwei MPis und gibt dann bekannt, dass die Waffenabgabe in fünfzehn Minuten erfolgt. Anschließend verlässt er den Raum.
«Mathe schwach, aber Stabü und Sport sehr gut», murmelt Schornberger bissig. «Und Taktik. Bauernschlau!»
Andreas Jungmann hebt den Kopf. Er hat der kurzen Auseinandersetzung keine besondere Aufmerksamkeit geschenkt. Seine Gedanken sind schon bei dem Gespräch, das er morgen mit Doris führen will. Er sucht und verwirft neue Argumente, bis ihn Schornbergers abfällige Bemerkung wieder in die Gegenwart holt. Bisher hat er seinen Ärger über die arroganten Frechheiten des Abiturienten stets hinuntergeschluckt, weil er die kameradschaftliche Atmosphäre des Stubenkollektivs nicht belasten wollte, zumal der Unteroffizier durchaus auch ohne Beistand mit derartigen Herausforderungen fertig wird. Nun jedoch ist das Maß urplötzlich voll. Es gibt keinen besonderen Anlass, und er hat auch keine Erklärung dafür, aber er kann mit einem Mal nicht länger schweigen, wenn ein Mann, der seinen Beruf mit viel Können, Erfahrung und Besonnenheit ausübt, ausgerechnet von einem Typ wie Schornberger lächerlich gemacht werden soll. Andreas Jungmann mag weder Duckmäuser noch Streber, und er will, dass es gerecht zugeht.
«Klugscheißer!», sagt er bloß und schaut Schornberger ins Gesicht.
Das Wort ist wie ein Funke in trockenes Pulver. Der Abiturient lässt seine MPi liegen, kommt mit zwei schnellen Schritten auf Jungmann zu und packt ihn am Kragen. «Los, sag das noch mal!»
Auch die anderen legen ihre Waffen auf den Tisch. Andreas versucht, Schornberger mit der Linken auf Distanz zu halten, doch der Abiturient schüttelt die Hand ab und holt zum Schlag aus. Aber der Hüne Koschenz ist schneller, er reißt die beiden auseinander. Es geht ihm keineswegs darum, eine Prügelei zu verhindern; er will nur nicht zulassen, dass sein Stubenältester angegriffen wird, und die Blicke ringsum bestätigen ihm, dass er damit ganz im Sinne der anderen handelt.
«Nu-nu-nu-nu!», besänftigt Koschenz die Streitenden. «Immer hübsch Friedenskämpfer bleiben!»
Unten im Kellergang des Blockes hockt Heinz Körner, dessen MPi von Preller gereinigt wird, auf einem umgekippten Wassereimer und spielt auf seiner Oboe zum wiederholten Male die gemütvoll-heitere Ländlerweise, mit der er bei den Soldatenfestspielen auftreten soll. Die Melodie hat die grauen Wände zerschmolzen. Er atmet nicht die von öl- und Kalk- und Ledergeruch geschwängerte Luft. Er spürt den heimatlichen Wald, riecht den Duft von Harz und Moos. Alles ist genau wie zu Hause hinter der verwitterten, überflüssig gewordenen Scheune, wo er seinem Instrument vor Jahren die ersten Töne entlockt hat. Zwei-, dreimal in der Woche, den ganzen Sommer hindurch, hockte er dort auf dem Brennholzstapel und spielte und träumte. Die Hochzeit hat nichts daran geändert und auch nicht die Geburt seines Sohnes Sebastian. Mit der Oboe hat der Melker Heinz Körner seine Frau, den Jungen, das Dorf, die Wiesen, den Wald und sechshundertzwölf Kühe der Genossenschaft mit in die Kaserne gebracht. Das Trillern einer Signalpfeife zerstört seine Vision und baut die tristen Kellerwände jäh wieder auf. Heinz Körner setzt das Instrument ab, verharrt ein paar Sekunden reglos mit hängenden Schultern, als lausche er der verklungenen Melodie nach, dann holt er tief Luft und steht auf.
Vor der Waffenkammer der 2. Kompanie hat sich eine Schlange gebildet. Der Feldwebel, der die MPis abnimmt, prüft jede Waffe genau. Brettschneider steht neben ihm, die Daumen hinter dem Rücken unter das Koppel gehakt. Für ihn käme jetzt jeder Mangel, den der Feldwebel feststellt, einer persönlichen Missbilligung gleich. Er hat das Waffenreinigen beaufsichtigt, hat die MPis kontrolliert, Hinweise gegeben, wieder kontrolliert und die Waffen endlich für ordnungsgemäß befunden. Die Soldaten haben seine Anordnungen befolgt und kennen sein Urteil. Sie verlassen sich darauf. Wenn der Feldwebel nun etwas zu bemängeln hat, versetzt er gleichzeitig der Autorität des Unteroffiziers einen empfindlichen Hieb. Karl-Heinz Brettschneider weiß ziemlich genau, was dann in den Köpfen einiger Genossen seiner Gruppe vorgehen würde. Er hat die Wehrunterlagen seiner Unterstellten studiert, hat die Männer während der Ausbildung und bei der Erfüllung von Gefechtsaufgaben ebenso aufmerksam beobachtet wie in ihrer Freizeit und zudem immer wieder das persönliche Gespräch gesucht. Deshalb macht er sich nichts vor: In seiner Gruppe gibt es mindestens einen Soldaten, nach dessen Meinung jeder Mensch Fehler machen darf, vorausgesetzt, er ist kein Unteroffizier.
«Einwandfrei!», urteilt der Feldwebel und nimmt sich die nächste MPi vor.
Die Schlange kriecht einen halben Meter weiter.
Andreas steht hinter Michael Koschenz. Sie unterhalten sich leise. «Da musst du dich mal richtig reindenken, Andy», redet der Hüne auf seinen Hintermann ein. «Ich kenne das von meiner Schwester. Die Freundinnen gehn an jedem Wochenende zum Schwof, ziehn alle Nasen lang irgendwo 'ne Fete ab, und deine Kleine sitzt mutterseelenallein zu Hause. Achtzehn Monate! Fünfhundertachtundvierzig Tage! Total trocken, sage ich dir. Das schafft nur eine über dreißig, oder wenn se Mundfäule hat.»
«Alle sind nicht gleich», wirft Andreas ein, doch die Argumente des anderen bleiben nicht ohne Wirkung. Sie verletzen nicht, aber sie stimmen nachdenklich. Ein Glück, dass Doris den sprechenden Schrank nicht hören kann, denkt er.
Koschenz ist noch nicht fertig mit seinen Weisheiten. «Weißt du, was meine Schwester immer sagt? Drei Dinge braucht der Mann, wenn er für 'ne Frau echt infrage kommen soll. Auf Dauer, meine ich: einen sauberen Beruf, einen Entlassungsschein von der Fahne und eben drittens!»
Hinten im Korridor kracht die Pendeltür. Heinz Körner eilt heran. Seine Oboe trägt er in einem schwarzen Etui. Er stellt es in die Fensterecke und lässt sich seine von Preller gereinigte MPi geben. Preller steht vor Koschenz. Er räumt Körner einen Platz in der Schlange ein.
«Weshalb soll meine Frau nicht ausgehen?», fragt Andreas den Hünen. «Hauptsache ist doch, man kann sich aufeinander verlassen - oder?»
Michael Koschenz grient mitleidig. «Sag bloß noch, es sticht dich nicht, wenn irgendein Macker deiner Kleinen die Taille misst ...»
Andreas merkt, wie ihm heiß wird, aber er winkt überlegen ab.
Koschenz fährt fort: «... und sie vor der Haustür abknutscht, ihr in die Hinterbacken kneift.»
«Hör doch auf!», unterbricht ihn Andreas ungehalten. Gegen seinen Willen beginnt er, sich alles bildhaft vorzustellen, «Ein Mädchen muss wissen, wie weit es gehen darf. Für meine Frau lege ich beide Hände ins Feuer!»
«Du, da gibt es komische Tage bei den Puppen», meint Koschenz zweifelnd und wiegt den Kopf. «Ich kenne das von meiner Schwester.»
«Das ist ein Unterschied!»
«Was?»
«Puppen und Mädchen!»
Vorn an der Waffenkammer ist jetzt Heinz Körner an der Reihe. Der Feldwebel empfängt ihn schmunzelnd. Die ganze Kompanie weiß, dass der Melker von der Saale die Einheit bei den Soldatenfestspielen als Solist vertreten soll.
«Unser Musikus! Duett für Oboe und Kalaschnikow, das wäre doch mal 'ne neue Variante!»