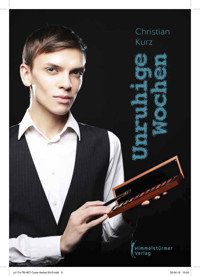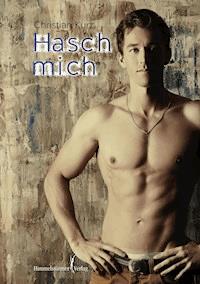
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Himmelstürmer
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der Redaktionsassistent Oliver hält sich für ein verkanntes literarisches Genie und steckt seine ganze Aufmerksamkeit in das Schreiben seines Romans, so dass er für nichts anderes Zeit findet, auch und erst recht nicht für die Liebe. Zwar empfindet er sich als schwul, denn das sind schließlich alle Genies, aber Gelegenheit zum Ausprobieren hatte er noch nicht. Eines Tages bekommt er von der Redaktionschefin den Auftrag, über eine Theatervorstellung zu schreiben. Dort passiert das Unglaubliche: Oliver verliebt sich in die schöne Andrea. Kann das sein? Ist Oliver etwa gar nicht schwul? Seine Gefühle geraten völlig durcheinander, als er der jungen Schauspielerin begegnet und sich ihr als wichtiger Kritiker vorstellt. Oliver ist so von der Schönheit geblendet, dass er überhaupt nicht realisiert, dass Andrea eigentlich Andreas ist und die junge Frau auf der Bühne nur gespielt hat. Andreas möchte Oliver zwar die Wahrheit sagen, aber da dieser sich ja als Kritiker vorgestellt hat, traut sich Andreas nicht, das Geheimnis zu lüften und ihm zu gestehen, dass er sich in ihn verguckt hat, denn Andreas ist ebenfalls schwul. Als Oliver die vermeintliche Andrea dann auch noch seiner Mutter vorstellen will, weil diese ihm nur Geld gibt, wenn er ihr eine Braut vorstellen kann, steht bald alles Kopf.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 344
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Christian Kurz
Hasch mich
Von Christian Kurz im Himmelstürmer Verlag bisher erschienen:
„Regenbogenträumer“ ISBN 978-3-86361-491-1
„Allein unter seinesgleichen“ ISBN 978-3-86361-564-2
Alle Bücher auch als Print
Himmelstürmer Verlag, part of Production House, Hamburg
www.himmelstuermer.de
E-Mail: [email protected]
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Verlages
Zuwiderhandeln wird strafrechtlich verfolgt
Rechtschreibung nach Duden, 24. Auflage
Coverfoto: de.123rf.com
Umschlaggestaltung: Olaf Welling, Grafik-Designer AGD, Hamburg. www.olafwelling.de
E-Book-Konvertierung: Satzweiss.com Print Web Software GmbH
ISBN print 978-3-86361-567-3
ISBN e-pub 978-3-86361-568-0
ISBN pdf 978-3-86361-569-7
Alle hier beschriebenen Personen und alle Begebenheiten sind frei erfunden. Jede Ähnlichkeit mit lebenden Personen ist nicht beabsichtigt.
Für meine Mutter – sie weiß warum.
Dank an meine Schwester fürs Korrekturlesen.
1.
Mehr als gelangweilt sah Oliver Fischer auf seinen Monitor und schließlich wieder auf den Schmierzettel, den er in den Computer übertragen musste. Es war doch immer wieder das gleiche – obwohl die Leute ausdrücklich dazu aufgefordert wurden, ihre Annoncen in Druckbuchstaben einzureichen, mussten manche, zumeist ältere Leute ihre in schmierigster Sudelschrift abgeben, was die Entzifferung, ja eigentlich Dechiffrierung dieser Hieroglyphen zu einer Herkulesaufgabe werden ließ. Er blies etwas gepresste Luft aus seinem Mundwinkel – es hatte ja doch keinen Sinn, sich darüber aufzuregen. Den Leuten war seine Verärgerung darüber sowieso egal, also musste er nun eben seine Zeit wieder damit aufbringen, in geradezu detektivischer Kleinarbeit sämtliche Buchstaben auf dem Formular miteinander zu vergleichen, um einwandfrei festzustellen, ob es sich beim fraglichen Buchstaben um ein verkümmertes „a“ oder ein dickbäuchiges „e“ handelte. Missmutig blickte er sodann um sich – er wollte sowieso nicht hier sein, aber es ging ja nicht anders, und ein kleiner, leidlich gut bezahlter Job als Redaktionsassistent bei der kleinen Lokalzeitung war immer noch besser als gar keine Arbeit, aber es war eben nicht das, was er wirklich wollte und was man ihn nicht machen ließ.
Alles, was er wollte, war ein anerkannter Schriftsteller zu werden. Nicht einfach nur ein „Autor“, denn das konnte ja jeder werden – selbst ein Affe, der eine Folge für eine dieser mies geschriebenen und noch schlechter umgesetzten Daily-Soap-Episoden fürs Fernsehen schrieb, konnte von sich behaupten, dass er ein AUTOR sei, aber ein Schriftsteller, das war was vollkommen anderes. Ein Schriftsteller, das war jemand wie Kafka oder Goethe, aber ein Autor, das war einfach nur jemand, der vorher beim Verlag nachhakte, ob diese oder jene Idee gekauft werden würde und sich noch darüber erkundigte, wie viele Zeichen gewünscht seien und dann auch wirklich nur so viele ablieferte, gleichgültig ob die Idee danach verlangte oder nicht. Ein Autor war für Oliver quasi eine Worthure – immer willig, sich für jeden hinzulegen und die Beine zu öffnen, solange derjenige nur gut genug zahlte ... aber was war er denn selber, wenn er sich und seine Situation nüchtern betrachtete? Eigentlich ein ziemlicher ... nun ja, gewiss nicht Versager, das nun wirklich nicht – immerhin hatte er eine Arbeit und musste nicht von der Stütze leben. Also konnte er kein Versager sein, auch wenn ihn manche Ignoranten wohl dennoch so einstufen würden, da er nach wie vor noch nie Sex gehabt hatte, einfach weil sich das nie einstellen wollte, aber deswegen sah er sich selber nicht als Versager an. Sex war ja sowieso nicht so wichtig im Leben. Wie schon Charles Bukowski feststellte, war Sex nicht so lebensnotwendig wie ein geregelter Stuhlgang, denn man konnte mühelos bis ins hohe Alter leben, ohne auch nur einmal Sex gehabt zu haben, aber man konnte nicht zwei Wochen durchhalten, ohne zwischendurch aufs Klo zu gehen. Wahre Worte und ein kleiner Trost, den sich Oliver immer mal wieder ins Gedächtnis rief, wenn er abends im Bett lag und sich mit einem Taschentuch den Bauch sauberwischte.
Er überprüfte die abgetippte Annonce routinemäßig noch einmal und stellte sich vor, dass er in einem anderen Land bestimmt schon längst nicht nur veröffentlicht wäre, sondern dass man ihn zum Nationaldichter erhoben hätte. Darin bestand für ihn, in aller Bescheidenheit, absolut keine Frage. Natürlich ... so gut wie Kafka war er nicht, das wusste er selber, denn dieser war für ihn das Non-plus-ultra eines sich selber für die Kunst rücksichtslos aufopfernden Schriftstellers. Einer, der sich in eine feuchte Altbauwohnung begab, um dort in Ruhe schreiben zu können und sich deswegen Tuberkulose einfing, die seinen von der Kunst verzehrten Körper noch mehr schwächte – aber was für Werke entstanden durch diese rigorose Selbstlosigkeit! Ja, was für reine, unantastbare Sätze waren Kafka da aus den Fingern geflossen! So musste ein echter, ein wahrer Schriftsteller vorgehen, aber Oliver konnte sich dann doch nicht vorstellen, in einer Ruine zu schreiben, denn da hätte die Atmosphäre seine Kreativität ganz sicher gestört, und überhaupt gab es heutzutage TBC nur noch in ärmeren Ländern, und wegen dieser Krankheit konnte er doch nicht extra dahin fahren, und überhaupt wäre es doch dumm, Erfolg zu haben, aber zu krank zu sein, um diesen sodann in vollen Zügen genießen zu können. Das war ein kleiner Vorgehensfehler, den er Kafka in aller Bescheidenheit professionell ankreiden musste. Die Erkrankung war doch nun wirklich ein vollkommen überflüssiger Showeffekt gewesen, um seinen besonderen Status als Schriftsteller zu untermauern. Das musste Kafka – und da war sich Oliver als seelenverwandter Schriftsteller sicher – am Schluss auf dem Sterbebett auch eingesehen haben, ohne jeden Zweifel.
Aber Kafka wurde immer noch gelesen – und wer las Oliver Fischer? Niemand, denn es interessierte niemanden, wer die Kleinanzeigen in die Zeitung gebracht hatte. Und auch seine Chefin reagierte auf seine Vorschläge, dass er eine kleine Beitragsserie schrieb und damit den kulturellen Aspekt der Zeitung beträchtlich anhob, mit permanenter Abweisung, aber ein echtes, literarisches Verlangen nach seinen Worten konnte er sich bei ihr sowieso nicht vorstellen. Andernfalls hätte sie bei ihm doch garantiert bereits nachgefragt, ob er sich nicht denken könnte, zumindest eine Art Pseudo-Billigen-Fortsetzungsroman für das Blättchen zu verfassen, um den Lesern auf diese Art seine Vorstellung von höherer Kultur näher zu bringen. Natürlich hätte ein solches Angebot ihm geschmeichelt, wenngleich auch ein wenig gekränkt, denn so nett es wäre, von jemand anderem zu hören, dass seine Worte für einen höheren Vertrieb der hauptsächlich durch Werbung finanzierten Zeitung sorgen würde, so sehr wäre es doch fraglos eine Schande für den Literaturbetrieb, wenn er eines seiner Meisterwerke derart verramschte. Nein, das ging nun wirklich nicht. Gar nicht. Ein echter Schriftsteller tat so was einfach nicht ... nun gut, Dickens schrieb in Fortsetzungen, aber das war ja was völlig anderes, nicht nur weil es eine andere Zeit gewesen war, sondern auch und gerade hauptsächlich wegen dem nicht zu debattierenden Grund, dass Charles Dickens eben nicht Oliver Fischer war, und daran konnte niemand etwas ändern, so was gehörte eben zu den Mysterien des Lebens, vor denen man nur fragend stehen konnte, bis man eben achselzuckend weiterging.
Seine Chefin kam mit einer Tasse Kaffee zu ihm. „Soweit alles klar?“ sagte Frau Westeried und nippte an ihrer Kaffeetasse, während sie über den Rand auf seinen Monitor spähte, so als vermutete sie, dass er sich heimlich auf irgendeiner Porno-Internetseite herumtrieb.
„Ja.“
„Gut“, meinte sie und ging zu den anderen beiden Mitarbeitern der Zeitung.
Oliver hatte keinen wahren Kontakt zu ihnen, denn was waren sie schon mehr als kleine Mitarbeiter ohne wahren Antrieb? Die Müller-Klein war eine unwahrscheinlich dicke, quietschbunt angezogene Abart der Gattung Mensch, deren sogenannten Späßchen sich allesamt darin erschöpften, jeden Tag das gleiche launige, selbstgefällige Material von sich zu geben, was eher für Stress als Spaß sorgte. Herr Spix hingegen war als Schweizer wohl von Natur aus träge, und sein fortgeschrittenes Alter sorgte dafür, dass er täglich noch mehr verlangsamte – eine auf einer Schildkröte reitende Schnecke wäre schneller als der Alte, aber Oliver konnte nicht wirklich etwas gegen ihn haben, da Herr Spix einfach zu wenig tat, um genügend Angriffsfläche zu erzeugen, weswegen sich seine Abneigung auf die beiden Frauen konzentrierte. Nicht, dass er etwas gegen Frauen hätte – denn er hatte ja noch nie mit einer etwas –, aber Frau Müller-Kleins ständig-gleiches Gequacke tötete langsam jeden Nerv ab wie eben der Tropfen Wasser, der durch bloße Hartnäckigkeit den Stein höhlt, und Frau Westerieds zum Himmel schreiende Unfähigkeit, sein Talent zu erkennen und zu fördern, machten ihm seine verfahrene Situation jeden Tag aufs Neue bewusst und ließ ihn mehr und mehr verzweifeln. Er wollte einfach nur raus. Weg. Die Welt sollte ihn endlich anerkennen als große Entdeckung der Literaturwelt, denn das, und nur das, war seine Bestimmung und sein einziger Lebenszweck.
„Hallo?“, sagte Frau Westeried mit einem Unterton, der andeutete, dass sie sich wiederholen musste, um auf sich aufmerksam zu machen.
Er hatte sie nicht wahrgenommen, weil er sich in seinen Gedanken ein wenig verlief. „Mmh?“, kam es schließlich aus ihm heraus.
„Tagträume?“, hakte sie nach, woraufhin Frau Müller-Klein ihr Pfannkuchengesicht zu einem selbstgefälligen Grinsen verzog.
„Nein, nein ...“, lächelte er geschwind.
„Feierabend ist noch lange nicht. Ich hätte einen Job für Sie“, sagte sie und nippte erneut an der Tasse. „Wir müssen über eine Theatervorstellung berichten, aber wir haben keinen, der hingeht. Der, den wir hatten, hat gerade angerufen – liegt mit Grippe im Bett. Alle anderen sind bereits anderweitig beschäftigt. Frau Müller-Klein hat Familie, und Herr Spix“, der Erwähnte sah kurz von seinem Monitor auf, „kann auch nicht.“ Der Schweizer blickte wieder lethargisch auf den Bildschirm. „Darum müssen Sie gehen – oder haben Sie heute Abend was vor?“
Oliver schüttelte den Kopf. „Nein ... das geht schon ...“
„Gut“, sagte sie mit einer Selbstverständlichkeit, die ihm seltsam vorkam, so als habe sie gewusst, dass er nichts anderes vorhaben konnte.
„Ich meine, das kommt natürlich etwas kurzfristig, aber für die Zeitung ...“, meinte er schnell, um zu signalisieren, dass er eigentlich schon über ein unwahrscheinlich bewegtes und abwechslungsreiches Privatleben verfügte und er nur deswegen gnädig ein wenig von seiner Zeit opferte, um den Fortbestand der Zeitung zu gewährleisten, denn ohne die tatkräftige Mithilfe selbstaufopfernder Mitarbeiter wie ihm würde das zwangsläufig zum Sterben verdammte Medium der Zeitung bereits in die ewigen Jagdgründe eingegangen sein.
„Ich gebe Ihnen die Eintrittskarte. Machen Sie ein paar Bilder, Notizen. Ich weiß noch nicht, wie viel Zeichen ich freihalten kann.“ Sie nippte an ihrer Tasse. „In Ordnung?“
„Natürlich.“
„Gut.“ Sie ging aus dem Raum und kam mit der Eintrittskarte wieder. „Fängt in drei Stunden an. Wissen Sie, wo das ist?“
Er sah auf die Karte und las: „Theatergruppe Gänseblume präsentiert: Der stolze Leuchtturmwächter – ein Theaterstück von Bernd Kasius ...“ Er überflog den Rest. „Die Straße kenne ich ... aber das Stück nicht ...“
„Macht doch nichts. Öfters mal was Neues“, grinste Frau Müller-Klein. „Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht, und was die Bäuerin nicht will, das streichelt sie nicht“, gab sie einen ihrer Standardsprüche zum Besten, die sie nach wie vor für unglaublich lustig hielt, weswegen sie vergnügt kicherte.
„Einfach hin, Bilder machen und später ein kleiner Beitrag. In Ordnung?“ Sie wartete überhaupt nicht auf eine Bestätigung, sondern verließ Kaffeetrinkend den Raum.
Oliver las die Karte erneut durch und steckte sie sodann ein. Eine Theateraufführung ... er war noch nie in einem Theater gewesen, und das aus dem einfachen Grund, weil er all seine Freizeit in sein Schreiben investierte, weswegen er eigentlich nie wirklich über Freizeit verfügte, denn was man der Kunst gab, konnte man ja schlecht als „Freizeit“ deklarieren. Plötzlich schoss ihm ein wahrer Geistesblitz durch den Kopf: Theaterleute waren von jeher feingeistiger als der Rest der Bevölkerung. Diese Vertreter der hohen Kunst würden sein Meisterwerk fraglos sofort als das hochwertige Monument der Literatur erkennen, das es auch war. Ein Lächeln erschien auf seinem Gesicht, woraufhin er es sofort unterdrückte – seine „Kollegen“ brauchten nicht zu sehen, dass er einen Ausweg aus diesem Elend gefunden hatte!
Er würde vorschriftsmäßig zur Theateraufführung gehen und Bilder machen, aber sich anschließend zu den Künstlern begeben und ihnen mitteilen, dass auch er ein Künstler sei, und dann würden sie gemeinsam zu der Erkenntnis gelangen, dass es eine naturgewollte Notwendigkeit sein musste, dass er für sie ein Theaterstück schrieb, das ihrer von der Muse geküssten Truppe und ihn von der Muse hemmungslos in Besitz genommen Künstler ein für alle Mal bekannt und berühmt machen würde! Ja, so würde es, so müsste es, so sollte es sein! Darin bestand für ihn kein Zweifel – zwar galt seine wahre Bestimmung dem Roman, aber ein Theaterstück konnte er auch schreiben, ja sogar besser und wahrhaftiger als alle anderen. Was war denn schon „Warten auf Godot“ - ein Nichts von einem Amateurwerk gegen das, was er hervorzubringen imstande war!
Er atmete tief durch: Theatergruppe Gänseblume, mach dich bereit – hier kommt dein Künstler!
„Jetzt sieh dir den Fleck an! Du bist eine alte Sau!“, meckerte Detlef in die Richtung von Dennis, der nur mit den Achseln zuckte.
„Meine Güte, stell dich nicht so an – den Fleck sieht doch keiner.“ Er leckte sich den Daumen und kratzte ein wenig am Make-up herum, das auf seinem Kostüm einen weißen Fleck verursachte.
Andreas blickte quer durch den kleinen Umkleideraum zu ihnen rüber und wendete sich wieder dem zusammengehefteten Manuskript zu, um seine Rolle nochmals zu überprüfen, auch wenn er eigentlich jedes Wort gewissenhaft gelernt hatte. Das Stück, welches Bernd, der Leiter der kleinen Gruppe, geschrieben hatte, war gut, aber nichts weltbewegendes, sollte aber dennoch die Zuschauer angemessen unterhalten können. Außerdem war es für ihn fast schon eine schauspielerische Herausforderung, da er aufgrund der Tatsache, dass die kleine Theatergruppe nur aus Männern bestand, eine Doppelrolle spielen musste, weswegen er sich diese Textstellen noch einmal genauestens durchlas.
Bernd kam hinein. „Alles soweit in Ordnung?“
„Der hat sich vollgemalt.“
„Petze“, meinte Dennis und wischte mit seiner rechten Hand oberflächlich auf dem Kostüm herum. „Das sieht doch sowieso keiner.“
„Mmh ...“ Bernd besah es sich näher. „Naja, vielleicht vorher, aber jetzt verschmierst du es ja überall hin.“
„Siehst du“, grinste Detlef.
„Mäulchen.“ Dennis streckte die Zunge raus.
„Andi, komm mal“, wies Bernd ihn an.
Er legte das Manuskript beiseite. „Ja?“
„Hol mal ein nasses Tuch.“
Er nickte und ging aus dem Raum zur Toilette, fand dort allerdings nur etwas Klopapier, das er sodann im Waschbecken leicht befeuchtete und zurückbrachte. „Ein Tuch habe ich nicht gefunden.“
Bernd nahm das Papier an sich und wischte über den Fleck. „Ach, so geht das nicht“, sagte er, als er bemerkte, dass das Papier ausfranzte und kleine weiße Kügelchen ins Kostüm schmierte. „Das wird ja immer schlimmer.“
„Sag ich doch“, mischte sich Detlef ein und brachte gleichzeitig seine Perücke in Form.
„Mäulchen und Schnäuzchen“, meinte Dennis mit einer leicht genervten Betonung. „War ja keine Absicht.“
„Das macht den Fleck auch nicht weniger.“ Er wischte erneut auf dem Fleck herum, so als würde er denken, dass sich die kleinen Papierbällchen nun auf geradezu magische Weise verflüchtigten, was sie jedoch nicht taten, weshalb der einstmals nur latent zu erahnende Make-up-Fleck zu einem deutlich sichtbaren Toilettenpapierzeichen mutierte.
„Verdammt. Das musste ja so kommen.“
Andreas ging zum Schrank mit den anderen Kostümen, die die Gruppe besaß, und suchte nach etwas, mit dem man den Fleck verbergen konnte. Nach einigem Suchen fand er einen Orden, der groß genug ausfiel, um die Aufgabe zu übernehmen. „Hier.“ Er brachte das Teil zu Bernd.
„Und was soll ich damit?“
„Draufstecken, dann sieht man den Fleck nicht.“
Er drehte das Teil in seinen Händen. „Das ist ein eisernes Kreuz.“
„Und? Ist die Rolle eben religiös.“
„Ein eisernes Kreuz hat nichts mit Religion zu tun – eher im Gegenteil.“
Dennis nahm es an sich. „Woher hast du denn so was?“
Bernd zuckte mit den Schultern. „War bei dem Kostümverkauf, nehme ich mal an.“
Andreas setzte sich wieder hin und las seinen Rollentext. „Du bist der Autor – also kannst du die Veränderung doch auch vornehmen, dass der eben ein eisernes Kreuz trägt.“
Bernd schüttelte den Kopf. „Das passt doch nicht zur Rolle.“
„Genau“, stimmte Dennis zu. „Das setzt doch den völlig falschen visuellen Ton für die Rolle. Da komm ich doch gleich als Unsympath rüber. Das geht nicht.“ Er ging zum Schrank, warf den Orden regelrecht hinein und holte ein kleines weißes Tuch heraus, das er sich über den Fleck hielt. „So, das geht aber. Ich nehm eine Nadel und mach das Tuch hier drüber – fällt gar nicht auf.“
„Und warum hat deine Rolle ein Tuch auf der Brust heften?“, hakte Andreas nach.
„Weil ... er eben so ist, darum.“ Er sah zu Bernd. „Passt doch, oder?“
„Naja ...“
„Tut mir ja wirklich leid, dass ich da einen Fleck draufgemacht habe, aber wir haben kein zweites Kostüm für mich, und das jetzt auszuwaschen geht nicht, also müssen wir eben improvisieren. Wird doch sowieso nicht volles Haus sein.“
„Naja, immerhin haben wir im Vorverkauf vierzehn Karten wegbekommen“, meinte Bernd achselzuckend.
„Und der Raum fasst fünfzig Leute.“ Es sollte nicht wie ein Vorwurf klingen, aber es wirkte dennoch so. „Ist doch egal – Theater ist lebendig, nicht wahr? Da gibt es eben Veränderungen.“
„Schon, aber über die erste Aufführung wird immer berichtet, also ...“
„... also haben die Leute was Neues zum gucken, wenn sie in die zweite Aufführung kommen.“ Er hielt sich das Tuch weiterhin über den Fleck. „Passt doch.“
„Meinetwegen“, winkte Bernd ab.
Detlef kicherte. „Also wenn ich mich aus Versehen am ganzen Kostüm beschmiere, dann darf ich mich auch einfach so umziehen wie ich es für richtig halte?“
„Mäulchen, Schnäuzchen, Klappe“, war alles, was Dennis dazu zu sagen hatte.
Bernd ging zu Andreas. „Und bei dir alles soweit klar?“
Er nickte. „Klar.“
Der Regisseur lächelte. Es war deutlich, dass er ihn am Arm streicheln wollte, sich jedoch nicht traute, entweder weil die Aufführung kurz bevor stand und alle darum hochkonzentriert sein mussten, oder weil er dem hübschen und jungen Schauspieler schon mal Annäherungsversuche unterbreiten wollte, sich dann allerdings nicht traute weiterzumachen, weil Andi erst 19 und er selber schon jenseits der 40 war und es dann doch irgendwie eine geistige Sperre gab, die er sich durch Professionalität erklärte, denn ein guter Theaterregisseur schläft nicht mit seiner Besetzung. Aber dennoch wollte er ihn gerade streicheln, einfach weil Andi so unverschämt süß aussah. „Gut“, war alles, was er von sich gab, bevor er sich an die beiden anderen wandte. „Das packen wir schon. Hals- und Beinbruch.“
Detlef grinste in die Richtung von Dennis: „Nimm's aber nicht wörtlich.“
„Mäulchen, Schnäuzchen, Klappe und vor allem: Fresse.“
Oliver traute seinen Augen nicht – das war kein Theater, das war eher eine Kleinbühne, ja strenggenommen eine Kleinstbühne! Er hatte zwar gewusst, dass es sich nicht um das Stadttheater handelte, aber dennoch nahm er an, dass die Bühne größer sein müsste, denn wie bitte schön konnte auf einem solchen Winzding wahrhaftig große Kunst deklariert werden? Es musste doch alles seine Form haben. Aber natürlich – große Kunst bleibt auch dann noch große Kunst, selbst wenn sie in kleine Dosen gequetscht wurde. Die „Mona Lisa“ blieb auch weiterhin ein Meisterwerk, selbst wenn man sie schamlos kommerziell verwertete und auf T-Shirts druckte. Wahre Kunst konnte eben nicht durch ein inadäquates Umfeld ruiniert oder sonst wie runtergesetzt werden.
Er setzte sich auf den Klappstuhl, auf welchem mit einem Klebestreifen befestigt ein Zettel hing, der seiner Sitznummer entsprach, und blickte sich um – er war der einzige Zuschauer, der sich bislang eingefunden hatte. Nun gut, dachte er bei sich, das gab ihm immerhin genügend Gelegenheit, sich angemessen vorzubereiten. Er holte seinen kleinen Notizblock hervor, den er von zuhause mitgenommen hatte, und begann zu notieren: „...Theaterbühne zu klein für große Kunst ... große Kunst veredelt alles ... Wände dreckig ... Dreck verblasst in Gegenwart der Kunst ...“ Er steckte den Notizblock wieder ein und begann zu überlegen, wie er den Schauspielern hinterher überzeugend näherbringen konnte, dass – egal wie dieses Theaterstück, das sie hier und heute aufführten, eigentlich ablief – sie unbedingt ein von ihm geschriebenes Stück brauchten, um wirklich zur wahren Größe aufzulaufen. Er wusste ja, das die Schauspieler eigentlich keine besondere Leistung imstande zu bringen waren, da sie nicht ein Theaterstück spielen durften, das von ihm stammte – also würde die schauspielerische Leistung von vornherein gedämpft sein, aber da er es erwartete, konnte er bestimmt damit umgehen.
Plötzlich bemerkte er, dass zwei andere Zuschauer hineinkamen. Er drehte sich um und musterte sie ein wenig abfällig, aber nur, weil er wusste, dass sie nicht imstande sein konnten, die hohe Kunst des Theaterschauspiels so angemessen zu würdigen wie er. Immerhin befasste er sich tagtäglich mit der Ausarbeitung seines Meisterwerks, da war es nur verständlich, dass er über einen besseren Blick in solchen Angelegenheiten verfügte. Er überlegte, ob er mit den beiden sprechen sollte – ein wenig Lokalkolorit bzw. Ansichten von Leuten sammeln sollte, die von der Muse ungeküsst sein mussten. Er entschied sich dagegen – immerhin hatte er später schließlich nicht so viel Platz in der Zeitung übrig, da konnte er keine einzelne Zeile mit einer Wiedergabe eines unqualifizierten Zuschauerkommentars verschwenden, welche sich sowieso nur in derartigen Belanglosigkeiten ergossen wie „Mir hat's gefallen, war voll toll, ey.“ oder „Is' mal was anderes als immer nur fernseh'n, wa'.“ – das brauchte er nun wirklich nicht für die Nachwelt zu konservieren.
Je mehr Zeit verstrich, desto mehr Leute kamen, auch wenn sich die Zahl nicht über 12 bewegte. Lag es daran, dass es sich um eine Kleinbühne handelte? Er konnte es nicht fassen – wie kulturlos waren die Leute denn bitte schön, sich von so etwas von einem Theaterbesuch abbringen zu lassen? Er war doch auch gekommen. Sicher, bei ihm war es etwas berufliches, aber auch so wäre er erschienen, wenn er denn gewusst hätte, dass heute eine Aufführung stattfand, aber er hatte keine Werbung dafür gesehen, was ihn dann doch für einen Moment verwunderte, bis er sich selber überzeugend erklärte, das wahre Kunst keine schnöde Werbung brauchte, denn das wahre Genie wird sich immer durchsetzen. Und „Der stolze Leuchtturmwächter“ von dem ihm leider unbekannten Bernd Kasius musste Kunst sein, denn eine Theatertruppe, die was auf sich hielt, würde nur das Beste zur Aufführung bringen. Die Zahl der Stunden, die in die Vorbereitungen gingen, erlaubten es schließlich nicht, irgendwelchen beliebigen Tinnef auf die Bühne zu bringen – nur die besten der besten gelangten zur Aufführung, also musste auch das Werk von Kasius ein Triumph des geschriebenen Wortes sein. Mit Stolz in der Brust wusste er, dass er als Autor ein viel tiefergehendes Verständnis für das Werk hatte als all die anderen Zuschauer, die eben bloß zuschauten, aber nicht zu empfinden und deswegen auch nicht in der Lage waren zu verstehen, denn dazu musste man ebenso ein Künstler sein wie es dieser Kasius zweifelsfrei war.
Schließlich begann die Vorstellung – einige Zuschauer räusperten sich, aber er zischte ihnen geschwind zu, dass sie gefälligst ruhig zu sein hatten: drei Schiffbrüchige trieben in einem kleinen Boot auf hoher See, und nur der von der Muse geküsste Oliver sah sich imstande über die Unzulänglichkeiten der Requisiten hinweg zu sehen, denn die Kostüme der Schiffbrüchigen wirkten für alle kulturlosen Zuschauer eher zweckmäßig, jedoch nicht wirklich überzeugend, was durch den Umstand, dass der bleichgeschminkte Admiral aus nicht näher erklärten Gründen ein Taschentuch auf der Brust geheftet hatte, nicht gerade leichter wurde. Auch das Boot war ein eher liebloser Zusammenhau von Orangenkistenbrettern als dass es ein echtes Boot auch nur ansatzweise simulieren konnte, aber Schauspielen kam eben primär von Schau-spielen, und die Bedeutung dieser Feinheit zu verstehen, war eben nur Oliver in der Lage, weswegen er über diese kleinen Unzulänglichkeiten hinwegsah und sich auf die Handlung konzentrierte, die sich auf der Bühne vor ihm entfaltete: der Admiral trieb mit seinem ersten Maat und einem Schiffsjungen im Boot – die Hintergrundgeschichte wurde durch geschickte Einwürfe deutlich gemacht – die Schiffbrüchigen entwickelten eine Hackordnung, denn nach Tagen auf hoher See war der Rang des Admirals eigentlich nichts mehr wert (ein hervorragender gesellschaftskritischer Kommentar, wie Oliver neidlos anerkennen musste, auch wenn den anderen Zuschauern diese Komponente wohl nicht auffiel) – schließlich gab es keine Verpflegung mehr, weswegen der Admiral und der Maat den Schiffsjungen fressen wollten, was sie sodann auch taten (der Schauspieler, der diesen spielte, schaffte es einigermaßen überzeugend, sich weitestgehend unbemerkt vom Publikum aus dem Bühnenbild zu schleichen).
„Was haben wir getan?“, sagte der Maat sodann mit zittriger Stimme.
„Was wir tun mussten“, meinte der Admiral. „Wir mussten es tun. Vergiss das nie. Wir mussten es tun.“
„... warum?“
„Weil ich es entschieden habe.“
„... warum? Warum sind wir besser als er?“
„Weil wir leben.“
„Wir leben, ja, aber nur, weil er sterben musste.“
„Ja. Er musste.“
„... warum?“
„Weil ich es entschieden habe.“
„... gut ... es war also ein Befehl ...“
„Nein. Kein Befehl. Notwendigkeit.“
„... es muss ein Befehl gewesen sein, ansonsten war es ...“
„Was? ... Was?“
„Nichts ... es war nichts ... er war ...“ Der Maat verstummte und sah den Admiral geradezu mordlüsternd an.
Olivers Herz hüpfte vor Freude – dieses infrage stellen einer Anordnung eines Admirals war so tiefschürfend, dass es einer Schande gleichkam, dass gerade mal 12, nein, mittlerweile nur noch 10 Leute, es miterlebten. So ein geniales Schauspiel gehörte an den Schulen gelehrt – wer brauchte schon „Das Schiff Esperanza“, wenn es dieses Stück gab? Und dabei war noch nicht einmal die erste Hälfte des Stückes vorbei.
„Da – Land! Ich sehe Land! Land! LAND!“, rief der Maat aufgeregt, und der Vorhang kam kurz runter, bevor er wieder aufgezogen wurde und die beiden Schiffbrüchigen an einem Tisch sitzend zeigte, während sie vom Leuchtturmwächter bedient wurden. Der Leuchtturmwächter erzählte ihnen, dass bald ein Sturm aufkam, weswegen es keine Verbindung zum Festland gab und sie deswegen die Insel vorläufig nicht verlassen konnten – der Admiral erzählte vom Schiffsunglück und dass nur er und der Maat überlebt hätten – der Maat kämpfte sichtlich mit seinen Empfindungen – plötzlich kam die Tochter des Wärters herein, ein unglaublich schönes Mädchen, das sich devot gab und eine neckisches Schleife um den Hals trug.
Oliver wusste nicht wieso, aber das Mädchen besaß eine Ausstrahlung, die ihn einfach nur wuschig im Kopf machte, und dabei dachte er immer, dass er homosexuell sei, denn schließlich waren das die meisten kreativen Menschen, und auch wenn er noch nie Sex gehabt hatte, so war ihm ein wohlgeformter Männerkörper immer noch schöner anzusehen als Frauen, die in den Werbungen mit ihren knubbeligen Vorderhupen immer und überall ins Gesicht der Leute gepresst wurden, egal ob man nun darauf stand oder nicht. Aber diese Frau ... sie war unwahrscheinlich schön und sprach mit einer süßen, Engelsgleichen Stimme ... verdammt, was war los? Wieso empfand er derartige Gefühle für sie? Er musste sich konzentrieren – alle Aufmerksamkeit auf die Handlung!
Die Tochter bandelte mit dem Maat an – dieser bekam vom Admiral die Aufforderung, dieses zu unterlassen, denn schließlich besaß der Admiral den höheren Rang – der Leuchtturmwächter wiederum wollte nicht, dass seine Tochter überhaupt mit einem der beiden zusammen kam, da ihm etwas an ihnen nicht ganz zu schmecken schien – der Maat wurde zunehmend wütender auf den Admiral und nahm sodann ein Messer, mit dem er ihn umbrachte, wobei er allerdings von der Tochter überrascht wurde (und der Schauspieler, der den Admiral verkörperte, schien nicht in der Lage, für den Rest des Stückes ruhig liegen zu bleiben, weswegen es so wirkte, als würde der Admiral doch noch einmal aufstehen und etwas unternehmen, auch wenn er eigentlich eben tot und damit irrelevant sein sollte) – der Maat erzählte nun der Tochter, dass der Admiral den zuvor unerwähnt gebliebenen Schiffsjungen getötet habe und er diesen nun gerächt hatte, und er erzählte weiter, dass er und die Tochter ja nun zusammen sein könnten, und wenn der Vater das nicht wollen würde, ja dann könnte man doch einfach fliehen, denn wahre Liebe besiegt alles – der Maat schnappte sich die Tochter und hielt sie ziemlich gewaltsam (Oliver war überrascht, dass die Schauspielerin sich so etwas gefallen ließ) – sie nahm das Messer und tötete den Maat, wurde dabei aber vom Leuchtturmwächter überrascht – sie sagte ihrem Vater, was vorgefallen war – der Leuchtturmwächter nahm stumm eine Bibel zur Hand und las aus den zehn Geboten – die Tochter flehte um Verständnis und Vergebung – der Vater wollte es nicht hören – die Tochter fragte, ob sie sich nun töten sollte, aber das wies der Vater ab, denn dann würde er sich ja versündigen – die Tochter weinte – der stolze Leuchtturmwächter entschied schließlich, dass seine Tochter ins Boot der Schiffbrüchigen gehen und in den Sturm treiben soll, denn damit liegt ihr weiteres Schicksal in der Hand Gottes, und wenn dieser ihr vergeben könne, dann würde der Herrgott sie beschützen und wieder zu ihm, dem stolzen Vater, zurückbringen. Das Stück endete damit, dass der Vater in die Ferne sah, schließlich die Hände vors Gesicht schlug, auf die Knie sank und starb, denn sein einziges Kind kam nicht mehr zurück. Vorhang.
Oliver war regelrecht geplättet – seine gesamte vorherige Vermutung, dass wahre Kunst unabhängig von der Größe der Bühne sei, wurde durch diese grandiose Darstellung restlos bestätigt. Er würde eine umfassende Review schreiben, die diesem Ereignis angemessen ist – nur das allerbeste kam dafür in Frage! Er ließ seinen Blick zu den anderen Zuschauern schweifen, die eher mäßig applaudierten und sich bereits zum Gehen aufmachten, ohne „Zugabe!“ oder dergleichen zu rufen. Kunstbanausen, allesamt! Aber gut, sollten sie nur gehen, dachte er, denn dann konnte er in Ruhe mit den Schauspielern reden und das verlangte Foto schießen.
Er erhob sich und sah sich um, bis er schließlich jemanden ausfindig machte, der wohl hier arbeitete. „Entschuldigung, arbeiten sie hier?“
„Kann man so sagen, ja“, nickte Herr Kröger.
„Ich möchte gerne mit den Schauspielern sprechen – ich komme von der Zeitung.“
„Na, dann gehen Sie doch einfach über die Bühne nach hinten“, sagte er beiläufig. „Ich muss mit denen auch noch reden.“
Oliver nickte geschwind und begab sich nach hinten, wo er nahe dem Umkleideraum stehen blieb und an die verschlossene Tür klopfte, die sich sodann öffnete. „Ja?“, sagte Bernd und streckte seinen Kopf heraus.
„Entschuldigen Sie, ich bin von der Zeitung und hätte gerne mit den Schauspielern gesprochen“, sagte er zum Leuchtturmwächter, der keine Perücke mehr trug.
„Wirklich?“
„Ja. Und wenn es geht, wäre es ganz toll, wenn ich ein Foto von ihnen machen könnte. Die Aufführung hat mich sehr bewegt. Das wird ein großer Bericht“, japste er beinahe atemlos vor Aufregung.
„Wirklich?“ Er lächelte. „Na, dann warten Sie bitte einen Moment.“
„Natürlich.“
Bernd schloss die Tür und drehte sich zu den anderen. „Wieder anziehen – Zeitung will ein Bild machen.“
„Mann“, stöhnte Detlef. „Die Jacke juckt.“
„Weil du reinschwitzt wie ein Schwein“, triezte Dennis.
Andreas schlüpfte wieder in die Stöckelschuhe, setzte seine Perücke auf und brachte die falschen Brüste in Position, da es leichter war, sich in der kurzen Zeit als Tochter denn als Schiffsjungen herzurichten. Bernd öffnete die Tür. „Bitte sehr.“
Oliver lächelte reichlich debil, was ihm allerdings selber nicht auffiel – zu sehr übermannte ihn das Gefühl, mit den Leuten in einem Raum zu sein, welche ihm zuvor eine so große Kunst darboten. „Guten Abend – ich ... ich ... ich möchte mich bedanken. Das war wirklich große Kunst. Wirklich“, sagte er beinahe atemlos und ließ einige Sekunden verstreichen, bevor ihm einfiel, dass er ja eigentlich ein Bild machen wollte, weshalb er sein Handy aus der Jackentasche zog. „Ich müsste ein Bild machen. Wenn sie alle zusammenrücken könnten. Das junge Fräulein vielleicht in die Mitte, ja?“
„Fräulein?“, gab Detlef von sich.
„Das heißt junge Frau“, grinste Dennis Andreas an, der kein Wort von sich gab, sondern einfach nur devot lächelte und sich neben die anderen stellte, damit der Reporter das Foto knipsen konnte.
„Soooo – danke.“ Er sah sich um. „Ähm, wo ist denn der Regisseur?“
„Das bin ich“, sagte Bernd.
„Ah, und gleichzeitig der Leuchtturmwächter. So hat man die Situation auf der Bühne natürlich jeder Zeit viel besser unter Kontrolle, nicht wahr?“
„Ja“, meinte er, da er nicht darauf aufmerksam machen wollte, dass sie zu wenig Schauspieler für alle Rollen besaßen. „Ein guter Regisseur verlangt nichts von seinen Schauspielern, was er nicht auch selber tun würde. Aber wir möchten uns jetzt gerne umziehen – wenn Sie noch Fragen haben, dann warten Sie doch einfach im Zuschauerraum, ja?“
„Natürlich, natürlich“, sagte er und verließ den Raum.
Er schloss die Tür. „Interessante Type“, gab Dennis von sich.
„Immerhin hat es ihm gefallen.“
„Scheint so.“
Bernd sah zu Detlef. „Hattest du eigentlich Flöhe im Arsch oder warum hast du dich die ganze Zeit bewegt? Der Admiral war tot.“
„Ich musste einen fahren lassen, aber ich wollte nicht riskieren, dass man es hört“, verteidigte er sich.
„Und darum hast du dich so bewegt?“, hakte Dennis nach. „Wolltest du ihn leise kneten oder was?“
„Halt du doch mal dein Schnäuzchen, wie wär's, hmm?“
„Diva“, gab Detlef lächelnd von sich. „Du musst dich einfach anal rannehmen lassen, dann kannst du furzen wie ein Weltmeister, ohne dass man was hört.“
„Nee, danke – darauf steh ich nicht.“
Er zuckte mit den Schultern. „Tja Diva – die Profis machen es wie der Spruch aus der Zahnpasta Werbung: morgens oral, abends anal.“
„... du hörst auch nur das, was du willst.“
Er lächelte. „Ja, ein Bier wäre jetzt nett, danke.“
Andreas schminkte sich ab. „Ich fand's ganz gut.“
„Schon – also ihr seid ganz ehrlich gesagt großartig“, stimmte Bernd zu, „und die Leute, die rausgegangen sind, die sind eben ... so was passiert eben“, winkte er ab. „Wichtig ist, dass ihr großartig seid, und dafür sage ich danke, und das ganz ehrlich.“
Es klopfte an der Tür, die auch sofort geöffnet wurde. Herr Kröger trat ein. „War ja ganz nett“, meinte er und sah Bernd direkt an. „Aber nicht gut besucht.“
Er lächelte. „Ja ... ähm, können wir das nachher besprechen? Ich muss mich umziehen und jemanden von der Zeitung ein Interview geben.“
Herr Kröger verließ den Raum. „Nachher“, sagte er fast schon streng.
Andi sah ihn an. „Alles in Ordnung?“
„Ja, ja, natürlich – aber jetzt umziehen. Die Sachen müssen gereinigt werden.“
„Weil du schwitzt wie ein Esel“, grinste Dennis, woraufhin Detlef ihm den erhobenen Mittelfinger zeigte. „Ooooh, gerne doch.“
Oliver wartete währenddessen im Zuschauerraum und notierte sich weitere Einzelheiten über das Stück, bis schließlich nach einigen Minuten der Regisseur zu ihm kam. „Ah, sehr gut – ich bin schon dabei, die Review zu schreiben.“
„Hoffentlich positiv.“
„Natürlich, natürlich“, nickte er. „Wenn sSe dann Zeit hätten für ein paar Fragen ...“
„Sicher.“ Er setzte sich hin. „Fragen Sie.“
„Nun, zuerst einmal – wie kamen sie darauf, dieses Stück hier zu spielen?“
„Wie meinen Sie das?“
„Nun, verstehen Sie mich bitte nicht falsch, aber ich hatte bislang noch nie etwas von diesem Stück gehört ... wie sind Sie darauf gekommen?“
Bernd verstand die Frage ein wenig anders als Oliver sie beabsichtigt hatte: „Naja, so was liegt eben im kreativen Bereich, wenn ich das mal so sagen darf. Man sieht was, man hört was, und dann macht es eben Klick im Kopf und schon ist die Idee dafür da.“
„Natürlich, das ist ganz klar – ich schreibe selber auch“, ließ er absichtlich beiläufig einfließen. „Gab es irgendwelche Schwierigkeiten, das Stück umzusetzen?“ Er wollte Beispiele hinzufügen wie die Urheberrechtsfrage und ob der Autor, falls dieser noch lebte, etwas dagegen einzuwenden hatte, dachte sich aber, dass die Fragestellung solche Beispiele bereits zur Genüge implizierten.
„Naja, unsere Schauspielgruppe ist leider nicht die größte“, meinte er in Bezug auf die Doppelrolle von Andreas, „und die Kostüme mussten wir auch selber herbeischaffen, und die Requisiten waren auch noch so eine Sache für sich, aber solange das Publikum sich von der Aufführung überzeugen lässt, haben wir ja dann doch eigentlich alles richtig gemacht, nicht wahr?“
„Ja, natürlich“, nickte er. „Sie haben wirklich eine begabte Truppe, wenn ich das mal so sagen darf. Alle waren perfekt für die Rolle. Besonders die Tochter hat ihre Rolle hervorragend gespielt.“
Bernd lächelte schräg. „Hat sie“, bestätigte er schelmisch, da er es nicht für nötig hielt, den Reporter darüber aufzuklären, dass die Schauspieler allesamt aus Schwulen bestand – höchstwahrscheinlich würde die Zeitung nicht darüber berichten, wenn er diese Tatsache herausstellen würde, weshalb er es für besser hielt, nichts weiter dazu zu sagen.
„Ein Naturtalent, wenn ich das einmal so sagen darf“, meinte er mit einer Stimmlage, die andeuten sollte, dass er komplett von der Muse umwogen war und seine Aussage deshalb nicht das kulturlose Gewäsch eines Ignoranten sei, sondern vielmehr eine offene, ehrliche Anerkennung eines verwandten Hochtalents. „Wie viele Aufführungen sind denn geplant?“
„Naja, so viele wie das Publikum sehen möchte. Kommt immer auf die Zuschauerzahl an – von Kunst allein kann der Mensch nicht leben. Man muss auch Geld verdienen. Die Bühne hier wurde von mir gemietet und das Geld muss natürlich auch irgendwie wieder reinkommen ... wenn das Publikum ausbleibt, dann müssen wir uns leider anderweitig umsehen. Das ist leider eine traurige Tatsache.“
„Das stimmt, das stimmt, das habe ich selber schon oft feststellen müssen – den Leuten ist Kunst einfach nicht mehr wichtig genug“, stimmte er zu. „Die nehmen Kunst einfach als etwas Selbstverständliches und ignorieren es dann mit der Ausrede, dass sie keine Zeit für so was hätten, weil sie selber zur Arbeit gehen müssten, aber das so was dann zur Kulturlosigkeit führt, das verstehen die dann nicht. Ein Zeitalter wird ja später nicht anhand der arbeitenden Leute bemessen, sondern an der Kunst, die es hervorbringt.“
Bernd stutzte – meinte der Reporter diese lebensfernen Äußerungen etwa ernst? Er hatte ihm doch gerade erst gesagt, dass auch sie ihre Kunst nicht umsonst darbieten konnten, sondern wie jeder andere Rechnungen zu zahlen hatten, und dass, wenn es kein Geld gab, die weiteren Aufführungen gestrichen werden mussten. Kein Künstler konnte nur von der Kunst leben, man musste sie irgendwie gewinnbringend vermarkten.
Bevor Bernd allerdings etwas dazu sagen konnte, kam es aus Oliver förmlich herausgeschossen: „Ich habe selber bereits ein Buch geschrieben über den künstlerischen Aufwand, den Schauspieler betreiben, und daher weiß ich, wie es ist, wenn man künstlerisch tätig ist. Und ich wünsche Ihrem Theater alles Gute, aber ich möchte dennoch die Gelegenheit nutzen und Ihnen anbieten, dass ich ein exklusives Theaterstück für Sie schreibe. Ich bin mir sicher, dass die Leute dann darüber sprechen werden.“
Er musterte ihn eindringlich. „... wird man sehen ...“, war alles, was er von sich gab. War dieser Reporter etwa ein Neuling? „Aber im Moment haben wir ja den Leuchtturmwächter auf dem Spielplan, also ...“
„Sicher, sicher“, unterbrach er, „aber das könnte sich ja, also wird sich sicherlich irgendwann einmal ändern. Nicht sofort, das nicht, ha-ha, ich wünsche Ihnen ja durchaus Erfolg damit. Aber irgendwann wird das Publikum den Leuchtturmwärter ja auch über haben und sich nach etwas neuem sehnen. Etwas wirklich künstlerischen. Und dann könnte ich ja ein Stück für Ihr Theater beisteuern. Ich könnte mir mühelos vorstellen, ein Stück zu schreiben, das jedem Ihrer Schauspieler eine besondere Rolle zukommen lässt.“
„Auch der Tochter des Leuchtturmwächters?“
„Natürlich – sie verfügt über besondere Qualitäten, das ist ganz klar.“
„Verstehe ... Und der Schiffsjunge?“
Oliver stutzte. „Wer? ... Ach ja, ja, ja der natürlich auch, ja“, nickte er geschwind, um zu überspielen, dass er gerade nur an die Schauspielerin dachte, welche die Tochter verkörpert hatte und ihn dadurch in seinem Sexualitätsverständnis verwirrte. Er fühlte eine tiefe Zuneigung zu ihr, auch wenn sie eine Frau war.
„Naja ... ich will nicht zu viel sagen, aber ...“, fing er an, wurde jedoch erneut unterbrochen.
„Natürlich nicht, das ist mir klar, das alles kommt natürlich im Moment etwas plötzlich.“ Er kritzelte auf ein Blatt des Notizblocks und riss es heraus. „Hier, meine private Telefonnummer. Wenn Sie wissen, ob Sie ein neues Stück einplanen können, dann rufen Sie mich bitte an.“
Bernd steckte das Blatt ein. „Kann man schon machen.“
„Sehr gut, vielen Dank. Ich werde eine hervorragende Kritik schreiben, darauf können Sie sich verlassen“, nickte er und erhob sich. „Ich danke Ihnen für das Gespräch, aber noch mehr danke ich Ihnen für diese hervorragende Aufführung.“
„Kein Problem.“
Mit einem körpererfüllenden Gefühl der Freude verließ Oliver das kleine Theater und ging nach Hause, wo er sich sofort dranmachte, eine umfassende Kritik zu schreiben, die sämtliche Aspekte des Stückes würdigte: von der genialen Schauspielführung über den kreativen Einsatz der Kostüme, der absichtlich Brecht'schen Verfremdung der Requisiten bis hin zu dem wahren Star der Aufführung – der jungen Schauspielerin, die die Tochter spielte, nein: voll und ganz mit Leib und Seele durch und durch verkörperte. Plötzlich fiel ihm ein, dass er überhaupt nicht nach den Namen der Schauspieler gefragt hatte, aber er erklärte sich diesen Fauxpas durch die nachhaltige Wirkung, die das Stück auf ihn ausübte. Da war ein solches Versehen durchaus verzeihlich.
Er ging sodann zu seinem Romanmanuskript, welches er mit der Hand verfasste, da er der Meinung war, dass nur so große Kunst entstehen konnte – er hätte auch mit einer Schreibmaschine hantiert, jedoch wäre diese aufgrund der Lautstärke nicht rund um die Uhr nutzbar gewesen, und wer wusste schon, wann die Muse einen umgarnte? Überhaupt kam ihm der Gebrauch von Stift und Papier viel natürlicher vor als der Umgang mit einer Schreibmaschine oder gar einem Computer, auch wenn er wusste, dass er, sobald sein Werk vollendet war, es so oder so in den Computer übertragen musste, um es Verlagen anbieten zu können, aber bis dahin war ja noch Zeit. Er blätterte ein wenig darin herum und korrigierte einen Satz, der ihm zuvor gut genug vorkam, jedoch durch die jetzige Verkürzung einfach nur noch perfekt war. Kurze Sätze. Klare Gedanken. Wie bei Hemingway. Ebenfalls ein Reporter. Alles fügte sich zusammen. So wie es sollte.