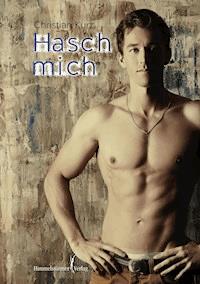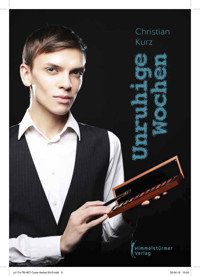Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Himmelstürmer Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Interessante Zukunftsvariante: Hier flüchten nun Deutsche aus dem autoritären Nazistaat nach Kanada! Karl Beck, der Autor von schwulen Winkel-Geschichten, hat es gewagt und das Deutsche Reich hinter sich gelassen, um im fernen Kanada sein Glück zu suchen. Allerdings muss er schnell erkennen, dass Deutsche hier nicht gerne gesehen sind, denn auch bei den Kanadiern gibt es Leute, die einen Hass auf Schwule haben. Karl versucht sich nicht entmutigen zu lassen und muss sich mit Gelegenheitsarbeiten am Leben halten, was ihm mehr schlecht als recht gelingt. Aber in der Heimat ist er nicht vergessen - seine Geschichte, die er für die verbotenen Winkel-Hefte verfasste, erregt die Aufmerksamkeit der Nazi-Partei. Für diese steht eindeutig fest: der Autor Karl Beck muss sterben, egal wo er sich gerade aufhält. Offizier Schmidtz reist deswegen bis nach Kanada, um ihn zu töten. Karl macht währenddessen Bekanntschaft mit einigen Schwulen, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, mit ihren Mitteln gegen die Partei anzukämpfen. Gerade als die Dinge anfangen gut zu laufen, tauchen plötzlich ein Serienkiller und ein Schwulenhassender Kanadier auf, die beide keinerlei Rücksicht auf menschliches Leben zu nehmen scheinen. Karl muss kämpfen wie noch nie zuvor in seinem Leben, um nicht gnadenlos zwischen all dem Hass um ihn herum aufgerieben zu werden.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 587
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Cristian Kurz
Die Welt zwischen uns
Von Christian Kurz bisher erschienen:
Allein unter seinesgleichen ISBN, print: 978-3-86361-564-2
Hasch mich, ISBN print: 978-3-86361-567-3
Regenbogenträumer, ISBN print: 978-3-86361-491-1
Samt sei meine Seele ,ISBN print: 978-3-86361-617-5
Alle Bücher auch als E-book
Himmelstürmer Verlag, part of Production House, Hamburg
www.himmelstuermer.de
E-Mail: [email protected]
Originalausgabe, Februar 2017
© Production House GmbH
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Verlages.
Zuwiderhandeln wird strafrechtlich verfolgt
Rechtschreibung nach Duden, 24. Auflage
Cover: 123rf.com
Umschlaggestaltung: Olaf Welling, Grafik-Designer AGD, Hamburg. www.olafwelling.de
E-Book-Konvertierung: Satzweiss.com Print Web Software GmbH
Printed in Germany
ISBN print 978-3-86361-614-4
ISBN e-pub 978-3-86361-615-1
ISBN pdf 978-3-86361-616-8
Alle hier beschriebenen Personen und alle Begebenheiten sind frei erfunden. Jede Ähnlichkeit mit lebenden Personen ist nicht beabsichtigt.
1.
Jimmu Kakahari lag neben der bereits kalten Leiche und starrte gegen die Zimmerdecke des kleinen, muffigen Zimmers. Seine Atmung war flach, aber er versuchte noch ruhiger, noch kontrollierter zu atmen, so dass sich sein Bauch fast gar nicht anhob. Sein Blick glitt runter auf das blutige Messer, das er in seiner rechten Hand hielt und mit dem er seinen Sexpartner einige Zeit zuvor getötet hatte. Es war ein gnadenvoller Tod gewesen, mehr als was dem Kerl zugestanden hatte. Der Kerl, den Jimmu in einer Kneipe für Homosexuelle getroffen hatte, war wie die meisten Einwanderer eher vorsichtig agierend gewesen, aber dann doch nicht so vorsichtig, als dass er die Möglichkeit zum schnellen Sex ausgeschlagen hätte. Es ekelte Jimmu nach wie vor an, dass die ganzen Sexsüchtigen vor Krankheiten nur so wimmelten. Aber er war ja selber bereits mit derlei Krankheiten gestraft, weswegen es ihn eigentlich nicht weiter kümmern sollte. Dennoch ekelte es ihn an, wenn er einen Typen ins Bett bekam, der die einfachsten Hygieneregeln nicht zu beherrschen schien.
Der Typ an sich sah im Zwielicht der Kneipe ja noch ganz nett aus und war auch ziemlich umgänglich gewesen, jedenfalls solange, bis sie beide sich in Jimmus Wohnung begaben. Dann erst gingen die Vorurteile los. „Wieso bist du denn nicht bei deinen Leuten?“, hatte der Kerl gefragt. „Ihr Japaner habt doch die halbe Welt unter euch. Da musst du doch nicht nach Kanada zum ficken.“
„Wir Japaner sind zwar verständnisvoller bei gleichgeschlechtlicher Liebe als die Deutschen, aber das bedeutet nicht, dass es gerne gesehen wird. Auch bei uns wird es eher als Unehrenhaft angesehen ... als Strafe ... als unmännlich. Genauso wie bei den Deutschen, und die haben ja auch schon hart durchgegriffen“, hatte er sanft geantwortet und insgeheim leise gehofft, dass der Typ es damit auf sich beruhen lassen würde.
„Ja, bei denen gibt es das anscheinend nicht mehr. Keine Ahnung, die haben wohl auch fast keinen mehr von uns“, er klopfte sich auf seine Brust, um anzudeuten, dass er damit schwarze Leute meinte. „Dreckspack, elendiges. Dass die Scheißer das alles an sich gerissen haben.“
„Politik“, sagte er erneut in der Hoffnung, dass das Thema damit erledigt sei.
Der Schwarze lümmelte regelrecht auf dem Sofa und machte seine Beine breit, um sich am Schritt zu kratzen. „Ja, Politik. Scheiße, ist doch keine Politik, wenn man dafür Menschen töten muss. Ich meine, was haben wir denen denn getan gehabt? Nichts, sage ich dir, gar nichts. Aber trotzdem haben die uns angegriffen und getötet. Mein Urgroßvater, der hat noch in Afrika gelebt, und da hat er nichts von Politik gewusst. Und trotzdem sind da eines Tages die Panzer gekommen. Die haben alles kaputt gemacht. Mein Urgroßvater ist dann geflohen, weil er mitbekommen hat, dass die Scheisser die Leute töten. Einfach so töten. Das muss man sich mal vorstellen. Die haben die zusammen getrieben und aussortiert – die Jungen dahin, die Alten dorthin. Und dann wurden die Alten getötet. Und die Jungen haben die Alten auf einen Haufen werfen müssen. Und dann wurde der Haufen angezündet. Der Rauch war so dick, dass es drei Tage lang schwarz geregnet hat. Und es hat nicht schwarz geregnet, weil Schwarze verbrannt wurden, das kann ich dir sagen. Scheißdreckspack, elendiges.“ Er sah sich um. „Hast du was zu trinken?“
„Natürlich.“ Jimmu verließ den Raum und kam mit einem halbgefüllten Glas wieder. „Woher weiß dein Urgroßvater davon?“
„Was meinst du?“ Er nahm das Glas aus Jimmus Hand.
„Dass der Regen schwarz war. Du hast gesagt, er ist geflohen, als die Panzer kamen. Die Leute wurden erst später getötet. Woher weiß er das also?“
Er zuckte mit den Schultern. „Er wusste es eben. ... Willst du sagen, dass mein Urgroßvater gelogen hat? Willst du das sagen?“
„Nein. Ich frage nur.“
„Der hat das gewusst. Ist doch auch logisch. Wohin sollen denn sonst die ganzen Leute verschwunden sein? Die Deutschen haben uns weggebrannt, und auch deine Schlitzaugenfreunde haben sich daran beteiligt. Genauso wie die Italiener. Sind einfach in unser Land gekommen und haben getötet und das Land dann auf drei Lager verteilt, ohne uns zu fragen. Wir hatten denen nichts getan, aber die rotten uns aus. Nur weil mein Urgroßvater nach Amerika fliehen konnte, hat er überlebt. Und dann wird auch noch Amerika besiegt ... Scheiße, der einzige Grund, warum wir deutsch reden, ist doch der, weil die Arschlöcher die Welt an sich reißen wollten, und das haben die nur geschafft, weil deine gelben Freunde mitgemacht haben. Ansonsten wäre das alles ganz anders verlaufen. Und irgendwann ist es dann auch in den D-S-A für uns Schwarze unerträglich geworden, also bleibt ja nur noch Kanada, und lass dir sagen: als Schwarzer in Kanada ist es verdammt kalt.“ Er trank einen Schluck und wollte es bereits ausspucken, schluckte es allerdings angewidert runter. „Wasser?“
„Natürlich.“
„Du gibst mir Wasser zum trinken?“
„Ja. Mehr als Wasser braucht der Mensch nicht zum trinken“, sagte der Japaner ehrlich. „Alkohol schadet dem Körper, und Säfte sind überflüssig.“
Er blickte ihn missgünstig an. „Ist das so eine Japanersache?“
„Nein. Nur Logik. Tiere trinken, wenn sie klein sind, Muttermilch, und sobald sie etwas größer sind, trinken sie nur noch Wasser. Das reicht zum Leben.“
Der Schwarze griente. „Tja, und darum seid ihr Japsen auch so kleine, zierliche Puppenmenschen, nicht wahr? Hähähähähä.“ Er zeigte auf seine Hose. „Na, was ist jetzt? Wollen wir?“ Er packte sich an den Schritt und knetete herum. „Oder meinst du, du kannst mich nicht verkraften? Hattest du überhaupt schon mal einen Schwarzen in dir? Ich will nicht angeben, aber ich kann dir sagen, dass ich mir aufrecht selber einen blasen kann, hähähähähä.“
„Ich habe schon einige Erfahrung“, gab Jimmu lächelnd von sich und gab seinem Sexbekannten ein Zeichen, ihm ins Schlafzimmer zu folgen.
„Du hast nicht gerade viele Sachen“, meinte der Farbige, nachdem er das spartanisch eingerichtete Schlafzimmer betreten hatte, in welchem sich außer dem Bett und einem Stuhl, auf dem ein geöffneter Koffer stand, in welchem Kleidungsstücke geordnet lagen, nichts weiter befand.
„Ich bin viel unterwegs.“
„Aha, immer von einem Fick zum nächsten, was? Aber ich sag dir gleich – wenn ich eine Warze an deinem Schwanz sehe, dann kannst du es vergessen. Das mache ich nicht mit.“
„Bei mir ist alles in Ordnung“, sagte Jimmu freundlich, obwohl er wusste, dass dem nicht so war.
„Ich meine nur“, der Farbige ließ sich ins Bett fallen, „dass da bei mir der Spaß aufhört. Ich brauch sowas nicht. Ich hatte mal einen, der war ganz nett, aber der hatte einen Sack mit Warzen überzogen, also so richtig komplett. Das sah aus wie ein Noppenhandschuh. Oder wie ein Igel. Und der wollte dann, dass ich ihn an mich ranlasse. Dem Wichser habe ich dann aber die Meinung gesagt, das kannst du mir glauben. Und wenn du Schimmel am Schwanz hast, dann kannst du es auch vergessen. Ist mir sowieso lieber, wenn ich dich rannehme als dass du mir am Arsch rumfummelst. Nicht falsch verstehen, aber ich hatte schon mal einen Japsen, und da war nicht viel dran. Der hat mir am Arsch rumgespielt und so, aber gespürt habe ich den nicht. Und mein Arschloch ist nicht so ausgeweitet, dass da eine Hand oder so reinpasst, das nun wirklich nicht, aber wenn eine Ameise einen Elefanten fickt ...“ Er ließ den Satz unbeendet und grinste Jimmu an. „Was hast du denn eigentlich in der Hose? Den ganzen Stolz des japanischen Kaiserreichs?“
„Bislang hat sich noch niemand beschwert.“
„Hähähähähähä, dann zeig mal her.“
Er öffnete die Hose und zeigte, was er zu bieten hatte.
Der Typ lachte auf. „Verdammt, Mann, ist doch immer wieder lustig, dass ihr die Hälfte der Welt beherrscht.“ Er setzte sich auf und beäugte die Genitalien kritisch. „Naja, immerhin keine Warzen. Aber einen Schutz will ich trotzdem.“
„Natürlich.“ Jimmu griff in seine Hose und holte einen Verhüter hervor, den er sich gekonnt überstülpte. „Ich darf anfangen? Es ist immerhin meine Wohnung.“
„Klar, Mann“, lachte der Typ und zog seine Hose aus, „du fängst an, und hinterher zeige ich dir, wie es richtig geht.“
„Sicher.“ Jimmu wartete, bis sein Sexpatner sich ausgezogen und auf den Bauch gelegt hatte, bevor er aus der anderen Hosentasche ein Klappmesser hervorholte und langsam öffnete.
„Nee, Mann, ernsthaft – wenn ich mit dir fertig bin, dann kannst du drei Wochen lang nur breitbeinig laufen.“ Der Kerl leckte sich über die Lippen und kicherte. „Hast du schon angefangen? Ist er schon drin? Musst du mir sagen, sonst wird es noch peinlich.“
Jimmu legte die linke Hand zwischen die Schulterblätter des Schwarzen und stieß die Messerspitze bis zum Anschlag ins Genick hinein. „Er ist drin.“ Er schnitt ein bisschen nach links und rechts und zog das Messer wieder heraus. Ein gnadenvoller Tod, viel mehr als was der Kerl verdient hatte.
Und nun lag Jimmu immer noch neben dem Typen mit der heruntergezogenen Hose und starrte abwechselnd auf die Zimmerdecke und sein Glied, das im Verhüter bereits erschlafft war und trotz einigem Herumzupfens nicht wieder hart werden wollte. Wahrscheinlich verhinderte der Geruch des entleerten Darms des Toten die Erektion. Bei einem solchen Geruch wollte sich einfach kein Ständer einstellen. Jimmu zog das Kondom daher ab und stopfte es in seine Hose, bevor er seinen Penis wieder verstaute, aufstand, das Glas nahm und in die Küche ging, wo er es gründlich reinigte. Er ließ auch etwas Wasser über das Messer laufen und trocknete es penibel ab, damit sich kein Rost bilden konnte. Auch wenn auf der Schneide die Aufschrift „Deutsches Qualitätsprodukt – Garantiert Rostfrei“ prangte, so hatte er doch schon einige Leute laufen lassen müssen, weil sein Messer unerwarteter Weise verrostet war und er niemanden mit einer solchen Waffe töten wollte.
Er verharrte für einen Moment und starrte auf die Schneide. Es war eine gute Waffe. Er hatte schon mehrere Homosexuelle damit getötet und damit wenigstens ein wenig Ehre wieder hergestellt. Zwar wurden gleichgeschlechtlich Liebende in den J-S-A nicht ausgerottet, aber es galt dennoch als unehrenhaft, wenn sich ein Mann einem anderen Mann derart hingab. Es war unterwürfig und sogar unmännlich, aber vor allem stellte es eine gewisse Form des Ehrverlustes dar. Man wurde in den J-S-A zwar nicht verfolgt, aber man galt dennoch als weniger wert als ein Weib, und Weiber hatten zu gehorchen und den Mund zu halten. So war das schon immer, vor dem ehrenvollen Krieg und erst recht seither, denn das glorreiche Kaiserreich hatte den Krieg schließlich nur deswegen gewonnen, weil es sich auf seine jahrtausende alten Traditionen berufen konnte. In so einer Umgebung konnte Jimmu nicht leben – er fühlte sich permanent klein und unbedeutend, ja er hatte sogar Wahnvorstellungen wegen seines Penis. An und für sich hatte er ihn eigentlich für ganz normal empfunden, aber nachdem er sich für Männer interessierte und die Ablehnung seiner Umwelt spürte, machte sich der Gedanke in ihm breit, dass sein Penis nicht nur zu klein war, sondern sogar noch kleiner wurde. Er hatte Angst davor, dass sein Geschlechtsteil wegen seiner Aktivitäten zusammenschrumpfte und irgendwann vollständig im Körper verschwand, was ihn dann mit einer Vagina zurücklassen würde. Immerhin war es nicht männlich, mit einem Mann zu schlafen – so etwas war weiblich, also würde ihn der Geschlechtsverkehr wohl nach und nach seines Glieds berauben.
Das dachte er jedenfalls immer wieder, und nur wenn der sexuelle Trieb ganz groß wurde, konnte er sich dahingehend überzeugen, dass das nicht passieren würde. Immerhin hatte er schon einige andere Homosexuelle kennengelernt, die nicht darüber klagten, dass ihr Penis wegen dem Sex zusammenschnurren würde, also war es unsinnig anzunehmen, dass es ausgerechnet bei ihm geschah. Aber der Kern dieser Vorstellung blieb immer in ihm drin. Immer. Und wenn er sich dann dazu bringen konnte, jemanden mitzunehmen für ein gemütliches Miteinander, dann war es wie Öl ins Feuer, wenn derjenige Bemerkungen über die vermeintlich kleinen Japanerschwänze machte. Es fühlte sich bei jedem Wort in dieser Richtung so an, als würde sein Glied Zentimeter für Zentimeter verlieren. Das konnte er nicht zulassen – er musste etwas tun, und sein Gehirn, in dem diese Vorstellung existierte, hatte auch sofort die passende Antwort parat: vernichte das, was dich vernichten will!
Jedes Mal, wenn er das Gefühl hatte, dass sein Glied wegen seiner unehrenhaften sexuellen Orientierung kleiner zu werden drohte, verhalf er einem Schwulen zu einem ehrenvollen Tod, auch wenn dieser das gar nicht verdient hatte. Dann verschwand das Gefühl für einige Zeit, aber es blieb dennoch leicht im Hintergrund bestehen. Sein Schwanz war in letzter Zeit nicht geschrumpft, aber als er ihn vorhin schlaff im Kondom gesehen hatte, hätte er schwören können, dass sein Glied noch vor einigen Tagen etwas größer war. Wirkte es nicht länger? Half das ehrenvolle Töten von Homosexuellen nicht mehr? Oder musste er einfach noch mehr töten?
Falls das die Antwort war, so konnte er es leicht bewerkstelligen. Kanada wimmelte geradezu von Schwulen, die alle hergekommen waren, weil sie hier das gelobte Land vermuteten. Es war kein Problem, einen zu finden und zu töten. Und wirklich zu befürchten hatte Jimmu deswegen auch nichts – die Polizei schien bei derlei Tötungsdelikten immer eher uninteressiert zu ermitteln. Ein toter, womöglich illegal eingereister Schwuler weniger – wen kümmert das schon? Niemanden, aber dennoch agierte Jimmu vorsichtig.
Er steckte das Messer wieder ein und griff sich danach an den Schritt. Ja, sein Penis war vorhanden. Noch hatte er keine Probleme damit, ihn zu fassen. Er wollte lächeln, aber er musste an den toten Schwarzen denken, der sein Bett vollstank. Diese rasierten Affen hatten wirklich immer ganz dicke, lange Prügel zwischen den Beinen. War das etwa normal? War das die Norm? Nein, nein, das konnte nicht sein, ganz und gar nicht. Er hatte auch schon andere Kerle gehabt und nackt gesehen, aber bei näherem Nachdenken war auch deren Penis immer etwas größer als seiner gewesen.
Er griff härter zu. Er musste sicher sein, dass ihm sein Glied nicht wegschrumpfte. Er wusste, dass es eigentlich nur eine Wahnvorstellung war. Natürlich, was denn sonst? Aber verdammt, es geschah doch wirklich – er konnte es fühlen. Und er hatte Angst, dass er irgendwann einmal nur ein Loch zwischen den Beinen hatte. Verdammt, warum musste er denn auch so weibisch sein und Männer lieben? Kein Wunder, dass so etwas geschah. Es war eine Krankheit, jawohl, eine Krankheit, und die einzige Heilung bestand in der Ehrwiederherstellung, und das bedeutete nun einmal, so viele von diesen Homosexuellen zu töten wie nur möglich.
Er ließ die Hand im Schritt und ging ins Schlafzimmer zurück. Die aus dem erschlafften Anus des Toten herausgequollene Scheiße stank erbärmlich, weswegen Jimmu ins Badezimmer ging, das Fenster auf Kippe öffnete und mit einem Deo-Spray zurück ins Zimmer kam und sprühte. Kein Benehmen, diese Homosexuellen. War ja auch nicht anders zu erwarten. Er sprühte weiter und musste husten, weswegen er für einen Moment seine Hand vom Schritt nahm. Geradezu panisch griff er wieder zu und bekam sein Glied nicht sofort zu fassen, weswegen er sich die Hose fast schon vom Leib riss, die Spraydose fallen ließ und mit beiden Händen seinen Penis festhielt. Verdammt, hatte es etwa nicht gewirkt? War der Schwarze so unehrenhaft gewesen, dass sein Tod nichts zur Verhinderung beitrug?
Er lehnte sich gegen die Wand und ließ sich zu Boden gleiten. Er sah wieder zum Toten. Zwar steckte Scheiße zwischen den Arschbacken, aber eigentlich war der Typ ja doch ganz nett gewesen. Also zumindest hatte er gut ausgesehen, aber seine Worte hatten ihn dann doch als Überträger der Krankheit verraten. Dennoch ... er sah gut aus. Jimmu zupfte bei sich ein wenig herum und bekam eine einigermaßen solide Erektion hin. Er griff hart mit der linken zu, spuckte ihn die rechte und holte sich einen runter, wobei er weiterhin mit der linken Hand unten ziemlich festhielt, damit sein Glied wegen der unehrenhaften Gedanken nicht doch plötzlich wegschrumpfen sollte. Es dauerte ein wenig, bis er zum Höhepunkt kam und abspritzte. Er lächelte, aber es erstarb auf seinen Lippen, als er sah, dass trotz des Festhaltens sein Glied wieder schlaff wurde und nun kleiner wirkte als zuvor. Fast schon ein Würmchen – er hätte es ohne Zweifel durch leichtes Draufdrücken komplett in seinen Körper verschwinden lassen können, aber dann wäre es wohl nie wieder herausgekommen. Er hielt fest, immer fester, weswegen die Eichel purpurn wurde. Er musste mehr Schwule töten, damit sein Glied nicht noch weiter zusammenschrumpfte. Es war eine dumme Wahnvorstellung, ja, aber es passierte wirklich, also hatte er einfach keine andere Wahl. Er musste es tun.
Er sah von seinem Penis hin zur Leiche. Er musste sich auch darum kümmern. Mal wieder. Aber da hatte er mittlerweile bereits Erfahrung. Das würde kein Problem darstellen. Er blickte runter und erspähte sein Sperma, das sich bereits verflüssigte. Was machte man nicht alles, um seinen Trieb zu befriedigen?
Karl Beck öffnete die Augen und atmete müde durch. Ein weiterer Tag stand bevor. Ein weiterer Tag in der Hölle, die sein Paradies hätte sein sollen. Er hatte es gewagt und sich getraut, nach Kanada abzuhauen, wohl wissend, dass er unmöglich zurück in seine Heimat gehen konnte. Seine Heimat, die so einen wie ihn nur tot sehen wollte. Eine Heimat, die ihn als Aussatz betrachtete und in der selbstgerechte Frauen ungestraft haltlose Unterstellungen und Beschuldigungen in die Welt setzen konnten, während er selber keine Möglichkeit besaß, sich dagegen zur Wehr zu setzen. Es war also eine Heimat, die keine war und die man hinter sich lassen konnte.
Es war Karl, nachdem er den Entschluss gefasst hatte, nicht wirklich schwer gefallen, nach Kanada zu kommen. Ein bisschen Aufwand samt einem nicht unerheblichen Geldverlusts später hatte er sich bereits aus den D-S-A ins vermeintlich gelobte Land abgesetzt und fast sofort einen ziemlichen Realitätsdämpfer bekommen, denn niemand schien hier noch einen Schwulen zu wollen.
Kanada war von unerwünschten Aussteigern und illegalen Einwanderern, die hier ihr Glück suchten, vollkommen überrannt – es schien, als gebe es nur wenige echte Kanadier, und alle anderen waren aus anderen Ländern hergekommen und versuchten nun, irgendwie über die Runden zu kommen. Arbeit war daher Mangelware, und man musste zumeist zwielichtige Hand-in-den-Mund-Gelegenheitstätigkeiten annehmen, bei denen man nicht nach der Legalität fragen sollte. Aber mit Legalität war es sowieso nicht sonderlich weit bestellt: Kanada ließ offiziell niemanden mehr rein. Eine Information, die Karl erst vor kurzem erfahren hatte. Anscheinend war die einheimische Bevölkerung der Ansicht, dass die Zuströme von Deutschen, Japanern und dergleichen nicht aus der Not der zuwandernden Personen geboren wurde, sondern im Gegenteil einer gezielten Unterwanderung entsprang. Es schien die meisten Kanadier nicht zu kümmern, dass man nur hier als Schwuler oder sonst wie Unerwünschter einigermaßen frei und offen leben konnte – alles, was die meisten Kanadier in den Einwanderern sahen, waren zersetzende Elemente, die dafür sorgen sollten, dass auch Kanada in nächster Zeit der Partei oder dem Kaiserreich anheimfallen sollte. Deswegen hatte der kanadische Premierminister schon vor langer Zeit ein striktes Einreiseverbot verhängt, über das in der Presse in Deutschland allerdings mit keinem einzigen Wort berichtet worden war. Karl hätte es als Zeichen sehen können, dass er besser umkehren und ein stiller, zurückgezogenes Leben fristen sollte, aber er wollte ins gelobte Land, und bei Gott, wenn dies bedeutete, sein Erspartes einem Schlepper zu übergeben, ja dann würde er es tun.
Und er hatte es getan. Und es fast augenblicklich bereut.
Kanada war schön. Kanada war herb. Es war ein Traum und ein Albtraum in einem. Die Fantasie wurde von der Realität gnadenlos zu Boden geprügelt und bezwungen. Karl wusste nicht, wie er sich hier zurecht finden sollte – es gab bei seiner Ankunft kein schwules Begrüßungskomitee, das einen Gleichgesinnten willkommen hieß und ihn bei der Hand nahm und alles Wichtige erklärte und für eine Unterkunft oder dergleichen sorgte. Nein, alles, was Karl und die anderen illegalen Einwanderer zuerst von Kanada sahen, war die finstere Nacht der kleinen Grenzstadt, in die man vom Schlepper rausgeschmissen wurde. Dann stieg der Schlepper wieder in seinen Laster und fuhr weg. Er hatte sein Geld bekommen und die Leute hergebracht – alles Weitere war ihm egal.
Karl hatten sich die Ereignisse der Nacht ins Gehirn eingebrannt. Es war ihm immer noch lebhaft vor Augen, wie er und die anderen auf dem Platz mitten im Nirgendwo standen, sich hilfesuchend ansahen in der Hoffnung, dass wenigstens einer von ihnen auch nur den Hauch einer Ahnung hatte, wie es jetzt weiterging. Zu dem Gefühl der Unsicherheit kam die Gänsehaut, das der eisige Wind verursachte, und schließlich erschraken alle zutiefst, da von irgendwoher ein Geräusch erklang, das sich wie eine Polizeipfeife anhörte, aber im Nachhinein betrachtet wohl eher von einem Zug gekommen war. Dennoch – man durfte kein Risiko eingehen, weswegen die neuen Einwohner von Kanada wie die Hasen schreckhaft flohen und in die erstbeste Richtung liefen, in der Hoffnung, dort irgendwie eine neue Heimat zu finden.
Karl hatte keinen seiner Mitreisenden seitdem wiedergesehen, aber er dachte auch nicht an sie. Er hatte eigene Probleme zu bewältigen, da konnte er sich nicht damit aufhalten, sich zu fragen, was aus dem oder dem geworden war. Lebte der noch? Ging es dem gut? Wer weiß? Es gab wichtigeres zu bedenken, so zum Beispiel den Umstand, dass Karl nun noch mehr gegen das Gesetz verstieß als zuvor in Deutschland. Dort galt er zwar als Verbrecher, weil er Männer liebte, aber immerhin konnte er problemlos zum Arzt gehen, wenn es denn sein musste. Nun aber wäre ein Besuch beim Doktor unweigerlich mit der Gefahr verbunden, als Illegaler entlarvt und bestraft zu werden. Er wollte nicht weiter darüber nachdenken, aber er musste es ständig im Hinterkopf behalten.
Nach der Ankunft hatte er sich erst einmal so umgesehen, und jeder, der ihm begegnete, schien ihn misstrauisch zu beäugen. Womöglich kannten die Bewohner der Grenzstadt sich alle untereinander und sahen daher jeden Fremden automatisch als Flüchtling an, der ihr schönes Land weiter zerstörte. Aber genauso gut konnte Karl sich die Blicke auch nur einbilden, weil er sich zwar frei fühlen wollte, es aber tief in seinem Inneren nicht konnte. Er hatte die D-S-A und ihre Gesetze hinter sich gelassen, nur um in einem anderen Land aus anderen Gründen ebenso verfolgt zu werden. In seiner Heimat konnte er nicht frei sein, ohne Aufmerksamkeit zu erregen, und hier konnte er seine Freiheit vorerst nicht zelebrieren, ohne gleichfalls Verdacht zu erregen. Er war buchstäblich vom Regen in die Traufe geraten.
Irgendwie war es ihm dann doch gelungen, sich einigermaßen durchzuschlagen. Die ersten Tage hatte er sich nur auf öffentlichen Toiletten ein wenig saubermachen können, aber nachdem es ihm gelungen war, zu Fuß aus der Stadt rauszukommen, wurde es zunehmend besser für ihn. Die kleinen Imbisse an den Straßen suchten immer wieder Tellerwäscher, und manche Besitzer waren ganz erpicht darauf, zu beweisen, dass Kanada doch das gelobte Land sei und man hier nur nette Leute traf. Karl war es dadurch gelungen, an neue Kleidung und etwas Geld zu kommen, und auch als er nach langem Fußmarsch in einer anderen Stadt ankam, schien seine Glückssträhne zu halten, da er fast sofort eine Arbeit als Tellerwäscher in einem Restaurant finden konnte, weil der dortige Besitzer nicht nach Ausweisen fragte. Damit endete die Glückssträhne vorläufig aber auch schon wieder und schien sich nicht zu erholen.
Die billige Ein-Zimmer-Absteige, in der er hauste, da er sich nichts Besseres leisten konnte, stank nach Urin und billigem Fusel. Kalter Zigarettenrauch hing schwer in der Luft, egal wie sehr er auch lüftete. Trotzdem war er nicht undankbar – immerhin musste er nicht im Freien schlafen, was bei den Wetterbedingungen wohl ziemlich schnell für eine Lungenentzündung gesorgt hätte. Aber die Absteige schien auch nicht das Beste für seine Gesundheit zu sein. Etwas Besseres kam allerdings nicht in Frage, zumindest vorläufig – von dem bisschen Geld, das er verdiente, musste er auch noch einen gewissen Anteil sparen, damit ihm sein Arbeitskollege Jonsey einen Ausweis besorgen konnte. Das war wichtig, und alles andere stand darum erst einmal hinten an.
Karl erhob sich langsam aus dem Bett. Sein Magen knurrte. Weil er Geld sparen musste, hatte er immer wieder aufs Essen verzichten und darum bereits einige Kilo abgenommen. Er fasste mit der linken Hand an seinen Bauch und blickte auf die beschädigte Uhr, die er aus einem Mülleimer genommen hatte. Er hatte noch etwas Zeit, bevor er zur Arbeit gehen musste, weshalb er aufstand, aufs Klo ging und danach einen Schreibblock samt Bleistift zur Hand nahm, sich zurück ins Bett setzte und an seiner Geschichte weiter schrieb.
Er musste versuchen, eine Geschichte von sich an die örtlichen Zeitschriften zu verkaufen. Dann könnte er – hoffentlich – genügend Geld verdienen, um ein wahrhaft befreites Leben zu führen, also genau das, was er sich durch das Emigrieren nach Kanada eigentlich erhoffte. Leider wollten die meisten Magazine nichts von ihm wissen, sie hatten genügend eigene Autoren. Vor allem die zwei kleineren Homosexuellen-Verlage, von denen Karl zum jetzigen Zeitpunkt wusste, schienen bis auf Jahre hinaus ausgelastet zu sein. Anscheinend versuchten die meisten Einwanderer, mit hastig geschriebenen Geschichten zu schnellem Geld zu kommen. Die Qualität war dabei natürlich sehr unterschiedlich, jedoch war wohl in Anbetracht der Umstände nichts anders zu erwarten. Karl konnte nicht wirklich böse sein, dass auch andere es versuchten, nur störte es ihn auf einem „künstlerischen“ Empfinden, dass andere Typen es leichter hatten, etwas zu veröffentlichen als jemand, der bereits etwas publiziert hatte. Aber wer in Kanada hatte denn je von einem klammheimlich produzierten Winkel-Magazin namens „Gejo“ gehört? Doch wohl niemand.
Er musste sich damit abfinden: in Kanada war er im Moment ein Niemand, und er musste auch solange ein Niemand bleiben, bis er genug Geld besaß, um durch einen Personalausweis zu einem Jemand zu werden. Sein deutscher Ausweis half ihm hier nicht weiter, ganz und gar nicht. Er musste auf illegalem Wege legal werden, anders ging es nicht.
Er tippte mit der Spitze des Bleistifts auf dem Block herum. Er versuchte seit Tagen, eine Geschichte zu schreiben, die er an nicht-schwule Magazine verkaufen könnte. Einen Krimi, womöglich, vielleicht sogar eine lustige Alltagsgeschichte. Es schien ihm als beste Alternativ zu den überforderten Schwulenheften, jedoch wusste er insgeheim, dass die nicht-schwulen Verlage womöglich zunächst einen Identifikationsnachweis erbracht haben wollten, bevor sie eine Geschichte annahmen, weshalb seine Bemühungen in dieser Richtung vergeblich wären. Dennoch – es schien ihm als beste Alternative. Er brauchte Geld, und mit bloßem Tellerwaschen würde er es nie schaffen. Oder es würde zumindest mehr Zeit in Anspruch nehmen, als das er zu opfern bereit wäre. Verdammt, er war doch nicht nach Kanada gegangen, um sich weiter zu verstecken! Er wollte Geld haben, er wollte rausgehen, das Leben genießen, durchs Land reisen, an den Strand gehen und hübsche braungebrannte Männer mit durchtrainierten Oberkörper kennenlernen, mit denen er kuscheln und an deren starken Schultern er sich anlehnen konnte! Wenn er das erst tun könnte, wenn er sich durchs Tellerwaschen das Geld für den Ausweis zusammen gespart hatte, dann wäre er doch garantiert alt, und die hübschen jungen Kerle, auf die er stand, würden ihn dann keinen guten Blickes mehr würdigen, sondern ihn nur als perversen, alten Lustgreis betrachten. Als ob ältere Schwule kein Recht auf Liebe mehr besaßen ... aber verdammt, er wollte jetzt mit den hübschen Männern zusammen sein, die er in den „Gejo“-Heften neben seinen Geschichten immer gesehen hatte. Er wollte so sehr ... aber das Leben ließ ihn nicht.
Der Bleistift schwebte immer noch über dem Papier, das mit mehreren fehlgeschlagenen Versuchen übersät war. An einigen Stellen waren die ins Leere laufenden Wörter noch wegradiert, so dass sich dort das Papier ausdünnte, aber alle anderen Anfänge wurden einfach durch dicke, frustrierte Striche unkenntlich gemacht. Ihm wollte einfach kein guter Anfang einfallen. Es schien, als sei sein kreatives Talent regelrecht ausgetrocknet, so als hätten die letzten Wochen ihn innerlich ausgehöhlt und nur die dumme, schmerzhafte Hülle zurückgelassen. Immerhin würde das die ständigen Magenverstimmungen erklären, dachte er und massierte sich flüchtig den Bauch.
Er brauchte eine gute Geschichte. Etwas, das ihn aus diesem Loch heraus in ein besseres Leben führen würde. Aber ihm fiel nichts ein. Er konnte einfach nichts schreiben. Er starrte aufs Blatt, sah die vielen vorherigen Versuche und realisierte schließlich, dass er keine Zeit mehr hatte. Er musste zur Arbeit. Es ging nicht anders. Ein weiterer Tag in der Hölle, die sein Paradies hätte sein sollen, verdammt, verdammt nochmal ...
Für einen Moment dachte er, dass er alles hinschmeißen sollte. Dass er wieder zurückkehren sollte. Auch auf die Gefahr hin, dass man ihn dann kontrollierte und ins Gefängnis warf ... aber der Gedanke verschwand so schnell, wie er aufgetaucht war. Aufgeben war keine Option. Es musste einfach weitergehen, irgendwie ... es musste ...
Das Flugzeug landete auf dem Flughafen von Austin, Texas. Offizier Schmidtz ging mit den anderen Fluggästen von Bord, wo ihn bereits ein Mann erwartete. Der Mann trug eine strenge schwarze Uniform und hielt ein Schild hoch, auf dem Schmidtz' Name stand.
„Offizier Schmidtz? Ich bin Offizier Straub. Darf ich Ihnen Ihren Koffer abnehmen?“
„Danke, nicht nötig. Ich würde es begrüßen, wenn wir die Angelegenheit hier so schnell wie möglich über die Bühne bringen können.“
„Natürlich. Folgen Sie mir.“ Straub ging voran durch den großen Flughafen, auf dem ein reges Durcheinander herrschte. „Oberoffizier Legfeld erwartet Ihren Besuch bereits. Worum geht es denn genau?“
„Nun, das werde ich wohl am besten mit ihm besprechen, nicht wahr?“, sagte er listig.
Straub nickte. „Gewiss. Verzeihen Sie meine Neugierde, aber es ist, mit Verlaub, schon etwas ungewöhnlich, dass wir derartigen Besuch bekommen.“
Er zuckte mit der Schulter. „Ich bin ein ganz normaler Offizier.“
Der D-S-A-Offizier blickte ihn schräg an. „Naja, so würde ich das nicht sagen. Immerhin wurde uns Ihr Besuch von der obersten Abteilung im Heimatland angekündigt. Das haben wir normalerweise nur bei hochrangigem Besuch ... mit Verlaub.“
„Ich bin zwar nur ein Offizier, aber wenn die Oberen meinen, mich so ankündigen zu müssen, dann werde ich nichts dagegen sagen. Die wissen schon, was sie tun, nicht wahr?“
„Natürlich. Die Partei steht über allem. Ich war nur neugierig, verzeihen Sie.“ Er verließ mit Schmidtz den Flughafen und ging zu einem großen schwarzen Auto, vor dem bereits ein farbiger Fahrer wartete. „Bitte“, Straub wies auf den Wagen.
Der Fahrer nahm den Koffer und verstaute ihn im Kofferraum. Schmidtz sah zum Offizier. „Ein Nigger?“
„Natürlich. Unwahrscheinlich zuverlässig, wenn man ihre primitiven Affengehirne erst einmal entsprechend abgerichtet hat. Wieso wundert Sie das?“
„Weil Nigger laut der Partei ausgerottet gehören“, sagte er monoton.
Der Fahrer lächelte und öffnete die Türen, woraufhin Straub und Schmidtz einstiegen. „Sicher, ja, Nigger gehören eigentlich ausgerottet“, fing der D-S-A-Offizier zu erklären an, während der Fahrer die Tür schloss, hinter dem Lenkrad Platz nahm und los fuhr. „Aber wir handhaben das hier ein wenig anders.“
„So?“
„Ja. Sie müssen verstehen – hierzulande wurden die Nigger ja schon immer als Arbeitskräfte eingesetzt. Das hat quasi Tradition. Erst als die Demokraten kamen, wurde das natürliche Verhältnis der Natur gestört, und den Niggern wurden irrsinniger Weise dieselben Rechte wie den Ariern aufgebürdet. Das ging natürlich nicht lange gut. Mord und Totschlag soll es gegeben haben. Aber das ist ja auch ganz natürlich und gar nicht anders zu erwarten. Man kann einen blutrünstigen, primitiven Hund nicht einfach so unabgerichtet irgendwo eingliedern. Das kann ja nicht gut gehen. Also ...“ Er machte eine fast schon entschuldigende Geste. „Aber nachdem die Partei den großen Krieg gewonnen hat, wurde das ja zum Glück alles geregelt.“
„Das beantwortet nicht meine Frage.“
„Ihre Frage? ... Ach, so, ja. Wissen Sie, die Partei hat zwar gesagt, dass alle blutsfremden Elemente ausgerottet gehören, aber das gilt doch eigentlich nur für größere Ansammlungen von diesen Niggern. Verstehen Sie? Afrika zum Beispiel. Da war es notwendig, die ganzen Nigger auszurotten, weil die sich sonst immer wieder vermehren. Wie wilde Tiere. Aber hierzulande haben wir nach dem Krieg eine ganz passable Lösung gefunden. Wir erlauben nur eine bestimmte Anzahl Nigger im Land, die wir auch noch streng kontrollieren. Das ist nötig geworden, weil einige trotz guter Erziehung dennoch artfremd gehandelt haben. Aber seit einigen Jahren achten wir da vermehrt darauf. Die Nigger dürfen maximal zwei Kinder zeugen und werden dann unfruchtbar gemacht. Die Niggerkinder werden von uns zu Helfern erzogen und dürfen dann ebenfalls bis zu zwei Kindern zeugen, bevor auch sie unfruchtbar gemacht werden. Auf diese Weise halten wir die Bevölkerungszahl der Nigger unter Kontrolle und haben genügend Arbeiter, die auf den Farmen zur Hand gehen. Das hat Tradition.“
„Trotzdem – was ist, wenn ein nicht kastrierter Nigger jetzt jemanden vergewaltigt oder ein Kind tötet? Man kann nicht alles mit Tradition entschuldigen. Die Partei hat ihre Gründe, warum sie ethnische Säuberungen anordnet.“
„Natürlich, selbstverständlich“, nickte Straub. „Aber ...“
„Weiß die Parteiführung davon?“, unterbrach Schmidtz.
„Nun ... Berlin ist weit ...“
Er sah zum Fahrer, dann zum D-S-A-Offizier. „Wenn man die Untermenschen nicht ausrottet, werden sie unweigerlich zur Gefahr. Tolerieren bedeutet Kapitulieren. Man darf in solchen Angelegenheiten keinerlei Zugeständnisse machen“, meinte er hart, bevor er wieder freundlich und entwaffnend guckte, so als würde von ihm keine wie auch immer geartete Bedrohung ausgehen. „Aber wo bleiben meine Manieren? Ich bin zum ersten Mal in diesem Teil des Reichs. Da ist es nur verständlich, wenn ich einigen Dingen begegne, die Sie hier anders handhaben.“
Straub nickte erneut. „Natürlich, natürlich, das verstehe ich. Und glauben Sie mir, unser Nigger hier ist ein ganz freundlicher, nicht wahr, Malcolm?“
Der Fahrer grinste breit und entblößte dabei seine Zähne. „Jawohl, das stimmt, ich könnte niemanden jemals etwas zu leide tun. Niemanden, nicht einmal einer Frau. Ich hatte bereits meine zwei Kinder und bin dann behandelt worden, und seitdem geht es mir besser“, sagte er und schien es auch zu meinen. „Ich tue, was man mir sagt, und was man mir sagt, das tue ich. Ich bin ein guter Fahrer, jawohl, das bin ich, und mehr will ich auch nicht sein.“
„Freut mich zu hören“, lächelte Straub. „Sehen Sie? Es funktioniert. Wir setzen die Vorgaben der Partei durchaus um, aber weil die D-S-A dann doch ein klein wenig anders sind als das Heimatland, müssen wir eben ein paar Anpassungen vornehmen. Anders wäre das aufgrund der Größe des Landes gar nicht zu bewerkstelligen.“
„Verstehe.“ Er sah geschwind aus dem Fenster. „Haben Sie Informationen aus der J-S-A?“
Der D-S-A-Offizier horchte auf. „Sind Sie etwa deswegen hier?“
„Nein. Es interessiert mich nur.“
Er zuckte erneut mit den Schultern. „Wir haben die Japaner zwar im Auge, aber es scheint alles in Ordnung zu sein. Wir sind ja schließlich nach wie vor Verbündete.“
„Gut. Das ist gut.“ Er sah weiter nach draußen.
Straub blickte ihn kurz an und wandte seinen Blick sodann zum Fahrer, der zuvor den Koffer des Heimatland-Offiziers einfach so in den Kofferraum packen konnte. Die Tatsache, dass Schmidtz dagegen nicht protestiert hatte, bewies für Straub, dass der Offizier den Grund seines Besuches nicht in irgendwelchen Unterlagen bei sich führte, sondern als Information im Kopf herum trug. Das deutete darauf hin, dass es sich um eine Angelegenheit von höchster Stufe handeln musste. Aber wenn dem wirklich so war, dann hätte die Parteiführung doch nicht einen einfachen Staatspolizei-Offizier vorbeigeschickt, sondern gleich einen General oder dergleichen. Etwas Ungutes schien vor sich zu gehen, weswegen es das klügste wäre, sich auf die positive Seite von Schmidtz zu stellen: „Ich könnte aber in Erfahrung bringen, ob es irgendwelche Hinweise auf verdächtige Aktivitäten innerhalb der J-S-A gibt. Das wäre kein Problem.“
„Wäre vielleicht hilfreich, danke.“
Er nickte. „Wenn es irgendetwas gibt, womit ich behilflich sein kann, dann sagen Sie es mir einfach, ja?“
Schmidtz wandte sich vom Fenster ab. „In Ordnung.“ Er blickte wieder raus.
Straub atmete tief durch und sah auf das gekräuselte Haar seines Fahrers, das unter der Mütze hervorlugte, bevor auch er sich dazu entschied, still aus dem Fenster zu sehen.
2.
Karl tauchte die Teller in die lauwarme Brühe und befreite sie von den verschmierten Essensresten, die teilweise hartnäckig kleben blieben. Für einen Moment grummelte ihm wieder der Magen, und ein stechendes Gefühl gesellte sich hinzu, weswegen er an seinen Bauch fasste und tief durchatmete. Eine Stimme erklang durch die gesamte Küche des Restaurants:
„Pause ist noch nicht. Arbeiten“, rief sein Chef Mr. LeMesurier. Der Kanadier sprach mit einer seltsamen Aussprache, die aber nicht allzu schwer verständlich war. Aufgrund der Einwanderer hatten die meisten Kanadier soviel an Deutsch aufgeschnappt, dass eine Kommunikation nicht vollständig unmöglich schien, auch wenn sich viele weigerten, die verhasste Feindessprache zu benutzen und stattdessen lieber auf Englisch oder sogar Französisch sprachen, aber das waren dann meistens Beleidigungen.
„Ich ruhe mich nicht aus ...“, sagte er gepresst und arbeitete weiter. Das Hungergefühl schien seinen gesamten Magen in Anspruch zu nehmen.
„Ich sehe alles“, rief LeMesurier und ging sofort zu einem der Köche, um ihn zu kritisieren: „Umrühren. Verstehen du das? Umrühren.“
„Ja doch, ja“, meinte der Angesprochene und tat wie befohlen.
Karl befreite die anderen Teller vom Dreck und schielte immer wieder auf die Uhr, die ziemlich versteckt in einer Ecke der Küche hing. Die Zeit wollte nicht schneller vergehen, aber irgendwann kamen auch die dahin kriechenden Sekunden ans Ziel, so dass er in die Mittagspause gehen konnte. Er saß in dem kleinen Raum, der wohl nur notdürftig als Mitarbeiterzimmer durchgehen konnte, und hielt sich wieder den Magen, was Jonsey bemerkte, der bereits vor ihm Platz genommen hatte.
„Was Falsches gegessen?“, sagte der schnurrbärtige Mann, der immer auf dem Sprung zu sein schien.
„Wohl eher zu wenig ... Ich will wirklich nicht ... ähm ...“
„Was denn? Well?“
„Könntest du mir nicht den Ausweis jetzt schon besorgen? Ich zahle ihn dir ja auch. Du kannst dich auf mich verlassen.“
Jonsey schüttelte den Kopf. „Sorry, aber das geht wirklich nicht. Ich meine, du sagst zwar, dass du mir dann das Geld gibst, und wahrscheinlich würdest du das auch tun, aber darauf lasse ich mich nicht ein. Ist eine, how do you say, Prinzipienfrage.“ Der leichte fremde Akzent kam in der Stimme durch – Jonsey war mit allen Wassern gewaschen und konnte darum Deutsch sowie Englisch und Französisch sprechen, wodurch allerdings seine eigentliche Klangfärbung verloren ging.
„Es ist nur ...“ Er griff sich stärker an den Magen. „Ich bekomme schon Magenkrämpfe, weil ich ständig Angst habe, dass man mich erwischt und wieder zurückschickt.“
„Das verstehe ich, das verstehe ich sogar gut.“ Er holte sich eine Zigarette aus der Brusttasche und zündete sie an. „Und mit der Gesundheit ist nicht zu spaßen. Aber du musst das auch von meiner Seite aus betrachten. Ich meine, es ist doch so – du bist zwar ein netter Kerl, aber du wirst ja auch nicht ewig hier bleiben wollen, richtig?“
Er nickte. „Richtig. Ich wollte ...“, fing er an, aber Jonsey sprach sofort weiter.
„Niemand will ewig hier bleiben. Nichts gegen den Chef, aber wenn der bellt, dann wird es ungemütlich. Das verstehe ich. Das hier ist nur ein Zwischenstopp für euch Aussteiger. Eine Möglichkeit, unkompliziert Geld zu verdienen. Aber sobald ihr die Möglichkeit habt, weiterzuziehen, tut ihr das auch. Das ist immer so. Ich habe das schon oft gesehen. Das ist jedes Mal das gleiche. Die Aussteiger kommen irgendwie über die Grenze, und dann landen sie in irgendeiner Arbeitsstelle, bei der man nicht viel fragt, und jemand Nettes wie ich gibt dann gegen eine gewisse Bezahlung die Möglichkeit, legal in unserem schönen Land zu wohnen. Und soll ich dir sagen, was das erste ist, das passiert, sobald einer von euch Aussteigern den Ausweis in der Hand hat?“ Er stieß etwas Rauch durch die Nase. „Sobald das geschieht, wird hier wieder ein Posten frei. Das ist immer so. Sobald man legal hier ist, wird weiter gereist. Die meisten haben noch nicht einmal den Anstand vorbeizukommen und richtig zu kündigen, aber gut, ihr arbeitet ja auch nicht richtig hier. Ich meine, LeMesurier muss ja auch aufpassen und den Kontrolleur schmieren. Das darfst du auch nicht vergessen. Ist alles eine schön funktionierende Maschine, und Maschinen mögt ihr Deutschen doch, mmh? Aber damit das alles funktioniert, muss es eben nach gewissen Regeln ablaufen, und Regeln mögt ihr Deutschen doch noch mehr, habe ich recht?“
„Ich würde nicht abhauen. Ich würde den Ausweis bezahlen.“
„Sicher. Du würdest das tun. Aber wenn ich das bei dir mache, wenn ich also bei dir ein Auge zudrücke, ja dann wird das doch jeder wollen.“
Karl schüttelte den Kopf. „Ich sage das doch nicht weiter ...“
„Trotzdem – irgendwie macht so was immer die Runde. Hey, glaub mir, ich bin hier nicht der Böse oder so, nur weil ich auf Vorkasse bestehe. So geht das nun einmal. Ich kann mir das Geld, das ich dem Fälscher geben muss, doch auch nicht einfach so aus den Rippen schneiden. Okay?“
Er nickte schwach. „Ja ...“
Jonsey zog an der Zigarette. Während er sprach, stieß er den Rauch durch den Mund aus, wodurch sein Gesicht kurzzeitig im Dunst verschwand. „Das hier ist doch eine Chance für euch. Verstehst du das Wort Chance? Oder wie sagt man im Deutschen? ... Ähm, Möglichkeit, genau. Das hier ist eine Möglichkeit für euch Aussteiger. Ich meine, ich weiß ja nicht, weswegen du geflohen bist, und das geht mich auch nichts an. Jeder hat seine eigenen Probleme, und jeder, der vor den Nazis flieht, ist für mich okay. Aber niemand kann erwarten, dass man ihm einfach so alles in die Hand gibt. Ist doch klar, oder? Ihr müsst erst mal etwas tun, um euch hier zu beweisen. Und das bedeutet nun einmal, Geld zu beschaffen.“ Er kratzte sich nachdenklich am Kinn. „... wenn du wirklich schnell den Ausweis bezahlen willst, dann musst du eben schnell an Geld kommen. Und mit Tellerwaschen wird das eine Weile dauern, das weißt du, ja?“
„Ich weiß.“
Jonsey betrachtete ihn lauernd. „Was hast du im Reich denn gearbeitet?“
Er stieß etwas Luft durch die Nase. „Ich habe in einem Großhandel gearbeitet. Den Hubwagen gesteuert. So was eben.“
Der Kanadier lachte auf. „Ha, wenigstens etwas, würde ich sagen. Ist nicht viel, aber wenigstens etwas. Kann ich nur zu gut verstehen, dass du davor fliehen wolltest.“
„Darum ging's nicht ...“
„Klar, klar. Ich mache doch nur Spaß.“
Karl sah zu Boden. „Ja, aber danach ist mir gerade nicht zumute ...“
„Sicher.“ Er lutschte förmlich an der Zigarette. „Und sonst keine Fähigkeiten?“
„... inwiefern?“
Er stutzte für einen Augenblick, so als müsste er erst überlegen, was das Wort bedeutete, bevor er wieder seine normale Einstellung wiedererlangte. „Was hast du sonst so gemacht? Nur mit dem Hubwagen durchs großdeutsche Reich?“
Karl lächelte leicht verlegen. „Nein ... ich habe auch geschrieben.“
„Geschrieben?“
„Ja“, nickte er. „Das versuche ich auch hier, aber ...“
„Niemand will dich?“
„Keine Ahnung ... Ich kann einfach im Moment nicht schreiben ...“ Wieder fuhr ein Schmerz in seinen Bauch, aber er wollte es sich nicht anmerken lassen.
„Auch was veröffentlicht?“
„Schon, aber das hilft mir hier nicht weiter, nicht wahr?“
Jonsey grinste schmal. „Nein, nein, das wohl weniger, nein.“ Er stieß wieder Rauch aus und stand auf. „Hey, ich sag dir was – ich kann zwar den Ausweis für dich nicht im Voraus besorgen, das geht wirklich nicht ... aber ich kann versuchen, für dich irgendwie sonst Arbeit zu finden. Das wäre dann zwar wegen dem fehlenden Ausweis immer noch nicht völlig legal, aber du könntest schneller an Geld kommen. Was meinst du?“
Karl wusste, das Jonsey damit unter Garantie etwas meinte, worauf man sich nicht einlassen sollte, aber die Möglichkeiten, anders schnell an Geld zu kommen, waren aufgrund von Bürokratie versperrt, weshalb er nickte. „Das wäre gut ... danke ...“
„Hey, für einen Aussteiger doch immer“, grinste der Kanadier und ging aus dem Raum.
Karl blieb noch etwas, bevor er auch wieder in die Küche ging und weiter die Teller säuberte. Das Druckgefühl in seinem Bauch blieb – es war ein Ziehen mitsamt einem stechenden, fast schon gelegentlich brennenden Gefühl seitlich des Bauchnabels. Höchstwahrscheinlich bildete sich wegen der Sorgen ein Magengeschwür. Verdammt, hätte er gewusst, dass es so schwer werden würde, er hätte ... ja, er hätte ... verdammt, er hätte sich genauso entschieden wie er es getan hatte. Es gab für ihn keine Heimat in Deutschland oder einem anderen von der Partei regiertem Land, und in die Japanischen Staaten oder die von den Italienern kontrollierten brauchte er auch nicht zu gehen. Es gab nur Kanada und sonst nichts auf der Welt. Da musste man eben eine Zeitlang mit der Nase durch den Dreck schleifen, bevor man sich endlich aufrecht hinstellen durfte.
Er verrichtete seine Arbeit, ohne wirklich darüber nachzudenken, was er eigentlich tat. Es waren immer wieder die gleichen Handhabungen und Abläufe, so dass er schon automatisch handelte. Er dachte darüber nach, dass er eine tolle Geschichte schreiben würde, die dann sofort angenommen wird und ihn von all seinen Sorgen befreit. Und er dachte darüber nach, wie schön es wäre, auch hier endlich mal wieder jemanden zu treffen, mit dem man zusammen sein und sich lieben konnte. Das letzte Mal Sex war schon einige Zeit her und zählte nicht – es war mit einer Frau unter Zwang geschehen, und daran wollte er nun wirklich nicht denken müssen. Mochten auch so gut wie alle anderen Männer Sex mit einer Frau bevorzugen, aber für ihn war diese eine Erfahrung mithin die schlimmste Erinnerung seines Lebens. Selbst die Erinnerungen an einen unangenehmen Zahnarztbesuch waren nicht so stark wie der Ekel, den er empfand, wenn er daran dachte, wo hinein er sein Glied gesteckt hatte, um nicht als „andersartig“ entlarvt zu werden. Bevor der Gedanke daran überhandnahm, lenkte das Magengefühl ausnahmsweise einmal hilfreich ab.
Er atmete erneut tief durch – er musste schnell an Geld kommen, um hier überleben zu können. Und er müsste wieder schreiben, damit er sich nicht ständig selber in Frage stellte. Wenn er schrieb, dann war die Welt für diesen Augenblick in Ordnung, aber wenn er es nicht konnte, dann nahm er die Hölle, in der er lebte, ungefiltert wahr, und es schien, als gebe es nichts, was er dagegen tun könnte.
Der schwarze Wagen hielt vor einem großen, weitläufigen Haus, das schon eher einem Palast gleichkam und von einer enormen Rasenanlage umgeben war. „Das ist nicht das Hauptquartier“, sagte Schmidtz matt.
„Nein“, meinte Straub, während der Fahrer die Tür aufhielt. „Aber Oberoffizier Legfeld erwartet Sie offiziell erst morgen.“
„Und das bedeutet?“ Der Offizier stieg aus und sah sich das Haus mit den enormen Säulen genauer an. Es war eindeutig mit dem Vorsatz gebaut worden, möglichst einschüchternd auf jeden Besucher zu wirken.
„Dass Sie ihn heute bereits privat sehen.“
„Ich muss zugeben, dass ich immer noch nicht ganz verstehe, was Sie meinen.“ Er ging zum Kofferraum und wartete, bis der Fahrer ihm seinen Koffer gereicht hatte.
Straub lächelte. „Nun, es ist ganz einfach. Der morgige Termin im Hauptquartier wird natürlich in den Unterlagen aufgezeichnet, so wie es sich gehört.“ Er gab dem Fahrer ein Zeichen, sich um den Wagen zu kümmern, während er zusammen mit Schmidtz zur Eingangstür des Gebäudes ging. „Und das bedeutet, dass Sie und Oberoffizier Legfeld überhaupt keine Gelegenheit haben werden, sich privat zu unterhalten.“
„Und wer sagt, dass das nötig ist?“
„Nun, das liegt doch auf der Hand.“ Er blickte ihn seitlich an. „Das Heimatland schickt keinen einfachen Offizier hier her, ohne dass es einen besonderen Grund dafür gibt. Der Oberoffizier möchte darum nur sicherstellen, dass Sie morgen im Hauptquartier nichts sagen oder anweisen, was für Verwirrung sorgen könnte, Sie verstehen?“
Er nickte. „Natürlich.“
„Sehr gut.“ Straub ging zur Tür, die ohne dass er anklopfte oder klingelte, bereits von einem bullig aussehenden Sicherheitsbeamten geöffnet wurde.
„Der Oberoffizier erwartet Sie bereits“, knurrte der Kerl und sah zu Schmidtz. „Keine Waffen.“
„Ich habe keine“, meinte er und hob die Hände ein wenig an. „Aber wenn es Sie beruhigt, dürfen Sie mich gerne durchsuchen.“
Der Sicherheitsbeamte packte ihn grob an, durchsuchte ihn sowie den Koffer, wobei Straub vergeblich versuchte, einen Blick hinein zu werfen, und nickte sodann. „Sauber.“
„Natürlich.“ Der Offizier sah zu Straub. „Können wir?“
„Hier entlang“, lächelte der D-S-A-Offizier und ging voran.
Schmidtz sah die große Eingangshalle, in der eine goldene, latent kitschig anmutende Statue des großen Führers stand. Der Arm war weit ausgestreckt, und die Augen der Figur blickten beinahe gebieterisch in die Ferne. „Ein Einzelstück“, wies Straub darauf.
„So?“ Er war nicht beeindruckt.
„Ja. Das gute Stück wurde Anfang der 1950er Jahre angefertigt. Es besteht aus ... mmh, die genaue Anzahl weiß ich jetzt auch nicht, aber es sind schon ziemlich viele ...“
„Viele was?“
„Zähne“, meinte der D-S-A-Offizier sofort. „Wir hatten hier in Amerika ja auch viele Unerwünschte, die ausgerottet werden mussten. Wir haben sie dann ebenfalls weiter verwertet, um noch etwas aus ihnen raus zu bekommen. Da sind wir genauso effizient wie die Leute im Heimatland. Die Statue wurde aus vielen Goldzähnen gegossen. Es gibt noch eine ähnliche im Hauptquartier, aber streng genommen ist diese hier ein Unikat, weil die andere Statue nicht aus denselben Zähnen hergestellt sein kann, Sie verstehen?“ Er ging weiter. „Der Oberoffizier ist sehr stolz auf diese Statue. Wenn er Ihnen also etwas dazu sagen möchte, dann sein Sie bitte so höflich und hören ohne Unterbrechung zu, ja?“
„Natürlich.“ Schmidtz blickte sich weiter um, während er und Straub die langen Gänge entlang schritten, an deren Wänden unzählige Portraits hingen, die Legfeld in kämpferischen Posen zeigten. Ganz offensichtlich hatte der Oberoffizier seine arische Linie voll und ganz aufgesogen und präsentierte sich nun als waschechten Vollblutdeutschen, obwohl bereits eine kurze Recherche bei der Staatspolizei ergeben konnte, dass Legfelds Familie noch bis 1947 als Layfield bekannt war und die angeblich deutschen Vorfahren eigentlich aus Holland stammten. Schmidtz registrierte die bedingungs- und hemmungslose „Arisierung“ von Legfeld mit einiger Genugtuung – die von der Partei angeordnete Umerziehung der kulturellen Werte und nationalen Selbstverständlichkeit schienen hier vollends gegriffen zu haben, auch wenn in einigen anderen Bereichen durchaus noch Verbesserungsbedarf bestand.
Sie erreichten einen großen Raum, in dem einige hochgewachsene Männer um einen Billardtisch herum standen. „Oberoffizier Legfeld? Ich habe Oberst Schmidtz bei mir“, sagte Straub untertänig.
Legfeld, ein stattlich gewachsener Mann mit einem falschen Grinsen, ging sofort auf Schmidtz zu und reichte ihm seine prankenhafte Hand. „Freut mich, freut mich. Ich hoffe, Sie hatten bisher eine gute Reise.“
„Den Umständen entsprechend.“
„Den Umständen?“ Er verstand nicht.
Schmidtz erklärte. „Der Fahrer. Ein Nigger. Es war mir neu, dass einige hier noch erlaubt sind, aber Offizier Straub hat es mir erklärt.“
Legfeld lachte künstlich. „Ja, ha-ha, das ist bei uns nun mal ein wenig anders als im Vaterland. Aber selbst da ist es doch von Bundesland zu Bundesland etwas anders, nicht wahr? Glauben Sie mir, ich mag die Nigger auch nicht, aber man kann sich an die durchaus gewöhnen.“
„Und genau das sollte man nicht.“ Er blieb freundlich, aber streng.
Straub schaltete sich ein. „Ich habe Ihm bereits erklärt, wie das mit der Sterilisierung abläuft. Uns werden die Nigger nicht auf der Nase herumtanzen.“
Schmidtz nickte. „Natürlich nicht, das wollte ich damit auch nicht angedeutet haben. Es ist für mich nur eine kleine Irritation, nichts weiter.“
„Ha, ja, das kommt vor, was?“, lachte Legfeld und zeigte auf den Billardtisch. „Spielen Sie mit? Oder können Sie das nicht?“
„Darum geht es nicht, danke. Ich hatte eigentlich gedacht, dass ich gleich in Ihrem Büro mit Ihnen spreche, aber wie mir Offizier Straub sagte, wollten Sie mich gerne zuvor persönlich sprechen.“ Er sagte die Worte ohne besondere Betonung.
Der hochgewachsene Leiter der D-S-A-Staatspolizei grinste breit, drehte sich zu den anderen Männern um, gab diesen ein Zeichen und sah wieder zu Schmidtz. Die Männer spielten allein weiter, während Legfeld auf den Koffer blickte.„Nun ja, Sie müssen zugeben, dass Ihre Ankunft hier schon ein paar Fragen aufwirft.“ Der Oberoffizier ging voran durch den Raum und setzte sich auf der Terrasse auf einen Stuhl, vor dem ein großer weißer Tisch stand. Von der Terrasse aus konnte man das gesamte weitläufige Gebiet überblicken, das an den Rändern von hohen Mauern und Wachtürmen umgeben war. „Ich meine, es kommt schließlich nicht alle Tage vor, dass ein Offizier aus dem Vaterland hier her kommt und einen persönlichen Termin bei mir hat. Da werden natürlich einige Fragen laut.“
„Wieso?“ Der Deutsche setzte sich hin und stellte den Koffer zwischen seine Beine.
Straub nahm neben ihm Platz. „Das habe ich Ihnen doch gesagt – es wirkt seltsam, wenn die oberste Abteilung den Besuch eines einfachen Offiziers ankündigt.“
Schmidtz ließ seine Augen kurz zu ihm schnellen. „Ja, das haben Sie gesagt.“
Ein farbiger Diener kam an den Tisch. „Das übliche, für alle“, wies Legfeld den Diener an. Nachdem der Mann verschwunden war, lehnte er sich vor. „Ich bin gerne Befehlshaber, und ich bin ein guter Befehlshaber. Verstehen Sie das? Als guter Befehlshaber der Staatspolizei der Deutschen Staaten von Amerika kann ich es daher auf den Tod nicht leiden, wenn etwas vor sich geht, von dem ich nichts weiß. Und ich weiß auf Teufel komm raus nicht den Grund Ihres Besuches. Normalerweise kann ich so etwas ganz einfach in Erfahrung bringen, aber dieses Mal scheint das alles absolut geheim zu sein. Das macht mich stutzig, und das macht mich dann rasend. Und das will ich nicht sein. Darum haben wir hier dieses kleine, freundschaftliche Gespräch. Ich werde nicht zulassen, dass irgendjemand in mein Büro kommt und etwas sagt oder anordnet, von dem ich keine Ahnung habe. Und es ist mir verdammt nochmal egal, ob er von der obersten Abteilung der Staatspolizei des Vaterlandes hergeschickt worden ist oder nicht. Hier habe ich das Sagen. Haben wir uns klar und deutlich verstanden?“
Schmidtz nickte. „Natürlich.“
„Sehr gut“, der Oberoffizier grinste wieder sein falsches, breites Lächeln. „Damit Sie nicht denken, dass ich keine Manieren habe, gibt es erst einmal etwas zu essen. Meine Köche sind zwar Nigger, aber gerade darum können die gut kochen. Die wissen, das zu viel Salz bedeutet, dass ich sie als Freiwild benutze, ha ha ha ha.“ Er lehnte sich zurück. „Haben Sie schon mal einen Nigger um sein Leben laufen sehen? Das ist ein Anblick, den man gesehen haben muss. Aber das kennt ihr im Vaterland wohl nicht. Da hättet ihr euch ein paar Nigger zum Züchten aufheben müssen.“
„Wir haben sie allesamt ausgerottet, damit wir da keine Probleme haben. Und trotzdem gibt es in anderen Bereichen Probleme.“
„... so?“ Legfeld horchte auf.
„Ja“, nickte Schmidtz, „darum bin ich auch hier.“
„Gut, gut“, der Oberoffizier leckte sich über die Lippen, „aber darüber reden wir dann nach dem Essen. Sie werden zugeben müssen, das es hervorragend schmeckt.“
Der Offizier blieb unnahbar, aber höflich: „Wir werden sehen.“
Legfeld lachte künstlich auf und sah zu Straub: „Wir werden sehen, ha ha ha, wir werden sehen. Das liebe ich an den Vaterlandsdeutschen – diese grenzenlose selbstsichere Überlegenheit, ha ha ha.“ Er entblößte seine falschen Zähne, so als wollte er mit ihnen seinen Gast am liebsten auf der Stelle zerreißen.
Jimmu säuberte seine Wohnung von allen verdächtigen Spuren und sah sich sodann noch einmal genauestens um, ob er nicht doch irgendwo an irgendeiner schwer zugänglichen Stelle einen Blutspritzer übersehen hatte. Zu seiner Erleichterung stellte er fest, dass er gute Arbeit geleistet hatte. Selbst seine Wahnvorstellung war wieder abgeklungen, so dass er mit klarem Verstand die beiden schwarzen Müllsäcke mit der fein säuberlich zerteilten Leiche packte, zur Wohnungstür schleifte und hinaus ging zu seinem kleinen kanadischen Wagen, der auf der Straße stand. Da er in einer ruhigen Nachbarschaft wohnte, in der jeder seinen eigenen Dingen nachging, kümmerte er sich nicht darum, ob es klug wäre, die Beweisstücke am helllichten Tag loszuwerden – bislang hatte ihn noch nie jemand dabei gestört, und auch dieses Mal konnte er die Säcke ohne Störungen von außen in den Kofferraum befördern. Er stieg sodann ins Auto und fuhr los.
Die kanadischen Wälder rauschten an seinem Wagen vorbei, während er sich dazu entschied, das Radio einzuschalten. Trotz der mittlerweile überwiegend aus Emigranten zu bestehenden Bevölkerung kamen die Nachrichten immer noch vorwiegend in Englisch, zumindest in diesem Teil des Landes. In einigen anderen Gebieten wurde das ansonsten weltweit fast schon vollkommen ausgestorbene Französisch gesprochen, das er nicht so gut verstand wie die englische Sprache. Der Moderator erwähnte nichts großartig interessantes: der kanadische Premierminister wollte wie üblich härter gegen die illegalen Einwanderer durchgreifen, und in einem anderen Teil des Landes war es zu einem Waldbrand gekommen, der mehrere Hektar Wald verbrannte, bevor er gelöscht werden konnte. Natürlich vermuteten die dortigen Einwohner, dass die Emigranten das Feuer gelegt hatten, um auf diesem Wege zu neuen Wohnräumen zu gelangen, denn auch wenn die Stadt keine weiteren billigen Wohnungen bauten, so hätten die Illegalen nun doch eine große Fläche, auf der sie sich ausbreiten könnten. So etwas Ähnliches hätte es schon in vielen anderen ländlichen Gegenden gegeben, jedenfalls nach Ansicht der Frau, die man zu diesem Thema befragte und die ihre ungefilterte Meinung dann durch den Äther hetzte. Erst ganz am Schluss wurde über deutsche Politik gesprochen, dann über die Italiener und schließlich fielen sogar ein, zwei Worte über die Japaner, die sich seit einiger Zeit abgeschottet hätten. Jimmu musste bei dieser Wortwahl lächeln – es war für den westlichen Verstand wohl nach wie vor nicht nachvollziehbar, warum die Japaner trotz relativer Weltbeherrschung ihre innenpolitischen Probleme lieber im Geheimen lösen wollten, anstatt die Bevölkerung anderer Länder daran teilhaben lassen zu wollen. Da war der japanische Geist doch etwas völlig anderes – nicht umsonst hatte Japan sich vor mehreren Jahrhunderten für einige hundert Jahre vom Rest der Welt abgetrennt, um auf diesem Wege zur inneren Stärke zu gelangen. Der Rest der Welt unterschätzte damals Japan deswegen, oder aber sie hatten das japanische Kaiserreich schlicht und ergreifend nicht als ernst zu nehmenden Gegner in ihre Überlegungen miteinbezogen, weshalb das Land der aufgehenden Sonne siegreich sein konnte. Zwar mit Hilfe der Nazis, ja, sicher, aber wer einen großen Krieg gewinnen will, der muss eben auch mal einen Frieden mit dem Feind des Feindes schließen. Das war der japanische Weg, und irgendwann würde die Weltsprache Japanisch lauten. Da war sich Jimmu sicher. Es war nur eine Frage der Zeit – Japan ruhte eben im Moment, um die Kräfte zu bündeln. Das konnte der Westen einfach nicht verstehen.
Nach den Nachrichten kam Musik. Wie immer kanadisches Gitarrenspiel samt unmelodischen Gejaule, das wohl Gesang darstellen sollte. Entweder in Englisch oder Französisch, da Japanisch, Deutsch und Italienisch nicht gespielt wurde, aber dieses untalentierte Geplärre machte ein ums andere Mal nur zu deutlich, dass man in diesen beiden hier erlaubten Sprachen einfach keine Gefühle transportieren konnte. Englische und französische Lieder klangen für Jimmu immer kalt, öde und leer. Die kanadische Regierung sollte verbieten, dass man in diesen widerlichen Sprachen singen durfte – das hatte einfach keinen Sinn. Selbst Kleinkindergeplärre wäre angenehmer gewesen.
Trotzdem ließ er das Radio weiterspielen. Die Fahrt würde noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Er musste die Müllsäcke schließlich irgendwo in den Wald bringen und dort wenn möglich vergraben. Die Arbeit nahm eben manchmal kein Ende, aber solange es ihn von seinen Vorstellungen befreite, nahm er es gerne in Kauf. Seine Penis-Wahnvorstellungen wurden von Mal zu Mal intensiver und damit realer ... er musste einfach töten, um sich selber zu schützen. Es war das Einzige, was er tun konnte ...
Legfeld klatschte in die Hände, woraufhin der farbige Diener den Tisch abräumte. „Na, was habe ich gesagt? War doch hervorragend, was?“
Schmidtz nickte leicht. „Das beste D-S-A-Essen, das ich bislang hatte“, sagte er schmal lächelnd.
Straub trank einen Schluck. „Und besser wird es nicht, das können Sie mir glauben.“
Der Oberoffizier schien zu warten, bis sein Diener den Tisch leer geräumt hatte und verschwunden war, bevor er sich zurücklehnte und Schmidtz ansah. „So, und Sie können uns allen jetzt eine Menge Zeit ersparen, wenn Sie einfach offen und ehrlich den Grund ihres Besuches nennen. Wäre nach dem guten Essen ja auch schon fast ein Zeichen der Dankbarkeit für die gezeigte Gastfreundlichkeit, nicht wahr?“
Der Deutsche ließ sich Zeit. „Eigentlich ist es eine offizielle Angelegenheit, und offizielle Angelegenheiten sollte auch nur in offizieller Umgebung besprochen werden. Das ist Vorschrift.“