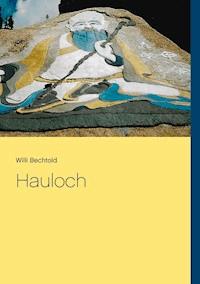
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Poesie und Drama
- Sprache: Deutsch
Hauloch - ein durch die Großeltern mit Mythen und Sagen beladener, leicht zerklüfteter Waldrain. Hier wurden die Träume von Weltreisen - verbunden mit großen Abenteuern - geboren. Nepal, Tibet und vor allem die Sahara waren die ersten Ziele. Auch schicksalhafte, oft abenteuerliche Begegnungen im Alltag berührten die Seele und ließen die Gefühlswelt aufwirbeln. Willi Bechtold, Hesse und Kosmopolit, erzählt in seinen Geschichten von außergewöhnlichen Reiseerlebnissen, wundersamen Begegnungen und prägenden Eindrücken. Sein authentischer Erzählstil ist lebendig und unverwechselbar und bereitet mit seinen tiefgründigen Gedanken ein unvergessliches Lesevergnügen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 180
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Für meine Familie
Inhalt
Kapitel 1: Absturz
Kapitel 2: Norden
Kapitel 3: Fremder
Kapitel 4: Schräglage
Kapitel 5: Wüste
Kapitel 6: Hexe
Kapitel 7: Heiligabend
Kapitel 8: Leichtsinn
Kapitel 9: Apokalyptische Wirrungen
Kapitel 10: Mungo
Kapitel 11: Flucht
Kapitel 12: Sterne singen
Kapitel 1
Absturz
British Columbia.
West-Kanada.
Trekking in den Bergen.
Was treibt mich eigentlich hierher?
Wollte solche Touren nicht mehr machen. Besessenheit, Illusionen oder Abenteuerlust? Vielleicht von jedem etwas.
Warum diese Plagerei wieder?
Bergauf, bergab, Regen, vielleicht Schnee, glitschiger Untergrund, Frieren, Schwitzen und weitere unangenehme Umstände.
Die Gruppengröße von acht Personen war ideal.
Ein Jeep brachte uns vom Ausgangsort, am Fluss gelegen, auf knapp 2.000 Höhenmeter.
Die ersten Regentropfen fielen.
Wind.
Nach Aussage der Einheimischen sollte das Wetter regnerisch bleiben. Keine optimalen Aussichten.
Der Fahrweg war zu Ende. Aufstieg.
Regenjacke anziehen und den Rucksack mit Regenschutz schultern.
Ein Blick in die Runde zeigte keine begeisterten Gesichter.
Der Jeep fuhr zurück und brachte unser Hauptgepäck auf die andere Talseite in eine Hütte. Diese Hütte war unser Anlaufpunkt. Die Tour ging über einen Pass, der auf 3.000 Höhenmetern lag.
Der Aufstieg, pfadlos, war rutschig und mühsam. Wir kamen in die Randzone der relativ tiefen Schlucht. Der Guide meinte, hier seien die Orientierung und auch die Bodenbeschaffenheit am besten.
Jeder schien seinen Gedanken nachzuhängen. Keine Gespräche.
Näheres Kennenlernen war bisher nicht möglich gewesen.
Der seitliche Abhang zur Schlucht war sehr steil. Stellenweise bewachsen. Die Sträucher verhinderten den Blick auf die Talsohle. Bach oder Fluss? An der Schluchtkante standen noch einige recht große Bäume. Die Wurzeln waren schluchtwärts zum Teil freigespült und ragten wie ein Federbausch in die Luft. Es grenzte an ein Wunder, dass diese schweren Kolosse noch Halt fanden.
Der Aufstieg wurde immer beschwerlicher.
Der Regen nahm zu.
Wind fegte durch die Schlucht und erzeugte eigenartige Geräusche.
Die meisten der Gruppe hielten sich im sicheren Abstand zur Kante.
Ich trat auf eine größere Wurzel. Plötzlich ein Erschüttern, die Wurzel hob sich und drohte auszureißen. Meine Reflexbewegung ging Richtung Baumstamm. Ich hatte größte Mühe, das Gleichgewicht zu halten und umklammerte den Stamm. Arme und Beine krallten sich affenartig fest. Das war eine schlechte Entscheidung. Ein Blick über die Schulter lähmte meinen Körper.
„Oh Sch...", die Wurzel reckte sich in die Höhe, und der Baum neigte sich immer mehr gen Schlucht.
Hätte ich mich anders entscheiden oder reagieren können? Nein.
Angst, Verzweiflung und Gefühlslosigkeit wechselten.
Die Gruppenmitglieder schrien: „Komm zurück!”
Unmöglich.
Langsam löste sich das Wurzelwerk aus dem Boden, und der Baum begab sich rutschend bergab in die Schlucht. Noch verzweifelter klammerte ich mich an den Stamm.
Ich verkrampfte.
Langsam bekam ich mit viel Mühe eine Hand frei und angelte einen kleinen Ast. Abrutschen vom Stamm war dadurch etwas reduziert. Die Rutschfahrt in die Tiefe ging mal schneller, mal langsamer. Je nach Hangbewuchs.
Ich schloss die Augen.
Immer wieder zuckte vorwurfsvoll durchs Hirn: Ich wollte nicht hierher. Ich wollte nicht hierher. Werde ich letztlich im Bergbach oder Fluss landen und ertrinken?
Die Gedanken fanden keine rationale Basis. Plötzlich ein Krachen der Äste, ein Ruck, und die Rutschfahrt schien zu Ende zu sein. Die Baumspitze war in der gegenüberliegenden Schluchtwand verkrallt.
Für die Dauer der Abfahrt hatte ich kein Zeitgefühl.
In solchen Situationen schwinden Einschätzung für Zeit und Raum.
Hinter mir hörte ich, dass noch einiges Geröll in die Tiefe schoss. Ohne mich zu treffen.
Nachdem das Ästekrachen und der Geröllabgang sich beruhigt hatten, atmete ich tief durch.
In welchem Zustand war ich?
Hände, o.k.
Füße, o.k.
Kopf, o.k. – Oh, meine Mütze war abhandengekommen.
Keinerlei Blessuren.
Rucksack war noch auf meinem Rücken.
Was nun?
Zurück war unmöglich.
Unter mir rauschte der Bergbach. Zwei oder drei Meter konnten es sein.
Mein Blick ging zur Baumspitze und von dort weiter nach oben.
Mir lief es eiskalt über den Rücken. Eine steile Bergwand ohne Bewuchs lag vor mir. Wenn ich hier wieder rauswollte, musste ich unweigerlich zur Felswand hoch.
Die Höhe war nur schwer einzuschätzen. Könnten achtzig bis hundert Meter sein. Spontan erinnerte ich mich an meine drei Klettergrundkurse und die folgenden Klettertouren mit einem Bergführer in den Alpen. Wenn ich die Grundregeln beachte, nicht kopflos werde, müsste ich da schon hochkommen.
Sofort schoss der altbekannte Horrorgedanke durch den Kopf: Wenn du aber in der Mitte der Wand die nötige Kraft verlierst, was wird dann?
Nun, ich war gut trainiert.
Allerdings, meine letzten Klettertouren lagen schon ein paar Tage zurück. Zunächst musste ich erst einmal zur Felswand. Ich hangelte mich mühsam durch das Geäst.
Der Baum lag stabil.
Was würde der Guide der Gruppe unternehmen? Würde er mich suchen lassen oder warten, bis ich vom Bergbach in den Fluss gespült würde? Ein Hubschrauber konnte hier nicht weiterhelfen. Ob es eine Bergrettungsmannschaft mit entsprechender Ausrüstung in dem kleinen Ort gab, bezweifelte ich schon.
Selber helfen, machte ich mir Mut.
Die Wand war aus festem Gestein; welcher Art konnte ich nicht exakt einordnen. Ähnlich Granit.
Erste Griffe zeigten ein festes Felsgefüge. Grundregel: Immer drei Punkte fix; beide Hände und ein Fuß oder beide Füße und eine Hand.
Ich angelte meine Trinkflasche aus dem Rucksack und nahm einen Schluck Tee.
Tief Luft holen.
Disziplin wahren, keine Hektik, signalisierte das Hirn.
Die ersten Klettermeter waren wie üblich: leicht und schnell.
Tempo drosseln; Kraft muss reichen, bis oben.
Ich schaute nicht nach oben und nicht nach unten. Meter für Meter hangelte ich mich im Zeitlupentempo hinauf.
Die Zeit verrann, und die Kräfte ließen nach. Erstes typisches Anzeichen: Knie zitterten. Rein gefühlsmäßig müssten die letzten Meter zu bewältigen sein.
Ich schaute nach oben. Drei bis vier Meter zum Ende der Wand, schätzte ich.
Allerdings ragte eine Humus- oder Erdschicht mit Wurzeln über die Kante. Seitlich sah ich eine helle Wurzel, leicht gekrümmt.
Das könnte ein Angelhaken sein.
Ein paar Griffe musste ich seitlich queren. Einige Steine lösten sich und kullerten in die Schlucht. Im oberen Teil der Felswand war das Steingefüge nicht mehr so fest.
Ich gelangte an die Wurzel.
Mehrfach heftiges Zerren blieb ohne Folgen. Dies gab mir die Gewissheit, dass ich diese Wurzel zum Hochziehen benutzen konnte. An die Wurzel und in den Boden krallend zog ich mich über die Kante. Krabbelte zwei bis drei Meter auf allen Vieren in sichere Gefilde.
Wieder spielten die Gedanken Karussell. Freude und ein gewisser Stolz überwogen jedoch bald.
Geschafft.
Mein Anorak und die Hose waren total verdreckt und nass. Ich stellte mich auf und ging noch ein paar Schritte Richtung Wald. Der Baumbestand war hier nicht so gewaltig wie auf der anderen Schluchtseite.
Was tun?
Ich musste wieder runter, talwärts, Richtung Fluss. In den Ausgangsort konnte ich ohne Überquerung des Bergbachs nicht gelangen.
Meine Hoffnung schwand.
Zunächst einmal bergab.
Der Regen hatte an Intensität zugenommen. Der Boden war rutschig und streckenweise morastig.
Umrisse einer Hütte oder eines Hauses zeichneten sich zwischen den Bäumen und dem Buschwerk ab.
Ich rief: „Hallo, ist da jemand?"
Nichts.
Ich wollte einem Erschrockenen nicht in die Flinte laufen.
Keine Regung, kein Laut. Nur das Rauschen des Bergbachs und der Regen waren zu hören.
Natürliche Geräusche.
Ich umrundete die Hütte.
Zur Bergseite war eine Tür.
Drei Stufen gingen hoch.
Die Tür war unverschlossen.
Quietschgeräusche beim Öffnen.
Das Innere machte einen halbwegs ordentlichen Eindruck. Ofen, kleiner Herd, zwei Regale gefüllt mit nicht leserlich beschrifteten Gläschen, ein Tisch, zwei Stühle und ein Eisenbett.
Im hinteren Teil war diverses Geschirr aufgehängt. Seitlich des Ofens lag noch etwas Trockenholz.
Den Ofen anheizen und die Kleidung trocknen war der erste Gedanke. Zündhölzer hatte ich immer in meinem Rucksack.
Ich zog Jacke und Hose aus, platzierte sie auf einem der Stühle vor dem Ofen.
Tee hatte ich noch. Wasser konnte ich, falls erforderlich, vom Bergbach holen.
Einige Nussriegel konnten mich noch wenigsten zwei bis drei Tage überleben lassen. Ich betrachtete meine Fingerkuppen, einige Risse und Schrammen.
Normal beim Klettern.
Die Kleidung trocknete schnell.
Ich beschloss, die kommende Nacht in der Hütte zu verbringen.
Das Schlafen auf dem Eisenbett war eine Tortur. Die Unterlage bestand nur aus Brettern. Ohne Schlafsack war das eine harte Angelegenheit. Im Stuhl sitzend hatte ich dann etappenweise ein paar Minuten geschlafen.
Der Morgen kam sehnlichst erwünscht. Ich musste weiter bergab. Meinen Rucksack platzierte ich an der Treppe und ging das Gelände nochmals inspizieren. Links verlief ein Pfad, wahrscheinlich zum Bergbach. Halbrechts ein Weg, konnte ein Fuhrweg Richtung Tal sein. Den konnte ich nehmen. Aber wo führte er hin?
Plötzlich, kurz vor mir, eine Bodenstruktur, die mir nicht natürlich vorkam. Der Vergleich mit dem umliegenden Waldboden zeigte klar einen menschlichen Eingriff. Eine Art Lattenstruktur zeichnete sich ab, mit Laub abgedeckt. Ich ging in die Knie und tastete mich langsam an das Gebilde heran. Es schien ein zugedecktes Erdloch zu sein. Eine Fallgrube für Wildfang? Eine nähere Untersuchung bestätigte meinen Verdacht.
Eine etwa zwei mal zwei Meter große Abdeckkonstruktion konnte ich ermitteln. Mit einem Stock stocherte ich durch das Abdeckgebilde; kein Grund.
Ich ging um die Fallgrube herum, welche mit Sicherheit von Jägern errichtet worden war, um mir den Abwärtsweg näher anzusehen. Ich war im Begriff meinen Rucksack zu holen, da hörte ich ein Motorengeräusch. Es kam vom Bergbach.
Suchte man doch nach mir?
Ich blieb stehen und lauschte. Plötzlich Ruhe.
Was tun?
Unvermittelt tauchte ein Mann auf. Als er mich sah, brachte er sofort sein Gewehr in Anschlag.
„Was suchst du hier?”, fragte er rechthaberisch. Er sah absolut nicht vertrauenserweckend aus.
„Ich bin auf Trekking-Tour", gab ich ohne langes Zögern zurück.
„Zieh deine Jacke aus und wirf sie hierüber!”
Ich zögerte.
„Die brauche ich aber."
Er kam mir ein paar Schritte entgegen und fuchtelte mit seinem Gewehr.
„Ich schieße, wenn du die Jacke nicht freiwillig hergibst."
Da schoss mir ein verwegener Gedanke durch den Kopf. Ich musste ihn zur Grube locken, in der Hoffnung, dass er sich hier nicht auskannte. Ich zog langsam meinen Anorak aus und legte ihn zögerlich ca. einen halben Meter auf die Grube.
„Zurück!”, befahl er.
Ich ging zwei, drei Schritte zurück. Er kam wie ein gieriges Tier Richtung Grube, um sich meine Jacke zu holen.
Mein Plan funktionierte. Prompt stapfte er auf die Abdeckung.
Ein Schrei.
Er fiel in die Grube, die recht tief schien. Sein Gewehr flog seitlich weg. Sofort hob ich es auf und beförderte es in die seitlichen Büsche.
Mein Anorak lag noch obenauf.
Was jetzt tun? Ihm helfen, aus der Grube zu kommen? Nein. Er jammerte. Er würde mir nicht wohlgesonnen sein.
Ich zog meinen Anorak wieder an, nahm meinen Rucksack und stapfte Richtung Bergbach. Der Pfad war nicht lang aber recht steil.
Der Bergbach war unten weniger reißend und wesentlich flacher. Ein Schlauchboot mit Außenbordmotor lag angebunden in einer kleinen Nische. Die Nische war nicht naturgegeben. Irgendwer hatte hier nachgearbeitet. Er musste schon ortskundig gewesen sein. Vermutlich war die Grube oben jüngeren Datums. Aber wo war der Aushub geblieben?
Ich schaute mir das Boot an. Der Zündschlüssel steckte im Zündschloss. Erfahrung mit Booten dieser Art hatte ich nicht. Wenn ich mit dem Boot wenigstens auf den Fluss käme, vielleicht würde man mich dort sehen.
Mit viel Unbehagen stieg ich in das Boot. Der Außenbordmotor, ein Yamaha, war hochgestellt. Ich drehte den Zündschlüssel und probierte einige Hebel und Schalter. Die kleine Antriebsschraube kam ins Rotieren.
Super.
Nochmaliges Schalten und Probieren gaben mir die Sicherheit, mit dem Gerät umgehen zu können.
Nachdem ich die Leine gelöst hatte, senkte ich zwar die Schraube ins Wasser, ließ aber den Motor nicht laufen. Irgendwie musste ich ja steuern können. So trieb ich Richtung Fluss.
Sofort schoss wieder ein Horrorgedanke durch meinen Kopf: Was würde geschehen, wenn der Motor versagte?
Ab in den Pazifik.
Die Gedanken rannten von einem zum anderen Karussell.
Nach relativ kurzer Fahrt erreichte ich den Fluss. Er floss gemächlich vor sich hin. Ich startete den Motor. Er sprang zu meiner Erleichterung sofort an.
Mit wenig Gas lenkte ich das Boot recht nahe an das Ufer und schipperte an ihm entlang.
Der Ort konnte nach meiner Einschätzung nicht mehr allzu weit sein. Wenn ich mich an die gestrige Fahrt erinnerte, betrug die Strecke höchstens fünfzehn Kilometer.
Keine Schiffe, keine Boote.
Langsam, mit wenig Gas, schlich ich mich am Ufer entlang.
Die ersten Häuser des Ortes kamen in Sicht. Jetzt packte mich die nächste Hektik. Kam der Bursche in der Grube etwa von diesem Ort? Ich konnte unmöglich mit dem Boot den Ort ansteuern.
Schätzungsweise zwei Kilometer vor dem Ort steuerte ich das Boot ans Ufer. Das Aussteigen war ein nicht geahntes Problem. Das Boot trieb immer wieder ab. Mir blieb nur eine Möglichkeit: mit Vollgas in die Uferböschung steuern. Meinen Rucksack hatte ich bereits ans Ufer geworfen.
Das Boot verhakte sich. Ich warf die Leine zum Ufer und sprang nach. Bekam die Leine sofort wieder zu fassen.
Halt.
Durchatmen.
Was wird mit dem Boot?
Ha, ab in den Pazifik, war meine Idee.
Ich zog das Boot soweit ans Ufer, dass ich den Motor erreichen konnte. Mit einem Stock sperrte ich die Lenkbewegungen des Außenborders. Ließ den Motor mit wenig Gas anlaufen und gab dem Boot einen Schubs. Die Leine warf ich hinterher. Sie trieb im Wasser.
Ich sah dem Boot lange nach. Es trieb etwa bis zur Mitte des Flusses und wendete sich Richtung Pazifik. Die Strömung in der Mitte des Flusses schien schneller zu sein als in Ufernähe. Erst jetzt bemerkte ich, dass ich mich total mit Schlamm besudelt hatte. Meine Bootsaktion hat mich das nicht merken lassen.
Weiter.
Was nun?
Ich erinnerte mich, bevor wir am gestrigen Morgen losgefahren waren, an ein Schild mit der Aufschrift Polizei.
Der Regen hatte zugenommen. Der Wind trieb den Regen fast in die Waagrechte.
Ich sah aus wie ein Schwein in der Suhle. Ein abrupter Gedanke formierte sich in meinen Hirnzellen: Bevor ich den Ort erreiche, beginne ich einen Geistesverwirrten zu spielen. Frage mich zur Polizei durch und erhoffe von dort weitere Hilfe.
Ob es klappt?
Ich ging los.
Kurz vor dem Ort - niemand war zu sehen - begann ich laut vor mich hin zu sprechen und torkelte etwas. Zwischen dem zweiten und dritten Haus stand ein Mann. Mir schien, er beobachtete mich schon länger. Er sah mich fragend an.
Ich stotterte: „Poli, Poli, Polizei.“
Er deutete nach vorn, zweite Straße rechts. Ich tat so, als verstünde ich ihn nicht.
Mit viel Geduld erklärte er mir den Weg nochmals.
Ich ging torkelnd weiter.
Polizeistation.
Ich setzte mich auf die Außentreppe. Der alte Herr war mir gefolgt. Er deutete mir an, reinzugehen.
Ich blieb sitzen.
Er ging rein und kam mit einem Polizisten zurück.
Wie ein Kind führte der Polizist mich in die Station.
Ich schwieg.
Der alte Herr ging.
Der Polizist nahm mir den Rucksack ab. Zögerlich öffnete er ihn. Eine Hülle mit meinen Papieren nahm er an sich. Mein Pass, Reisebeschreibung sowie auch die Adresse des Reisebüros in Deutschland waren in der Hülle.
Ein zweiter Polizist kam hinzu. Er brachte mir später ein Glas Tee. Mit vielen Gesten machte er mir klar, dass ich den trinken solle. Was ich dann auch tat, den Widerwilligen mimend.
Sie sahen sich meine nassen und verdreckten Klamotten an.
In einem Nebenraum hatte man mir eine Hose und ein Hemd bereitgelegt. Sie deuteten mir mehrfach an, ich solle mich umziehen. Es sah nach Sträflingskleidung aus. Ich nahm mir viel Zeit.
Inzwischen vernahm ich Gespräche, die, wenn ich mich nicht täuschte, mit dem Reisebüro in Deutschland geführt wurden.
Am Abend brachte man mir ein großes Sandwich und eine Kanne mit Tee. Anschließend führten sie mich in ein kleines Nebengebäude.
Auf dem Flur waren drei Türen unmittelbar hintereinander.
Die erste wurde geöffnet.
Es war eine Zelle für Gefangene. Man gab mir zu verstehen, ich solle hier schlafen.
Die Tür blieb offen. Ein kleines Lämpchen über der Tür ließ man angeschaltet.
Ich sackte relativ schnell weg. Der fehlende Schlaf der letzten Nacht machte sich doch bemerkbar. Ich nahm keine Zudecke, trotzdem schlief ich recht gut.
Am nächsten Morgen eine leichte Berührung am Arm. Ich schreckte hoch. Ein Polizist stand neben dem Bett und hielt ein Tablett in der Hand.
„Frühstück”, sagte er.
Ihn kannte ich nicht, wahrscheinlich Schichtwechsel.
Es war ein Gedeck, wie ich es nur aus guten Hotels kannte. Das meiste auf dem Tablett stopfte ich in mich hinein. Auch der Hunger hatte sich mittlerweile gemeldet.
Gierig verschlag ich alles sehr animalisch. Hoffentlich hatte man nirgends eine versteckte Kamera angebracht.
Gegen Mittag holte man mich ins Büro. Meine Papiere lagen auf dem Tisch. Man gab mir mit viel Mühe kund, dass am kommenden Tag ein Beauftragter des Reisebüros kommen werde, um mich abzuholen.
Den Rest des Tages verbrachte ich auf dem Bett. Am Abend gab es eine warme Fleischsuppe. Sie war gut.
Etwas später brachte man mir meine saubere Kleidung. Widerwillig tuend, zog ich mich um. Bevor ich mich zum Schlafen begab, zog ich diese Sachen wieder aus und nahm die Zudecke.
Jetzt beschäftigten mich eine Vielzahl anderer Probleme:
Wo war die Gruppe?
War die Tour noch am Laufen?
Wurde der Gewehrbursche schon vermisst?
Hatte man das Boot gesehen?
Kein Wort.
Keine Fragen.
Am nächsten Mittag kam ein junger Mann vom deutschen Reisebüro WTR-World-Trekking-Reisen.
Er sprach beruhigend auf mich ein. Wir fuhren zu einem kleinen Airport. Hier mussten wir lange warten. Der kleine Zubringer zum nächst größeren Airport hatte Motorschaden.
Auf die sprichwörtlich letzte Minute erreichten wir den Flieger nach Europa. Der junge Mann redete immer wieder beruhigend auf mich ein, obwohl ich nichts sagte. Vielleicht hatte er mein ruhiges Verhalten als seinen Erfolg verbucht?!
Ein langer Flug stand uns bevor. Die meiste Zeit während des Fluges mimte ich den Schlafenden.
Landung in Deutschland am nächsten Morgen.
Der junge Mann hatte meinen Rucksack getragen.
Halt, schoss es mir durch den Kopf, wo ist denn mein anderes Gepäck geblieben? Wird sich schon klären.
Nach dem Auschecken gingen wir zum Ausgang. Der junge Mann suchte einen Meeting-Point. Dort stand meine Frau.
Ich tat, als würde ich sie nicht erkennen. Er übergab mich mit Rucksack und wünschte meiner Frau viel Glück zum Gesunden meiner Person.
Wir gingen ins Parkhaus.
Der mehrmals wiederholte Kommentar meiner Frau: „Mann, was hast du nur gemacht?!"
Innerlich grinste ich.
Wir fuhren Richtung Wohnort. Kurz bevor wir ankamen, sagte ich meiner Frau, sie möge sich beruhigen, ich sei völlig intakt.
Sie schaute mich entgeistert an. Sie schüttelte kommentarlos mehrfach den Kopf.
Zuhause habe ich ihr die ganze Geschichte erzählt. Das war für mich die einzige Möglichkeit, ohne viel Fragen und Recherchen aus dieser Misere rauszukommen.
Per Email hatte das Reisebüro mittlerweile signalisiert, dass mein restliches Gepäck in spätestens zwei Tagen eintreffen werde.
Die Tour war übrigens sofort abgebrochen worden. Nach mir hatte niemand gesucht. Angeblich überlebt niemand einen solchen Absturz. Eine Suche in der Schlucht wurde als nicht machbar dargestellt.
Gewehrbursche und Boot sind nicht aus meinem Gedächtnis zu tilgen. Der Absturz manifestiert sich als Fata Morgana.
Es war mit Sicherheit meine letzte Tour.
Oder?
Kapitel 2
Norden
Endlich.
Nach langem Gezeter und Gezerre, sowohl mit der Familie als auch mit dem Direktor in der Firma, war ich nun auf einem Trip in den Norden.
Sollte alles einigermaßen funktionieren, dann für ein Jahr.
Wohin, war völlig offen.
Der Ausstieg war aus gesundheitlichen Gründen zwingend erforderlich. Die Psychiatrie-Anstalt war in Sichtweite. Nicht zuletzt der klare Hinweis eines Neurologen, der einen zeitlich begrenzten Ausstieg empfahl, festigte meinen Entschluss.
Das Auto war mäßig bepackt mit den wichtigsten Utensilien. Das Unbekannte, das vor mir lag, störte mich im Moment nicht.
Mehrfaches tiefes Durchatmen ließ den Wagen in ruhige Bahnen gleiten.
Nach gut zwei Stunden Fahrt war die erste Pause angesagt. Der Blick ging zurück: Der tägliche Irrsinn in der Firma oder in allen Firmen.
Dieser ökonomische Mythos vom unbegrenzten Wachstum. Drei Schlagworte waren bei den monatlichen Geschäftssitzungen dominant:
Umsatzsteigerung - Gewinnmaximierung - Personalabbau.
Ich konnte es nicht mehr hören.
In meinem Forschungs- und Entwicklungsbereich wurde permanent Druck erzeugt, der alle Kreativität tötete.
Ein Blick auf die Straßenkarte brachte mich zu dem Entschluss, irgendwo zwischen Hannover und Hamburg ostwärts abzubiegen, in der Hoffnung, einen passenden Ort und natürlich eine geeignete Unterkunft zu finden.
Langsam formierten sich meine Vorstellungen. Eine abgetrennte Wohnung oder ein kleines Haus, konnte auch eine Hütte sein, möglichst auf dem Lande, um der Stadthektik zu entgehen.
Hannover lag schon einige Kilometer hinter mir, und es wurde Zeit, den angedachten Abzweig nach Osten zu nehmen. So fuhr ich fast rechtwinklig nach Osten, 50 - 60 Kilometer, und die bevorstehende Suche nach einer passenden Bleibe trieb mir schon wieder hektische Symptome in den Körper. Nur mühsam konnte ich mich disziplinieren. Ein kleiner Ort kam in Sicht. Das Ortseingangsschild hatte ich übersehen. Auf der rechten Seite vor dem Ort stand separat ein Wohnhaus mit Scheune und Stallgebäuden. Ich beschloss zu diesem Haus zu fahren und mich nach einer Bleibe zu erkundigen. Möglichst nach meinen Wünschen. Kurz vor dem Haus, in einer einspurigen Ein- bzw. Ausfahrt, hielt ich an. Ein älterer Mann saß in einem Lehnstuhl vor dem Haus.
Ideal.
Nach den üblichen Begrüßungsworten bat ich um Entschuldigung für die Störung. Der alte Herr nickte nur. Ich trug ihm mein Anliegen vor und fragte, ob er mir weiterhelfen könne. Nach einigem Zögern sagte er:
„Eventuell. Aber Sie müssen warten bis meine Tochter kommt. In einer halben Stunde müsste sie hier sein."
Er bot mir einen Platz auf der nebenstehenden Bank an.
„Haben Sie eine mögliche Bleibe“, fragte ich.
Er antwortete recht gelassen: „Ich habe Ihnen bereits gesagt, eventuell.“
Das Bauernhaus, älteren Baudatums, begeisterte mich nicht unbedingt.
Meine Frage nach einer möglichen Übernachtung hier im Ort, verneinte er. Im Nachbarort, weitaus größer, gäbe es Gasthaus und Hotel. Der alte Herr schaute mich sehr prüfend an.
„Für wie lange und warum suchen Sie eine Wohnung?”, fragte er.





























